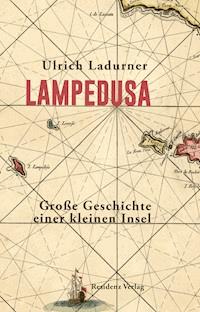Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Geburtsstunde des Roten Kreuzes, der Beginn vom Niedergang der Habsburger, eindringlich und spannend erzählt. Unterwegs an historischem Schauplatz: Die Schlacht von Solferino am 24. Juni 1859 endete mit einer Niederlage der Österreicher unter Kaiser Franz Joseph. Die französischen Truppen Napoleons III., Verbündeter des Königreiches Piemont-Sardinien, machten den Weg frei für die nationale Einigung Italiens. Joseph Roth setzte im "Radetzkymarsch" Solferino ein literarisches Denkmal und Henry Dunants Augenzeugenbericht von der grausamen Schlacht und dem Elend der Verwundeten führte zur Gründung des Internationalen Roten Kreuzes und zur Genfer Konvention. Als er die Tagebuchaufzeichnungen seines Urgroßvaters findet, eines Südtirolers, den das Los in die Schlacht schickte, macht sich Ulrich Ladurner auf den Weg in eine unbekannte Vergangenheit. In seiner politisch-historischen Reisereportage, die zu einer persönlichen Spurensuche wird, führt er uns an den Schauplatz in der Lombardei, südlich des Gardasees. Aus seinen Beobachtungen vor Ort, aus Gesprächen und Recherchen rekonstruiert er die Geschichte, wie sie gewesen sein könnte. "Der Sprache, die er dafür gefunden hat, wohnt eine bestechende Schönheit inne", schrieb die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG. "Dem schmalen Buch, glänzend geschrieben und spannend zu lesen, möchte man ebenso viele Leser wünschen wie den Aufzeichnungen des Bürgers Dunant."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 159
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ulrich Ladurner
Solferino
Ulrich Ladurner
Solferino
Kleine Geschichte eines großen Schauplatzes
Mit Fotos und Karte
Für die Transskription des Tagebuches von Peter Ladurner danken Autor und Verlag Simone Kostenzer, Wien. Alle Fotos und Übersetzungen aus dem Italienischen: Ulrich Ladurner
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
2. Auflage 2009
© 2009 Residenz Verlagim Niederösterreichischen PressehausDruck- und Verlagsgesellschaft mbHSt. Pölten – Salzburg
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.Keine unerlaubte Vervielfältigung!
ISBN ePub:978-3-7017-4244-8
ISBN Printausgabe:978-3-7017-3151-0
Für Peter, Peter, Lilli und Julius
Inhalt
Zu diesem Buch
Die Truhe
Das Fenster
Der Tornister
Der Turm
Villa Mirra
Constantine
Knochen
Anmerkungen
Literatur
Register
Zu diesem Buch
Solferino ist ein kleiner Ort in der Lombardei. Er liegt in einer idyllischen Hügellandschaft, wenige Kilometer vom Gardasee entfernt.
Während ich dieses Buch schrieb, habe ich immer wieder Freunde gefragt: »Sagt dir Solferino etwas?« Die Österreicher unter ihnen antworteten: »Klar, Joseph Roth, Radetzkymarsch! Leutnant Trotta rettet in Solferino Kaiser Franz Joseph das Leben und wird für diese Tat geadelt.« Die Italiener sagten: »Solferino? Das war eine entscheidende Etappe auf dem Weg zur Einigung Italiens.« Die Schweizer schauten mich etwas erstaunt an, so selbstverständlich schien ihnen die Antwort: »Die Schlacht von Solferino. Henry Dunant, das Rote Kreuz!«
1859 stießen in Solferino habsburgische Truppen auf die Piemontesen und die mit ihnen verbündeten Franzosen. Es kam zu einer grausamen Schlacht, bei der Tausende Soldaten ihr Leben ließen. Die Österreicher mussten sich geschlagen zurückziehen und die Lombardei den Piemontesen überlassen. Solferino war für den damals neunundzwanzigjährigen Kaiser Franz Joseph eine bittere Niederlage. Sie markierte den Beginn eines sich über Jahrzehnte hinziehenden Abstiegs der Monarchie. Joseph Roths »Radetzykmarsch« beginnt in Solferino und endet mit dem Zerfall des Kaiserreiches. Es ist ein Roman über die endlos lange Agonie der Habsburgermonarchie. Für die Italiener hingegen war Solferino der Beginn eines neuen Zeitalters. Hier stießen sie das Tor zur Freiheit auf. Wenige Jahre nach der Schlacht war Italien geeint. Für die Menschheit war Solferino – oder besser: waren die Folgen der Schlacht – von unschätzbarer Bedeutung. Das Gemetzel an diesem kleinen Ort führte zur Gründung des Roten Kreuzes und zur Genfer Konvention, den ersten Schritten des internationalen Menschenrechts.
Es gibt also viele gute Gründe, über Solferino zu schreiben. Den entscheidenden Anstoß aber gab mir mein Urgroßvater. Er war Soldat in Solferino und schrieb darüber ein Tagebuch. Seine Aufzeichnungen haben mich inspiriert. Dieses Buch ist kein wissenschaftliches Werk. Es ist auch kein Geschichtsbuch. Wenn man es schon einordnen möchte, dann ist es eine historische Reisereportage. Ich habe das Schlachtfeld von Solferino mit dem Tagebuch meines Urgroßvaters in der Hand abgeschritten. Je weiter ich kam, je tiefer ich in die Materie eintauchte, desto lebendiger wurde er. Er stand vor mir in seinem Waffenrock, verschwitzt vom vielen Marschieren in der glühenden Hitze eines italienischen Sommers, mit vom Weingenuss geröteten Backen, fröhlich und übermütig, wie es sich für einen Fünfundzwanzigjährigen gehört; mit entsetzten Augen, die zu viele Tote und zu viel Schmerz gesehen haben. Und so, wie er mir erschien, fanden auch die anderen Teilnehmer an der Schlacht wieder ins Leben zurück – für den langen Moment dieses Buches.
Hamburg, im Mai 2009
Die Truhe
Mein Vater war der Meinung, dass man die Menschen nur verstehen kann, wenn man ihre Geschichte kennt. Trotzdem war er kein Leser. Das Regal in unserem Wohnzimmer bot zwei Metern Büchern Platz, davon nahm ein ehrwürdiger Herder Weltatlas den größten Teil ein, den Rest füllte Konsalik aus. Vater musste das Lexikon meist zweimal im Jahr konsultieren, zu Weihnachten und zu Ostern. Bei diesen Anlässen traf sich die Familie, und mit schöner Regelmäßigkeit entbrannte am Küchentisch Streit über irgendein Ereignis, eine Person oder ein Datum. Jeder wusste es natürlich besser, bis mein Vater das Lexikon mit den Worten in die Hand nahm: »Hören wir, was der Schiedsrichter sagt!« Er blätterte sorgfältig in den schon etwas vergilbten Seiten und verkündete schließlich den Schiedsspruch, den wir alle ohne Widerrede akzeptierten. Zu mehr gebrauchte er Bücher nicht. Trotz seines Wissenshungers blieben sie ihm fremd. Seine Kenntnisse über die Geschichte bezog er von den Menschen. Er redete mit allen, die er traf. Keiner war ihm zu gering. Bei jedem glaubte er, wenn man nur tief genug grabe, könne man einen Schatz finden.
Woher kommst du? Das war immer die erste Frage, die er stellte. War sein Gesprächspartner auskunftsfreudig, schob er so lange Fragen nach, bis er auf das gestoßen war, was ihm wertvoll erschien. Dabei handelte es sich oft um die unscheinbarsten Dinge, die Tatsache zum Beispiel, dass ein Mensch in der italienischen Poebene aufgewachsen war, die im Winter vom dicksten Nebel bedeckt war, den man sich nur vorstellen konnte. Daraus entwickelte er Theorien über die Mentalität dieses Menschen, was freilich auch dazu führte, dass sich bei ihm Vorurteile verfestigten, die allerdings nie bösartiger Natur waren, sondern eher dazu dienten, ihn selbst durch die Welt zu geleiten, die ihm unübersichtlich schien wie ein vielversprechendes Labyrinth. Er besaß den staunenden Blick eines Kindes.
Doch wollte er nicht nur von den Menschen Antworten haben, sondern auch von den Dingen. Leidenschaftlich durchstöberte er Supermärkte, Geschäfte und Läden, nahm dabei die Waren in die Hand und studierte die Herkunftsbezeichnung. Nichts war für ihn wichtiger, als zu erfahren, wo etwas hergestellt, gewachsen oder verpackt worden war. Er begriff die Welt auf diese sehr handgreifliche Weise.
Er hatte es nicht so geplant, doch, glaube ich, ist es kein Zufall, dass er im Import-Export-Geschäft gelandet ist. Durch seine Hände gingen Bananen aus Ecuador, Gurken aus Südafrika, Salate aus Rumänien, Artischocken aus Ungarn, Orangen aus Sizilien. Manchmal begab er sich selbst in diese Länder, um die Echtheit der Herkunft der zu importierenden Ware zu überprüfen. Wie ein Detektiv durchstöberte er Felder, Äcker und Lagerhallen. Immer wieder blieb er an den Geschichten der Menschen hängen, die er traf. Ob Händler, Bauer oder Lagerarbeiter, sie öffneten sich ihm, weil er das Talent besaß, in Demut zu fragen. Wenn er nach Hause kam, war sein Netz prall gefüllt mit Geschichten, die er mit großem Vergnügen an alle weitergab, die sie hören wollten.
Da er nicht die Gelegenheit hatte, sich an einer Universität eine gewisse Systematik anzueignen, haftete seinen Erkundungen etwas Zufälliges an. Seine Neugier folgte keinen Gesetzen, sie unterwarf sich nicht, blieb dilettantisch, unbändig und unerschöpflich. Ihn interessierte, worüber er gerade stolperte.
Ungefähr zehn Jahre vor seinem Tod schenkte er mir das Tagebuch meines Urgroßvaters: »Damit du weißt, woher du kommst.« Ich reagierte darauf mit einem kaum verhohlenen Unwillen. Damals wollte ich mit aller Kraft meiner Familiengeschichte entkommen, weil ich ihre vermeintlich drückende Last nicht ertrug. Und was tat er? Indem er mir das Buch gab, drückte er mir meinen Herkunftsstempel in die Hand. Mir war so, als wollte er sagen: Du entkommst nicht! Doch war dieser Eindruck einer jugendlichen Phobie geschuldet, denn mein Vater tat nur, was Väter eben tun. Er gab an seine Kinder weiter, was ihm wichtig schien, und dieses Buch gehörte dazu. Ich strich mit den Fingern über den rissig gewordenen Ledereinband, dann wog ich es in der Hand. Es war leicht und klein. Staunend las ich das Jahr, in dem mein Urgroßvater es geschrieben hatte: 1859. Nach einer ersten flüchtigen Lektüre verstaute ich es in einer Truhe, die mein Vater in dem Glauben erworben hatte, dass sie sehr wertvoll sein müsse. In Wirklichkeit war sie ein zwar uraltes, aber sehr billiges Produkt. Doch er bestand starrsinnig darauf, dass es sich dabei um einen ganz und gar außergewöhnlichen Gegenstand handle, dem, wenn nicht jetzt, so doch in Zukunft, ein beträchtlicher Wert zuwachsen werde. Er plante, sie irgendwann für gutes Geld zu verkaufen. Dazu kam es nie, denn niemand wollte die Truhe, und er hat sie bei Gott oft genug angeboten. Entmutigen ließ er sich dadurch nicht. Man müsse, sagte er, halt noch ein bisschen länger warten, dann würde sich schon ein Käufer finden. Zu den Vorzügen meines Vaters gehörte, dass er sich seine Träume nicht ausreden ließ.
Das Tagebuch meines Urgroßvaters: Ein Zeuge, der 150 Jahre lang alle Gefahren überstanden hat und nun vor uns steht, in all seiner blutigen Unschuld.
Ich hütete die Truhe in all den Jahren wie meinen Augapfel, weil ich meinem Vater, der sie mir zu meinem achtzehnten Geburtstag mit feierlicher Geste bis zu dem Tag ihres Verkaufes in »Verwahrung« übergeben hatte, die Illusion nicht rauben wollte, es handle sich dabei um ein seltenes antiquarisches Stück. Mit den Jahren begann ich selbst daran zu glauben. Schließlich hatte ich viel Mühe darauf verwendet, sie zu behalten. Sie wechselte mit mir Wohnungen, Städte und Länder und niemals wäre mir der Gedanke gekommen, sie zurückzulassen, auch dann nicht, wenn ich sie keuchend und fluchend steile Treppen hochtragen musste. Ich suchte für diese Truhe immer den sichersten Ort, als sei sie ein Barren aus Gold, den ich vor Diebstahl schützen müsste. Die Täuschung, der mein Vater anheimgefallen war, entfaltete ihre Wirkung. Das Tagebuch lag in der Truhe, eingeschlagen in ein Wachstuch blieb es ungeöffnet. Ich vermied bewusst, darin zu blättern. Nicht etwa, weil ich dachte, dass die Lektüre schreckliche Geheimnisse offenbaren würde, Familientragödien oder dergleichen, sondern, ganz im Gegenteil, weil ich mir sicher war, auf diesen Seiten nichts anderem als unspektakulärer Normalität zu begegnen, dem erstickenden Staub des Alltags einer Familie, deren Mitglieder ohne großen Lärm zu erregen durch die Jahrhunderte gegangen waren.
Ich traute meinem Vater nicht. Ich verdächtigte ihn aller nur möglichen Phantastereien. Was wäre, wenn ich feststellen müsste, dass es sich mit dem Tagebuch genauso verhielt wie mit der Truhe, deren Wert ausschließlich im Kopf meines Vaters bestand? Ich hätte ihn bis auf die Knochen entblößt. Seine Würde speiste sich einzig aus seinem unveräußerlichen Recht zu träumen.
Als mich die Nachricht vom Tod meines Vaters erreichte, öffnete ich ohne langes Nachdenken die Truhe, ergriff das Tagebuch und nahm es mit in meine Geburtsstadt zu seinem Begräbnis. Erst jetzt konnte ich darin lesen. Ich musste nicht mehr fürchten, meinen Vater bloßzustellen. Kein Lebender stand mehr zwischen mir und meinem Urgroßvater. Der Weg war frei, um seine Stimme zu hören.
»Den 28ten habe ich es mit dem Losziehen verspielt und die sehr schöne Nr. 2 gezogen (…) es hat sich immer der Gedanken erinnert, nur noch eine kleine Zeit kannst du in dein Vaterland bleiben, dann musst du fort, und hin nach Italien, und der Gedanken ging auch in Erfüllung.«
Das sind die ersten Zeilen des Buches. Es war Winter 1857, als er das niederschrieb. Krieg lag in der Luft. Ich beschloss, mehr als hundertfünfzig Jahre später an den Ort zu fahren, an dem das Tagebuch meines Urgroßvaters seinen grausigen Höhepunkt erreichen sollte – nach Solferino.
Das Fenster
Es ist ein heißer Junitag, mittags. Die Bewohner Solferinos haben sich vor der Glut der Sonne in ihre Häuser geflüchtet. Die Straßen sind leer gefegt. Es ist still. Nur ab und an ist der Lärm eines Autos zu hören, das auf der Hauptstraße nach Castiglione delle Stiviere fährt. Ich gehe die Gasse zum Schloss empor, vorbei an den stummen Fassaden des Dorfes. Mein Hemd ist nass vom Schweiß. Obwohl ich einen Hut trage, dröhnt mein Kopf. Mein Atem geht schwer. Ich möchte gerne stehen bleiben, um mich auszuruhen, aber die Gasse ist heiß wie eine Backröhre. Nur so schnell wie möglich durch sie hindurch, hinauf auf den Schlossplatz, wo mich hoffentlich eine frische Brise erwartet, die vom Gardasee her über den Hügel von Solferino streicht. Dort werde ich meine Arme ausstrecken, mein Hemd wie ein Segel aufspannen und mich abkühlen lassen. Ich werde den Blick auf den blinkenden See, auf die mächtigen Berggipfel und die Hügel, die wellenartig Richtung Osten verlaufen, richten. Doch bis dahin sind es noch ein paar Hundert Meter. Um mich abzulenken, lausche ich auf Geräusche, auf Stimmen hinter den verschlossenen Türen und Fenstern. Doch höre ich nichts außer meinen Atem. Es muss an den dicken, uralten Mauern der Häuser liegen, die alles verschlucken. Denn bestimmt sitzen die Menschen an den Küchentischen, essen und schwatzen, oder sie schauen die Nachrichten an, die um diese Zeit im Fernsehen laufen, vielleicht hält auch jemand seinen Mittagschlaf und schnarcht. Wenn ich an einem angelehnten Fensterladen vorbeikomme, spähe ich hinein, doch ist nichts zu erkennen, nicht einmal Schatten sind zu sehen. Nur Hitze. Nur Stille.
Nach ungefähr einem Drittel des Weges sehe ich auf einer Hauswand, auf der Höhe des zweiten Stockes, eine seltsame Malerei. Sie zeigt, wie eine Frau einen Fensterladen öffnet. Die Proportionen des Bildes verraten, dass der Maler nicht zu den Erfahrenen seines Faches gehört, wahrscheinlich hat er sein Geld als Schildermaler verdient und sich nur ab und an der figürlichen Darstellung gewidmet. Doch liegt etwas Feierliches in der Art, wie die Frau aus dem Fenster schaut. Sie trägt ein rotes Kleid und ein sorgfältig gebundenes weißes Halstuch. Ihr Haar ist schwarz. Sie wirkt, als wollte sie die Passanten einladen, um sie im Haus zu bewirten und die Geschichte zu erzählen, die ihr widerfahren ist. Eine Figur aus einem Märchen, an eine graue, unverputzte Wand gebannt. Kommt näher! Kommt näher!, sagt sie, und ich gehe bis an die Hauswand, lege meinen Kopf in den Nacken. Unter dem Bild ist in ungelenker Schrift gepinselt: »Am 24. Juni 1859 tötete hier eine verirrte Kugel Antonia Savio Cerini.«
Die Ursachen für den Tod dieser Frau sind zu einem Knäuel verworren. Wenn man eine isolieren müsste, dann wäre es die geographische Lage Solferinos. Das Dorf schmiegt sich an mehrere Hügel. An der Spitze der höchsten Erhebung steht ein Turm, ein letztes Überbleibsel einer Festung der Familie Gonzaga, der ehemaligen Herrscher über Mantua. Die Festung ist der Überlieferung nach 1016 gebaut worden, ihre Mauern sind bis auf einen kleinen Rest vollständig verschwunden. Im Volksmund heißt der Turm: Spia d’Italia. Der Name hat seinen Ursprung im neunzehnten Jahrhundert. Die Spia ermöglicht einen Blick tief hinein nach Venetien und die Lombardei, die damals von den Habsburgern dominiert wurden – in den Augen italienischer Patrioten unerlöste Erde. Die Anhöhe von Solferino bot einen Schlüssel für die Befreiung dieses Landes, oder seine Unterwerfung, je nachdem. Im Umkreis von weniger als sechzig Kilometern hatten die Österreicher vier Festungen angelegt, in Peschiera, Verona, Mantua und Legnago. Dieses sogenannte Quadrilatero bildete die militärische Grundlage zur Beherrschung Lombardo-Venetiens. Das Quadrilatero war für die Italiener Symbol ihrer Unterdrückung.
Antonia Savio Cerini hat am falschen Tag, zur falschen Stunde aus dem Fenster geblickt. Es waren gerade schwere Kämpfe im Gange, als sie die Fensterläden öffnete. Auf den Anhöhen von Solferino hatten sich die österreichischen Soldaten verschanzt. Die französische Armee rückte aus Richtung Castiglione delle Stiviere vor, aus der Ebene, die für die Österreicher leicht einsehbar war. Den Franzosen gelang es unter hohen Verlusten voranzukommen. Sie waren zwar wegen des Geländes im Nachteil, doch je näher sie kamen, desto mehr Gräben, Bachläufe, Hecken, Weinreben, Bäume, Felsen fanden sie vor. Sie dienten den Soldaten als Schutzschild, hinter dem sie sich verbargen, ihre Gewehre nachluden, das Bajonett aufpflanzten und dann weiterstürmten, den alles beherrschenden Turm, dessen Eroberung den Sieg in der Schlacht bringen würde, fest im Blick. Die Franzosen mussten durch das sogenannte Valletta hindurch, ein kleines Tal zwischen den Anhöhen. Sie hatten keine andere Wahl. Die Österreicher konnten sie so in tödliches Kreuzfeuer nehmen.
Dieses Valletta ist nichts anderes als die alte Hauptstraße Solferinos, auf der ich nun schweißgebadet stehe und das Bild Antonia Savio Cerinis betrachte. An der Stirnseite liegt der Turm, zur rechten Seite der sogenannte Zypressenhügel und zur Linken, ebenfalls auf einer Anhöhe, der mit hohen Mauern umgebene Friedhof. Die Franzosen wurden von allen drei Seiten beschossen. Auf späteren Darstellungen sieht man eine Masse von Soldaten, die dicht gedrängt mit aufgepflanzten Bajonetten nach vorne rückt, wie ein vielköpfiges, stachelbewehrtes Tier wälzt sie sich durch die Ruinen Solferinos. Die Kämpfe waren im Morgengrauen ausgebrochen, es war ein glühend heißer Tag eines ungewöhnlich heißen Sommers. Die Soldaten beider Armeen waren in den vergangenen Wochen viele Kilometer marschiert. Sie waren erschöpft. Die Österreicher hatten noch nicht einmal gefrühstückt, als sie sich schon dem Feind gegenübersahen. Viele starben im Laufe des Tages an Entkräftung. In den verschlossenen Häusern staute sich die Hitze, und niemand wagte, ein Fenster zu öffnen. 1959 gab ein Mann aus Solferino folgenden Bericht zu Protokoll, den er von seinem Vater, der die Schlacht als Augenzeuge erlebte, immer wieder gehört hatte: »Als Kugeln und Bomben das Dorf trafen, verschlossen wir alle, ohne Ausnahme, Türen und Fenster. Wir sperrten Werkstätten und Ställe zu. Dann versteckten wir das wenige, das wir besaßen, und verbarrikadierten uns in Kellern, in Verschlägen und unter Treppen. Dort kauerten wir, den Atem aus Angst, entdeckt zu werden, anhaltend, viele Stunden lang, so lange, bis die Schlacht zu Ende war, zu Tode erschreckt von den Schüssen und Schreien, welche Straßen und Plätze erfüllten.
Manchmal hörten wir draußen ganz deutlich die Stimmen von Soldaten, die sich etwas zuriefen oder vor Schmerz aufschrieen. Wir hörten das Getrappel der Soldatenstiefel. Es war so, als würde sich die Schlacht dort abspielen, wenige Meter entfernt, nur ein paar Schritte weg, als würde der letzte Ansturm vor unserer Haustür stattfinden; wir warteten mit Schrecken darauf, dass jeden Moment eine Gruppe bewaffneter Soldaten in unsere Zimmer stürzte. Keiner traute sich nach draußen.«1
Warum Antonia Savio Cerini aus dem Fenster schaute, darüber gibt es zwei unterschiedliche Versionen. Angeblich tat sie es, weil österreichische Soldaten Kühe aus dem Stall der Familie stehlen wollten. Das Brüllen der Tiere hatte sie alle Vorsicht vergessen lassen. Als sie die Soldaten schreiend verscheuchen wollte, zielte einer von ihnen auf sie. Die Kugel traf sie mitten in die Stirn. Diese Version allerdings widerspricht dem Satz, der unter ihrem Bild steht: »Casualmente colpita«, steht da: getroffen von einer verirrten Kugel.
Es kann durchaus sein, dass Antonia Savio Cerini aus reiner Neugier die Fensterläden öffnete. Wer wollte nicht wissen, was da draußen vor sich ging? Wer hätte nicht erfahren wollen, ob die Österreicher oder die Franzosen den Sieg davontrugen? Bestimmt kauerte die ganze Familie Savio Cerini in einem der Straße abgewandten Zimmer und stellte sich ängstlich flüsternd Fragen. Da hat es Antonia nicht mehr ausgehalten, sprang auf, lief zum Fenster, öffnete die Läden, ein Schuss knallte und sie sackte nach hinten.
Die Geschichte mit dem gezielten Schuss aus einer österreichischen Waffe wurde mit Sicherheit unmittelbar nach der Schlacht erzählt. Denn die Bewohner von Solferino hatten nicht viele Sympathien für die Österreicher, wie im Übrigen die meisten Lombarden. Österreichs Regiment empfanden sie als Fremdherrschaft. Tatsächlich regierten die Österreicher mit harter Hand. Die Gefängnisse waren voll mit italienischen Patrioten, die Soldaten des Kaisers waren gefürchtet, die Behörden setzten hohe Steuern fest. Als die Schlacht von Solferino tobte, hatte die österreichische Krone kaum mehr Anhänger in dieser Region. Selbst die Bauern, die sich lange ohne Murren der Obrigkeit unterworfen hatten, waren von ihr abgefallen. Dazu gehörte sicher auch die Familie von Antonia Savio Cerini, und es kann sein, dass sie aus Wut über die Österreicher das Fenster öffnete. Sie starb nach dieser Version eine Art patriotischen Tod, gemeuchelt vom Unterdrücker, während sie ihren Besitz verteidigen wollte. Doch diese Propaganda setzte sich nicht durch, sonst würde nicht »getroffen von einer verirrten Kugel« unter dem Bild gepinselt stehen.