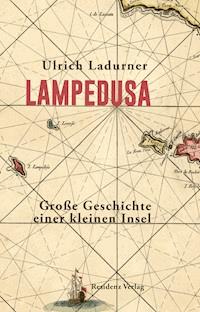Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Über Heilige und Scheinheilige, Märtyrer und Spione: eine andere Geschichte des Iran. Der Iran ist ein unberechenbares Land: undurchdringlich, verworren und geheimnisvoll. ZEIT-Journalist Ulrich Ladurner hat sich auf den Weg gemacht, um das Land und seine Menschen zu verstehen. Begleitet hat ihn sein Freund Amad, der in der Millionenstadt Teheran lebt, wo er aufgewachsen ist. In den vielen Jahren ihrer gemeinsamen Erkundungen hat Ladurner ihm aufmerksam zugehört - und Schicksale gesammelt. In seinen "Geschichten aus Teheran" erzählt er vom Ladenbesitzer Amir, der zum Heiligen wird und dabei gute Geschäfte macht; vom Fabrikanten Baba Zede, der mit skeptischem Auge jede Scheinheiligkeit seiner Nachbarn registriert; von der schönen Robabeh, die allen den Kopf verdreht und eine denkwürdige Entscheidung trifft; von drei jungen Männern, die völlig unterschiedliche Lebenswege einschlagen; vom Trinker, der zum Mörder wird; von der religiösen Eiferin, die für ihren Gott alles tun würde. Er erzählt von einem halben Jahrhundert iranischer Geschichte: wie die Iraner unter der Herrschaft des Schahs litten, wie sie die Revolution der Mullahs und den Krieg gegen den Irak erlebten und wie es heute, an der Schwelle zu einem neuen Krieg, um sie steht. Der Iran zeigt viele Gesichter, manche schön, manche hässlich, alle aber auf ihre Weise berührend. Ulrich Ladurner verschränkt in diesen Geschichten historische Fakten und persönliche Schicksale, die durch den Alltag hindurch den Blick auf den Iran schärfen, Geschichte für Geschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ulrich Ladurner
Küss die Hand,die du nichtbrechen kannst
Geschichten aus Teheran
Für Amad
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
© 2012 Residenz Verlag
im Niederösterreichischen Pressehaus
Druck- und Verlagsgesellschaft mbH
St. Pölten – Salzburg – Wien
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.
Keine unerlaubte Vervielfältigung!
ISBN ePub:
978-3-7017-4314-8
ISBN Printausgabe:
978-3-7017-3284-5
Inhalt
Vorwort
Dramatis personae
Amirs Aufstieg
Hadschi Amir baut
Hadschi Amir schmiedet Pläne
Baba Zede, der Fabrikant
Baba Zede hat einen unerwarteten Gast
Robabehs Verehrer
Machmud baut ein Denkmal
Dawuds Nase
Machmud, der Schöne
Mohsen demonstriert
Abbas, der Trinker
Robabeh und die Gerechtigkeit
Fereschtehs Paris
Amir besucht die Hinkende
Rezas Schuhe
Mohammed trifft Nietzsche
Baba Zede ist deprimiert
Mohsens Hochzeit
Mohammed bei der Armee
Machmud kommt nach Hause
Baba Zede kauft einen Fiat 132
Ein unwahrscheinliches Paar
Amir bei der Hinkenden
Abbas verliert seine Arbeit
Ein Brief an Baba Zede
Die Nacht des Umsturzes I
Die Nacht des Umsturzes II
Der Tag des Umsturzes I
Der Tag des Umsturzes II
Die neue Zeit
Fatimeh empfängt Khomeini
Abbas wartet auf ein Urteil
Robabeh in der Obhut Amirs
Ein zweiter Brief an Baba Zede
Fereschteh vor dem Volksgericht
Machmud zieht in den Krieg
Abbas stirbt als Märtyrer
Fereschteh kommt nach Paris
Reza, der Kommissar
Mohammed schreibt aus dem Exil
Machmud bei den Märtyrern
Reza zieht nach Qom
Robabeh geht an die Universität
Machmud auf dem Friedhof
Baba Zede verliert seine Fabrik
Amir verkauft seinen Laden
Reza empfindet Mitleid
Machmud und die Sittenwächter
Baba Zede schreibt einen Brief
Baba Zede hält eine Versammlung ab
Robabeh spürt den Wind des Wandels
Machmud und die Atombombe
Robabeh wird Stadträtin
Pegah und Meisan treffen sich
Es liegt an uns!
Der Tag der Wahl
Der Feind der Revolution
Zeittafel
Vorwort
Eines Tages bat ich meinen Freund Amad, mir den Platz zu zeigen, an dem er aufgewachsen ist. Er war über meinen Wunsch sehr erstaunt.
»Wirklich? Das willst du sehen? Aber das ist uninteressant! Völlig uninteressant!«
Das war nicht ablehnend gemeint, sondern eher Ausdruck seiner besorgten Gastfreundschaft. Dazu gehörte nämlich, dass er immer darum bemüht war, mir Interessantes zu zeigen – oder besser: Er zeigte mir Dinge, von denen er glaubte, sie könnten einem aus dem Westen gefallen. Der Platz seiner Kindheit und Jugend gehörte seiner Meinung nach definitiv nicht dazu. Was gab es da schon zu sehen?
Auch ich wusste es nicht. Die Neugier trieb mich.
Tatsächlich hatte der Platz nicht viel zu bieten: einen Streifen Grün, eine Straße und ein paar Häuser rundherum. Hier hatte mein Freund seine Kindheit und Jugend verbracht. Wir spazierten herum. Er begann zu erzählen. Und so wurde ich nach und nach mit den Menschen bekannt, die in diesem Buch die Asadis heißen, weil sie auf dem Asadiplatz leben. In Wirklichkeit heißt der Platz anders, auch den Bewohnern habe ich andere Namen gegeben. Den Platz aber gibt es, und die Geschichten sind nach dem Vorbild seiner Bewohner geschrieben. Ihre Schicksale dienten mir als Inspiration.
Der fromme Ladenbesitzer, der skeptische Fabrikant, die drei jungen Männer, die völlig unterschiedliche Lebenswege einschlagen, die schöne Frau, die allen den Kopf verdreht, der Trinker, der zum Mörder wird, die religiöse Eiferin, die für ihren Gott alles tun würde – der Iran zeigte plötzlich viele Gesichter, manche waren schön, manche hässlich, alle aber auf ihre Weise berührend. Nicht alle Geschichten haben sich genauso zugetragen, wie sie hier geschildert sind, doch gibt es niemanden auf dem Platz, der von solchen Geschichten nicht erzählen könnte.
Die Zeitspanne der Geschichten reicht von den 1950er Jahren über die Revolution des Jahres 1979, den Krieg gegen den Irak zwischen 1980 und 1988 bis zu den dramatischen Ereignissen des Jahres 2009.
Die Asadis sind lebenskluge, sympathische und zähe Menschen, die vor Fehlern freilich nicht gefeit sind. »Küss die Hand, die du nicht brechen kannst«, das ist ein Sprichwort, das ich oft von ihnen gehört habe. Doch auch die Asadis können verblendet sein, auch sie können verschlossen, hinterhältig und mitunter gefährlich fanatisch werden. Und doch ist es ihnen zuzutrauen, dass sie einen Weg für sich und ihr Land finden werden, der ihnen weitere Kriege und Revolutionen erspart. Wir müssen es hoffen, zu ihrem und zu unser aller Wohl.
Hamburg, im Juli 2012
Dramatis personae
Amirs Aufstieg
Als der Ladenbesitzer Amir von seiner Reise nach Mekka zurückkehrte, bereitete ihm seine Familie ein Fest. Auf dem Dach des Hauses hatten sie Flaggen gehisst. Sein Sohn hatte eine Stoffbahn rund um die Fassade gespannt. Eine Sure aus dem Koran war darauf gemalt. Nachdem Amir an der Eingangstür von seiner Familie und zahlreichen Nachbarn jubelnd begrüßt worden war, setzten sie sich an einen üppig gedeckten Tisch. Das Fleisch türmte sich hoch auf, der Reis bildete richtige Berge, das Gemüse schimmerte bunt in allen Farben, die Melonen protzten mit ihren dicken Bäuchen und die Weintrauben quollen aus den Schüsseln hervor. Der Duft der Gewürze mischte sich mit dem Dampf des Essens. Die Gesichter der Gäste glänzten vor Freude. Sie kauten, sie schmatzten, sie genossen jeden Bissen, und dabei starrten sie alle mit weit aufgerissenen Augen auf den Heimkehrer, als sei er nicht mehr Amir, der kleine, eilfertige Ladenbesitzer, sondern ein Respekt einflößender Prophet. Er musste berichten. Die Gäste waren gierig auf jedes Detail.
Es gab in der Tat viel zu erzählen, denn es war eine sehr weite Reise gewesen. Amir war über Land gefahren: mit dem Bus über die syrische Grenze nach Jordanien und von dort nach Saudi-Arabien, wo er nach drei Monaten endlich in Mekka ankam. Das war ganz normal für die Zeiten, als das Fliegen noch eine exklusive Angelegenheit für Reiche war. Überhaupt war es nur natürlich, dass eine Pilgerfahrt mit Entbehrungen und Gefahren verbunden war. Nicht wenige ließen auf diesen Reisen ihr Leben, umgekommen durch Krankheit, durch Unfälle oder durch die Hand eines Mörders. Amirs Zuhörer unterbrachen ihn deshalb immer wieder mit Sätzen wie: »Hast du denn keine Angst gehabt?«, oder: »Sind die Straßen sicher. Gibt es nicht viele Räuber?«, oder: »Die Hitze in der Wüste! Wie hast du das bloß ausgehalten?«
Amir winkte ab. Nie hätte er in dieser Runde zugeben können, dass er sich in jener Nacht, die sie in der saudischen Wüste unter freiem Himmel verbringen mussten, gefürchtet hatte vor den Schatten, die er zu sehen glaubte, vor den umherhuschenden Tieren, vor dem Flüstern des Windes. Selbst die zahllosen funkelnden Sterne waren ihm kein Trost gewesen, sondern verstärkten nur das Gefühl der absoluten Verlassenheit, die ihn angesichts dieser Weite erfasst hatte. Hätte er das alles erzählt, dann, glaubte er, hätten sie ihn als Schwächling gesehen und nicht als den tapferen, furchtlosen Amir, nicht als den Mann, der er selber gerne gewesen wäre. Dieser Gedanke aber zeigte nur, dass Amir seine Nachbarn nicht kannte. Menschliche Schwächen waren ihnen allen nicht fremd. Daher verfügten sie über ein instinktives Verständnis für Amirs Ängste, vorausgesetzt freilich, er hätte darüber gesprochen. Das aber tat er nicht, obwohl die Gäste mit dem Fragen nicht aufhören wollten.
Tatsächlich war Amir etwas Besonderes, etwas Bestaunenswertes, denn in seinem Viertel hatte nur er sich die weite und kostspielige Reise von Teheran nach Mekka leisten können. Nur er konnte jetzt den Zusatz »Hadschi« in seinem Namen tragen, als Zeichen dafür, dass er die Hadsch, die Pilgerreise nach Mekka, unternommen hatte. Selbst der Mullah begegnete ihm seit seiner Rückkehr mit Respekt. Hadschi Amir hatte für die Reise einen Großteil seiner Ersparnisse investiert. Daran dachte er, während sie aßen und er immer noch von seinen Erlebnissen erzählen musste. Er machte sich Sorgen um seine finanzielle Lage und schämte sich ein bisschen für diesen profanen Gedanken. Das dauerte aber nur einen Moment. Er schaute in die Runde und entdeckte unter den Gästen das Gesicht von Baba Zede, einem Nachbarn, den er nicht ausstehen konnte. Er hatte vor einiger Zeit mit Baba Zede einen heftigen Streit gehabt, und nun saß er hier, in seinem Haus, und vergnügte sich! Und er, Hadschi Amir, konnte ihn nicht einmal hinauswerfen!
Das Schlimmste war, dass Baba Zede Hadschi Amir mit einem Geschenk völlig überrascht hatte. Er hatte ihm den Tisch und die Stühle gekauft, auf denen sie nun alle saßen. »Zur Versöhnung!«, flüsterte Baba Zede Amir ins Ohr, als dieser das Wohnzimmer betrat.
»Das ist eine Provokation!«, dachte Amir. Er hatte wohl recht damit, denn er hätte lieber nach traditioneller Art auf dem Boden gesessen, um zu essen. Baba Zede wusste das, dieser Baba Zede, der sich immer als besonders modern aufspielte, dieser Baba Zede, der immer so überlegen tat. Hadschi Amir hätte am liebsten mit den Worten abgelehnt: »Du willst mich doch nur ärgern damit! Du bist ein Provokateur, ein hinterhältiger Provokateur!«, aber er konnte das Geschenk nicht zurückweisen, nicht vor den Augen der hier versammelten Nachbarschaft.
»Überhaupt«, dachte Hadschi Amir, »wer soll das Festmahl bezahlen, wenn nicht ich?« Er geriet in Wut, aber auch dies konnte er nicht zeigen.
Bald stellte sich heraus, dass seine Sorgen und sein Zorn grundlos waren. Seit er Hadschi Amir hieß, vermehrten sich die Kunden in seinem Geschäft. Manchmal herrschte ein richtiges Gedränge in dem engen Raum, der ohnehin schon vollgestellt war mit Reissäcken, Konserven, Flaschen und Körben. Viele kamen, um sich von Mekka berichten zu lassen. Dabei kauften sie das eine oder andere. Manche aber kauften, weil sie der Überzeugung waren, dass Hadschi Amirs Ware heilende Kräfte besäße.
Eines Tages verbreitete sich im Viertel die Kunde, dass Hadschi Amirs Reis eine Frau von einer hartnäckigen Hautallergie befreit hatte.
»Sie hat einen Löffel Reis gegessen und weg war der Ausschlag. Ein Leben lang war ihre Haut mit roten Flecken übersät, und nun: Einfach weg!« So ging das Gerücht. So glaubten es die Leute. Hadschi Amir widersprach nicht. Sein Reis verkaufte sich in rauen Mengen. Er genoss den Status, ein Heiliger zu sein.
Hadschi Amir baut
Hadschi Amirs Geschäfte liefen seit seiner Rückkehr aus Mekka prächtig. Seine Ersparnisse wuchsen und wuchsen. Freilich, er sprach darüber mit niemandem. Hadschi Amir war diskret, vor allem, wenn es um seine eigenen Dinge ging. Trotzdem blieb sein wachsender Wohlstand nicht unbemerkt.
Eines Morgens kam der Mullah des Viertels zu ihm ins Geschäft. Er wälzte seinen massigen Körper durch den Laden, bis er vor dem winzigen Schreibtisch Amirs zu stehen kam.
»Gott sei mit dir, Hadschi Amir!«
»Gott meint es gut mit mir! Willkommen! Ich danke für Ihren Besuch«, antwortete Hadschi Amir.
Er bot dem Mullah einen Stuhl an. Als der sich darauf setzte, knirschte das Holz verdächtig. Hadschi Amir befürchtete, dass der Stuhl unter dem Gewicht des Mullahs zusammenbrechen könnte. Das war ihm peinlich, denn er hätte sich leicht einen neuen Stuhl für den Laden leisten können. Aber seit er aus Mekka zurückgekehrt war, hatte er immer gespart. Hadschi Amir wusste nicht, wofür und wozu. Er hatte mit dem Geld nichts Bestimmtes vor, noch jedenfalls nicht. Er war einfach sparsam. »Wer auf sein Geld achtet, den liebt Gott!«, sagte er zu seinen Kindern, wenn er es wieder einmal ablehnte, ihnen etwas zu spendieren. Die Kinder freilich glaubten nicht, dass Gott eine Vorliebe für Knauserer hatte. Daher ließen sie sich nicht beeindrucken und drängten ihren Vater weiter, sich spendabel zu zeigen. Das versetzte Hadschi Amir mit schöner Regelmäßigkeit in Rage. Es gab dann Streit mit seinem Sohn, den Hadschi Amir damit beendete, dass er Kopfnüsse verteilte. Danach herrschte Ruhe.
Jetzt aber, da das dürre, alte Holz unter dem massigen Körper des Mullahs knackte, ermahnte er sich selbst im Gedanken. »Aber einen Stuhl, Hadschi, einen Stuhl hättest du dir schon gönnen können!« Danach bedeutete er seinem Laufburschen, dass er Tee bringen solle. Dieser flitzte davon.
Der Mullah schaute ihm nach.
»Ein guter Junge, dieser Ali!«, sagte er, und der Stuhl unter ihm knirschte noch lauter.
»Ja, ich bin sehr zufrieden mit ihm!«, antwortete Hadschi Amir. Was hätte er anderes sagen sollen: Es war der Mullah gewesen, der ihm vor einigen Wochen diesen Jungen aufgedrängt hatte. »Ali ist ein Waisenkind«, sagte der Mullah, als er ihm das schmächtige Kerlchen vorstellte. Der Mullah beschrieb das Schicksal des Waisenkindes Ali mit drastischen Bildern. Hunger, Not, Kälte, Gewalt, Schmutz, Erniedrigung – er ließ nichts aus. Hadschi Amir wusste sofort, was er zu tun hatte. Er musste Ali bei sich einstellen, wenn er nicht mit dem Mullah Schwierigkeiten bekommen wollte.
Hadschi Amir setzte sich hinter seinen Schreibtisch und wartete. Vielmehr lauerte er auf das, was da kommen mochte. Er hätte nur zu gerne gewusst, was den Mullah dazu bewogen hatte, ihn in seinem Laden aufzusuchen. Er war nämlich in allem, was er tat, von einer klaren Absicht getrieben. Immer führte er etwas im Schilde.
Der Mullah war im Viertel bekannt dafür, dass er die Dinge nicht direkt ansprach. Er war ein Meister der ausschweifenden Rede. Wer ihn verstehen wollte, der musste sich regelrecht durch ein Dickicht an Worten durcharbeiten und über Satzungetüme hinwegsteigen. Hadschi Amir bereitete sich innerlich auf einige anstrengende Stunden vor.
Der Mullah legte los. Seine Stimme verfiel nach den ersten Worten in einen Singsang, der sich klebrig über den gesamten Nachmittag legte. Nur einmal machte er eine Pause. Das war, als Ali mit den Teegläsern kam. Der Mullah nahm das Glas vom Tablett, das ihm Ali mit einer Verbeugung hinhielt, dann nahm er einen Schluck, und schließlich strich er dem Jungen mit einer väterlichen Geste über den Kopf.
»Ein guter Junge, ein guter Junge!«, sagte er, wieder zu Hadschi Amir gerichtet, der erschöpft hinter dem Schreibtisch saß und gerade noch die Kraft hatte, zustimmend zu nicken.
Der Mullah aber ließ nicht ab. Er war noch lange nicht fertig. Er redete weiter, über Mekka, über die Hadsch, über Mohammed und über die Menschen im Viertel, die sich wieder mehr der Religion zuwenden sollten. Vor allem aber redete er über Hadschi Amir, der seit seiner Pilgerreise ein so glückliches, gesegnetes Leben führe; über Hadschi Amir, den Wohltäter des Viertels.
»Die Menschen brauchen Gelegenheiten, um ihre religiösen Gefühle angemessen ausdrücken zu können. Gelegenheiten!« Das waren die letzten Worte des Mullahs gewesen. Danach schob er sich und seinen dicken Körper hinaus auf die Straße. Dort dämmerte es bereits. Hadschi Amir bedankte sich für den Besuch. Der Mullah nahm dies mit einer würdevollen Geste entgegen und verschwand.
Als Hadschi Amir sich wieder hinter seinen Schreibtisch setzte, wusste er bereits, was er zu tun hatte. Er sollte an der Ecke zum Markt den Bau eines Gebetshauses finanzieren. Genau das hatte der Mullah von ihm verlangt. Es war ihm gelungen, dies klarzumachen, ohne die Wörter »bauen« und »Geld« in den Mund genommen zu haben. Der Mullah war eben ein Meister der Anspielungen.
Hadschi Amir rief den Laufburschen. Er musste sehr laut rufen, denn Ali war auf den Reissäcken im hinteren Vorratsraum eingeschlafen. Als er endlich kam, gab Hadschi Amir ihm einen kurzen Befehl.
»Hol mir den Baumeister, schnell!«
Hadschi Amir schmiedet Pläne
Hadschi Amir hatte es sich zu Gewohnheit gemacht, die heißesten Stunden der Sommertage vor seinem Laden zu verbringen. Der Laufbursche Ali spannte ein kleines Sonnensegel auf, stellte einen Stuhl hin, säuberte den Sitz mit einem Staubtuch, dann erst ließ sich Hadschi Amir zufrieden seufzend nieder. Ali brachte Tee. Hadschi Amir blinzelte auf die Straße hinaus, die in der Hitze flimmerte. Es waren kaum Menschen zu sehen. Den meisten war es zu heiß. Hadschi Amir allerdings liebte diese Stunden. Der süße Tee floss durch seine Kehle, als wäre es Honig. Schweißtropfen rannen über seinen Rücken. Ein Windzug fuhr um die Ecke und kühlte seine Haut mit zärtlich streichelnder Hand. In ihm breitete sich ein Gefühl des Wohlbehagens aus. Er hätte – wenn es denn nicht unstattlich gewesen wäre – am liebsten geschnurrt wie ein Kater.
Den Gruß der wenigen Passanten erwiderte er mit einem Kopfnicken. Wenn einer stehen blieb, um mit ihm zu reden, bemühte er sich, das Gespräch kurz zu halten. Er hatte es trotz der zur Schau gestellten Gelassenheit eilig, mit sich allein zu sein. »Meine Meditationszeit« nannte Hadschi Amir die Stunden, die er an solchen Tagen unter dem Sonnensegel verbrachte. Zeit zum Ausspannen, Zeit zum Nachdenken. Er wollte nicht gestört sein.
Seine Gedanken flogen weit über den Horizont. Kein Hindernis stellte sich ihnen entgegen, und so konnten sie nach Herzenslust herumwirbeln. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft – alles mischte sich zusammen. Was Hadschi Amir in diesen Stunden alles einfiel, welche Bilder in ihm auftauchten!
Der Staub zum Beispiel, dieser allgegenwärtige, gelbe, grobkörnige Staub in den Straßen des Viertels, der ihm als Jungen so sehr zu schaffen gemacht hatte. Wenn ein Sturm diesen beißenden Staub aus der Salzwüste nach Teheran trug, dann tränten dem kleinen Amir sofort die Augen. Alles um ihn herum verschwamm. Er musste dann schnell nach Hause laufen, um hinter verschlossenen Türen und Fenstern abzuwarten, bis der Sturm sich gelegt hatte. Wie sehr er darunter gelitten hatte, dass ihn seine Mitschüler damals »Heulsuse« nannten, nur weil er von dieser Allergie gegen den Wüstenstaub befallen war. »Heulsuse! Heulsuse!«, riefen sie, wenn er mit tränenden Augen flüchten musste. Obwohl die Eltern mehrere Ärzte konsultiert hatten, gab es keine Besserung. Amir hatte die Hoffnung schon aufgegeben – bis eines Tages, als er mit seinem Vater in der Moschee war, um dem Mullah einen Besuch abzustatten, völlig unerwartet ein heftiger Wind über die Stadt herfiel. Staub, überall Staub. Amir drängte, er wollte schnell nach Hause laufen. Der Mullah, der von seiner Allergie wusste, hielt ihn zurück: »Warte, meine Junge!«, sagte er. Der Mullah legte ihm seine Hand auf die Augen und murmelte etwas Unverständliches. »Geh jetzt, mein Junge!«, sagte er und schob ihn hinaus auf die Straße. »Du musst keine Angst mehr haben!«
Tatsächlich: Amirs Augen tränten nicht, obwohl der Staub so dicht in den Straßen stand, dass man die eigene Hand nicht mehr sehen konnte. Die Augen tränten nicht! Nie wieder tränten sie! Es war ein Wunder geschehen!
Solche Erinnerungen kamen Hadschi Amir an diesen heißen Nachmittagen unter seinem Sonnensegel. Und es war typisch für ihn, dass er daraus Schlüsse zog – »Lehren«, wie er es nannte. »Das Leben hält für uns alle Lehren bereit. Wir müssen sie nur erkennen!«, das war einer seiner Lieblingssprüche. Und die »Lehre« aus seiner wie durch ein Wunder beendeten Allergie?!
»Nun ja«, dachte Hadschi Amir, »sie besteht wohl darin, dass ich immer schon für ein gottgefälliges Leben bestimmt gewesen bin. Dass ich«, sagte er zu sich selbst, während die Sonne noch wütender auf die Straßen hämmerte, »dass ich ein Auserwählter bin!«
So waren diese Nachmittage. Sie verführten zu allerlei Höhenflügen. Was für ein Vergnügen war es für Hadschi Amir, seinen eigenen Gedanken zuzusehen: Wie sie sich drehten! Wie sie tanzten! Wie sie sich verrenkten – und, ja leider, wie sie sich verwickelten!
Hadschi Amir musste regelmäßig in seinem Kopf für Ordnung sorgen. Er musste, so einsichtig war er durchaus, sich selbst wieder auf den Boden der Wirklichkeit holen. Deshalb sprach er sich selbst halblaut vor, wer er war und worin seine Pflichten bestanden.
»Ich bin Hadschi Amir«, murmelte er vor sich hin, »Ladenbesitzer, Familienvater. Ich bin Hadschi Amir, Diener Gottes! Diener Gottes!«
Hätte ihn einer in diesem Moment beobachtet, dann hätte er wohl den Schluss gezogen, dass Hadschi Amir verrückt geworden war. Das war natürlich nicht der Fall. Im Gegenteil, Hadschi Amir war damit beschäftigt, seinen Ausflug ins Reich der Träume zu beenden und wieder in die wirkliche Welt zurückzukehren.
Dabei dachte er wie immer in der letzten Zeit sofort daran, wie er Gutes tun könnte. In den ersten Wochen nach seiner Rückkehr aus Mekka war es ihm noch einigermaßen schwergefallen, sich als Mensch zu verstehen, der am Wohl der Gemeinschaft mehr interessiert war als an seinem eigenen. Aber er fand sich schnell damit ab, dass er als Hadschi nun Pflichten hatte, die er ohne seine Mekkareise nicht gehabt hätte. Innerlich hatte er sich noch gesträubt, als ihn der Mullah dazu gebracht hatte, das Gebetshaus zu bauen. Als es endlich fertiggestellt war und die Menschen zu ihm kamen, sich überschwänglich bedankten und zu Dutzenden mit ihm zusammen in das Gebetshaus gingen, um zu beten – als all dies sich ereignete, war Hadschi Amir regelrecht überwältigt. Es gab für ihn seither nichts Schöneres, als Gutes zu tun, nichts bereitete ihm so große Freude. Natürlich, er musste immer noch darauf achten, dass sein Laden Profite abwarf. Wie sonst sollte er sein Gutsein finanzieren? Aber der Laden war nur noch die Grundlage für seine Tätigkeit, das Geld war Mittel zum Zweck.
Gerade weil es ihm große innere Zufriedenheit bescherte, hielt Hadschi Amir immer Ausschau nach Möglichkeiten, Gutes zu tun. Das war eines der Ziele seiner Meditationszeit: darüber nachzudenken, wo er mit helfender Hand eingreifen konnte.
»Was sollte ich als nächstes tun?«, dachte Hadschi Amir und schaute hinaus auf die sommerheiße Straße. Auf der anderen Seite huschte eine Gestalt über den Bürgersteig. Eine Frau, eingehüllt in einen Tschador. Sie zog ein Bein etwas nach. Daran erkannte er sie.
»Die Hinkende«, so nannte man sie im Viertel. Sie war erst vor ein paar Monaten hierhergezogen. Sie hatte am Platz eine winzige Wohnung gemietet. Sie lebte allein, und es hatte nicht lange gedauert und allerlei Gerüchte über sie schwirrten durch die Nachbarschaft.
»Ein schlechte Frau!«, hieß es.
»Sie bringt Unglück!«
»Sie hat den bösen Blick!«
»Eine Hure!«
Hadschi Amir blickte ihr interessiert nach. Er wusste nun, wem er helfen wollte.
Baba Zede, der Fabrikant
Baba Zede war der reichste Mann am Asadiplatz. Jedenfalls behaupteten das die Leute. Genau wussten sie es nicht. Denn keiner kannte Baba Zede gut genug, um zuverlässig über ihn Auskunft geben zu können. Sicher war nur, dass Baba Zede eine Keramikfabrik besaß. Sie lag nicht weit entfernt. Wenn der Wind aus östlicher Richtung blies, waberte der Rauch der Fabrik über den Platz. Er war schwarz und dick. Er reizte die Atemwege der Menschen. An solchen Tagen war aus allen Häusern Husten zu hören, und wer sich im Freien befand, schützte seinen Mund mit einem Tuch. Ob alt oder jung, die Fabrik verschonte niemanden.
»Baba Zede macht heute wieder gute Geschäfte!«, hieß es an solchen Tagen. Die Menschen auf dem Platz sprachen mit einer Mischung aus Respekt und unterdrückter Wut über den Fabrikanten. Die Bewohner des Platzes lebten nicht in Armut, aber sie fühlten sich benachteiligt, wenn sie sich Baba Zedes Wohlstand vorstellten. Einerseits waren sie davon beeindruckt, dass er ein Unternehmen mit 25 Beschäftigten leitete; andererseits waren sie neidisch auf ihn, weil sie glaubten, er werde durch diese Fabrik reich. Neid war unter ihnen eine weit verbreitete Untugend. Außerdem waren die Menschen auf diesem Platz der Ansicht, dass man nur mit unlauteren Mitteln reich werden konnte.
Dieses Vorurteil darf nicht verwundern, denn in den Jahren, als der Schah herrschte, bereicherte sich eine Kaste von wenigen Privilegierten auf schamlose Weise. Nicht Arbeit, nicht Fähigkeiten und nicht Leistungen zählten, sondern die Nähe zum Hofe des Schahs. In den 1970er Jahren flossen dank der explodierenden Erdölpreise gewaltige Summen in die Kassen des Staates. Der Schah versprach Fortschritt, Entwicklung und Wohlstand für alle. Aber die Menschen am Asadiplatz bekamen davon nichts ab. Sie hörten die Geschichten von unglaublichem Reichtum, von Prasserei und Verschwendung. Während sie ein bescheidenes, fast ärmliches Leben führten, herrschte in den Palästen und Villen im Norden Teherans unvorstellbarer Überfluss. Es war in den Zeitungen zu lesen, wie sich die Reichen nach Europa aufmachten, nach Paris, nach London oder in die USA, wie sie dort ausgedehnte Einkaufstouren unternahmen, die mehrere Jahreseinkommen eines durchschnittlichen iranischen Arbeiters verschlangen. Vergeblich wartete die Mehrheit der Menschen, dass etwas von dem Geldsegen, der über das Land niederging, bis zu ihnen durchsickerte. Der Unmut wuchs deshalb. Reichtum roch für die Menschen auf unserem Platz immer nach Betrug. Wer ehrlich war, der blieb ihrer Meinung nach arm.
Einer wie Baba Zede musste daher unehrlich sein.
Baba Zede wusste natürlich von diesen Vorurteilen. Er fürchtete sie. Deshalb hielt er alle seine Nachbarn auf Distanz. Er spürte, dass sie begehrten, was er besaß, dass sie am liebsten in sein Leben schlüpfen wollten wie in eine zweite Haut. Wie sollte er ihnen da trauen?
Natürlich, er hätte von hier wegziehen können. Geld genug hatte er. Hin und wieder dachte er daran, sich in einem wohlhabenden Viertel ein Haus zu kaufen. Aber er war hier aufgewachsen als Sohn eines kleinen Beamten. Er hing an diesem Platz. Auch hatte er hier sein Glück gemacht, nicht woanders. In diesem Viertel hatte er alles gelernt, was er brauchte.
Nach Abschluss der Schule hatte er mit allem Möglichen gehandelt. Als er genügend Kapital zusammenhatte, gründete er die Keramikfabrik. Es war Ende der 1960er Jahre, der Erdölboom begann gerade erst zu wirken. Mehr und mehr Menschen waren bereit, viel Geld für schönes Interieur auszugeben. Baba Zedes Fliesen, seine Teller, Tassen und Töpfe waren von hoher Qualität, und er produzierte preiswert. Das Geschäft lief prächtig. Baba Zedes Fabrik war bald in der ganzen Hauptstadt bekannt. Selbst aus dem wohlhabenden Norden kamen Bestellungen. Manchmal fuhr er selbst zu einem Auftraggeber, um Details eines Geschäftes zu besprechen. Bei solchen Gelegenheiten kam es schon vor, dass Baba Zede ins Staunen geriet angesichts des glitzernden Pracht, die er zu sehen bekam. Er selbst kam sich dann armselig vor. Er hätte das gerne seinen Nachbarn erzählt, um ihnen klarzumachen, wie die Verhältnisse wirklich waren, aber sie hätten ihm nicht geglaubt. Für sie war er reich. Und er würde es immer bleiben, egal welche Argumente, welche Beweise er auch anführen mochte.
Trotzdem, er hatte alles in allem keinen Grund zur Klage. Er machte gutes Geld, und er bekam Anerkennung von höchster Stelle. Die Regierung sandte eines Tages einen Beamten. Er behauptete, dass er im Auftrag des Schahs käme. Der Beamte hatte eine große, glitzernde Medaille bei sich, die er Baba Zede vor versammeltem Publikum überreichte.
»Der Unternehmer Baba Zede ist ein leuchtendes Beispiel für die Größe unseres Volkes!«, diktierte der Beamte einem mitgebrachten Journalisten in den Block. Am nächsten Tag stand diese Zeile in der Zeitung. Ein Foto gab es auch dazu.
Baba Zede war das peinlich gewesen. Aber was hätte er tun sollen? Sich entziehen? Er hätte nur Kundschaft verloren.
Dieser Vorfall brachte seine Nachbarn in Wallung. Ihre Gefühle für Baba Zede verstärkten sich: Sie brachten ihm noch mehr Bewunderung entgegen – doch auch die Verachtung stieg. Er selbst spürte das freilich – und zu seiner Überraschung genoss er es. Plötzlich empfand er regelrecht Lust dabei. Er fühlte sich reicher, als er war.
»Wenn ich unter den anderen Reichen leben würde, ich wäre nur einer unter vielen. Hier aber bin ich einzigartig!«
Das sagte sich Baba Zede. Nie mehr sollte er zögern. Die Entscheidung war gefallen. Für den Rest seines Lebens würde er in diesem Viertel wohnen.
Baba Zede hat einen unerwarteten Gast
Hadschi Amir wollte mit der Hinkenden in Kontakt kommen. Aber er musste vorsichtig sein. Sie hatte einen schlechten Ruf. Er färbte auf jeden ab, der sich mit ihr unterhielt. Wer mit ihr ein Wort wechselte, stand unter Verdacht. Wenn sie einkaufen ging und sich ein Verkäufer mit ihr etwas länger als nötig zu unterhalten schien, wechselten die anderen Kunden im Geschäft sofort vielsagende Blicke …
»Hast du ihre Augen gesehen! Wie sie ihn angeblickt hat …«
»Und er … völlig benommen war er. Schau mal, er ist immer noch nicht bei sich … Sie hat ihn in den Bann geschlagen … Sie wird ihn zu sich locken …«
Die Hinkende brachte alle durcheinander, seit sie hierhergezogen war. Sie vernebelte die Köpfe und verdüsterte die Herzen.
Niemand wusste genau, woher sie kam. Eines Tages jedenfalls klopfte sie an die Tür von Baba Zede, dem Keramikfabrikanten.
»Ich habe gehört, Sie haben eine kleine Wohnung zu vermieten«, sagte sie mit einer heiseren Stimme zu ihm.
Baba Zede nickte. Er nahm sich Zeit, bevor er ihr eine Antwort gab. Zeit, um sie genau zu betrachten. Sie hatte ein bleiches, rundes Gesicht, eine kühn geschwungene Nase und braune Augen. »So groß wie Teetassen«, dachte Baba Zede und lachte leise über diesen Vergleich.
Baba Zede unterhielt sich mit ihr ein wenig. Ihm fiel nichts Besonderes an ihr auf. Natürlich fragte er sich, warum eine Frau alleine eine Wohnung mieten wollte. Das war mehr als ungewöhnlich. Andererseits herrschte damals noch der Schah, und der hatte der iranischen Gesellschaft per Dekret mehr Offenheit verordnet. Der Schah hatte allerlei religiöse Praktiken verboten oder sie in das Private verbannt. Religion war ihm grundsätzlich suspekt. Er bekämpfte die Mullahs nach Kräften, womit er sich ihren Zorn einhandelte. Die tiefe Frömmigkeit seines Volkes schien dem Schah förmlich peinlich zu sein. Wenn er auf seine Auslandsreisen ging und dabei auf dieses Thema angesprochen wurde, sparte er nicht mit Kritik an seinen Landsleuten. Man gewann den Eindruck, der Herrscher halte sein Land für »mittelalterlich«. Freilich war sein Spiel ziemlich durchsichtig. Je rückständiger er sein eigenes Volk darstellte, desto greller fiel das Licht auf ihn, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, die Iraner aus den Klauen der Mullahs zu befreien.
Als die Hinkende bei Baba Zede vorsprach, geschah dies also im Klima einer von oben verordneten Säkularisierung. Sie konnte mit Verständnis rechnen, wenn sie als alleinstehende Frau bei Baba Zede vorsprach. Für Baba Zede allerdings waren der Schah und seine Politik nicht von besonderem Belang. Er gehörte einfach nicht zu den Menschen, die ihre Nase in die Angelegenheiten anderer steckten. Er war kein Schnüffler. Außerdem war er froh, dass er die Miete einnehmen konnte. Die Wohnung stand schon einige Zeit leer. Schlafendes Kapital, das hasste Baba Zede. Noch am selben Tag wurde er sich mit der Hinkenden handelseins. Später sollte Baba Zede jedoch Ärger mit seiner Ehefrau bekommen, weil er die Wohnung an die Hinkende vermietet hatte.
»Du hast sie hier untergebracht. Du hast es möglich gemacht, du Dummkopf!«
Er musste sich das immer dann anhören, wenn die Hinkende wieder ins Gerede gekommen war. Und das geschah sehr, sehr oft. Baba Zede wies die Vorwürfe seiner Frau mit einer gleichgültigen Miene ab. Natürlich missfielen ihm diese Vorhaltungen. Aber er konnte die Hinkende nicht einfach hinauswerfen. Dazu fehlte ihm die Härte. Baba Zede brach einmal getroffene Abmachungen nicht. Er war ein Ehrenmann. Alle im Viertel wussten das.
Er musste nur lange genug seine Linie durchhalten, und die Kritik an seiner Entscheidung würde verstummen. Genauso kam es. Baba Zede war mit der Zeit der Einzige, der mit der Hinkenden Kontakt haben konnte, ohne dass er böswilligen Klatsch auf sich zog. Selbst seine Frau nahm es irgendwann schweigend hin, dass die Hinkende bei Baba Zede Unterschlupf gefunden hatte. Sie war allerdings die Letzte, die ihm verzieh.
»Baba Zede! Ich muss als Allererstes mit Baba Zede reden!«, dachte Hadschi Amir und meinte, damit die Lösung für seine verzwickte Lage gefunden zu haben. Er wollte der Hinkenden helfen, ohne Schaden zu nehmen. Er wollte etwas in dieser Sache unternehmen, ohne irgendetwas zu riskieren. Hadschi Amir war ein vorsichtiger Mann. Deshalb ging er zu Baba Zede.
Baba Zede staunte, als er Hadschi Amir an der Tür stehen sah. Die beiden hatten nie viel miteinander anfangen können. Wenn sie aufeinandertrafen, dann gerieten sie jedes Mal mit einer beängstigenden Unvermeidlichkeit in Streit. Der Ursprung dieser Auseinandersetzungen lag meist in ihrem Verhältnis zu Gott, das unterschiedlicher nicht sein konnte. Baba Zede war nicht besonders gläubig. Er machte daraus auch keinen Hehl. Hadschi Amir seinerseits verbarg nicht, dass er den mangelnden religiösen Eifer Baba Zedes nicht tolerierte. Besonders, seit er aus Mekka zurückgekommen war, ließ er keine Gelegenheit aus, Baba Zede zu bedeuten, dass er – Hadschi Amir – ihn für einen Heiden hielt. Baba Zede seinerseits beantwortete dies mit seiner bewährten gleichgültig herablassenden Miene. Die beiden gingen sich aus dem Weg, wo es nur ging.
»Du? Was für ein Überraschung!«, sagte Baba Zede.
»Ich weiß, ich weiß«, antwortete Hadschi Amir und rieb sich nervös die Hände. Baba Zede betrachtete ihn und schwieg. Hadschi Amir war dies unangenehm. Er wusste nicht, was er sagen sollte. »Ich … Ich …«, stotterte er.
»Jaaa …« Baba Zede genoss diesen Augenblick. »Es geht um … äh…« Hadschi Amir gelang es nicht, sein Anliegen direkt vorzutragen. Baba Zede sah, wie er sich wand. Hadschi Amirs Gesicht verzerrte sich, als hätte er starke Magenkrämpfe. Plötzlich überfiel Baba Zede Mitgefühl mit diesem Mann.
»Willst du nicht reinkommen?«, fragte er Hadschi Amir.
Dieser war überrascht von dem Angebot. Er schaute auf Baba Zede, dann drehte er sich um, als fürchtete er, von jemandem beobachtet zu werden. Als er Baba Zede wieder in die Augen blickte, sagte er: »Ja, danke!«
Noch bevor Baba Zede ihm Platz machen konnte, war Hadschi Amir schon an ihm vorbei in den Innenhof des Hauses geschlüpft. Wie ein Mann auf der Flucht.
Robabehs Verehrer
Robabeh war mit ihren Eltern und ihrem Bruder Hussein ein paar Jahre vor der Revolution in das Viertel eingezogen. Die jungen Männer begannen sofort, um Robabeh zu werben, weil sie das schönste Mädchen des Viertels war. Sie waren verrückt nach ihr.
»Robabeh, komm mit mir …!«
»Nein, nein, Robabeh, mit mir, komm mit mir …«
»Mit mir, mit mir …!
So flüsterten die Jungen ihr heimlich zu. Sie boten Geschenke an, sie hinterlegten unbemerkt Blumen für sie, sie lungerten vor ihrer Haustür herum, sie lächelten ihr unterwürfig zu, wenn sie aus der Tür trat und an ihnen vorbeiging. Sie waren bereit, für Robabeh alles zu tun, denn so eine Schönheit hatte man in diesem Viertel noch nie gesehen. Auch die Alten konnten sich nicht daran erinnern, dass ein derart vollkommenes Mädchen je unter ihnen gelebt hatte.
Dieses heftige Werben fand unter sehr schwierigen Bedingungen statt. Auch wenn der Schah Offenheit predigte und er damit auch das Verhältnis der Geschlechter meinte, änderten sich die Sitten der Menschen nicht. Mann und Frau blieben nach alter Tradition getrennt. Sie konnten sich nur auf ganz eng beschriebenen Bahnen treffen, meist waren es untereinander verwandte Familien, die solche Möglichkeiten eröffneten. Heirat, das war eine innere Angelegenheit der weit verzweigten Familien. Wer also, wie die Jungen auf dem Platz, um Robabeh warb, verstieß gegen die Sitte. Das konnte mitunter auch gefährlich sein, aber das schien die Jungen nicht zu kümmern, was natürlich der beste Beweis für die verstörende Kraft war, die von Robabehs Schönheit ausging – sie war buchstäblich umstürzend schön.
Die gleichgültige Gelassenheit, mit der Robabeh die Komplimente annahm, spornte die Jungen zu noch größeren Anstrengungen an. Es gab welche, die Kopf und Kragen riskierten, um sie zu beeindrucken. Ein Junge namens Mohammed kletterte auf das Dach des Hauses, in dem Robabeh wohnte, und seilte sich von dort bis vor das Schlafzimmerfenster Robabehs herunter, das sich im dritten Stock befand. Er starrte durch das Fenster, dann brachte er das Seil leicht zum Schwingen, bis er mit seinen Fingern am Glas klopfen konnte.
»Robabeh! Robabeh!«, schrie er so laut, dass man es am ganzen Platz hören konnte. Die Passanten blickten nach oben. Sie sahen belustigt und entsetzt zugleich, wie Mohammed verkrampft an dem Seil hing und den Namen des Mädchens brüllte, als ginge es um sein Leben. Unter den Schaulustigen war auch sein Vater, der vor Scham errötete. Die Tollheit seines Sohnes blamierte ihn vor den Augen der Nachbarn bis auf die Knochen. Was sollten sie bloß von ihm denken? Wie konnte er je wieder seine Autorität herstellen? Der Vater spürte, wie Wut in ihm aufstieg, während er gleichzeitig besorgt auf seinen Sohn blickte, der in gefährlicher Höhe an dem Seil hing und den Namen dieses Mädchens rief. »Robabeh! Robabeh!«
Aber sie machte ihm nicht auf, auch nach langen Minuten nicht. Mohammed musste schließlich aufgeben, weil das Seil, an dem er hing, verdächtig zu knirschen begann. Er hatte nicht mehr die Kraft, sich wieder auf das Dach zu hieven, und rutschte mühsam nach unten. Aber das Seil war mindestens drei Meter zu kurz. Mohammed sprang, landete auf den Betonplatten des Bürgersteiges und brach sich ein Bein. Er schrie auf vor Schmerz, aber sein Vater kam ihm nicht zu Hilfe. Er wandte sich ab. Die Nachbarn halfen ihm auf und verständigten den Krankenwagen.
Nie hat Mohammed sich über diesen Unfall beklagt, weder im Krankenhaus, noch in all den Wochen danach, in denen er mit einem Gips durch das Viertel humpeln musste. Robabeh war es wert gewesen.
Ein anderer Verehrer, er hieß Machmud, wurde von der Polizei bei einem Raubüberfall verhaftet. Er hatte einem Apotheker eine Wasserpistole vor die Nase gehalten und ihn gezwungen, die Kasse zu öffnen und das gesamte Geld herauszunehmen. Es war ein eigenartiger Anblick, denn Machmud war klein und schmächtig, gerade mal 16 Jahre alt. Der Apotheker überragte ihn um Haupteslänge, und er war stark wie ein Stier. Als Machmud das Geld in seine Hemdtasche stopfte und dadurch einen Augenblick unkonzentriert war, versetzte der Apotheker ihm einen kräftigen Faustschlag in die Magengrube. Er nahm Machmud die Pistole ab. Erst jetzt bemerkte er, dass es eine Wasserpistole war. Das brachte ihn so in Wut, dass er Machmud, der nach Luft schnappend am Boden lag, einen heftigen Tritt in die Rippen versetzte.
»Das hättest du dir so gedacht, du Scheißkerl!«, schrie er und trat noch einmal zu.
Die Polizei kam, verhaftete Machmud und brachte ihn direkt ins Gefängnis. Dort musste Machmud noch ein paar Schläge einstecken, das war nichts Besonderes. Das war so üblich in iranischen Gefängnissen.
Wenige Tage später kam Machmud vor den Richter. Das war ein strenger Herr, der die Angeklagten mit stechendem Blick musterte. Der Richter genoss es mit anzusehen, wie die Angeklagten vor Angst zitterten. Er ergötzte sich geradezu daran. Den Richterberuf nämlich nahm er vor allem als Möglichkeit wahr, seine sadistischen Neigungen auszuleben. Ganz egal, wer ihm vorgeführt wurde, Kleinkriminelle, Mörder oder Menschen, die sich der Majestätsbeleidigung schuldig gemacht hatten – er bestrafte alle mit großer Härte. Um seinen Genuss an der Bestrafung anderer noch zu steigern, hatte er eine besondere Methode erfunden. Er ließ die Angeklagten bis zum Ende des Prozesses in dem Glauben, dass sie die härteste aller Strafen treffen würde. Um das zu erreichen, sprach er mit Donnerstimme. Er drohte und schimpfte, er fauchte und schrie, bis den Angeklagten der Angstschweiß ausbrach. Am Höhepunkt dieses Schauspiels, wenn die Angeklagten nahe am Zusammenbruch waren, hielt der Richter plötzlich inne. Ein paar lange Minuten des Schweigens folgten. Der eisige Blick des Richters ließ alle Anwesenden erstarren. Schließlich sprach der Richter zur Überraschung aller ein vergleichsweise mildes Urteil aus. Die Angeklagten sackten in solchen Augenblicken förmlich in sich zusammen. Der Richter erreichte den Höhepunkt seiner perversen Leidenschaft.
Als Machmud vor den Richter gebracht wurde, entschloss sich dieser, seine besondere Methode anzuwenden. Dieser 15-Jährige schien dem Richter das geeignete Opfer für sein Katz-und-MausSpiel zu sein. Aber wie sehr er sich auch bemühte, Machmud Angst einzujagen, wie sehr er ihm mit gebotener Grausamkeit ausmalte, was ihn im Gefängnis erwartete – Machmud blieb völlig unbeeindruckt. Als der Richter schließlich entnervt aufgab und schlicht fragte, warum er die Apotheke überfallen habe, antwortete Machmud:
»Ich wollte Robabeh gefallen!«
»Robabeh?«
»Ja, Robabeh!«
Der Richter brummte Machmud zwei Jahre auf. Aber Machmud beklagte sich nicht über diese Strafe. Er bereute nichts.
Robabeh war es wert gewesen.
Machmud baut ein Denkmal
An einem warmen Frühlingstag frühmorgens tauchte ein Bautrupp am Vorplatz des Basars auf. Die Männer luden ihre Werkzeuge von einem Lastwagen, sperrten ein Stück des Platzes mit einem Seil ab und begannen, ein Loch zu graben. Die ersten Neugierigen fanden sich bald ein. Nach ein paar Stunden umringten Dutzende Menschen die Bauarbeiter.
»Was soll das werden?«, riefen sie einem Mann zu, der mit lauter Stimme die Arbeiter dirigierte. Er war der Ingenieur. Damals, zu Zeiten des Schahs, war das ein hoch angesehener Beruf. Jede Tätigkeit, die mit Planen und Bauen, mit Entwerfen und Errichten in Verbindung gebracht werden konnte, förderte der Schah nach Kräften. Technik im weitesten Sinne war für ihn zur Ersatzreligion geworden. Im königlichen Gedankenkosmos nahmen Maschinen den Platz der Moscheen ein, Techniker hatten die Mullahs verdrängt. Der Ingenieur machte ein entsprechend arrogantes Gesicht; mit jeder Körperbewegung schien er seine eigene Bedeutung unterstreichen zu wollen. Er drehte sich nicht mal nach den Menschen um, die ihn angesprochen hatten.
»Was soll das werden?!«, riefen alle zusammen wie ein Chor. »Was soll das werden?!«
»Weiße Revolution!«, antwortete der Ingenieur endlich. »Fortschritt!«, schrie er so laut, dass es alle hören konnten. »Wir brechen auf, Richtung Westen!«
Mit diesen Worten drehte er sich um, ging auf ein wartendes Auto zu und fuhr davon. Er ließ seine schwitzenden Arbeiter zurück und die ungestillte Neugier der Schaulustigen.
Weiße Revolution. Der Schah hatte dieses Programm landauf, landab verkünden lassen. Er wollte den rückständigen, aber rohstoffreichen Iran innerhalb weniger Jahrzehnte auf das Niveau eines westlichen Industriestaates bringen. Ein großer Sprung nach vorne sollte es werden. Der Schah sah sich selbst als Nachfolger des prächtigen Königs der Könige, Kyros, der vor 2500 Jahren das größte Reich der damaligen Welt geschaffen hatte. Die Menschen am Asadiplatz kannten die Sehnsüchte und Träume ihres Schahs.
Aber was sollte diese Baustelle damit zu tun haben? Dieses Loch, das mit jeder Minute tiefer und tiefer wurde? »Eine öffentliche Toilette!«, sagte ein Arbeiter endlich, während er eine Pause machte, seine Schaufel weglegte und einen Schluck Wasser zu sich nahm. »Wir bauen eine öffentliche Toilette!«
Die Menschen hatten gelernt, sich nicht allzu viel von den großen Worten des Schahs zu erwarten. Trotzdem, es war schwierig für sie, den Zusammenhang zwischen der grandiosen Weißen Revolution und dieser Toilette zu sehen. Deshalb zerstreuten sie sich bald und gingen wieder ihren Alltagsgeschäften nach. Der Schah, so dachten sie, erlaubte sich wieder einmal eine seiner Verrücktheiten. In jenen Jahren hatte er unter dem Großteil des Volkes bereits jeden Respekt verloren. Den meisten Menschen am Asadiplatz erschien er wie ein großes, unbelehrbares Kind, das seine Launen auslebte und dabei jede erdenkliche Grausamkeit beging. Es war besser, mit ihm nicht in Kontakt zu kommen.
Das war ein ganz natürlicher Wunsch, diktiert vom Überlebenswillen. Leider ging er nicht immer in Erfüllung, denn der Schah hatte eine sehr aufdringliche Art.
Als die Arbeiter nach ein paar Wochen endlich fertig waren, kam eine kleine Beamtenschar, um das Bauwerk einzuweihen. Ein adrett gekleideter Herr mit Krawatte hielt eine kurze Ansprache, danach durchschnitt er ein Band. Die herangekarrten Claqueure taten, wofür sie bezahlt wurden, und applaudierten, bis ihnen die Hände schmerzten. Auch das war charakteristisch für die Zeit. Selbst die banalsten Dinge versahen die Männer des Schahs mit einem pompösen Rahmen.
Nun waren die Toiletten offiziell eröffnet, aber keiner der Menschen im Viertel sollte darüber glücklich sein. Schuld daran war der Ingenieur. Er hatte auf das Dach des betonierten Toiletteneingangs einen großen Ventilator anbringen lassen, der die Anlage entlüften sollte – mit dem Ergebnis, dass er die Luft verpestete. Der Gestank nach Urin und Exkrementen durchzog die Gegend und verteilte sich ohne Rücksicht auf Stand und Ansehen der Menschen. Manche behaupteten, dass dies Absicht gewesen sei. »Der Schah«, so sagten sie, »will uns demütigen.«
»Er sch… auf uns!«
Es mag sein, dass Sätze wie diese Machmud auf seine folgenschwere Idee gebracht hatten.
Im Sommer nach dem Bau besagter Toilette verschwand er für ein paar Tage. Keiner wusste genau, wohin er gegangen war. Ein paar Jungen behaupteten, sie hätten ihn irgendwo auf den schlammigen Wegen gesehen, die zu den Fabriken führten, zu den Werkstätten und zum Schlachthof. Andere wieder wollten ihn am Bahnhof gesichtet haben, die Ankündigung der Abfahrten und Ankünfte der Züge studierend. Doch Gewissheit über seinen Verbleib gab es keine. Die Menschen am Asadiplatz nahmen an, dass Machmud sich aus Liebeskummer zurückgezogen hatte. Es war kein Geheimnis, dass er immer noch in Robabeh verliebt war. Auch das Gefängnis hatte ihm das nicht austreiben können. Im Gegenteil, er schien entschlossener als je zuvor, Robabeh zu beeindrucken. Er war regelrecht verrückt nach ihr.
An einem heißen Augustmorgen verbreitete sich in Windeseile die Nachricht, dass oben am Basar etwas Außergewöhnliches zu besichtigen war – an diesem Tag tauchte Machmud wieder auf.
»Der Schah hat ein neues Denkmal!«, hieß es. »Kommt! Kommt! Er hat ein neues Denkmal!«
Die Menschen liefen zusammen. Sie mussten nicht lange nach dem Denkmal suchen. Es stand auf dem Ventilatorkasten der Toiletten und war weithin sichtbar. Der Schah ließ sich nur mit Mühe in den groben Zügen dieses Gebildes aus Pappe wiedererkennen. Offensichtlich hatte ein Dilettant dieses Werk geschaffen, doch das störte niemanden, denn der Zweck bestand nicht darin, dem Schah zu huldigen, sondern ihn zu verspotten. Gerade weil das Denkmal so erbärmlich aussah, entlarvte es die pfauenhaften Posen des Herrschers umso besser.
Die Menschen starrten auf den Schah aus Pappe, und auf ihren Gesichtern ließ sich erkennen, dass sie ihre Gefühle mit großer Mühe zurückhielten. Sie hätten am liebsten laut losgelacht, aber ihre Vorsicht hinderte sie daran. Der Schah hatte überall Augen und Ohren. Ganz gleich, wo in dem weiten Land sich eine Majestätsbeleidigung zutrug, man würde dem Schah darüber berichten und er würde böse werden, und das konnte schwerwiegende Folgen haben. Die Menge verhielt sich deshalb still. Die Spione des Schahs spitzten ihre Ohren, nur die Kinder in ihrer Unschuld kicherten leise. Plötzlich trat Machmud einen Schritt vor, zeigte mit ausgestrecktem Arm auf das Denkmal und rief laut: »Der Schah stinkt!«
Die Menge brach in schallendes Gelächter aus, als hätte sie nur darauf gewartet, dass einer den Bann brach. Die Spione des Schahs blickten sich verwirrt an. Sie konnten doch nicht alle verhaften? Und dieser junge Mann? Er war bereits in der Menge verschwunden. Ihn musste man fassen. Nur finden musste man ihn.
Das erledigte Dawud, der Spion vom Asadiplatz. Später, unter der Folter, gab Machmud zu, dass er das Denkmal selbst gebaut hatte, allein, ganz allein, wie er behauptete. Das glaubten ihm die Folterer der Savak nicht, weil sie grundsätzlich überall Konspiration witterten. Sie tauchten Machmuds Kopf ins Wasser, bis er glaubte, ertrinken zu müssen. Als sie ihn anschrien: »Wer hat dich angestiftet? Wer ist dein Auftraggeber? Wer sind die Mitglieder deiner Gruppe?«, fiel er in Ohnmacht. Auch später würde er nie verraten, dass er das Denkmal nur gebaut hatte, um Robabeh endlich zu gewinnen. Selbst wenn es den Folterern gelungen wäre, aus Machmud diese Wahrheit herauszupressen, sie hätten sie nicht glauben können. Diese Nachricht von der Liebe hätte sie, die das blutige Tagewerk der Diktatur besorgten, zu sehr verstört.
Dawuds Nase
Dawud war ein schmächtiger Mann mit hängenden Schultern und einer dicken, roten Nase, die winters wie sommers tropfte. Jederzeit hielt er große Taschentücher griffbereit. Seine Kleider beulten sich davon unvorteilhaft aus. Erst wenn Dawud kaum mehr atmen konnte, schnäuzte er sich. Er tat es so geräuschvoll, dass es über den ganzen Platz zu hören war. Die Katzen duckten sich unter dem spärlichen Gebüsch, die Vögel flogen erschreckt auf, und die Nachbarn schüttelten den Kopf über diesen Dawud und seine schlechten Manieren. Das Meckern fiel ihnen umso leichter, als er ein Zugezogener war. Er war Anfang der 1970er Jahre mit seiner Frau Fereschteh und den beiden Kindern Robabeh und Hussein, die damals knapp zehn und sieben Jahre alt waren, hierhergekommen. An einem Donnerstag hielt ihr Möbelwagen vor dem Haus, in dem schon seit geraumer Zeit eine Wohnung frei stand. Daran erinnerten sich die Nachbarn, denn kaum war Dawud ausgestiegen, explodierte seine Nase wie ein Feuerwerkskörper. Eine solche Begrüßung hatten sie noch nie erlebt.
Der Schah war damals schon seit mehr als zwei Jahrzehnten Jahren auf dem Thron, und ein Ende seiner Herrschaft schien nicht in Sicht. Natürlich, es gab damals Hunderttausende Iraner, die ihn lieber heute als morgen gestürzt hätten. Viele Gegner des Schahs darbten in den Kerkern und litten unter der Folter furchtbare Qualen. Trotzdem schien seine Macht nicht gefährdet. Er hatte Panzer, Kanonen, Soldaten, er hatte eine prall gefüllte Schatztruhe und er konnte mit der Unterstützung des Westens rechnen. Was sollte ihm da schon passieren? Seine Lakaien sagten ihm weitere Jahrzehnte Herrschaft voraus. Sie gaben ihm das Gefühl, dass er seinen eigenen Tod per Dekret hinausschieben könnte. Und vermutlich glaubte er das.
Das waren die Zeiten, als Dawud mit seiner Familie im Viertel einzog. Keiner wusste, woher er gekommen war; es konnte auch niemand sagen, womit er seinen Lebensunterhalt verdiente. Auf dem Basar allerdings fiel schnell auf, dass Dawuds Frau Fereschteh genügend Geld hatte, um sich das Teuerste zu kaufen. Mageres Fleisch, frisches Obst, wohlriechende Gewürze, Fereschteh musste auf nichts verzichten. Sie zog deshalb manch missgünstige Bemerkung auf sich, die sie aber überlegen lächelnd überging. Sie gab den anderen Frauen das Gefühl, zu einem niedrigen Stand zu gehören. Eine wie Fereschteh musste sich mit solchen Menschen nicht auseinandersetzen.
Ihre Ausgaben erschienen den anderen umso verdächtiger, als Dawud den ganzen lieben Tag nichts anderes tat, als durch das Viertel zu schlendern und hier und dort ein Schwätzchen zu halten. Er hatte eine unverfängliche Art zu reden, und es gelang ihm gut, seinen Gesprächspartnern das Gefühl zu geben, dass er sich für sie interessierte. Seine Stimme wirkte einschläfernd und aufregend zugleich. Wenn da nicht dieses ungeheuerliche Niesen gewesen wäre, hätten ihn viele Nachbarn wohl bald ins Herz geschlossen. Aber so blieb sein Werben meist vergeblich. Dauerhafte Sympathien konnte er keine gewinnen. Das war nicht möglich für einen Mann, der seine Nase regelmäßig und, ohne jede Rücksicht zu nehmen, mit einem fürchterlichen Krach entlud.
Das hatte auch damit zu tun, dass die meisten Nachbarn glaubten, Dawud arbeite für die Savak, die Geheimpolizei des Schahs. Schließlich war er hier aufgetaucht, als sich Savak-Leute im ganzen Land ungeheuer vermehrten. Kein Asadi jedoch sprach seinen Verdacht aus. Dazu waren die Leute zu vorsichtig. Schon mancher war verschwunden, nur weil er mit dem Finger auf jemanden gezeigt und geflüstert hatte: »Der arbeitet für die Savak!«
Es gab unter den Menschen im Viertel auch einige wenige, die im Prinzip nichts gegen die Savak einzuwenden hatten. Sie mochten das Gerede von Revolution und Umsturz nicht, das sich damals breitmachte. Die jungen Männer mit ihren hitzigen Reden und die Mullahs mit ihren radikalen Ansichten waren ihnen durch und durch suspekt. Sie fürchteten den Ausbruch unkontrollierter Gewalt. Die Savak versprach zwar eine Zwangsordnung, aber immerhin eine Ordnung. Das war besser als das Chaos.
Aber dieser Dawud? Wer konnte den schon ernst nehmen? »Wie um Himmels willen«, dachten die Ordnungsliebenden, »sollte uns so einer vor den Revolutionären schützen?« Und wer unter den Menschen am Asadiplatz den Sturz des Schahs herbeisehnte, der hatte für Dawud ebenfalls nur abfällige Bemerkungen übrig. »Dieser Mann soll ein Bollwerk gegen die Revolution sein?! Dass wir nicht lachen!«