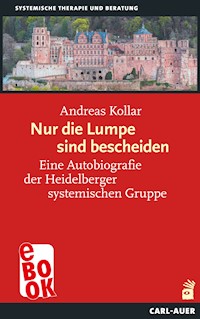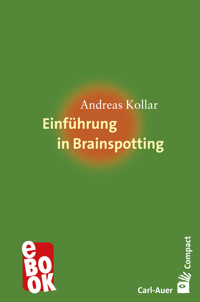
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl-Auer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Carl-Auer Compact
- Sprache: Deutsch
"Wir [im Brainspotting] wollen gar nicht, dass alle [Therapeut:innen] Brainspotter:innen werden. Mir geht es darum, die Hauptideen von Brainspotting im Bereich der Psychotherapie zu verbreiten." David Grand Erste Hilfe in der Traumatherapie Brainspotting ist eine körperorientierte Therapieform, die auf neurobiologischen Erkenntnissen aufbaut. Sie basiert auf der Annahme, dass emotionale Empfindungen mit bestimmten Augenpositionen korrespondieren. Diesen Zusammenhang macht sich Brainspotting zunutze, indem therapierelevante Emotionen und physiologische Prozesse über das Gesichtsfeld zielgerichtet aktiviert werden. Die Methode geht auf Beobachtungen des amerikanischen Therapeuten David Grand zurück, der die Abläufe und theoretischen Aspekte von Brainspotting seit vielen Jahren fortlaufend verfeinert. Dieses Buch liefert auch eine differenzierte Auseinandersetzung mit aktuellen Erkenntnissen. Durch die hohe Aufmerksamkeit auf die therapeutische Beziehung kann das Vorgehen ständig an den laufenden Therapieprozess angepasst werden. Gleichzeitig wird durch das achtsame, fokussierte Begleiten der Klient:innen viel Raum für innere Verarbeitungsprozesse aufgebaut. Aufgrund der deutlichen Komplexitätsreduktion im therapeutischen Prozess hat Brainspotting das Potenzial, die Psychotraumatherapie nachhaltig zu erweitern. Der Autor: Andreas Kollar, Klinischer Psychologe, Gesundheitspsychologe und Sportpsychologe; Coach; Lehrtrainer für Klinische Hypnose; Neurofeedback-Dozent; Vorstandsmitglied der European Society of Hypnosis (ESH); internationale Seminartätigkeit für unterschiedliche Berufsgruppen; Leitung des Kompetenzfokus Institut.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas Kollar
Einführung in Brainspotting
2024
Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats des Carl-Auer Verlags:
Prof. Dr. Dr. h. c. Rolf Arnold (Kaiserslautern)
Prof. Dr. Dirk Baecker (Dresden)
Prof. Dr. Ulrich Clement (Heidelberg)
Prof. Dr. Jörg Fengler (Köln)
Dr. Barbara Heitger (Wien)
Prof. Dr. Johannes Herwig-Lempp (Merseburg)
Prof. Dr. Bruno Hildenbrand (Jena)
Prof. Dr. Karl L. Holtz (Heidelberg)
Prof. Dr. Heiko Kleve (Witten/Herdecke)
Dr. Roswita Königswieser (Wien)
Prof. Dr. Jürgen Kriz (Osnabrück)
Prof. Dr. Friedebert Kröger (Heidelberg)
Tom Levold (Köln)
Dr. Kurt Ludewig (Münster)
Dr. Burkhard Peter (München)
Prof. Dr. Bernhard Pörksen (Tübingen)
Prof. Dr. Kersten Reich (Köln)
Dr. Rüdiger Retzlaff (Heidelberg)
Prof. Dr. Wolf Ritscher (Esslingen)
Dr. Wilhelm Rotthaus (Bergheim bei Köln)
Prof. Dr. Arist von Schlippe (Witten/Herdecke)
Dr. Gunther Schmidt (Heidelberg)
Prof. Dr. Siegfried J. Schmidt (Münster)
Jakob R. Schneider (München)
Prof. Dr. Jochen Schweitzer † (Heidelberg)
Prof. Dr. Fritz B. Simon (Berlin)
Dr. Therese Steiner (Embrach)
Prof. Dr. Dr. Helm Stierlin † (Heidelberg)
Karsten Trebesch (Dallgow-Döberitz)
Bernhard Trenkle (Rottweil)
Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler (Köln)
Prof. Dr. Reinhard Voß (Koblenz)
Dr. Gunthard Weber (Wiesloch)
Prof. Dr. Rudolf Wimmer (Wien)
Prof. Dr. Michael Wirsching (Freiburg)
Prof. Dr. Jan V. Wirth (Meerbusch)
Reihengestaltung: Uwe Göbel
Umschlaggestaltung: B. Charlotte Ulrich
Redaktion: Veronika Licher
Satz: Verlagsservice Hegele, Heiligkreuzsteinach
Printed in Germany
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Erste Auflage, 2024
ISBN 978-3-8497-0521-3 (Printausgabe)
ISBN 978-3-8497-8475-1 (ePUB)
© 2024 Carl-Auer-Systeme Verlag
und Verlagsbuchhandlung GmbH, Heidelberg
Alle Rechte vorbehalten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Informationen zu unserem gesamten Programm, unseren Autoren und zum Verlag finden Sie unter: https://www.carl-auer.de/.
Dort können Sie auch unseren Newsletter abonnieren.
Carl-Auer Verlag GmbH
Vangerowstraße 14 • 69115 Heidelberg
Tel. +49 6221 6438-0 • Fax +49 6221 6438-22
Inhalt
Einleitung
1 Zur Geschichte von Brainspotting
1.1 David Grand, Ph. D.
1.2 Die Entdeckung von Brainspotting
2 Was ist Brainspotting?
2.1 Brainspotting als Methode der Traumakonfrontation und -integration
2.2 Brainspotting als gehirn- und körperbasierte Bottom-up-Methode
3 Der therapeutische Rahmen im Brainspotting
3.1 Das neuroexperienzielle Modell – die Ebene der Beobachtung
3.2 Der Set-up-Rahmen im Brainspotting – die Kommunikations- und Handlungsebene
3.3 Was passiert innerhalb des zweifach eingestimmten Rahmens? – Das Prozessieren im Brainspotting
4 Die relevante Augenposition als »neurobiologischer Gamechanger«?
4.1 Was hat es mit den Augen auf sich? Und wofür braucht man den Zeigestab?
4.2 Drei strategische Wege zu den tiefen Hirnregionen
4.3 Erweiterungen im Set-up-Prozess und Fortgeschrittenen-Techniken zum Finden von Zugangs-Spots
4.4 Unterschiedliche Zugänge über drei spezifische innere Zustände der Klient:innen – das AREAS-Zugangsmodell
5 Die Vorgehensweise im Brainspotting
5.1 Der Set-up-Prozess mit dem Aktivierungszugang
5.2 Weitere Interventionsprinzipien für den Prozess der fokussierten Achtsamkeit
5.3 Der Set-up-Prozess mit dem Ressourcenzugang und weitere Möglichkeiten, die Aktivierung zu titrieren
5.4 Brainspotting und die Anwendung des Expansionsmodells bei Leistungsthemen und kreativen Prozessen
5.5 Der Kreislauf der Compliance und die limbische Gegenübertragung
6 Brainspotting auf dem Prüfstand
6.1 Zur Wirksamkeit von Brainspotting
6.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen
6.3 Brainspotting – eine eigenwillige Traumatherapiemethode?
7 Abschließende Bemerkungen
Literatur
Über den Autor
Einleitung
»Wir [im Brainspotting] wollen gar nicht, dass alle [Therapeut:innen] Brainspotter werden. Mir geht es darum, die Hauptideen von Brainspotting im Bereich der Psychotherapie zu verbreiten.«
David Grand (2022a; Übers.: A. K.)1
»Wohin wir schauen, beeinflusst, wie wir uns fühlen.« Dieser Satz ist die Basis für alles, was Sie jetzt lesen werden. David Grand, der Entwickler des Brainspottings, bezeichnet ihn als wesentliche Grundlage, wenn man erklären will, worum es beim Brainspotting eigentlich geht. Sie haben das bestimmt schon an sich selbst beobachtet oder werden es während oder nach der Lektüre dieses Einführungsbuches aufmerksamer tun: Wenn Sie über etwas nachdenken, kann es leicht sein, dass Sie dabei in eine bestimmte Richtung schauen. Das, was Sie dann empfinden, kann sich aber schnell und grundlegend verändern, wenn Sie Ihren Blick in eine andere Richtung lenken. Genau das macht sich Brainspotting zunutze. Die noch recht junge Methode hat längst international Einzug gehalten in die psychologische und psychotherapeutische Behandlung von psychischen Erkrankungen (vor allem bei Traumafolgestörungen) oder wird zur Leistungssteigerung eingesetzt.
Dieses Buch gibt einen Überblick über die Anfänge und Hintergründe von Brainspotting und erklärt, wie man vorgeht, wenn man Brainspotting anwenden will. Gleichzeitig ist es ein »Jubiläumsbuch«, weil Brainspotting genau vor 20 Jahren entdeckt wurde. Vielleicht ist es auch deswegen ein bisschen mehr als ein Einführungsbuch. Einiges von dem, was Sie lesen werden, ist noch nicht in Schriftform publiziert und stammt aus YouTube-Interviews mit David Grand. Diese Einführung enthält somit das Aktuellste, was es im Brainspotting zurzeit gibt. Ich beschäftige mich seit mehr als zehn Jahren mit dieser Methode und bin fasziniert davon, wie viel sie mir geholfen hat, meine therapeutischen Fähigkeiten zu schulen. Und ich bin auch überzeugt, dass viele Elemente davon unbedingt in eine »Grundlagenausbildung« von Therapeut:innen, aber auch von Coaches und Berater:innen gehören. Auch wenn ich mittlerweile ganz stark meinen eigenen Weg gehe und den hypnosystemischen Ansatz mit einem Kernelement von Brainspotting, dem fokussierten Prozessieren, verbinde, empfinde ich immer wieder eine große Freude, wenn ich mich mit Brainspotting beschäftige.
Diese Einführung will auch dazu beitragen, die kritische Diskussion um Brainspotting neu zu kultivieren. Als langjähriger Vorsitzender der MEGA2 und Hypnotherapie-Lehrtrainer kenne ich Brainspotting aus der Warte eines nicht ausschließlich mit dieser Methode identifizierten Anwenders und habe mir einen kritischen Blick darauf bewahrt. Bei aller Begeisterung für Brainspotting sind mir manche Inhalte noch nicht klar genug ausformuliert. Somit schreibe ich diese Einführung nicht nur für Einsteiger:innen und als »Jubiläumsgeschenk« für die Methode, sondern auch für die Kritiker:innen und mich selbst.
Ich habe mich bemüht, stark am Wortlaut von David Grand zu bleiben, der selbst immer wieder betont, dass Brainspotting nach wie vor eine Entwicklung durchmacht. Da kann es schon vorkommen, dass Ihnen bei manchen Passagen »Unebenheiten« auffallen. Insofern ist dieses Buch vielleicht nicht die klassische »Einführung«, die Sie erwartet haben. Umso mehr denke ich, dass Sie einen Blick auf Brainspotting erhalten werden, der über eine reine Einführung hinausgeht.
In Kapitel 1 erfahren Sie etwas über die Person von David Grand und die Entdeckung von Brainspotting.
Kapitel 2 möchte die Einordnung in die Traumatherapielandschaft ermöglichen.
Dann musste ich eine schwierige Entscheidung treffen: Soll ich Sie gleich mit der Methode und dem Vorgehen vertraut machen oder zuerst die Philosophie von Brainspotting anhand des therapeutischen Rahmens vorstellen? Ich habe mich für Letzteres entschieden, weil die Philosophie für die Methode zentral ist. Dies ist ungewöhnlich für eine traumatherapeutische Methode. Dem Akt der Beobachtung wird im Brainspotting ein entscheidender Beitrag zu einer gelingenden Beziehungsgestaltung und Rahmung des therapeutischen Prozesses eingeräumt. Achtsames Beobachten ist ein zentrales Therapietool und soll dementsprechend in Kapitel 3 in den Vordergrund gerückt werden. Außerdem werden wichtige Begriffe erläutert, die später für die Umsetzung der Methode zentral sind.
In Kapitel 4 lernen Sie dann ein weiteres Herzstück der Methode kennen. Es geht darum, wie Brainspotting die Augen nutzt, um Zugang zu den sog. »tiefen« Ebenen des Gehirns zu bekommen.
Wie ein Brainspotting-Prozess praktisch umgesetzt wird, erfahren Sie dann in Kapitel 5.
In Kapitel 6 wird Brainspotting dann auf den Prüfstand gestellt, wenn es um Fragen zur Wirksamkeit, den Indikationen und Kontraindikationen sowie Nebenwirkungen geht. Ein allgemeiner Vergleich mit Methoden der Traumatherapie rundet das Kapitel ab und zeigt, warum Brainspotting in der Tat ein wenig »eigenwillig« daherkommt, es aber auf jeden Fall wert ist, sich in der einen oder anderen Form damit zu beschäftigen.
In Kapitel 7 möchte ich Sie mit einigen abschließenden Bemerkungen verabschieden.
Ein großes Dankeschön für die Unterstützung möchte ich an dieser Stelle an das Team des Carl-Auer Verlags sowie an Veronika Licher, Gerhard Wolfrum, Ursula Neubauer und Katharina Hager aussprechen.
Andreas KollarWien, im Januar 2024
1 Aus einem Interview mit David Grand; ca. Minute 34:00. Verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=wUBZVKsXV4c [22.7.2023].
2 Milton Erickson Gesellschaft Austria (www.hypno-mega.at).
1 Zur Geschichte von Brainspotting
»Es lag nicht in meiner Entwicklungsgeschichte, es wie alle anderen zu machen. Ich musste es auf meine eigene Art und Weise machen.«
David Grand (2022a)3
Dieses Zitat erklärt möglicherweise, warum Brainspotting einerseits fasziniert und neu bzw. kreativ wirkt, andererseits jedoch verwirrt und bei manchen Ablehnung auslöst. Im weiteren Verlauf sollen daher die Person David Grand vorgestellt und die Entdeckung von Brainspotting kurz skizziert werden, um den Entstehungskontext verstehen zu können.
1.1 David Grand, Ph. D.
David Grand, der Entwickler von Brainspotting, ist Sozialarbeiter, Psychoanalytiker und Gründer des »Brainspotting Institute«4, das Ausbildungen und Zertifizierungen anbietet.5 Heute ist er weltweit als Trainer und Ausbilder tätig. Er hält Vorträge, Fortbildungen und Workshops in vielen Ländern und ist ein gefragter Redner auf Konferenzen und Veranstaltungen. Was David Grand im Laufe seiner Entwicklung als Therapeut auszeichnete, ist seine bis heute ungebrochene Lust an der Entwicklung seiner eigenen Vorstellungen einer Therapie, in der es nicht darum geht einem vorgegebenen Protokoll zu folgen, »sondern den Klienten die bestmögliche Art eines Prozesses zu deren Heilung anzubieten« (Grand 2022d; Übers.: A. K.).
David Grand wurde 1952 in New York City geboren und wuchs in einem Vorort von Long Island auf. Er studierte zunächst an der Yeshiva University School of Social Work, bevor er sich in den 1980er-Jahren als Psychoanalytiker ausbilden ließ. Bereits während dieser Ausbildung bemerkte er, dass er mit den durch das Verfahren auferlegten Begrenzungen und der starren Abstinenz nicht viel anfangen konnte. Er sah sich als interaktions- und beziehungsbezogenen Menschen, weshalb er sich nicht an das formale Prozedere der Psychoanalyse halten konnte und wollte und eine stark relationale Form der Behandlung anbot. Die Idee der gleichschwebenden Aufmerksamkeit und die Technik des freien Assoziierens haben ihn jedoch fasziniert und sind auch in einer angepassten Form beim Brainspotting übernommen worden (Grand 2022a).6
1993 kam David Grand mit EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) nach Francine Shapiro7 in Verbindung und trug dazu bei, die Methode bekannter zu machen. Auch sein erstes Buch, das wenige Tage vor den Anschlägen auf das World Trade Center erschien, handelt davon: Emotional Healing at Warp Speed: The Power of EMDR (Grand 2001). Er war aber auch beim EMDR nicht einverstanden mit den Begrenzungen durch das strikte Protokoll, das streng eingehalten werden sollte. Insofern begann er schon früh, neue Entwicklungen und Abwandlungen zu kreieren. Und auch beim EMDR fehlte ihm der Beziehungsaspekt. Wichtig für ihn war jedoch die Erweiterung seines Verständnisses der Phänomene Trauma und Dissoziation durch EMDR.
Ein paar Jahre später (1999) lernte er auf einem Kongress Peter Levine – und in einer Live-Demo mit ihm das »Somatic Experiencing (SE)®« – kennen und vertiefte sich in Levines Konzept. Zwei Dinge waren für ihn eine wertvolle Erweiterung seines therapeutischen Denkens und Handelns: der starke Einbezug des Körpers und die Wiederentdeckung der Langsamkeit. Es fanden sich rasch Niederschläge in seiner therapeutischen Praxis. Er erweiterte sein EMDR-Konzept um die Arbeit mit einer Körperressource (Rost 2014) und entwickelte daraus eine Vorgehensweise, die er als »Natural Flow EMDR« bezeichnete.
All seine Erfahrungen und das Wissen aus seinen Ausbildungen führten ihn bald zu spannenden Beobachtungen und Interventionsversuchen, mit denen er »Brainspotting« entdecken, begründen und durch viele weitere Ergänzungen und Erkenntnisse zu einer anerkannten traumatherapeutischen Methode machen konnte. Mit der Beschreibung des »neuroexperienziellen Modells« (vgl. Abschn. 3.1) ermöglichte er neue Sichtweisen auf alte Begriffe und neue Erklärungen für beobachtete Vorgänge.
Auch dass er nach den Ereignissen des 9. September 2001 in New York vor allem mit stark belasteten, traumatisierten Überlebenden und Rettungskräften arbeitete und selbst in einen Burn-out rutschte, trug dazu bei, dass er seine Beobachtungsfähigkeit weiter schulte:
»Ich lernte, sowohl bewusst als auch unbewusst die physischen Hinweise und Signale von Klienten so scharf zu beobachten, dass es manchmal fast schien, als wüsste ich bereits, was kommen würde, bevor es tatsächlich geschah. In diesem Zustand erhöhter Aufnahmebereitschaft entdeckte ich Brainspotting« (Grand 2017, S. 10).
Diese Fähigkeit, in der Arbeit mit Klient:innen einerseits derart wachsam und aufmerksam zu sein und gleichzeitig emotional intensiv in Beziehung mit der jeweiligen Person, ist übrigens etwas, das er später als Bedingung für eine vertrauensvolle, gemeinsame Arbeit bezeichnete. Es stellte eine wichtige Vorbedingung für die spätere Entwicklung von Brainspotting dar (Grand 2022a).8
1.2 Die Entdeckung von Brainspotting
Die »offizielle« Entdeckung von Brainspotting kann man auf das Jahr 2003 datieren, als David Grand mit einer 16-jährigen Eiskunstläuferin namens Karen arbeitete. Obwohl ihr im Training alles gelang, konnte sie ihre Leistung bei Wettkämpfen nicht abrufen. Als eines ihrer Symptome beschrieb Grand, dass sie an Wettkampftagen schon beim Aufwärmen ihre Beine nicht spüren konnte (Grand 2017). Karen und ihr Sport waren nicht nur von ihrer Mutter massiv abgewertet worden, sondern sie musste auch mit Stürzen im Training und einer schweren Rückenverletzung fertigwerden. Zunächst arbeitete David Grand mit ihr mit Natural Flow EMDR – diese Vorgehensweise hatte sich bei Sportler:innen, die mit dem Versagen kämpften, wenn es um öffentliche Wettbewerbe ging, als wirksam erwiesen:
»Mit langsamen, sanften Augenbewegungen und dem Bewusstsein, sich im Augenblick geerdet zu fühlen, war Karen in der Lage, die Traumata aus ihrer Kindheit und ihrer Zeit auf dem Eis in ihrem Nervensystem zu lösen« (Grand 2017, S. 23).
Auch wenn sie gute Fortschritte machte, beim dreifachen Rittberger bestand nach wie vor eine Leistungsblockade. Grand leitete sie dazu an, sich vor ihrem inneren Auge vorzustellen, wie sie diesen Sprung durchführte und wie sich ihr Körper dabei anfühlte, um dann den Moment einzufrieren, in dem sie aus dem Gleichgewicht kam. An der Stelle sollten ihre Augen David Grands Fingern folgen, die er langsam und zunächst unaufhörlich in ihrem Blickfeld hin- und herbewegte. Nach ungefähr einer Minute begannen ihre Augenlider an einer bestimmten Stelle zu flattern und ihr Blick erstarrte. Rund 10 Minuten sollten beide so – David Grand mit seiner Hand an dieser Stelle und Karens Augen fixiert darauf – verharren, während Bilder und Körperempfindungen Karen regelrecht überfluteten:
»Karen arbeitete sich schnell durch die Erinnerungen […], erlebte die Geräusche und Bilder von Familienstreitigkeiten, Verletzungen und Krankheiten in der Kindheit und den Tod der Großmutter noch einmal, wobei alle diese Bilder aufflackerten, an ihr vorbeizogen und wieder zu verschwinden schienen« (Grand 2017, S. 24).
Danach gelang ihr der dreifache Rittberger und David Grand begann, auch bei anderen Klient:innen die Bewegung seiner Hand zu stoppen, wenn er auffällige Reaktionen in deren Augen oder andere Reflexe entdeckte. Ihm war sofort klar, dass er da »auf etwas« gestoßen war. Dennoch wollte er seine Entdeckung noch weiter untersuchen. Er achtete anschließend auch auf Signale wie ein Husten, ein starkes Schlucken oder ein tiefes Ein- oder Ausatmen und verstand all das als Hinweise, die anzeigten, dass tief im Gehirn Traumata gespeichert waren: »Ich spürte, dass das Reflexsystem der Klienten mich an Schlüsselpunkten in ihrem Gesichtsfeld auf etwas Bestimmtes hinwies« (Grand 2017, S. 27).
Grand betont aber, dass die Entdeckung von Brainspotting durch die Erfahrungen vor besagtem Tag und dann in weiterer Folge aus einer Vielzahl von Experimenten in Sitzungen mit Klient:innen, vor allem mit Therapeut:innen, entstanden ist, die bei ihm in Behandlung waren. Über viele Wochen und Monate hinweg haben dann Therapeut:innen ihre Erfahrungen mit diesem neuen Vorgehen gemacht und Grand geholfen, zu verstehen, was er da entdeckt hatte (Grand 2017).
3 Ca. Minute 16:20.
4 Das Institut wurde mittlerweile in »Brainspotting Trainings, LLC« umbenannt.
5 Verfügbar unter: www.brainspotting.com [10.7.2023].
6 Ca. Minute 13:50.
7 EMDR ist eine Methode der Psychotraumatherapie. Sie wurde von Francine Shapiro entwickelt und arbeitet mit bilateraler Stimulation über die Augen bzw. mittlerweile allgemein über die Sinne (Hofmann 2009).
8 Im YouTube-Interview (Minute 23:20) bezeichnet er die Ereignisse vom 9. September 2001 als einen neuroexperienziellen »Gamechanger« für seine Art zu arbeiten.
2 Was ist Brainspotting?
»Brainspotting is: don’t worry, be happy.«
David Grand (2022c)9
Egal, ob es Fachartikel oder Fachbücher sind, immer wieder findet man Formulierungen wie »das seltsam anmutende Verfahren« oder »die eigenartige Vorgehensweise«, wenn von Brainspotting die Rede ist. Hat man noch keinerlei Berührung gehabt mit einem Brainspotting-Prozess, so kann es tatsächlich merkwürdig erscheinen, wenn in einer Sitzung Patient:innen oder Klient:innen für eine lange Zeit auf einen Punkt schauen und sowohl sie als auch die Behandler:innen dabei zum großen Teil still sind. Was hierdurch möglich wird, sind Selbstregulationsprozesse, um eine blockierende Überaktivierung im Gehirn zu lösen, die die angemessene Verarbeitung von Emotionen und Erinnerungen bisher be- oder verhindert hat.
Die Augen-Scanner-Metapher (Grand 2017):
»Brainspotting nutzt dabei die Augen als eine Art Scanner der inneren Welt.«
Folgendes Fallbeispiel beschreibt eine meiner frühesten Erfahrungen, wo mir zum ersten Mal die Art und Weise, wie Menschen während des Erzählens bestimmte Punkte fokussieren, aufgefallen ist.
Fallbeispiel: Der Todestag der Großmutter
In einer der ersten Sitzungen mit einer jungen Klientin erklärte mir diese sofort beim Hereinkommen, dass sie heute nicht mit mir arbeiten könne. Sie erzählte, dass genau an diesem Tag vor zwei Jahren ihre Großmutter gestorben sei, und jetzt müsse sie andauernd an sie denken und weinen. Sie könne gar nicht mehr aufhören zu weinen.
Während sie mit mir sprach und das erzählte, starrte sie unentwegt an genau einen Punkt auf der Mauer. Meine Zwickmühle als Therapeut habe ich dann transparent kommuniziert: Ich nähme wahr, dass sie den Verlust der Großmutter offensichtlich als sehr schmerzhaft erlebe, und gleichzeitig glaubte ich, dass sie einen neuen Umgang damit finden könnte. Der Verlust wäre dann zwar sicherlich noch immer belastend, aber sie könnte die schönen Momente mit ihrer Oma vielleicht besser in sich tragen und sich dankbar daran erinnern. Ich lud sie dann nach einigen Erklärungen zu einem Versuch ein, nämlich, ihre Geschichte mit der Großmutter noch einmal zu erzählen, dabei sollte sie aber auf einen Punkt auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes schauen. Zu ihrem großen Erstaunen konnte sie so, ohne zu weinen, über ihre Oma und ihre Beziehung zu ihr reden. Wenn sie hingegen zum ersten Punkt zurückschaute, konnte sie das Weinen wieder nicht zurückhalten. Jeder Wechsel zeigte das Gleiche.
Kommen wir hier also wieder zum Kern von Brainspotting, der besagt: »Wohin wir schauen, beeinflusst wie wir uns fühlen«. Im Folgenden sollen die Elemente, die dafür im Brainspotting relevant sind, vorgestellt werden, d. h., hier geht es um die Einführung in die Theorie und den Wirkmechanismus. Wichtige Begrifflichkeiten und Konzepte im Brainspotting finden Sie dann in Kapitel 3 näher erläutert.
2.1 Brainspotting als Methode der Traumakonfrontation und -integration
Brainspotting ist, wie aus der Herleitung aus dem EMDR heraus gefolgert werden kann, ursprünglich als traumatherapeutische Methode entwickelt worden. Man kann sie in die Reihe der sogenannten »Konfrontationsmethoden« einreihen, bei denen man sich aktiv mit den belastenden Inhalten von traumatischen Erlebnissen beschäftigt. Der Vorgehensweise im Brainspotting liegt ein Traumamodell zugrunde, das die Genese unerwünschter Erlebens- und Verhaltensweisen erklären soll. Aus neurobiologischer Sicht – die für Brainspotting sehr relevant ist – spricht man von einer Traumatisierungserfahrung, wenn das Stressverarbeitungssystem massiv überfordert ist und weder ein Bewältigen noch Integrieren möglich ist, die Homöostase der Systeme durch die Selbstregulationskräfte nicht wiederhergestellt werden kann und man derart überschwemmt von Stresshormonen ist, dass keine Beruhigung möglich ist (Wolfrum 2020). David Grand sagt:
»Brainspotting steht auf dem Standpunkt, dass sich das Unvermögen, reflexartig von Dysregulation zu Regulation zu gelangen, bei subkortikalen dissoziativen Barrieren findet, die im Zuge anhaltender Entwicklungstraumen entstehen, die sich durch wiederholte, akkumulierte Traumen im Erwachsenenalter weiter verfestigen – Retraumatisierungen, die ein Echo der ursprünglichen präverbalen, intrauterinen und generationalen Traumen sind. Brainspotting ist unmittelbar trauma- und dissoziationsinformiert, entsprechend auf die Substrate aller symptom- und verhaltensbezogenen Manifestationen abgestimmt« (Grand 2021; Übers.: A. K.).
In Bezug auf die Genese traumabedingter Dissoziationsprozesse sagt Grand (2022d)10