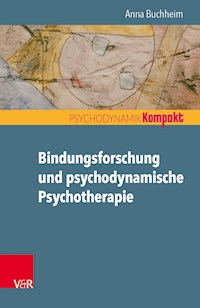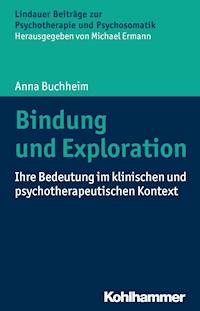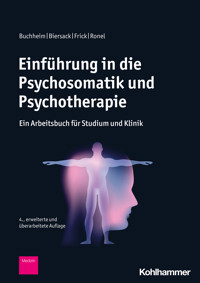
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dieses von erfahrenen HochschullehrerInnen und KlinikerInnen entwickelte Arbeitsbuch dient als Einstieg und Vertiefung in die Fachgebiete der Psychosomatischen Medizin, der Klinischen Psychologie und Psychotherapie. Es stellt die wichtigsten Krankheitsbilder, ihre Verläufe sowie psychosomatische und psychologische Behandlungsansätze vor und bietet darüber hinaus einen fundierten Einblick in die bio-psycho-soziale Herangehensweise und Diagnostik. Dabei wird auch die spirituelle Dimension von Krankheit und Leiden in den Blick genommen. Weitere Schwerpunkte bilden die Geschichte der Disziplinen und Krankheitsbilder, die ärztlich-/psychologisch-psychotherapeutische Gesprächsführung und Anamneseerhebung, die therapeutische Beziehung sowie die spezielle Krankheitslehre der Psychosomatischen Medizin und Klinischen Psychologie. Die Inhalte folgen einer psychodynamischen Ausrichtung, aber auch anderen relevanten Schulen und Denkweisen. Die grundlegend neu konzipierte 4. Auflage ist durch fortlaufende Fallbeispiele sowie Audio-Interviews mit ExpertInnen anschaulich und praxisnah gestaltet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Autorinnen und Autoren
Prof. Dr. biol. hum. Dipl.-Psych. Anna Buchheim ist seit 2008 Professorin für Klinische Psychologie am Institut für Psychologie an der Universität Innsbruck, derzeit Dekanin der Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaft sowie Psychoanalytikerin. Am Universitätsklinik Ulm absolvierte sie an der Psychosomatischen Klinik ihre Venia für Psychotherapeutische Medizin, Psychotherapie sowie Medizinische Psychologie und psychoanalytische Ausbildung (DPV). Ihre Forschungsschwerpunkte sind Klinische Bindungsforschung, Präventionsforschung, psychodynamische Psychotherapieforschung, Persönlichkeitsstörungen und die Neurowissenschaften. Sie lebt seit über 15 Jahren in Innsbruck.
Dr. med. Katharina Biersack ist Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie mit Psychodynamischem Fokus und als Oberärztin an der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie in der München Klinik Harlaching tätig. Schwerpunkte ihrer klinischen Arbeit sind Körperbeschwerden, Essstörungen und schwere Strukturstörungen unterschiedlicher Symptomatik. Ihre Forschung ist auf funktionelle Körperbeschwerden und psychomedizinische Versorgung konzentriert. Sie ist vertiefend ausgebildet in Mentalisierungsbasierter Therapie. Sie lebt und arbeitet in München.
Prof. Dr. med. Eckhard Frick sj ist Professor für Spiritual Care und psychosomatische Gesundheit, Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, TUM Universitätsklinikum, Technische Universität München. Er ist Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Psychiater und Psychoanalytiker (DGPT/IAAP). Publikationen zu Spiritualität und Analytischer Psychologie nach C. G. Jung: Gerufen oder nicht gerufen? Spiritualität in der Analytischen Psychologie; herausgegeben mit T. Roser und G. Stotz-Ingenlath: Spiritualität und Medizin. Er lebt und arbeitet seit 1988 in München.
PD Dr. med. Joram Ronel ist Chefarzt und Leiter des Departements für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Klinik Barmelweid. Er ist Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Internist, Psychoanalytiker und Gruppenanalytiker. Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sind u.a. Themen der stationären Psychotherapie, der Entwicklungspsychologie bei somatoformen und somatopsychischen Störungen sowie die psychosoziale (auch transgenerationale) Versorgung nach Extremtraumatisierungen. Er lebt im Schweizer Kanton Aargau und in München.
Das Werk wurde begründet und in der 1. bis 3. Auflage verfasst von Michael Ermann, Eckhard Frick, Christian Kinzel und Otmar Seidl.
Anna Buchheim Katharina Biersack Eckhard Frick Joram Ronel
Einführung in die Psychosomatik und Psychotherapie
Ein Arbeitsbuch für Studium und Klinik
4., erweiterte und überarbeitete Auflage
Begründet und in 1.–3. Auflage verfasst von Michael Ermann, Eckhard Frick, Christian Kinzel und Otmar Seidl
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Pharmakologische Daten, d. h. u. a. Angaben von Medikamenten, ihren Dosierungen und Applikationen, verändern sich fortlaufend durch klinische Erfahrung, pharmakologische Forschung und Änderung von Produktionsverfahren. Verlag und Autoren haben große Sorgfalt darauf gelegt, dass alle in diesem Buch gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Da jedoch die Medizin als Wissenschaft ständig im Fluss ist, da menschliche Irrtümer und Druckfehler nie völlig auszuschließen sind, können Verlag und Autoren hierfür jedoch keine Gewähr und Haftung übernehmen. Jeder Benutzer ist daher dringend angehalten, die gemachten Angaben, insbesondere in Hinsicht auf Arzneimittelnamen, enthaltene Wirkstoffe, spezifische Anwendungsbereiche und Dosierungen anhand des Medikamentenbeipackzettels und der entsprechenden Fachinformationen zu überprüfen und in eigener Verantwortung im Bereich der Patientenversorgung zu handeln. Aufgrund der Auswahl häufig angewendeter Arzneimittel besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
4., erweiterte und überarbeitete Auflage 2025
Die von Michael Ermann, Eckhard Frick, Christian Kinzel und Otmar Seidl verfassten ersten drei Auflagen erschienen unter dem Titel »Einführung in die Psychosomatik und Psychotherapie. Ein Arbeitsbuch für Unterricht und Eigenstudium«.
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-038946-5
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-038947-2
epub: ISBN 978-3-17-038948-9
Inhalt
Die Autorinnen und Autoren
Vorwort
Was der Medizinstudent Marc Lemort Demétigny nicht ahnen konnte …
1 Von der Geschichte in die Gegenwart
1.1 Die Erforschung der Hysterie – zugleich ein kurzer Streifzug durch die lange Geschichte der Psychosomatischen Medizin
1.2 Die Entwicklung der Psychosomatik in Spätantike und Mittelalter, …
1.3 … Neuzeit …
1.4 … und Moderne
1.5 Aktuelle Psychosomatik-Konzepte
2 Frau Nowak hat Bauchschmerzen
3 Simultandiagnostik: Vom Entweder-oder zum Sowohl-als-auch
3.1 Konsiliar- und Liaisondienst
3.2 Simultandiagnostik: Alles miteinander
3.3 Das Bio-psycho-soziale Modell
3.4 Wie funktioniert das mit der Simultandiagnostik?
4 Entwicklungspsychologie: Von Primärbeziehungen zu Bauchschmerzen
4.1 Mentalisierung: ein Konzept zu Entwicklung, Interaktion und Reflexion
4.2 Störungen in der Entwicklung
4.3 Entwicklung als Modell für Somatisierungsstörungen
5 Psychosomatische Anamnese? – Klar, mache ich!
5.1 Ziele der psychosomatischen Anamnese
5.1.1 Reflektierende Kommunikation
5.1.2 Technische Aspekte der Beziehungsgestaltung
5.2 Kernbereiche der psychosomatischen Anamnese
5.3 Beschwerdefokussierte Anamnese am Beispiel Schmerz
6 Frau Nowak ist der Appetit vergangen
7 Essstörungen am Beispiel der Anorexia nervosa
7.1 Ätiologie und Dynamik
7.2 Anorexia nervosa
7.3 Die »Sucht« in der »Magersucht«
7.4 Symptome
7.5 Körperschemastörung
7.6 Gewichtsreduzierende Maßnahmen
7.7 Epidemiologie und Bedeutung
7.8 Körperliche Folgen und Komplikationen
7.9 Behandlung
8 Frau Nowak fühlt sich verlassen
9 Bindung und Bindungskonflikt
10 Herr Gerber will nicht mehr leben
11 Depression und Suizidalität
11.1 Formen und Schweregrad der Depression
11.2 Behandlung der Depression
11.3 Suizidalität
11.4 Depression versus Demoralisierung und Trauer
12 Angststörungen
12.1 Formen der Angst
12.2 Ätiologiemodelle
12.2.1 Psychologische Modelle
12.2.2 Kognitive Schemata
12.2.3 Entwicklungspsychologische Modelle
12.2.4 Lerntheoretische Modelle
12.2.5 Psychoanalyse und psychodynamische Modelle
12.3 Behandlungsansätze
13 Frau Nowak hat Albträume und erinnert sich nicht gern
14 Traumafolgestörungen: Wunden der Seele
14.1 Was ist ein Trauma?
14.1.1 Symptome
14.2 Komplexe Traumatisierung (kPTBS)
14.3 Trauma und Persönlichkeit
14.4 Körperliche Folgen
14.5 Behandlung
15 Persönlichkeitsstörung: Borderline
15.1 Historie
15.2 Diagnostische Kriterien
15.3 Ätiologiemodelle
15.4 Behandlungsansätze
16 Persönlichkeitsstörung: Narzissmus
16.1 Ein wenig Geschichte und Mythos
16.2 Gesunder und pathologischer Narzissmus
16.3 Das gespaltene Selbst
16.4 Wenn die Selbstwert-Regulation versagt: Narzisstische Krisen
16.5 Narzissmus als Symptom bei verschiedenen Störungen
16.6 Diagnostik der Persönlichkeitsstörungen in ICD-11
16.7 Narzissmus als Persönlichkeitsstörung
16.8 Behandlung
17 Frau Nowak braucht eine ambulante Weiterbehandlung
18 Die passende Psychotherapie finden
18.1 Behandlungsmöglichkeiten der Panikstörung
18.2 Behandlungsmöglichkeiten der Borderline-Persönlichkeitsstörung
18.3 Behandlungsmöglichkeiten bei Essstörungen
19 Psychokardiologie – eine vielfältige Disziplin
19.1 Das Herz als Symbol
19.2 Funktionelle Psychokardiologie
19.3 Strukturelle Psychokardiologie
20 Psychoonkologie – Psychotherapie bei schweren organischen Krankheiten
20.1 Psyche und Krebs
20.2 Störungsspezifische oder ressourcenorientierte Diagnostik und Therapie?
20.3 Additives Modell (psychische Komorbidität)
20.4 Integratives Modell (Bewältigungsressourcen und Disstress)
20.5 Indikationsstellung für die psychoonkologische Intervention
20.6 Therapeutische Grundprinzipien in der Psychoonkologie
21 Coping zwischen sozialer Unterstützung und professioneller Therapie
22 Resilienz und Spiritualität
Wie weiter mit der Psychosomatik? Ein Ausblick
Anhang
1 Tabelle: Anamnesestruktur
2 Tabelle: Fragetechnik
3 Tabelle: ICD-11-Klassifikation
Verzeichnisse
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Podcasts: Psychosomatik zum Weiterhören
Zur inhaltlichen Bereicherung und Auflockerung der reinen Lektüre wurden zwischen 2020 und 2022 Interviews mit Fachpersonen aus dem Bereich der Psychosomatik geführt. Auszüge dieser Interviews sind z. T. als Zitate in den Text integriert. Die vollständigen Podcasts sind jeweils online verfügbar unter:
https://dl.kohlhammer.de/978-3-17-038946-5
Vorwort
Wen wollen wir mit diesem Buch, mit dieser Neuauflage der Einführung in die Psychosomatik und Psychotherapie ansprechen?
Dieses Buch ist für Studierende der Medizin, der Psychologie und der Psychotherapiewissenschaft geschrieben, auch für Ärzte, Ärztinnen, Psychologinnen und Psychologen, die sich noch nicht als Expertinnen und Experten in der Psychosomatik und Psychotherapie verstehen.1
Immer wieder werden im Studium Störungsbilder oft nur nach den klassischen Kriterienkatalogen gelehrt. Auch Ätiologiemodelle und Interventionen werden in vielen Fällen störungsorientiert und nach Definitionskategorien nähergebracht. Auf diese Weise kann das Verständnis für das Subjektive, also »das Menschliche« im Menschen, für sein individuelles Leiden, für die Lebenserfahrungen, die ihn geprägt und entwickelt haben, für seine (auch nonverbale) Sprache, mit der er besser oder schlechter gelernt hat, sich auszudrücken, und für die Umwelt, die ihn mal mehr, mal weniger wahrgenommen hat, nicht unbedingt entstehen. In diesem Buch kommt es uns daher darauf an, den medizinischen und den psychologischen Zugang miteinander zu verknüpfen. Im Sinne eines bio-psycho-sozialen Modells ist ein Mensch, der unter einer Erkrankung leidet, deutlich mehr als nur seine medizinische Diagnose. Eine in der Psychosomatik oft zitierte Haltung, die auch diesem Buch zugrunde liegt, lautet: »Wir behandeln keine Krankheiten, sondern kranke Menschen.«2
Dieses Lern- und Arbeitsbuch basiert daher auf den Grundlagen einer sogenannten integrierten Medizin, die psychische, soziale und körperliche Aspekte des Lebens gleichwertig berücksichtigt. Ein weiterer Schwerpunkt unseres Buches liegt in der Vorstellung, dass wir Menschen gar nicht anders können, als immer in Beziehungen zu leben, und nicht als isolierte Einzelwesen funktionieren. Gerade im Bereich der psychischen und psychosomatischen Leiden hat eine solche beziehungsorientierte Perspektive vielerlei Konsequenzen. Für die theoretischen Konzepte von Gesundheit und Krankheit genauso wie für Diagnostik und Behandlung.
Der Bedeutung von Beziehungen und Beziehungserfahrungen für uns Menschen tragen insbesondere psychodynamische und psychoanalytische Sichtweisen und Theorien Rechnung. Was bedeutet das? Kurz gesprochen, geht es um das Zusammenspiel von inneren Konflikten, Triebkräften, sich wiederholenden Beziehungsmustern und der durch die biografisch geprägte Entwicklung geformten Persönlichkeitsstruktur als Verstehens-Grundlage für die Entstehung von psychosomatischen oder psychischen Störungen. Die Begriffe »Psychodynamik« und »Psychoanalyse« werden hierbei oft synonym verwendet. Der erste fokussiert eher auf das Zusammenspiel der verschiedenen innerseelischen Kräfte, der zweite auf die Erfahrungen zur psychotherapeutischen Behandlung, aber auch zur gesellschaftspolitischen Kulturtheorie, welche der Wiener Arzt Sigmund Freud (1856–1939) um das Jahr 1890 begründete. Auch auf andere therapeutische »Schulen« werden wir in unserem Buch (teils auch sehr ausführlich) eingehen – aber der Schwerpunkt liegt auf der psychodynamischen Denkweise.
Wir sind davon überzeugt: Alle Fächer der Medizin sind »psychosomatisch«. Die Existenz des Facharzttitels »Psychosomatische Medizin und Psychotherapie« in Deutschland ist einerseits eine sehr große Chance. Sie birgt aber andererseits auch eine Gefahr:
»Man würde an dieses Fach den psychischen und den sozialen Aspekt quasi ›überweisen‹, so wie man abgrenzbare hormonelle Störungen an den Endokrinologen zu delegieren vermag. Eine solche ›Psychosomatik‹ würde der übrigen Medizin also eher dazu verhelfen, ihre Verantwortung für die Einbeziehung des psychischen und des sozialen Aspektes bei jeder Krankheit und bei jedem Kranken weiterhin zu verdrängen.« 3
Wenn wir der Patientin sagen: »Das ist psychosomatisch!« oder »Wir überweisen Sie zu einem Facharzt für Psychosomatische Medizin oder zu einer Psychotherapeutin« – was geschieht dann in der therapeutischen Beziehung? Es kann schlimmstenfalls wahrgenommen werden als ein Nicht-Ernstnehmen oder ein Abschieben. Oder es kann, wenn es konstruktiv gehandhabt wird, in dem integrierten Sinn des »Sowohl-als-auch« der Simultandiagnostik und Simultanbehandlung von körperlichen und psychischen Aspekten erfolgen, den wir diesem Buch zentral zugrunde legen wollen.
Viele unserer Patienten und Patientinnen haben den Wunsch, dass ihre Beschwerden »organisch« erklärbar sind. Das ist in den persönlichen Beziehungen und gesamtgesellschaftlich bis heute immer noch besser anerkannt und weniger stigmatisierend als eine vermeintlich rein »psychische« Verursachung. Als Fachleute für Psychosomatik und Psychotherapie haben wir stets auch die Verpflichtung, organische Aspekte von Störungen, z. B. in der Kardiologie, Neurologie etc., mit dem Erleben der Betroffenen zusammenzubringen und hier keinesfalls einer einseitigen Psychologisierung oder gar »Psychopathologisierung« das Wort zu reden.
Diese besondere Art der integrierten (bio-psycho-sozialen) Perspektive sollte jedoch nicht nur eine Aufgabe für Fachleute sein. Auch diejenigen Leser und Leserinnen, die weder psychosomatische Fachärztinnen werden noch Psychologen, brauchen im Patientenkontakt den erwähnten »psychosomatischen« Blick. Dazu gehört auch die Berücksichtigung des existenziellen und spirituellen Gesichtspunkts, nicht als entbehrliches Sahnehäubchen, sondern als notwendige Perspektiv-Erweiterung: Was bedeutet eigentlich eine Erkrankung für die Biografie eines Menschen? Und wie hängt das mit der Sinnfrage zusammen? Mit dem Zerbrechen von bisherigen Sinn- oder Identitätsentwürfen möglicherweise? Auch das ist nicht nur einer kleinen Gruppe von Erkrankungen vorbehalten – wie beispielsweise in der Psychoonkologie oder Palliativmedizin –, sondern es betrifft die gesamte Medizin.
Was also ist das Besondere an unserem Buch?
Wir wollen die ärztlich-psychologisch-psychotherapeutische Perspektive der Vorauflagen durch einige Aspekte erweitern: Das Buch spricht bewusst Kolleginnen und Kollegen an, die am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn stehen – angehende Ärztinnen, Psychologen, Psychotherapiewissenschaftler und alle anderen Gesundheitsberufe, denen die Beziehungsaspekte und eine integrierte bio-psycho-soziale Perspektive wichtig sind. Eine Besonderheit sind die Expertinnen-Interviews (im Online-Anhang als Audiodateien abrufbar) und die Einarbeitung der durch das ganze Buch hindurch beschriebenen Krankengeschichte einer Patientin (wir haben Sie Frau Nowak genannt) als anschauliches Fallbeispiel.
Die Tabellen, Übersichtskästen und Übungsmaterialien am Ende des Buches bündeln konkrete Fakten wie die Beschreibung der Störungen nach ICD-11, aber sie sind auch eine Möglichkeit, nachzuschlagen und zu lernen. Zusätzlich haben wir Materialien zusammengestellt, welche für eine gelungene und reflektierende Kommunikation mit Patientinnen und Patienten hilfreich und somit gut für die Verwendung in den entsprechenden Kursen (z. B. der ärztlichen Gesprächsführung und Kommunikation) zu nutzen sind.
Obwohl wir die gängigsten Störungsbilder des Fachgebietes der Psychosomatik und Psychotherapie hier auf eine verständliche und gleichzeitig profunde Weise näherbringen wollen und zu diesen Bereichen auch Lernmaterialien zur Verfügung stellen, kann dieses Buch kein allumfassendes Handbuch oder Nachschlagewerk sein.
Im Rahmen der Erstellung der Audioanhänge durften wir ein sehr inspirierendes Expertengespräch mit Professor Michael Ermann führen, der erstmals 1994 die bisherigen Auflagen dieses Buches als Ergänzung zu seinem Werk Psychotherapie und Psychosomatik. Ein Lehrbuch auf psychoanalytischer Grundlage4 begründet und konzipiert hat.
Podcast: Michael Ermann
Was verdanken wir dem Aufschlag, den Michael Ermann, Otmar Seidl, Christian Kinzel und Eckhard Frick gemacht haben (Letzterer konnte auch für diese Ausgabe als Autor gewonnen werden)? Die Erfahrungen mit ihrem Skript des Studierendenkurses flossen in das sehr beliebte Lehrbuch der Psychosomatik auf psychoanalytischer Grundlage ein. In der vorliegenden Auflage sind wir ebenso bemüht gewesen, leicht verständlich, einprägsam und dennoch nicht oberflächlich zu formulieren. Wir waren bestrebt, neugierig auf die psychosomatische Sichtweise zu machen, wieder nicht im typisch curricularen Lehrbuchstil. So trifft sich eine wesentliche Grundhaltung der Psychosomatik mit der Schreibweise der vorherigen und dieser vorliegenden Auflage: Psychosomatik und Psychotherapie sind nicht nur wissenschaftliche Fachgebiete, sondern auch eine zutiefst »gesamtmenschliche« Angelegenheit, welche mit Beziehungen und den persönlichen, subjektiven Erzählungen und Geschichten unserer Patientinnen und Patienten zu tun haben.
Unser Dank gebührt daher zuallererst den Gründungsautoren. Ferner möchten wir besonders Dr. Elisabeth Olliges, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Klinik Barmelweid, für die kritisch-konstruktive Durchsicht des Manuskriptes sowie das Verfassen und Zusammenstellen insbesondere des Übungsmaterials zur Reflektierenden Kommunikation und Gesprächsführung danken. Im Hinblick auf die hier zur Verfügung gestellten Materialien zum Thema Kommunikation und Anamneseerhebung danken wir Herrn PD Dr. Nikolaus Egloff, der sich zusammen mit anderen Kolleginnen und Kollegen an der Zusammenstellung des Studierendenskriptes für das Medizinstudium an der Universität Bern und der ETH Zürich verdient gemacht hat, welches wir als Grundlage für diese Themen verwenden durften. Des Weiteren danken wir den ehemaligen Masteranden der Universität Innsbruck M.Sc. Maren Adler, M.Sc. Lena Gerbracht und M.Sc. Martin Pietsch für wertvolle vorbereitende Beiträge und Bearbeitungen. Selbstverständlich gilt auch den Mitarbeitenden des Kohlhammer-Verlages in Stuttgart, allen voran Herrn Verlagsleiter Dr. Ruprecht Poensgen und unserem wunderbaren Projektleitungs- und Lektorenteam, namentlich Anita Brutler und Julius Jansen, unser tiefer Dank für die stete Unterstützung, die strapazierfähige Geduld und die »zärtlichen« Ermahnungen. Ganz besonders aber für die Initiative zur Erstellung dieser Neuauflage, zu der wir viel Freude beim Lesen wünschen.
Innsbruck, München und Barmelweid, im Frühjahr 2025
Anna Buchheim, Katharina Biersack, Eckhard Frick und Joram Ronel
1 Uns ist eine inkludierende Sprache sehr wichtig. Um zugleich die Lesbarkeit zu wahren, wechselt dieses Buch zwischen der weiblichen und männlichen Form. Natürlich sind damit Menschen aller Geschlechtsidentitäten (männlich, weiblich, divers) angesprochen.
2 Dieser Satz wird Ludolf Krehl (1861–1937), einem Heidelberger Internisten und frühen Psychosomatiker, zugeschrieben.
3 Horst-Eberhard Richter am 06.06.1978 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
4 Das Lehrbuch liegt seit 2024 in der achten Auflage vor (Ermann, 2024).
Was der Medizinstudent Marc Lemort Demétigny nicht ahnen konnte …
Marc aus dem belgischen Gent reicht seine Doktorarbeit in der berühmten medizinischen Fakultät Montpellier ein, fünf Jahre vor der Französischen Revolution. Vorher studierte er Kunst, und geblieben ist ihm während des gesamten Medizinstudiums ein Hang zu philosophischen Fragen. Marc las mit großem Interesse über den Philosophen, Mathematiker und Naturwissenschaftler René Descartes (1596–1650). Dieser hatte nicht nur die Bedeutung des Herzens für den Blutkreislauf erkannt, sondern der Medizin seinen Dualismus der Substanzen ins Stammbuch geschrieben: Der Mensch besteht aus Materie, die ausgedehnt ist und die wir messen können (res extensa), und einer Geistseele (res cogitans).
Abb. 0.1: Titelblatt der 1784 von Marc Lemort Demétigny eingereichten Doktorarbeit
Was Marc nicht gefällt: Im Studium geht es ausschließlich um den Körper. Er findet, dass die Seele das Wesentliche am Menschen sei. In seine Dissertation über die Rolle der Seele in der Krankheitsentstehung schreibt er den provozierenden Satz:
»Man wird mir entgegenhalten, dass der Körper der Haupt-Gegenstand der Medizin ist, dass es für diese Wissenschaft unerheblich ist, eine Definition und exaktere Begriffe von der spirituellen Substanz zu haben, die diesen Körper bewohnt. Darauf antworte ich, dass der Körper Materie ist und dass die Materie wie schon gesagt nicht empfinden oder handeln könnte. Der Körper als Materie könnte also nicht leben, wenn er nicht leben kann, kann er weder Subjekt von Gesundheit noch von Krankheit sein, also ist der Körper kein Gegenstand der Medizin.«
(Demétigny, 1784, S. 14, Übersetzung durch E. F.)
Marc braucht noch einen Titel für seine Doktorarbeit, und zwar auf Lateinisch! Er hatte auch ein bisschen Griechisch in der Schule und überlegt: Die Griechen nannten das, was beim Sterben wie ein Schmetterling aus dem Menschen herausfliegt: psyché und was übrigbleibt, also die Leiche: soma. Und iatrós heißt Arzt. Marc spielt mit den Wörtern und hat schließlich die Lösung: Er bastelt einen Dreierbegriff psycho-somato-iatrikon als griechischen Titel für sein lateinisches Deckblatt.
Was Marc nicht ahnen konnte: Er ist wohl der erste Autor, der das Wort »psychosomatisch« verwendet. Seine Dissertation teilt das Schicksal vieler Doktorarbeiten: Sie wird weitgehend vergessen. Jedoch: Auch heute noch beschäftigt Descartes’ Leib-Seele-Dualismus Patienten und Ärzte, manche bekämpfen ihn vehement und wollen eine »ganzheitliche« (holistische) Medizin oder aber sie ziehen es vor, psychische, soziale und spirituelle Aspekte aus der Medizin auszuschließen. Und eine allgemein anerkannte Definition der Seele hat die Medizin immer noch nicht gefunden, obwohl die Psycho-Fächer Psychosomatik, Psychotherapie, Psychiatrie, Psychologie, Psychoanalyse inzwischen einigermaßen etabliert sind.
Mehr als zwei Jahrhunderte nach Marcs Doktorarbeit ist »psycho-somatisch« (Demétigny, 1784; Heinroth, 1818; Steinberg, 2007) noch immer ein unreifer Begriff, ein »Säugling auf der Suche nach einer wissenschaftlichen Brust« (Engel, 1967). Der Gedankenstrich, die Verbindung zwischen beiden Worthälften, ist ebenso offen wie die Wirkungsrichtung zwischen Soma und Psyche. Dasselbe gilt für das bio-psycho-soziale Modell der Humanmedizin insgesamt (Engel, 1977).
Ob wir es gut finden oder nicht: Es gibt sehr viele unterschiedliche Zusammenhänge zwischen »Psyche« und »Soma« und zudem verschiedene Bedeutungen von »psychosomatisch« im medizinischen Sprachgebrauch (Tab. 0.1). Wie können wir die hier gezeigte Tabelle verstehen?
Einige zentrale Beispiele erläutern wir hier:
(1) Wird keine kausale Verknüpfung zwischen körperlicher und seelischer Störung angenommen, spricht man im medizinischen Jargon von Komorbidität: Der Patient hat »Läuse und Flöhe«, in diesem Fall eine oder mehrere psychische Diagnosen (aus dem Kapitel 6 des ICD-11) neben Diagnosen aus anderen ICD-11-Kapiteln.
Tab. 0.1: Häufig benutzte Begriffe und ihre angenommenen zugrundeliegenden Mechanismen
Das Stresskonzept wird sowohl im wissenschaftlichen als auch im alltäglichen Sprachgebrauch verwendet: Ein Stressor kann gleichzeitig eine körperliche und eine seelische Störung verursachen.
(2) Eine seelische Störung als Folge einer körperlichen nennt man psychoreaktiv oder somatopsychisch. Diese Verursachungsrichtung verträgt sich besser mit dem gewohnten ärztlichen Denken als die …
(3) … Psychogenese: »jener rätselhafte Sprung aus dem Seelischen ins Körperliche« bei der Konversionsneurose (Freud, 1916–17/1940, S. 265) oder aus heutiger Sicht des Embodiments: Der Körper zeigt, was die Seele spürt.
(4) Störungen können auch als Nebenwirkung eines ärztlichen Handelns entstehen (iatrós bedeutet »Arzt« auf Griechisch): Auch eine Psychotherapie kann seelisches oder psychosomatisches Leid verursachen, und ein Medikament kann ebenfalls körperliche oder seelische Nebenwirkungen haben.
(5) Eine körperliche Störung entsteht aus einer seelischen Problematik, z. B. über bestimmte Verhaltensweisen. Eine Leberzirrhose kann die Folge von chronischem Alkoholabusus oder extremes Untergewicht (Kachexie) die Folge einer Anorexie sein. Unter (6) können wir auch sog. Psychosomatosen einordnen, »organische Erkrankungen mit fassbaren morphologischen Veränderungen, auf deren Entstehung und/oder Verlauf psychische Faktoren nachweisbar einen wesentlichen Einfluss haben« (Ermann, 2024). Franz Alexander, ein jüdischer Arzt und Psychoanalytiker, der aus Österreich-Ungarn nach Chicago emigrieren musste und der als einer der Mitbegründer der Psychosomatischen Medizin gilt, ging von einer Organwahl durch spezifische Konflikte und Persönlichkeitsmuster der einzelnen Psychosomatosen aus (Alexander, 1950/1977; Alexander & French, 1948). Er zählte sieben dieser Störungen auf und nannte sie »Holy Seven« (Entzündliche Darmerkrankungen, Ulcus pepticum, Asthma bronchiale, essenzielle Hypertonie, atopische Neurodermitis, Hyperthyreose und rheumatoide Arthritis). Heute würde man diese Einteilung der »Holy Seven« nicht mehr vornehmen, dennoch sind die Entdeckungen von Alexander weiterhin wegweisend, auch nach der Entdeckung der Ulcus-Ätiologie durch Helicobacter Pylori (Marshall & Warren, 1984). Alexanders Perspektive auf Erkrankungen des Menschen unter psychosomatischen Gesichtspunkten kann heute z. B. besser im wissenschaftlichen Feld der »Psychoneuroimmunologie« verstanden werden, wo inzwischen gut nachweisbar ist, dass psychische Stressoren z. B. durch eine Entzündung vermittelte Wirkung auf den Körper ausüben können.
(6) Schließlich gibt es als häufige Restkategorie die psychosomatische »Ausschlussdiagnose«. Gründliche, auch apparative und möglicherweise wiederholte Suchen nach einer körperlichen Störung bleiben ohne Ergebnis: Die seelische Störung wird nicht positiv (durch Überprüfung diagnostischer Kriterien) diagnostiziert, sondern negativ dadurch, dass körperliche Ursachen nicht nachzuweisen sind. Wir sehen diese Haltung kritisch und stellen in diesem Buch einen anderen Weg vor: Psychosomatische Beschwerden sind keine Verlegenheits- oder Ausschlussdiagnosen. Vielmehr werden sie im Dialog mit dem kranken Menschen wahrgenommen und verstanden.
Heute verstehen wir das bio-psycho-soziale (Engel, 1977) oder bio-psycho-sozio-spirituelle (Dyer, 2011) Modell als eine bewusste Gegenreaktion auf ein dualistisches Weltbild, welche vielmehr im Sinne einer »Sowohl-als-auch«-Haltung alle »Grundelemente« des menschlichen Organismus einschließt (Kap. 3).
Der Neurologe und Psychosomatiker Viktor von Weizsäcker verwendete den Vergleich der Drehtür für das »Hin- und Hergehen« des Arztes zwischen den »Räumen« des naturwissenschaftlichen Beobachtens und Handelns und des biografischen Verstehens (Weizsäcker, 1997). Die Achse der Drehtür wäre demnach das erkennende Subjekt, die Türflügel begrenzen die jeweils mögliche Wahrnehmung. Sie können verhangen sein und als Scheuklappen des Subjekts wirken oder durchsichtig auf den jeweils anderen Ausschnitt (Hahn, 2007). Die Zahl der Türflügel und Ausschnitte ist im Prinzip offen: somatisch, psychisch, sozial, spirituell, bewusst, unbewusst …
Wäre Marc mit diesem Vergleich einverstanden? Wahrscheinlich würde ihn die Funktionsweise von Drehtüren, die es damals noch nicht gab, ebenso interessieren wie von Weizsäckers Vergleich.
1 Von der Geschichte in die Gegenwart
1.1 Die Erforschung der Hysterie – zugleich ein kurzer Streifzug durch die lange Geschichte der Psychosomatischen Medizin
Der Schriftsteller und Journalist Kurt Tucholsky (1890–1935), der schon 1929 aus dem zunehmend faschistischen Deutschland emigrierte, schrieb einst: »Wenn ein Mann weiß, daß die Epoche seiner stärksten Potenz nicht die ausschlaggebendste der Weltgeschichte ist – das ist schon sehr viel.«5
Ähnliches kann für die Medizingeschichte gelten und uns unbedingt ein wenig Bescheidenheit in der Betrachtung medizinischer Paradigmen früherer Zeiten abfordern. Auch wenn wir über gewisse, aus heutiger Sicht teils absurde Theorien schmunzeln müssen, beispielsweise der mittelalterlichen Säftelehre (»zu viel der schwarzen Galle!«), so kann uns niemand versprechen, dass unsere Nachfahren in nur wenigen Jahrzehnten auch unsere eigenen Theorien, Leitlinien und Kategorisierungssysteme belächeln werden. Denken wir nur an unsere Diagnosesystematiken, z. B. die Klassifikationsverzeichnisse der WHO, die ICD-Listen, welche alle paar Jahre angepasst werden. Diese sind nämlich bei kritischer Betrachtung nicht nur Evidenz-, sondern in vielen Unterbereichen lediglich »Eminenz«-basiert (d. h. von Fachleuten definiert und nicht ausschließlich aus wissenschaftlichen Studien abgeleitet).
Aber zurück zur Potenz der Männer, die Tucholsky hier in Frage stellt. Die Geschichte der Psychosomatischen Medizin ist über die Jahrhunderte eine Geschichte aus fast ausschließlich männlicher Perspektive. Männer waren die Ärzte, die Gelehrten, die Lehrer, die über ihre weiblichen Patienten und deren »hysterische« Beschwerden berichteten. Merkmale der Jahrtausende alten patriarchalischen Machtausübung, die bis heute ihren Nachhall findet. Aus guten Gründen wird der Begriff der Hysterie in den aktuellen Diagnosesystemen daher nicht mehr verwendet. Insbesondere wegen der diskriminierenden sexistischen Konnotation als vermeintliche Frauenerkrankung, welche sich über die Zeiten tradiert hat. Dennoch und gerade deswegen ist es lohnend, sich der Geschichte der Hysterie als Inbegriff psychosomatischer Erkrankungen zuzuwenden.
Die Konzeptualisierung psychosomatischer Störungen beginnt mit der faszinierenden Geschichte über das Phänomen der Hysterie. Der Psychiatrie-Historiker Henry Ellenberger übertrieb wahrscheinlich nur geringfügig, als er 1961 behauptete, dass die Geschichte der Psychiatrie »zur Gänze auf den Studien zum Verständnis der Hysterie« beruht (Janssen, 2009). An dieser Stelle kann nur umrisshaft auf teils uralte Entwicklungen eingegangen werden, eine empfehlenswerte Übersicht wurde 1994 von Mark S. Micale und R. Porter erstellt (Micale & Porter, 1994).
Die Beeinflussung organischer Prozesse durch seelische Faktoren beschäftigt seit Urzeiten Forscher und Ärzte. Schon in der Antike wurden Fragen nach der Rolle der Psyche auf die Entstehung von Krankheiten gestellt. Platon, Hippokrates, Aristoteles, Galen und viele andere Denker prägten ein medizinisches Paradigma, welches bis heute teils in beachtenswerter Präzision Relevanz hat (Janssen, 2009). Die europäische Geistesgeschichte kennt aber auch wissenschaftsverachtende Strömungen, deren trauriger Höhepunkt die Verbrennung des Astronomen und Naturgelehrten Giordano Bruno (1548–1600) auf dem Scheiterhaufen in Rom darstellt.
Hystéra ist das griechische Wort für Gebärmutter, und Hysteria bezeichnet die herumwandernde Gebärmutter. Die antike Vorstellung einer Organstörung des Uterus scheint aus unserer heutigen Perspektive auf den ersten Blick zunächst befremdlich. Die Hysterie wurde über Jahrhunderte als Prototyp einer frauenspezifischen Erkrankung betrachtet, was teilweise bis heute in epidemiologischen Vorstellungen (z. B. hinsichtlich dissoziativer Störungen) beharrlich andauert. Eine spezifisch feministische Historiografie und Gender-Forschungen setzen sich mit dieser Thematik immer wieder auseinander (Spitzer & Freyberger, 2008). Trotz der nicht nur aus heutiger Sicht Gender-unsensiblen Perspektive lohnt der Blick in die Medizingeschichte:
Die Vorstellung einer umherwandernden Gebärmutter geht auf Platon (427–347 v. Chr.) zurück, der im 44. Kapitel seines Timaios-Dialoges schreibt:
»[Gleich einem der Vernunft nicht gehorchendem Tiere] aber empfindet es das, was man bei den Frauen Gebärmutter und Mutterscheide nennt, welches als ein auf Kinderzeugung begieriges Lebendiges in ihnen ist, dies empfindet es mit schmerzlichem Unwillen, wenn es länger, über die rechte Zeit hinaus, unfruchtbar bleibt, und schafft, indem es dann allerwärts im Körper umherschweift und durch Versperren der Durchgänge das Atemholen nicht gestattet, große Beängstigung, so wie es noch andere Krankheiten aller Art herbeiführt.«
(Platon, 1998)
Die Zusammenhänge, die Platon hier beschreibt, kommen auf eine besondere Weise der triebtheoretischen Neurosenlehre Sigmund Freuds (1856–1939) nahe. Freud und nach ihm in konsequenterer Weise auch Wilhelm Reich (1897–1959) beschrieben den Konflikt zwischen »Realitäts- und Lustprinzip« (Freud, 1930/2012) bzw. die Dysregulation der »Sexualökonomie« (Reich, 1972) als Ursache für eine Vielzahl körperlicher Störungen. In dem auf die Lehren des Hippokrates (466–377 v. Chr.) zurückzuführenden Corpus Hippocraticum (um ca. 300–400 v. Chr.) werden sexuell nicht aktive Frauen (Witwen, Jungfrauen) beschrieben, die an verschiedensten Symptomen wie Krampfanfällen, Schmerzen, Lähmungen, Schwindel, Übelkeit und Sprachlosigkeit leiden. Ursächlich wird eine ausgetrocknete Gebärmutter diagnostiziert und insofern wird (für unser heutiges Empfinden ein wenig absurd) als Behandlung die Wiederaufnahme sexueller Beziehungen (Heirat, Schwangerschaft) empfohlen (Golder, 2007).
1.2 Die Entwicklung der Psychosomatik in Spätantike und Mittelalter, …
In der Spätantike verwirft Galen von Pergamon (129–199 n. Chr.) die Doktrin des frei beweglichen Uterus, wobei hysterische Symptome als in Verbindung mit im Körper zurückbleibenden, schädigenden vaginalen und uterinen Sekreten stehend verstanden bleiben. Interessanterweise beschreibt Galen auch Männer mit Hysterie-ähnlichen Symptomen, was in diesen Fällen mit im Körper zurückbleibendem Sperma begründet wird (Veith, 1965).
Diese Auffassungen Galens blieben weitgehend bis ins Hochmittelalter bestehen. Im christlich fundierten Mystizismus lösten klerikal-religiöse Ursachenattribuierungen medizinische Vorstellungen ab. Krankheit wurde mit Schuld, Hysterie mit dem Bösen in Verbindung gebracht (Veith, 1965). Die Entmedikalisierung der Hysterie führte dazu, Menschen mit hysterischen Symptomen (»stigmata diaboli«) als Dämonen, Hexen und Teufel zu brandmarken. Im Malleus Maleficarum (»Hexenhammer«), einer Schrift des Dominikaners Heinrich Kramer (Institoris), die zu einer zentralen Schrift der Hexenverfolgung wurde und der eine Bulle Papst Innozenz’ VIII. vorangestellt wurde, werden »Hexen« dargestellt, die Verhaltensweisen hervorbringen, die den Beschreibungen der Hysterie sehr genau entsprechen (Kramer, 2000). Noch 1631 rief der Jesuit Friedrich Spee heftige kirchliche Kritik hervor, als er mit seiner Cautio Criminalis dem kollektiven Hexenwahn entgegentrat. Inquisition, Hexenverbrennungen und Teufelsaustreibungen als »Behandlung« hysterischer Symptome sind wohl eines der dunkelsten Kapitel nicht nur in der Geschichte der Hysterie. Es ist anzumerken, dass der Vatikan bis heute unter besonderen Voraussetzungen (z. B. dass ein Psychiater vorher hinzugezogen wurde) exorzistische Rituale gestattet. Tragischerweise kam es dabei noch in den letzten Jahren zu tödlichen Ausgängen (Schulz, 1979).
1.3 … Neuzeit …
In der Neuzeit wurde die Uterustheorie von verschiedenen Ärzten wieder aufgegriffen und es kam nach den Dämonisierungen des Mittelalters endlich zu einer Demystifizierung der Hysterie, zurück in die Medizin, woran bereits Paracelsus (1493–1541) maßgeblich durch seine Arbeiten beteiligt war. Der italienische Chirurg Charles Lepois (auf Italienisch Carlo Piso, 1563–1633) sowie die Engländer Thomas Sydenham (1624–1689) und Thomas Willis (1621–1675) kamen getrennt voneinander zu der Auffassung, dass die Hysterie in erster Linie eine Erkrankung des Kopfes sei und dass sie deshalb (wie die Hypochondrie) auch bei Männern auftreten könne. Insbesondere Sydenham beschrieb als Erster zudem seelische und psychosoziale Faktoren (Zorn, Eifersucht, Trauer, Kummer), welche hysterische Symptome auslösen können. Eine Abkehr von hippokratischen Vorstellungen einer viszeralen Uterus-Ätiologie war eingeleitet, wenngleich sich die alten Theorien durch das Zeitalter der Aufklärung hindurch in der Ärzteschaft noch lange aufrecht hielten (Gilman et al., 1993).
Die Symptome der Hysterie waren, wie von Sydenham zutreffend geschildert, insbesondere bei Patienten in den wohlhabenderen Schichten inflationär zu beobachten und entsprechend entwickelten sich Methoden der Hysterie-Behandlung, die einer Erwähnung in diesem Buch wert sind.
Franz Anton Mesmer (1734–1815) fiel mit einem Bericht über die Behandlung von Fräulein Österlein