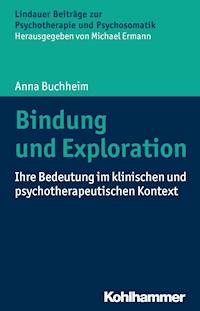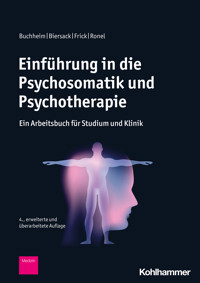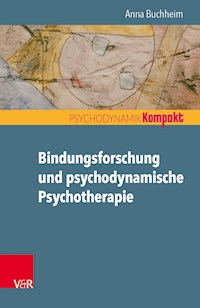
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Psychodynamik kompakt
- Sprache: Deutsch
Die nachhaltige Bedeutung früher Beziehungserfahrungen für die spätere sozioemotionale Entwicklung wird durch die Bindungsforschung seit vielen Jahren wissenschaftlich untermauert. Je nachdem, wie konsistent oder widersprüchlich diese frühen Erfahrungen erlebt wurden, gestalten sich sogenannte Arbeitsmodelle von Bindung bei Erwachsenen unterschiedlich und werden durch Merkmale wie zum Beispiel verinnerlichte Sicherheit, mentale Ressourcen, unbewusste Brüche oder Inkonsistenzen geprägt. Die Bindungsdiagnostik zur Erfassung von bindungsrelevanten unbewussten Prozessen erfolgt durch zwei Interviewmethoden, die Anna Buchheim im Detail beschreibt und deren klinische Bedeutung sie anhand von eindrucksvollen Fallbeispielen aus der eigenen Praxis veranschaulicht und mit aktuellen Studien in Zusammenhang bringt. Forschungsergebnisse belegen eine positive Veränderung von Bindungsrepräsentationen durch psychodynamische Therapien: Unsichere und desorganisierte Bindungsmuster können in Richtung von sicheren und organisierten verändert werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 90
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herausgegeben von
Franz Resch und Inge Seiffge-Krenke
Anna Buchheim
Bindungsforschungund psychodynamischePsychotherapie
Vandenhoeck & Ruprecht
Für Dr. Lotte Köhler
Mit 4 Abbildungen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sindim Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-647-90077-3
Weitere Ausgaben und Online-Angebote sind erhältlich unter:www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
Umschlagabbildung: Paul Klee, Engel noch tastend, 1939/akg-images
© 2018, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG,Theaterstraße 13, D-37073 Göttingenwww.vandenhoeck-ruprecht-verlage.comAlle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlichgeschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällenbedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Erstellung: Lumina Datamatics, Griesheim
Inhalt
Vorwort zur Reihe
Vorwort zum Band
1Einführung
2Bindungsdiagnostik zur Erfassung von bindungsrelevanten unbewussten Prozessen
2.1 Einführung in das Adult Attachment Interview (AAI)
2.2 Die klinische Anwendung des AAI
2.3 Kasuistik: Das AAI als Erstinterview und seine szenische Information
2.4 Einführung in das Adult Attachment Projective Picture System (AAP)
2.5 Die klinische Anwendung des AAP
2.6 Kasuistik: Patientin mit einer Angststörung
3Veränderung von Bindungsrepräsentationen durch psychodynamische Therapien
3.1 Psychodynamische Therapie der Borderline-Persönlichkeitsstörung
3.2 Langzeitpsychoanalysen und Veränderung von Bindungsrepräsentationen im Münchner Bindungs- und Wirkungsforschungsprojekt
3.3 Veränderung von Bindungsrepräsentation während einer Katathym Imaginativen Psychotherapie (KIP)
4Zusammenfassung und Ausblick
Literatur
Vorwort zur Reihe
Zielsetzung von PSYCHODYNAMIK KOMPAKT ist es, alle psychotherapeutisch Interessierten, die in verschiedenen Settings mit unterschiedlichen Klientengruppen arbeiten, zu aktuellen und wichtigen Fragestellungen anzusprechen. Die Reihe soll Diskussionsgrundlagen liefern, den Forschungsstand aufarbeiten, Therapieerfahrungen vermitteln und neue Konzepte vorstellen: theoretisch fundiert, kurz, bündig und praxistauglich.
Die Psychoanalyse hat nicht nur historisch beeindruckende Modellvorstellungen für das Verständnis und die psychotherapeutische Behandlung von Patienten hervorgebracht. In den letzten Jahren sind neue Entwicklungen hinzugekommen, die klassische Konzepte erweitern, ergänzen und für den therapeutischen Alltag fruchtbar machen. Psychodynamisch denken und handeln ist mehr und mehr in verschiedensten Berufsfeldern gefordert, nicht nur in den klassischen psychotherapeutischen Angeboten. Mit einer schlanken Handreichung von 70 bis 80 Seiten je Band kann sich der Leser schnell und kompetent zu den unterschiedlichen Themen auf den Stand bringen.
Themenschwerpunkte sind unter anderem:
–Kernbegriffe und Konzepte wie zum Beispiel therapeutische Haltung und therapeutische Beziehung, Widerstand und Abwehr, Interventionsformen, Arbeitsbündnis, Übertragung und Gegenübertragung, Trauma, Mitgefühl und Achtsamkeit, Autonomie und Selbstbestimmung, Bindung.
–Neuere und integrative Konzepte und Behandlungsansätze wie zum Beispiel Übertragungsfokussierte Psychotherapie, Schematherapie, Mentalisierungsbasierte Therapie, Traumatherapie, internetbasierte Therapie, Psychotherapie und Pharmakotherapie, Verhaltenstherapie und psychodynamische Ansätze.
–Störungsbezogene Behandlungsansätze wie zum Beispiel Dissoziation und Traumatisierung, Persönlichkeitsstörungen, Essstörungen, Borderline-Störungen bei Männern, autistische Störungen, ADHS bei Frauen.
–Lösungen für Problemsituationen in Behandlungen wie zum Beispiel bei Beginn und Ende der Therapie, suizidalen Gefährdungen, Schweigen, Verweigern, Agieren, Therapieabbrüchen; Kunst als therapeutisches Medium, Symbolisierung und Kreativität, Umgang mit Grenzen.
–Arbeitsfelder jenseits klassischer Settings wie zum Beispiel Supervision, psychodynamische Beratung, Arbeit mit Geflüchteten und Migranten, Psychotherapie im Alter, die Arbeit mit Angehörigen, Eltern, Familien, Gruppen, Eltern-Säuglings-Kleinkind-Psychotherapie.
–Berufsbild, Effektivität, Evaluation wie zum Beispiel zentrale Wirkprinzipien psychodynamischer Therapie, psychotherapeutische Identität, Psychotherapieforschung.
Alle Themen werden von ausgewiesenen Expertinnen und Experten bearbeitet. Die Bände enthalten Fallbeispiele und konkrete Umsetzungen für psychodynamisches Arbeiten. Ziel ist es, auch jenseits des therapeutischen Schulendenkens psychodynamische Konzepte verstehbar zu machen, deren Wirkprinzipien und Praxisfelder aufzuzeigen und damit für alle Therapeutinnen und Therapeuten eine gemeinsame Verständnisgrundlage zu schaffen, die den Dialog befördern kann.
Franz Resch und Inge Seiffge-Krenke
Vorwort zum Band
Das menschliche Bedürfnis nach Nähe, Zärtlichkeit und der Ausgestaltung enger emotionaler Beziehungen zu wichtigen anderen Personen wird im Bindungskonzept umfassend theoretisch abgebildet. Die Bedeutung früher Bindungserfahrungen für die spätere sozioemotionale Entwicklung konnte damit wissenschaftlich untermauert werden. Je nachdem, wie unterschiedlich und widersprüchlich diese frühen Erfahrungen waren, können auch die späteren Arbeitsmodelle von Beziehungen Brüche und Inkonsistenzen aufweisen. Vorschläge einer bindungsbezogenen Psychotherapie zur Bewusstmachung und Bearbeitung solcher Arbeitsmodelle werden bis heute als wertvoll und aktuell angesehen. Der Therapeut, die Therapeutin dient als sichere Basis für die Selbstexploration. Veränderungen von unsicheren und desorganisierten Bindungsrepräsentationen in Richtung von sicheren und organisierten können durch aktuelle Psychotherapiestudien belegt werden.
Die Bindungsdiagnostik zur Erfassung von bindungsrelevanten unbewussten Prozessen, die Ausdruck der jeweiligen inneren Arbeitsmodelle sind, wird durch zwei Interviewmethoden repräsentiert: Das Adult Attachment Interview und das Adult Attachment Projective Picture System haben sich aus der Entwicklungspsychologie und Klinischen Psychologie entwickelt. Anna Buchheim beschreibt im Detail beide Methoden und belegt deren klinische Bedeutung mit eindrucksvollen Fallbeispielen aus der eigenen analytischen Praxis und Forschung. Sie hat selbst nicht nur große Erfahrung in der Anwendung der Diagnostiksysteme, sie hat auch Modifikationen entwickelt und auf diese Weise empirische Forschungen mit dem Oxytozinsystem und bildgebenden Verfahren mittels fMRT-Experimenten ermöglicht. Damit gelingt ihr der Brückenschlag zur interdisziplinären Forschung.
In einem Kapitel werden eigene Forschungsergebnisse präsentiert, die eine positive Veränderung von Bindungsrepräsentationen durch psychodynamische Therapien belegen. Dazu gehören Studien zur Erforschung der »Transference-Focused Psychotherapy« (TFP) bei Borderline-Patienten und ein Bericht zur Bindungsrepräsentation bei Langzeitpsychoanalysen (Münchner Bindungs- und Wirkungsforschungsprojekt). Auch eine Studie zur Veränderung von Bindungsrepräsentationen während einer Katathym Imaginativen Psychotherapie (KIP) zeigt eindrucksvoll den Therapieerfolg.
Schließlich wird in einem Ausblick verdeutlicht, dass die Bindung der Therapeutin oder des Therapeuten einen Einfluss auf den Therapieerfolg hat. Dabei ist spannend, dass es in der Therapeut-Patienten-Dyade hilfreich sein kann, wenn beide über gegensätzliche Bindungsstile verfügen.
Ein gut lesbares, inhaltsreiches und klinisch hilfreiches Buch.
Inge Seiffge-Krenke und Franz Resch
1Einführung
»[…] es ist häufig hilfreich, den Patienten zu ermutigen, sich so detailliert wie möglich an tatsächliche Geschehnisse zu erinnern, damit er neu und mit allen entsprechenden Gefühlen sowohl seine eigenen Wünsche, Gefühle und Verhaltensweisen bei jeder speziellen Gelegenheit als auch das mögliche Verhalten seiner Eltern bewerten kann. Auf diese Weise hat er Gelegenheit, Vorstellungen im semantischen Speicher zu korrigieren oder modifizieren, von denen er feststellt, dass sie nicht mit dem historischen und gegenwärtigen Beweismaterial übereinstimmen«(Bowlby, 1983, S. 88).
Die Bindungstheorie wurde von dem Psychoanalytiker und Psychiater John Bowlby formuliert, der in den 1950er Jahren klinisch-psychoanalytische und evolutionsbiologische Ansätze und Betrachtungsebenen zur Grundlage seiner Forschung und seiner Publikationen machte. Die Bindungstheorie bietet ein Konzept zur Erklärung der menschlichen Neigung, enge emotionale Beziehungen zu anderen zu entwickeln, und ist zugleich ein Modell der Bedeutung früher Erfahrungen in den ersten Bindungsbeziehungen für die spätere sozioemotionale Entwicklung (Grossmann, Fremmer-Bombik, Rudolph u. Grossmann, 1988). Bowlby (1980) beschrieb seine Theorie insbesondere auch für das therapeutische Handeln – wie das obige Zitat deutlich macht – und prägte in diesem Zusammenhang (1980, 1983) den Begriff der »multiplen Arbeitsmodelle«. Hier ging er von der Beobachtung aus, dass Beschreibungen seiner Patienten über die Beziehung zu ihren Eltern teilweise nicht übereinstimmend waren und den Patienten der enthaltene Widerspruch nicht bewusst war. Bowlby legte dar, dass mehrere Arbeitsmodelle nebeneinander existieren können, wenn widerspruchsvolle Erfahrungen in der Realität gemacht wurden. In Anlehnung an Tulving (1972) begründete er die Existenz dieser »multiplen Arbeitsmodelle« damit, dass ein semantisches und ein episodisches (bzw. autobiografisches) Gedächtnis nebeneinander bestehen können und dass ihr Inhalt nicht übereinstimmen muss. Bowlby (1980) sieht daher die Bewusstmachung und Bearbeitung dieser frühen widersprüchlichen Arbeitsmodelle und ihre Ablösung durch sichere Modelle als die Hauptaufgabe des therapeutischen Prozesses.
Diese Vorschläge für eine bindungsbezogene Psychotherapie werden bis heute als wertvoll und aktuell angesehen und von Psychotherapeuten aufgegriffen (vgl. z. B. Holmes, 2001; Strauss, Buchheim u. Kächele, 2002; Bateman u. Fonagy, 2006; Muller, 2013; Buchheim, 2016). Bowlby formulierte programmatisch fünf therapeutische Aufgaben aus der Sicht der Bindungstheorie (Bowlby, 1980): 1) Der Therapeut, die Therapeutin dient als sichere Basis für die Selbstexploration, 2) Reflexion der inneren Arbeitsmodelle in gegenwärtigen Beziehungen, 3) Prüfung der therapeutischen Beziehung, 4) Genese der inneren Arbeitsmodelle in den Bindungsrepräsentationen der Eltern, 5) Realitätsprüfung der »alten« inneren Arbeitsmodelle auf Angemessenheit.
Alte innere Arbeitsmodelle von Bindung sollten seiner Meinung nach an der Realität überprüft werden, um flexiblere, angemessenere neue Modelle zu entwickeln (Bowlby, 1980). Er forderte seine Patientinnen und Patienten konkret auf, darüber nachzudenken, wie sie heute ihren wichtigsten Bezugspersonen mit welchen Gefühlen begegnen. Er leitete sie behutsam an, ihr aktuelles Erleben mit demjenigen der Kindheit zu vergleichen und auf Wiederholungen zu achten. Auch die therapeutische Beziehung sollte überprüft und mit Selbst- und Elternrepräsentanzen verglichen werden (Bowlby, 1980, 1988). Aus bindungstheoretischer Sicht ist eines der Ziele von Psychotherapie, ein sicheres bzw. organisiertes inneres Arbeitsmodell von Bindung herzustellen, um eine Reaktionsbereitschaft auf Belastung beim Schutz- und Hilfesuchen sowie die Exploration neuer Bewältigungsstrategien verfügbar zu machen (Buchheim, 2016).
Aktuelle Psychotherapiestudien aus dem psychodynamischen Kontext belegen die Veränderbarkeit von unsicheren und desorganisierten zu sicheren bzw. organisierten Bindungsrepräsentationen, wie sie Bowlby (1980) vorgeschlagen hat (z. B. Levy et al., 2006; Taylor et al., 2015; Buchheim et al., 2012a, 2012b; Hörz-Sagstetter et al., 2016; Buchheim et al., 2017). Die Verbesserung von Selbst- und Beziehungsregulation und der Fähigkeit, eigene innere Prozesse und die anderer Menschen zu erkennen, zu verstehen sowie darüber zu reflektieren, sind Fokus psychodynamischer Verfahren, die durch etablierte Interviewmethoden (siehe Kapitel 2) zur Erfassung von inneren Arbeitsmodellen von Bindung mithilfe des »Adult Attachment Interviews« (George, Kaplan u. Main, 1985/1996; Main u. Goldwyn, 1985/1998) oder des »Adult Attachment Projective Picture Systems« (George u. West, 2012) abgebildet werden können. Der Anstieg von Bindungssicherheit zeigt sich beispielsweise in einer erhöhten Kohärenz im Narrativ der Patienten bzw. einer erhöhten Selbstwirksamkeit in den erzählten Geschichten zu bindungsrelevanten Bildern nach einem Jahr Behandlung (siehe Kapitel 3). Das Wissen um Charakteristiken von Bindungsmustern und deren Entstehung kann für Therapeuten gerade dann besonders hilfreich sein, wenn es in der Therapie um die Arbeit im Hier und Jetzt an der Veränderung von aktualisierten maladaptiven, verzerrten Selbst- und Objektrepräsentationen geht (Köhler, 1998, 2002; Buchheim u. Kächele, 2001, 2002, 2003; Buchheim, 2016).
2Bindungsdiagnostik zur Erfassung von bindungsrelevanten unbewussten Prozessen
In seiner Trilogie stellte uns Bowlby (1969, 1973, 1980) ein entwicklungspsychologisches Modell mit nachvollziehbaren Implikationen für eine psychopathologische Entwicklung zur Verfügung. Innere Arbeitsmodelle von Bindung werden klassisch als Organisationsstrukturen beschrieben, die Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Handlungen und später auch Sprache beeinflussen (Main, Kaplan u. Cassidy, 1985; Bretherton u. Munholland, 2008). Das bedeutet, dass innere Arbeitsmodelle die Wahrnehmung und Interpretation von Situationen sowie deren Antizipation steuern, was größtenteils unbewusst geschieht.
Im Bereich der klinischen Bindungsforschung lassen sich bezüglich der Operationalisierung bzw. des Erfassens der jeweiligen inneren Arbeitsmodelle zwei Hauptlinien aufzeigen. Zum einen hat die Erwachsenenbindungsforschung ihre Wurzeln in der klinischen Entwicklungspsychologie, in deren Kontext das Adult Attachment Interview (AAI, Main u. Goldwyn, 1985/1998) und das Adult Attachment Projective Picture System (AAP, George, West u. Pettem, 1999; George u. West, 2012) entwickelt wurden mit dem Fokus, Bindungsrepräsentationen in Bezug auf bindungsrelevante Themen wie Eltern-Kind-Beziehung, Trennungserlebnisse oder Verlust und Missbrauchserlebnisse anhand von Interviews valide zu erheben. Beide Instrumente eignen sich dazu, unbewusste strukturelle Aspekte von Bindung zu erfassen.
Zum anderen liegt eine zweite Wurzel in der Persönlichkeits- und Sozialpsychologie und der Forschung zu Einsamkeit bzw. Partnerbeziehungen. Traditionsgemäß überwiegen in diesem Feld Fragebogenmethoden zur Erfassung von Bindungsmerkmalen, die subjektive Einschätzungen wiedergeben (siehe Buchheim u. Strauss, 2002; Höger, 2002; Roismann et al., 2007; Ravitz et al., 2010; Kirchmann et al., 2017).