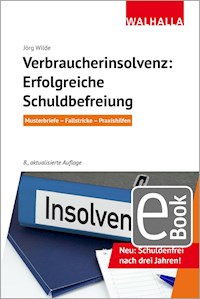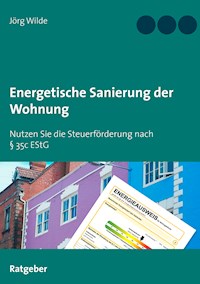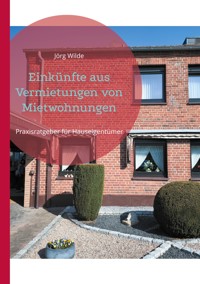
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Vermietung von Wohnungen ist in Deutschland an viele Bedingungen und Voraussetzungen gebunden. Als Vermieter müssen Sie sich mit dem Mietrecht und Steuerrecht befassen, wenn Ihre Vermietung nicht zum Fiasko werden soll. Auch die Betriebskostenabrechnung ist eines der wichtigen Themen für Sie als Vermieter. Dieser kleine Ratgeber gibt Ihnen viele wichtige und nützliche Informationen für Sie als Vermieter. Viele Beispielen, Musterbriefen und Checklisten werden Ihnen die Tätigkeit als Vermieter sehr vereinfachen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Abkürzungsverzeichnis
Kapitel 1: Einleitung
1.1 Zielsetzung und Zielgruppe
1.2 Aufbau des Buches
1.3 Rechtliche Hinweise und Haftungsausschluss
Kapitel 2: Grundlagen der Vermietung und Verpachtung
2.1 Rechtliche Rahmenbedingungen im Mietrecht
2.2 Steuerliche Grundlagen bei Vermietung und Verpachtung
2.3 Nutzen Sie Checklisten und Musterbriefe
Kapitel 3: Erstellung eines Mietvertrags
3.1 Die wesentlichen Bestandteile eines Mietvertrags
3.1.1 Die Hausordnung
3.1.1.1 Was in Ihrer Hausordnung nicht enthalten sein darf
3.1.1.2 Was ist, wenn der Mieter gegen die Hausordnung verstößt?
3.1.1.3 Hausordnung vergessen
3.2 Ihre Rechte und Pflichten als Vermieter – Ein Überblick
3.2.1 Gesetzliche Grundlagen
3.2.2 Instandhaltung und Mängelbeseitigung
3.2.3 Betriebskostenabrechnung
3.2.4 Informationspflichten
3.2.5 Modernisierungsmaßnahmen
3.2.6 Datenschutz und Persönlichkeitsrechte
3.2.7 Rechte des Mieters und Ihre Gegenrechte
3.4 Rechte und Pflichten des Mieters
3.5 Kündigung des Mietvertrags durch Sie als Vermieter
3.5.1 Ordentliche Kündigung (§ 573 BGB)
3.5.2 Außerordentliche fristlose Kündigung (§ 543 BGB)
3.5.3 Form und Fristen der Kündigung (§§ 568, 573c BGB)
3.5.3.1 Schriftform (§ 568 BGB)
3.5.3.2 Gründe für eine ordentliche Kündigung
3.5.3.3 Gründe für eine außerordentliche fristlose Kündigung
3.5.3.4 Kündigungsfristen (§ 573c BGB)
3.5.4 Relevante BGH-Urteile
3.5.5 Besonderer Kündigungsschutz bei Kauf von vermieteten Wohnungen
3.5.6 Was passiert, wenn der Ihr Mieter der Kündigung widerspricht
3.5.6.1 Widerspruch bei einer ordentlichen Kündigung (§ 574 BGB – Sozialklausel)
3.5.6.2 Widerspruch bei einer außerordentlichen (fristlosen) Kündigung
3.5.6.3 Wie sollte der Vermieter reagieren?
3.6 Wann und wie Sie die Miete erhöhen dürfen
3.6.1 Dies müssen Sie beachten
3.7 Wann Ihr Mieter die Miete mindern darf
3.8 Die Mietkaution
3.8.1 Wann darf die Kaution einbehalten werden?
3.8.2 Fristen für die Rückzahlung der Kaution
3.8.3 Voraussetzungen für den Einbehalt
3.8.4 Rückzahlung nach Abzug der Kaution
3.9 Was beinhaltet die Mietpreisbremse
3.9.1 Hier greift die Mietpreisbremse nicht
3.9.2 Folgen der Nichtbeachtung der Mietpreisbremse
3.10 So berechnen Sie die Wohnfläche für den Mietvertrag
3.11 Nutzung von Gärten
3.11.1 Ist der Garten Teil der Mietsache?
3.11.2 Welche Rechte hat der Mieter?
3.11.3 Wer muss den Garten pflegen?
3.11.4 Grillen im Garten – erlaubt oder verboten?
3.11.5 Dürfen Sie dem Mieter die Gartennutzung verbieten?
Kapitel 4: Erstellung einer Betriebskostenabrechnung
4.1 Definition und gesetzliche Grundlagen der Betriebskosten
4.2 Diese Frist gilt für Ihre Betriebskostenabrechnung
4.2.1 Bedeutung der Frist
4.2.2 Konsequenzen bei Fristüberschreitung
4.3 Welche Kosten können auf den Mieter umgelegt werden?
4.3.1 Diese Kosten dürfen von Ihnen auf die Mieter umgelegt
4.3.2 Aufbau einer Betriebskostenabrechnung – Schritt für Schritt
4.3.2.1 So verteilen Sie die umlagefähigen Kosten auf die Mieter
4.3.2.2 Praktisches Fallbeispiel
4.4 Häufige Fehler und wie Sie diese vermeiden
4.5 Diese Rechte und Möglichkeiten hat Ihr Mieter
Kapitel 5: Versteuerung der Einnahmen beim Finanzamt
5.1 Grundlagen der steuerlichen Erfassung von Mieteinnahmen
5.1.1 Einkommensteuer
5.1.2 Umsatzsteuer
5.1.3 Gewerbesteuer
5.2 Einnahmen nach § 21 EStG
5.2.1 Teilvermietung und Vereinfachungsregelungen
5.2.2 Besonderheiten
5.2.3 Schnellübersicht Einnahmen
5.2.4 Die verbilligte Überlassung von Mietwohnungen nach § 21 EStG
5.2.4.1 Aufteilung der verbilligten Miete
5.2.4.2 Bestimmung der ortsüblichen Marktmiete
5.2.5 Mietverträge mit Angehörigen und Lebenspartnern – Steuerliche Risiken für Sie als Vermieter
5.2.5.1 Mietverträge mit Angehörigen – der Fremdvergleich entscheidet
5.2.5.2 Besondere Vorsicht bei nichtehelichen Lebensgemeinschaften
5.2.5.3 Verbilligte Vermietung – nicht immer steuerlich vorteilhaft
5.2.5.4 Vorsicht bei Grundstücksübertragungen mit anschließender Vermietung
5.3 Abzugsfähige Werbungskosten und weitere steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten
5.3.1 Was sind Werbungskosten?
5.3.2 Schnellübersicht der wichtigsten Werbungskosten
5.3.3 Besonderheit Erhaltungsaufwendungen
5.3.3.1 Abgrenzung zu Herstellungsaufwand
5.3.3.2 Besondere Fälle und Aufteilung
5.3.3.3 Erhaltungsaufwand als Werbungskosten in der Vermietung
5.3.3.4 Sie können die Erhaltungsaufwendungen auf 5 Jahre verteilen
5.3.3.5 Abgrenzung von Erhaltungsaufwendungen zu anschaffungsnahen Aufwendungen
5.3.3.6 Modernisierungsaufwendungen vor Übergang von Nutzen und Lasten – Was für Sie zu beachten ist
5.3.4 Abschreibungen und deren Bedeutung
5.3.4.1 Lineare Abschreibung
5.3.4.2 Degressive Abschreibung – für Neubauten seit 2023
5.3.4.3 Berechnung der Anschaffungskosten (bei Kauf einer Immobilie)
5.3.4.4 Berechnung der Herstellungskosten (bei Neubau)
5.4 Steuererklärungen: Tipps zum Umgang mit dem Finanzamt
Anhang
A. Musterbriefe
A.1 Musterbrief: Ordentliche Kündigung
A.2 Musterbrief: Abmahnung an den Mieter
A.3 Musterbrief: Außerordentliche fristlose Kündigung
A.4 Musterbrief: Antwort auf Widerspruch des Mieters
A.5 Musterbrief: Antwort auf Widerspruch des Mieters
A.6 Musterbrief: Abmahnung wegen Verstoßes gegen die Hausordnung
B. Checklisten und Formulare
B.1 Checkliste für die Erstellung eines Mietvertrags
B.2 Checkliste für die Erstellung Ihrer Betriebskostenabrechnung
B.3 Checkliste zur Prüfung anschaffungsnaher Aufwendungen
B.4 Checkliste für Vermieter: Prüfen, ob eine ordentliche Kündigung möglich ist
B.5 Checkliste für Vermieter: Prüfung einer außerordentlichen (fristlosen) Kündigung nach § 543 BGB
B.6 Checkliste für Vermieter: Widerspruch des Vermieters
B.7 Checkliste zur Prüfung der Zulässigkeit Ihrer Mieterhöhung
C. Betriebskostenverordnung
Findex
KAPITEL 1: EINLEITUNG
1.1 Zielsetzung und Zielgruppe
Dieses Buch richtet sich an Hauseigentümer, die Wohnungen vermieten und sich dabei mit Fragen rund um die Erstellung rechtssicherer Mietverträge, die ordnungsgemäße Betriebskostenabrechnung sowie die steuerliche Erfassung ihrer Einnahmen auseinandersetzen müssen. Ziel ist es, Ihnen fundiertes Wissen sowie praxisnahe Tipps zu vermitteln, die dir den Vermietungsalltag erleichtern.
1.2 Aufbau des Buches
Ich beginne mit den grundlegenden rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen, bevor Ich mich detailliert den praktischen Themen widmen. Zunächst steht die Erstellung eines Mietvertrags im Fokus – das Fundament jeder Vermietung. Anschließend folgt ein Kapitel zur Betriebskostenabrechnung, in dem Schritt für Schritt erklärt wird, wie du deine Kosten korrekt und nachvollziehbar an den Mieter weiterreichen kannst. Den Abschluss bildet das Kapitel zur steuerlichen Behandlung, das dir hilft, deine Einnahmen ordnungsgemäß zu versteuern und dabei alle relevanten Vorschriften zu beachten.
1.3 Rechtliche Hinweise und Haftungsausschluss
Die hier dargestellten Inhalte basieren auf dem aktuellen Wissensstand und den geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen. Da sich Gesetze und Vorschriften ändern können, übernehmen weder der Autor noch der Verlag die Gewähr für die Aktualität und Richtigkeit der Inhalte. Für individuelle Fälle und bei Unsicherheiten empfehlen wir die Konsultation von Experten.
KAPITEL 2: GRUNDLAGEN DER VERMIETUNG UND VERPACHTUNG
2.1 Rechtliche Rahmenbedingungen im Mietrecht
In Deutschland beruhen Mietverträge für Wohnungen vor allem auf den Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB). Neben den allgemeinen Vorschriften des Vertragsrechts gibt es zahlreiche spezielle Bestimmungen, die die Rechte und Pflichten von Mietern und Vermietern regeln. Im Folgenden sind die wesentlichen rechtlichen Grundlagen zusammengefasst:
1. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Allgemeine Grundlagen (§§ 535–580a BGB):
Diese Paragrafen regeln das Mietverhältnis. Insbesondere wird festgelegt, dass der Vermieter verpflichtet ist, dem Mieter die Mietsache in einem vertragsgemäßen Zustand zu überlassen und zu erhalten, während der Mieter im Gegenzug zur Zahlung der vereinbarten Miete und zur sorgsamen Behandlung der Wohnung verpflichtet ist.
Pflichten des Vermieters:
✓
Gebrauchstauglichkeit:
Die Wohnung muss bei Übergabe den vertraglich zugesicherten Zustand aufweisen.
✓
Instandhaltung:
Der Vermieter muss notwendige Instandhaltungsmaßnahmen durchführen, um den Wohnwert zu erhalten.
✓
Mängelbeseitigung:
Bei Mängeln, die nicht vom Mieter zu verantworten sind, muss der Vermieter diese beheben.
Pflichten des Mieters:
✓
Zahlung der Miete:
Der Mieter hat die Miete pünktlich zu zahlen.
✓
Sorgfaltspflicht:
Der Mieter muss die Wohnung schonend behandeln und Schäden vermeiden.
✓
Kleinreparaturen:
Oft werden vertraglich bestimmte Kleinreparaturen dem Mieter zugeschrieben, wobei hier darauf geachtet werden muss, dass solche Klauseln den Mieter nicht unangemessen benachteiligen.
2. Kündigungsfristen und Kündigungsschutz
Kündigungsfristen (§ 573c BGB):
Für Mieter gilt in der Regel eine Kündigungsfrist von drei Monaten. Vermieter müssen längere Fristen einhalten, die von der Dauer des Mietverhältnisses abhängen. Außerdem bedarf es bei der Kündigung durch den Vermieter eines berechtigten Interesses (z. B. Eigenbedarf, erhebliche Vertragsverletzungen).
Kündigungsschutz:
Der Gesetzgeber schützt Mieter vor willkürlichen Kündigungen. Gründe, die eine ordentliche Kündigung rechtfertigen, müssen nachvollziehbar und gesetzlich anerkannt sein.
3. Mieterhöhungen und Modernisierungsmaßnahmen
Mieterhöhungen (§ 558 BGB):
Vermieter können die Miete anpassen, müssen dabei jedoch bestimmte gesetzliche Grenzen (z. B. die Kappungsgrenze) und Voraussetzungen (wie die Bezugnahme auf den örtlichen Mietspiegel) einhalten.
Modernisierungsmaßnahmen (§ 559 BGB und weitere Regelungen):
Werden Modernisierungen durchgeführt, die zu einer nachhaltigen Verbesserung der Wohnsituation führen, können diese unter strengen Voraussetzungen zu einer Mieterhöhung führen. Auch hier sind gesetzliche Obergrenzen und Fristen zu beachten.
4. Nebenkosten und Betriebskostenabrechnung
Betriebskosten:
Neben der Kaltmiete können Betriebskosten (z. B. Heizkosten, Wasser, Müllabfuhr) umgelegt werden. Die rechtlichen Grundlagen hierfür finden sich im BGB sowie in der Betriebskostenverordnung.
Transparenz und Abrechnung:
Der Vermieter ist verpflichtet, eine nachvollziehbare und prüffähige Betriebskostenabrechnung vorzulegen. Hierbei sind Fristen und Formvorschriften einzuhalten.
5. Energieausweis und energetische Vorschriften
Energieausweis:
Vermieter müssen bei der Vermietung einen gültigen Energieausweis vorlegen. Dieser weist die energetische Qualität der Immobilie aus und basiert auf dem Gebäudeenergiegesetz (GEG).
Weitere Vorschriften:
Regelungen zur Energieeffizienz und zu Modernisierungsmaßnahmen zur Verbesserung der energetischen Standards der Wohnung spielen eine immer wichtigere Rolle.
6. Landesrechtliche und weitere spezielle Regelungen
Mietpreisbremse:
In einigen angespannten Wohnungsmärkten gibt es gesetzliche Regelungen zur Mietpreisbremse, die in bestimmten Regionen gelten. Diese sollen überhöhte Mieten verhindern.
Gerichtliche Rechtsprechung:
Viele Details des Mietrechts werden durch Gerichtsentscheidungen konkretisiert. Beispielsweise haben zahlreiche Urteile klargestellt, dass bestimmte Klauseln in Mietverträgen (z. B. zu Schönheitsreparaturen) unwirksam sein können, wenn sie den Mieter unangemessen benachteiligen.
Vertragsfreiheit:
Grundsätzlich besteht bei Mietverträgen ein hohes Maß an Vertragsfreiheit. Diese Freiheit ist jedoch durch die oben genannten gesetzlichen Bestimmungen und den Schutz des Mieters begrenzt.
Zusammenfassung
Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Mietverträge in Deutschland basieren primär auf den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs (insbesondere §§ 535–580a BGB) und werden durch ergänzende Regelungen (z. B. Betriebskostenverordnung, Gebäudeenergiegesetz) sowie durch gerichtliche Entscheidungen konkretisiert. Sowohl Mieter als auch Vermieter sollten diese gesetzlichen Grundlagen kennen, um ihre Rechte und Pflichten korrekt wahrzunehmen. Bei Unklarheiten oder spezifischen Fragen ist es ratsam, sich rechtlich beraten zu lassen (z. B. durch Mietervereine oder Fachanwälte für Mietrecht).
Diese Grundlagen bilden den Rahmen, innerhalb dessen Mietverträge abgeschlossen und durchgeführt werden – immer unter Berücksichtigung, dass einzelne Vereinbarungen im Mietvertrag nicht gegen zwingendes Recht verstoßen dürfen.
Hier die wichtigsten Regelungen für Sie
Im deutschen Mietrecht spielen zahlreiche gesetzliche Vorschriften eine Rolle. Im Folgenden findest du eine Übersicht über die wesentlichen gesetzlichen Grundlagen und die dazugehörigen Paragrafen bzw. Verordnungen:
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Das BGB bildet die zentrale Grundlage des Mietrechts. Insbesondere die §§ 535 bis 580a BGB regeln die Rechte und Pflichten von Mietern und Vermietern.
§ 535 BGB – Inhalt und Pflichten aus dem Mietvertrag:
Regelt die Hauptpflichten beider Parteien:
Vermieter:
Überlassung der Mietsache in einem vertragsgemäßen Zustand und deren Erhaltung.
Mieter:
Zahlung der Miete und vertragsgemäßer Gebrauch der Mietsache.
§ 536 BGB – Mietminderung bei Mängeln:
Ermöglicht dem Mieter eine Minderung der Miete, wenn die Wohnung Mängel aufweist, die ihre Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen.
§ 536a BGB – Schadensersatz bei Mängeln:
Regelt Ansprüche des Mieters auf Schadensersatz, wenn Mängel vorliegen und der Vermieter seine Pflichten verletzt.
§ 546 BGB – Rückgabepflicht der Mietsache:
Bestimmt, dass der Mieter die Wohnung nach Beendigung des Mietverhältnisses zurückzugeben hat.
§ 550 BGB – Formerfordernisse bei Mietverträgen:
Legt fest, dass Mietverträge über Wohnraum in Textform abgeschlossen werden können, wobei für langfristige Mietverhältnisse besondere Formvorschriften (schriftlich) gelten.
§ 551 BGB – Mietkaution:
Regelt die Hinterlegung und Verzinsung von Mietkautionen.
§ 556 BGB – Betriebskosten:
Enthält Vorschriften zur Vereinbarung und Umlage von Betriebskosten auf den Mieter.
§ 558 BGB – Mieterhöhung bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete:
Erlaubt dem Vermieter unter bestimmten Voraussetzungen, die Miete an die ortsübliche Vergleichsmiete anzupassen.
§ 559 BGB – Mieterhöhung nach Modernisierungsmaßnahmen:
Regelt, unter welchen Voraussetzungen Modernisierungsmaßnahmen zu einer Erhöhung der Miete führen können.
§ 573 BGB – Ordentliche Kündigung durch den Vermieter:
Enthält die Voraussetzungen, unter denen ein Vermieter das Mietverhältnis kündigen darf (z. B. bei Eigenbedarf oder erheblichen Vertragsverletzungen).
§ 573c BGB – Kündigungsfristen:
Bestimmt die einzuhaltenden Kündigungsfristen, wobei für den Mieter meist eine Frist von drei Monaten gilt und für den Vermieter abhängig von der Mietdauer längere Fristen vorgeschrieben sind.
Weitere Vorschriften innerhalb der §§ 535–580a BGB regeln zusätzliche Aspekte, wie z. B. Mängelrechte und Rücktrittsrechte.
2. Betriebskostenverordnung (BetrKV)
Diese Verordnung konkretisiert, welche Betriebskosten (z. B. Heizkosten, Wasser, Müllabfuhr) auf den Mieter umgelegt werden dürfen und wie die Abrechnung vorzunehmen ist.
3. Gebäudeenergiegesetz (GEG)
Das Gebäudeenergiegesetz löst die frühere Energieeinsparverordnung (EnEV) ab und regelt unter anderem: Die energetische Qualität von Gebäuden Die Pflicht zur Vorlage eines gültigen Energieausweises bei der Vermietung.
4. Mietpreisbremse
Die mietpreisregulierenden Vorschriften zielen darauf ab, in angespannten Wohnungsmärkten überhöhte Mieten zu begrenzen. Die gesetzlichen Grundlagen ergeben sich aus Bundesgesetzen, die in den einzelnen Bundesländern häufig durch ergänzende Regelungen konkretisiert werden (z. B. im Rahmen von Mietrechtsnovellierungen oder speziellen Landesgesetzen).
Weitere rechtliche Grundlagen
Landesrechtliche Vorschriften:
In einigen Bundesländern gibt es zusätzliche Regelungen, die das Mietrecht (z. B. bezüglich der Betriebskosten oder energetischen Anforderungen) weiter präzisieren.
Rechtsprechung:
Gerichtliche Entscheidungen (Urteile) tragen dazu bei, die gesetzlichen Vorschriften in der Praxis auszulegen. So wurden beispielsweise viele Standardklauseln in Mietverträgen (z. B. zu Schönheitsreparaturen) im Lichte des § 307 BGB (Unwirksamkeit von AGB-Klauseln) immer wieder überprüft.
2.2 Steuerliche Grundlagen bei Vemietung und Verpachtung
In Kapitel 5 „Versteuerung der Einnahmen beim Finanzamt“ erhalten Sie eine systematische Darstellung aller wesentlichen Aspekte, die Sie bei der steuerlichen Behandlung Ihrer Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung beachten müssen. Beginnend mit Abschnitt 5.1, den „Grundlagen der steuerlichen Erfassung von Mieteinnahmen“, wird Ihnen vermittelt, wie Sie Ihre Mieteinnahmen ordnungsgemäß dokumentieren und erfassen. Hier erfahren Sie, welche Belege und Unterlagen erforderlich sind, um mittels einer Einnahmenüberschussrechnung den Überblick über Ihre steuerpflichtigen Einkünfte zu behalten – inklusive der korrekten Zurechnung von Nebeneinnahmen.
Im Anschluss widmet sich Abschnitt 5.2 den „Einnahmen nach § 21 EStG“. In diesem Teil des Kapitels wird detailliert erklärt, welche Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung unter die Regelungen des § 21 des Einkommensteuergesetzes fallen und wie diese steuerlich zu behandeln sind. Sie erhalten hier fundierte Informationen zur Ermittlung der steuerlichen Belastung sowie zu speziellen Ausnahmeregelungen und Sonderfällen, die Ihnen dabei helfen, Ihre steuerlichen Pflichten präzise umzusetzen.
Darauf aufbauend geht Abschnitt 5.3 auf „Abzugsfähige Werbungskosten und weitere steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten“ ein. Dieser Teil zeigt Ihnen nicht nur, welche Kosten – etwa Instandhaltungs-, Verwaltungs- oder Finanzierungskosten – Sie als Werbungskosten steuerlich geltend machen können, sondern beleuchtet auch weiterführende Gestaltungsspielräume. Anhand praxisnaher Beispiele erfahren Sie, wie Investitionsabzugsbeträge und Abschreibungen zur Optimierung Ihrer Steuerlast beitragen können.
Abschließend erhalten Sie in Abschnitt 5.4, „Steuererklärungen: Tipps zum Umgang mit dem Finanzamt“, wertvolle Ratschläge für die Erstellung Ihrer Steuererklärung. Hier wird erläutert, welche Unterlagen und Belege Sie bereithalten sollten, um Ihre Angaben stichhaltig zu untermauern, und wie Sie typische Fehler vermeiden können, die zu Rückfragen seitens des Finanzamts führen könnten. Zudem erfahren Sie, wie eine transparente und konstruktive Kommunikation mit den Finanzbehörden zu einem reibungslosen Ablauf beiträgt.
Mit dieser klar strukturierten Gliederung, die von den Grundlagen der Erfassung über die spezifischen Regelungen des § 21 EStG bis hin zu den praktischen Tipps für die Steuererklärung reicht, bietet Kapitel 5 Ihnen eine fundierte und praxisorientierte Anleitung. So sind Sie bestens gerüstet, Ihre steuerlichen Pflichten als Vermieter oder Verpächter effizient und rechtssicher zu erfüllen.
2.3 Nutzen Sie Checklisten und Musterbriefe
Der Anhang des Buches bietet Ihnen einen unmittelbaren praktischen Mehrwert, indem er die in den Kapiteln vermittelten theoretischen Kenntnisse direkt in die Praxis überführt. Er enthält eine Vielzahl von Musterschreiben, wie beispielsweise Musterbriefe zur ordentlichen Kündigung, Abmahnung oder auch zur außerordentlichen fristlosen Kündigung, die Ihnen als verlässliche Vorlagen für die Kommunikation mit Ihren Mietern dienen. Darüber hinaus finden Sie im Anhang zahlreiche Checklisten und Formulare, die Ihnen helfen, bei der Erstellung von Mietverträgen, Betriebskostenabrechnungen und der Prüfung relevanter Aufwendungen systematisch und vollständig vorzugehen. So können Sie sicherstellen, dass Sie alle wichtigen Punkte berücksichtigen und rechtliche Fallstricke vermeiden. Insgesamt unterstützt Sie der Anhang dabei, Ihre Aufgaben im Bereich Vermietung und Verpachtung effizient, zeitsparend und rechtssicher zu bewältigen, indem er Ihnen bewährte Instrumente und praxisnahe Hilfestellungen an die Hand gibt.
KAPITEL 3: ERSTELLUNG EINES MIETVERTRAGS
3.1 Die wesentlichen Bestandteile eines Mietvertrags
Ein rechtssicherer Mietvertrag bildet die Basis für ein gutes Mietverhältnis. Hier finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten Bestandteile eines Mietvertrags samt kurzer Beschreibung zusammenfasst:
Bestandteil
Beschreibung / Inhalt
Vertragsparteien
Vollständige Angaben zu Vermieter und Mieter (Name, Anschrift, und ggf. Kontaktdaten)
Mietobjekt
Detaillierte Beschreibung der Mieträume (Adresse, Lage, Größe, Aufteilung, Ausstattung) sowie der Zustand der Mietsache (ggf. dokumentiert durch ein Übergabeprotokoll)
Mietdauer & Kündigungsfristen
Festlegung des Mietbeginns, ob das Mietverhältnis befristet oder unbefristet ist, sowie die jeweils geltenden Kündigungsfristen und -modalitäten
Mietzins & Zahlungsmodalitäten
Höhe der monatlichen Miete, Fälligkeit und Art der Zahlung (z. B. Überweisung) sowie Regelungen zu möglichen Mietanpassungen
Nebenkosten
Aufschlüsselung der zusätzlich zur Miete zu zahlenden Betriebskosten (z. B. Heizung, Wasser, Müllabfuhr) und die Modalitäten zur Abrechnung (jährlich, monatlich o.ä.); siehe hierzu auch 3.2.3.
Kaution
Vereinbarungen zur Sicherheitsleistung: Höhe der Kaution (oft in Monatsmieten bemessen), Zahlungsmodalitäten sowie die Bedingungen für deren Rückzahlung
Instandhaltung & Reparaturen
Regelungen, wer für Instandhaltungsmaßnahmen, Reparaturen und ggf. Schönheitsreparaturen zuständig ist, sowie das Verfahren zur Mängelanzeige
Nutzung & Besondere Vereinbarungen
Bestimmung des Nutzungszwecks (z. B. Wohnoder Gewerbezwecke), Regelungen zur Untervermietung, Hinweise zur Hausordnung und weitere individuelle Vereinbarungen (wie Tierhaltung, Nutzung von Abstellräumen oder Parkplätzen)
Schriftform & Unterzeichnung
Vorgabe, dass der Vertrag schriftlich abgeschlossen wird, inklusive der erforderlichen Unterschriften beider Parteien, sowie Regelungen, wie spätere Änderungen vorzunehmen sind (meist nur schriftlich zulässig)
Sonstige Vereinbarungen