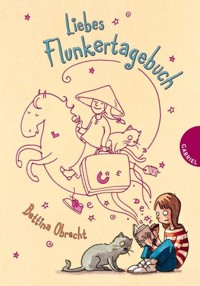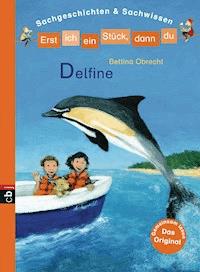7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj TB
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Going viral: Youtube-Star über Nacht
Franziska ist eine, die unbequem ist; eine, die Fragen stellt. Muss sie wirklich so aalglatt funktionieren wie ihre beiden älteren Schwestern, die große Karriere machen? Fran träumt von einem anderen Leben. Aber sind unsere Träume nicht wie Eintagsküken?, fragt sich Fran. Träume, die vom System aussortiert werden, bevor sie richtig zum Leben erwachen können ... Als sie beginnt, Raptexte zu schreiben und Videos auf YouTube stellt, wird sie plötzlich gehört. Abertausende Klicks, ein Erfolg wie eine Lawine, schon klopft eine Produktionsfirma an, Fran wird über Nacht zum Star. Doch ist das der Erfolg, von dem sie geträumt hat?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
DIE AUTORIN
Foto: © Isabelle Grubert/Random House
Bettina Obrecht wurde 1964 in Lörrach geboren und studierte Englisch und Spanisch. Sie arbeitet als Autorin, Übersetzerin und Rundfunkredakteurin und wurde für ihre Kurzprosa und Lyrik mehrfach ausgezeichnet. Seit 1994 schreibt sie Kinder- und Jugendbücher und hat sich seitdem in die »Garde wichtiger Kinderbuchautorinnen hineingeschrieben« (Eselsohr).
Mehr zu cbj auf Instagram @hey_reader
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt
und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen
unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung
sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung,
Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglich-
machung, insbesondere in elektronischer Form, ist
untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen
nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter
enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine
Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen,
sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der
Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage
Erstmals als cbj Taschenbuch Dezember 2017
© 2017 cbj Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Geviert Grafik & Typografie
Foto: © plainpicture (Cavan Images);
shutterstock (vectorstudiori , Magnia, Mironova Iuliia)
CK · Herstellung: UK
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-17979-3V001
www.cbj-verlag.de
»There’s no time to lose«, I heard her say
Catch your dreams before they slip away
Dying all the time
Lose your dreams and you will lose your mind
Ruby Tuesday/The Rolling Stones
Two years he walks the earth. No phone,
no pool, no pets, no cigarettes. Ultimate freedom. (…)
No longer to be poisoned by civilization he flees
and walks alone upon the land to become lost in
the wild.
Alexander Supertramp, Mai 1992
August/I
Paul, mein Großvater, ein mir vollkommen Unbekannter also, holt mich am Flughafen ab.
Wir haben uns so gut wie noch nie gesehen. Ich werde ein bisschen nervös, als ich ihn entdecke, nicht, weil er so furchterregend aussähe, sondern eben deswegen, weil wir uns überhaupt nicht kennen. Ein fremder älterer, braun gebrannter Mann steht vor mir, einer mit kleinem, aber deutlich ausgeprägtem Bauch, Schnurrbart, einer weißen Schirmmütze auf den Haaren und grauem Pelz auf den Armen. Ein Fremder, der mir fröhlich zuwinkt und mich jeden Moment in sein Auto verfrachten wird.
Wir haben uns zweimal getroffen, das letzte Mal vor fünf Jahren – es war die Beerdigung meiner Uroma Brigitte. Damals habe ich mich gar nicht getraut, mit ihm zu reden. Zu jener Zeit war das Urteil meiner Eltern für mich noch unanfechtbar, und ihr Urteil fiel im Fall meines Großvaters vernichtend aus. Für mich war lange Zeit klar: Wenn meine Eltern von Opa Paul nichts hielten, dann konnte mit ihm wirklich etwas nicht stimmen, auch wenn er noch so freundlich tat. Ich fürchte, ich habe bei ihm keinen sehr positiven Eindruck hinterlassen, deswegen ist es ihm um so höher anzurechnen, dass er meinem Besuch ohne weitere Fragen zugestimmt hat, ja, dass er sogar damit einverstanden war, dass ich meinen Hund mitbringe. Ich habe selbst ein schlechtes Gewissen, dass ich Tramp eine Reise im Flugzeug zugemutet habe. Er war im Frachtraum bestimmt in voller Panik. Aber ich wusste einfach nicht, wo ich ihn unterbringen sollte. In unserer Familie und im Freundeskreis gibt es weit und breit niemanden, der Zeit für einen Hund übrig hätte. Und Hundepension kam für mich nicht in Frage. Ist ja eigentlich auch kein Problem. Opa Paul mag Hunde, er hat selbst welche. Vielleicht doch ein Problem? … Ich steuere auf ihn zu und er breitet höchst peinlich seine Arme aus und quetscht mich an sich.
»Na endlich!«, sagt er dazu.
»Hatten wir Verspätung?«
»So ungefähr sechzehn Jahre«, schätzt Paul. Er hält Tramp die Hand zum Schnuppern hin, strahlt mich dann wieder an.
»Warum hast du deine Schwestern nicht mitgebracht?«
»Die … ach, die haben … die sind … beschäftigt.«
(»Zu Paul? Wieso das denn, spinnst du? Du kennst ihn doch gar nicht. Außerdem kannst du doch nicht ausgerechnet jetzt … Wo doch gerade … das ist deine Chance! … Wie kann man so doof sein …«)
»Wie geht es deinem Vater?«
»Gut. Er lässt dich grüßen.«
(»Sag dem alten Sturkopf … nein, sag ihm lieber … ach, sag, was du willst. Oder sag gar nichts. Er kann es sich ja denken.«)
»Und deine Mutter?«
»Alles o.k.«
(»Ich verbiete es dir natürlich nicht. Ich verbiete dir nichts, was dir eine Lehre sein kann, das weißt du. Du kannst mich jederzeit anrufen, wir buchen dein Ticket um und du kommst zurück. Ich würde es dir ja ausreden, aber ich weiß, wie stur du bist. Du musst deine Erfahrungen offenbar selber machen. Irgendwann wirst du wieder vernünftig. Ich weiß nicht, woher das bei dir kommt, wenn ich an deine Schwestern denke … Vielleicht ist es ganz gut, wenn du mal mit Abstand …blablabla … aber ausgerechnet Paul … blablabla …«)
Paul fragt nicht weiter. Er nimmt mir meinen Koffer ab und zieht ihn zum Parkplatz. Die Sonne brutzelt fast senkrecht auf uns herunter. Mit der Fernbedienung öffnet mein Großvater die Verriegelung eines weißen Kastenwagens, in dessen Laderaum mein Gepäck verschwindet. Tramp, der nach dem Schock der Reise allmählich wieder zu sich kommt, schnuppert interessiert hinterher und steigt nur sehr unwillig mit mir auf den langweiligen Vordersitz.
Paul lässt den Motor an und fährt rückwärts vom Parkplatz.
»Gleich wird es kühler«, verspricht er. »Klimaanlage.«
»Ist schon o.k.«
Er wirft mir einen prüfenden Blick zu.
»Entschuldige, dass ich gleich mit der Tür ins Haus falle, aber ich bin schon ein bisschen neugierig. So richtig schlau geworden bin ich aus deiner letzten Mail ja nicht. Zoff mit deiner Familie? Mit der Schule auch? Und irgendwas mit Musik?«
Erwartet er, dass ich jetzt im Auto gleich die große Beichte oder was auch immer ablege? Wenigstens fährt er während des Fragens weiter, biegt auf eine große Straße ein. Die Berge stehen kahl, wüstenhaft im Norden, die wenigen Pflanzen wirken durstig und staubig. Ich kann das Meer sehen, eine tiefblaue Fläche, und öde Siedlungen, Hotels vielleicht. Alles wirkt erschreckend trostlos und ich drücke mich tief in meinen Autositz. Ein bisschen freundlicher, üppiger hatte ich mir meine Fluchtinsel vorgestellt.
»Wir fahren nach Norden«, sagt Paul, als hätte er meine Gedanken gelesen. »Da sieht es ganz anders aus. Tropischer. Obwohl auch bei uns jetzt alles sehr trocken ist.«
»Ist schon okay.«
Eine Weile fahren wir schweigend. Die Autobahn verläuft an der Küste entlang. Das Meer ist mit Schaumkronen gesprenkelt, Staub liegt in der Luft. Links in Richtung der hohen Berge tauchen jetzt Felder auf, die mit Plastikplanen überzogen sind.
»Bananen«, sagt Opa Paul. »Plastik spart Wasser.«
»Und macht die Landschaft kaputt.«
»Und wie.« Er seufzt, setzt zum Überholen eines Lastwagens an, der bedenklich schlingert. »Luisa freut sich übrigens schon sehr darauf, dich kennenzulernen! Sie war schon ganz aufgeregt, weil sie nicht wusste, was sie für dich kochen soll. Stimmt doch, dass du kein Fleisch isst?«
»Stimmt.«
»Und keinen Fisch?«
»Nein.«
»Ein Jammer.« Paul schüttelt den Kopf. »Na, hier wächst ja viel Gemüse und Obst. Und Tortillas kannst du essen. Eierpfannkuchen mit Kartoffeln.«
Ich verkneife mir die Erklärung, dass ich eigentlich auch keine Eier mehr esse. Okay, dass es mit der veganen Ernährung hier nicht ganz einfach werden würde, war mir klar. Ich muss eben ein paar Abstriche machen, solange ich hier bin. Sonst gehe ich meinem Großvater auf die Nerven, bevor er mich überhaupt kennengelernt hat. Vielleicht sind die Hühner hier glücklich und ihre Eier deswegen akzeptabel.
Wir reden nichts mehr, bis wir von der Autobahn nach Westen abbiegen, in die Berge. Allmählich wird es grüner um uns herum. Ich atme auf. Die Straße schraubt sich höher hinauf durch Gärten und Wälder. Dann geht es über eine kaum noch gepflasterte Schlaglochpiste. Wir erreichen ein kleines Dorf mit weißen, flachen Häusern: Santa Catalina.
»Da vorne ist es.«
Opa Pauls Haus sieht viel kleiner aus als erwartet. Es hat kalkweiße Wände und ein rotes Ziegeldach, kleine Fenster und eine große Terrasse aus dunklen Holzbrettern. Hühner scharren auf dem Grundstück, eine schwarzbraune Katze liegt auf der Mauer und drei Hunde, alle ungefähr gleich groß, aber mit unterschiedlichen Frisuren, stürzen uns kläffend entgegen. Tramp stellt sich auf meinem Schoß auf und spitzt die Ohren, so gut es geht.
Die Tür geht auf und eine Frau erscheint und ruft die Hunde zurück.
»Luisa«, sagt Opa Paul.
Ich starre die Frau an. Sie hat so überhaupt keine Ähnlichkeit mit dem Bild, das man mir vermittelt hat.
(»So ein Luder, das sich nur für Pauls Geld interessiert …«)
(»Ein Bauernmädchen, die beiden haben doch nichts gemeinsam …«)
(»Was sollte sie denn an dem Alten finden, wenn nicht das Geld …?«)
Sie sieht … nun ja, sie sieht wie eine ganz normale Frau Mitte, Ende fünfzig aus. Halblange dunkle, von grauen Strähnen durchzogene Haare, moderne Brille, dezentes Make-up … aber vor allem: strahlendes Lächeln.
Schon steht sie neben dem Wagen, öffnet mir die Tür. »Willkommen! Herzlich willkommen!« Sie drückt mich, küsst mich auf die Wange. Ich hänge ein bisschen steif in ihren Armen. Sie lässt mich los und drückt stattdessen Paul. »Mi amor«, sagt sie dazu.
Ich konzentriere mich auf Tramp, der noch im Auto sitzt und misstrauisch die drei Revierbesitzer beäugt, die sich nun hechelnd im Schatten des Vordachs niedergelassen haben. Ich packe ihn am Halsband und ziehe, aber er sträubt sich. Seufzend nehme ich ihn auf den Arm. Die drei Hunde setzen sich auf, stellen die Ohren. Ich setze Tramp auf den Boden, er versucht panisch, wieder auf meinen Arm zu krabbeln. Einer der drei Hunde erhebt sich und kommt auf uns zu. Tramp schmeißt sich auf den Boden, dreht sich auf den Rücken. Okay, er ist nicht zum Helden geboren. Die anderen drei nähern sich steifbeinig und beschnuppern ihn. Wir drei Menschen sehen gebannt zu. Eine schaulustige braun-weiße Ziege reckt die Nase über den Zaun. Opas Hunde beschnuppern Tramps Bauch sehr ausführlich, dann wenden sie sich ab und verziehen sich wieder in den Schatten. Tramp bleibt vorsichtshalber noch eine Weile liegen, dann dreht er sich auf die Füße, steht auf, schüttelt sich Staub aus dem Fell und marschiert zu den Hunden hinüber, die sich nun nicht weiter um ihn kümmern.
»So weit, so gut«, sagt Opa Paul. »Komm ins Haus.«
»Du hast sicher Durst«, sagt Luisa. »Ich habe Ananassaft im Kühlschrank.« Ihr Deutsch ist zögernd, aber korrekt. Das hätte meine Familie dem »Bauernmädchen« sicher nicht zugetraut.
Kurz darauf sitze ich in der Küche, hinter dicken, kühlenden Lehmmauern, trinke eisgekühlten Saft, betrachte die sicherlich nicht veganen Gebäckkringel auf dem kleinen Teller, den mir Luisa zugeschoben hat, und warte darauf, dass sich das merkwürdige Schwindelgefühl legt, das ich nach jeder Flugreise eine Weile spüre.
»Hast du eigentlich zu Hause angerufen?«, fragt Paul, der gerade wieder zur Tür hereinkommt. Er hat sich jetzt einen zerfledderten Strohhut aufgesetzt.
»Hab kein Handy.«
Er starrt mich eine Weile schweigend an, dann zuckt er mit den Schultern.
»Nimm meins.« Er zieht sein Telefon aus der Hosentasche und reicht es mir. Ich zögere, aber dann wähle ich die Nummer meines Vaters.
»Ja?«
Er klingt nicht wie sonst, es ist kein »Ist-was-Dringendes-sonst-stör-mich-nicht-Ja«, er klingt eher besorgt.
»Ich bin’s. Franziska. Wollte nur sagen, dass ich gut angekommen bin.«
»Gut. Da bin ich froh. Mit Tramp auch alles okay?«
»Alles okay.« Ich zögere. »Das ist Pauls Telefon. Willst du ihn sprechen?«
»Nein. Nein, jetzt nicht.« Jetzt wird mein Vater doch wieder hektisch. »Hast du dich bei deiner Mutter gemeldet?«
»Noch nicht. Sagst du ihr Bescheid?«
»Ja … ja, gut. Ruf aber wieder an.«
»Mach ich. Tschüs.«
»Tschüs, mein Schatz.«
Ich lege das Telefon auf den Tisch.
Opa fragt nicht nach.
Mein Zimmer hinten in der Pension ist wunderbar, groß, hell, mit fröhlichen Bildern an der Wand und hellblau gemusterter Bettwäsche. An der Decke hängt ein Ventilator, den Luisa sofort einschaltet. Er quietscht und brummt und rührt geduldig die Sommerluft um. Ich habe sogar ein kleines eigenes Bad. Als ich meinen Koffer auspacke, fühle ich mich sehr erwachsen und auch ein bisschen verlassen. Wenn ich noch ein Handy hätte, könnte ich meine Freundinnen anfunken, Stummel auf jeden Fall, vielleicht sogar Lory, obwohl ich eigentlich nichts mehr mit ihr zu tun habe. Aber ich habe kein Handy dabei.
»Du bist nicht schuld«, sage ich zu Tramp, der gerade probeweise in einen bunt gescheckten Flickenteppich beißt. »Du hast mein Handy damals ja nicht gefressen. Das war übrigens glatte Befehlsverweigerung.«
Er wedelt mit dem Schwanz.
Ob er sich erinnert?
Einige Monate zuvor (April)
1.
Ich liege auf meinem Bett und halte Tramp, der erwartungsvoll davorsitzt, auffordernd mein Handy hin.
Folgsam nimmt er es in die Schnauze, bleibt so sitzen, den Kopf jetzt gesenkt, ratlos.
»Jetzt beiß schon drauf«, ermuntere ich ihn. »Los, kräftig!«
Jetzt wird er ganz starr. Ich bin für ihn einmal mehr unbegreiflich geworden. Einen Moment lang glaube ich, er wird tatsächlich zubeißen und ich bin mein Telefon los, kann nur hoffen, dass dessen Innereien nicht ähnlich giftig sind wie die eines japanischen Kugelfischs (tödlich!). In diesem Moment des Abwartens, des Zweifelns durchläuft mich ein Schauer: Spannung, Hoffnung, Befürchtung, Erleichterung.
Tramp lässt das Telefon auf den Teppichboden fallen, leckt sich enttäuscht die Schnauze. Mein Handy liegt da, intakt, vollgesabbert, aufdringlich.
»Feigling«, sage ich zu Tramp. Er wedelt ein bisschen mit dem Schwanz. Dabei weiß ich: Hier im Raum gibt es nur einen Feigling, und der bin ich, ich ganz allein.
»Ich schmier’s dir mit Leberwurst ein«, schlage ich vor. Er grunzt nur.
Ich seufze, angle nach meinem Telefon, mit zwei Fingern, wische es mit einem Papiertaschentuch einigermaßen sauber. Währenddessen piept und vibriert es zweimal. Hätte jemand eine Nachricht geschickt, während das Telefon in Tramps Schnauze steckte, dann hätte er womöglich doch zugebissen, vor Schreck oder in der Annahme, das tote Ding in seinem Maul sei mit einem Mal lebendig, gefährlich oder wenigstens genießbar geworden.
Schritte nähern sich meiner Tür. Es klopft vorsichtig.
»Kommst du?«, fragt mein Vater, ohne die Tür zu öffnen.
Es ist einer seiner leicht getarnten Befehle mit dem beinahe unsichtbaren Fragezeichen dahinter. Mir einfach zu befehlen: »Komm jetzt!«, das würde seinem Selbstbild widersprechen: Er ist doch ein kumpelhafter, verständnisvoller Vater, im Herzen so jung wie seine eigenen Kinder, von diesen aber dennoch geachtet und geliebt. Er hätte sagen können: »Komm jetzt, sofort, ohne Widerrede, und gefälligst mit einem Lächeln!« Aber das würde er nie tun.
Weil ich nicht reagiere, öffnet er die Tür doch, einen Spalt wenigstens. Ich wende langsam den Kopf und sehe ihn an, versuche, ihm so lange in die Augen zu gucken, bis sein linkes Lid zuckt, aber er macht das Spiel heute nicht mit, wendet den Blick auf seine Armbanduhr.
»Wir müssen los.«
Mein Telefon piept und brummt. Mein Vater runzelt die Stirn.
»WhatsApp«, sage ich knapp, beachte die Nachricht aber nicht. Mein Vater beobachtet mich wortlos, als ich mich im Zeitlupentempo aufrapple. Erst als ich mit den Fußspitzen nach meinen Lieblingsschuhen angle, reagiert er wieder.
»Mit diesen Schuhen aber doch nicht!«
Ich kümmere mich gar nicht um seinen Kommentar. Wenn meine Schwester mich in meinen Super-Bequem-Chucks nicht zur Tür hereinlässt, dann bleibe ich eben draußen, gehe einfach ein bisschen in der Stadt spazieren, kaufe mir irgendwo ein Falafel oder eine Butterbrezel und beobachte, wie Hunde ihre Menschen an der Leine herumzerren. Sektempfang! Carla ist gerade mal vierundzwanzig Jahre alt! Dass sie jetzt ihre hoch bezahlte Superstelle mit Aufstiegschancen bis in den siebten Managerhimmel bekommen hat, überrascht niemanden wirklich. Ihr Weg führte schon immer schnurgerade auf das Ziel zu. Carla hat einen auffällig langen, sehr geraden Hals, vielleicht deswegen, weil sie nicht nach links und rechts guckt. Sie konnte sich schon als Dreizehnjährige ein dickes Buch auf den Kopf legen und einfach losmarschieren, ohne dass es ins Rutschen geraten wäre. Ich dagegen ähnle – was meine Kopfbewegungen angeht – eher einem Faultier. Ich drehe meinen Kopf wissbegierig in alle Richtungen, auch nach hinten, und vergesse dabei, dass ich mich eigentlich auch noch ein bisschen vorwärtsbewegen könnte. Ich bin nicht so träge wie ein Faultier, das nun nicht. Dafür ist auf der Welt viel zu viel los, was ich sehen möchte.
Ich gehe aus dem Zimmer. Mein Handy lasse ich absichtlich auf dem Tisch liegen. Tramp hat schon kapiert, dass er nicht mitdarf, er steht noch nicht einmal auf, folgt mir nur mit seinem allertraurigsten Du-verlässt-mich-ja-sowieso-Blick. An der Haustür halte ich an, drehe mich noch einmal um, renne zurück und hole dieses blöde Telefon doch noch, stecke es rasch in meine Jackentasche wie Diebesgut, das man im nächsten Augenblick doch lieber nicht an sich genommen hätte.
Als ich mit den Chucks ins Auto steige, schüttelt meine Mutter, die mir kritisch entgegengeblickt hat, gequält den Kopf.
»Muss das sein? Diese alten Treter?«
»Ja.«
»Und die Tasche?« Sie deutet auf meinen abgewetzten Lederrucksack, den ich sehr liebe.
»Was ist mit der?«
»Such dir was anderes. Du kannst dir eine von meinen Handtaschen nehmen. Eine, die zu deiner Jacke passt.«
Aber ich schüttle voller Verachtung den Kopf.
Handtaschen, Schuhe. Andere Sorgen haben die nicht, oder?
Klar, die Welt hat ja auch gar keine ernsthaften Probleme.
Außer dass ganz Syrien gerade in Schutt und Asche gelegt wird. Dass in China ein Bergwerk eingestürzt ist und Dutzende Menschen verschüttet wurden. Dass das letzte weiße Nashorn in Afrika von einer Leibgarde gegen Wilderer geschützt werden muss. Dass die italienische Mafia Schiffe mit radioaktivem Abfall im Mittelmeer versenkt hat. Dass wir demnächst nur noch gentechnisch veränderte Lebensmittel zu essen kriegen …
Ob meine Eltern mit fünfzehn auch schon so waren? Oberflächlich, angepasst?
Beinahe hätte ich sie gefragt, aber ich verkneife es mir. Ich habe keine Lust auf Diskussionen darüber, warum gerade ich, das jüngste der drei Lehmann-Küken, so aus der Art geschlagen bin. Meine Eltern können sich trösten: Wenigstens meine beiden älteren Schwestern sind gut gelungen, geradezu optimal. Carla mit ihrem Superjob und Fiona mit ihrem Stipendium in Berkeley, California, auf dem Weg zur Elite der Wissenschaften.
Ich entscheide mich für ein anderes Thema.
»Kann ich Tramp nicht doch mitnehmen?«, frage ich und lächle dabei so charmant wie möglich.
Meine Mutter schüttelt nur den Kopf, ohne mich anzusehen.
Mir war klar, dass ich meinen Hund nicht zum Sektempfang mitnehmen darf. Dabei ist Tramp wirklich unkompliziert, besser erzogen als wir alle zusammen, er haart im Moment nicht besonders stark und liebt Fingerfood. Dürfte ich ihn mitnehmen, wäre wenigstens ein vernünftiges Wesen im Raum, mit dem ich mich unterhalten könnte. Außerdem hätte ich so einen überzeugenden Grund, mich nach den Anstandsküsschen links-rechts, einer ergreifenden Rede von meinem Vater (sein linkes Augenlid wird zucken) und einer Viertelstunde allgemeinem Small Talk davonzustehlen.
Kein Tramp. Ich ergebe mich in mein Schicksal, ziehe mir den Sicherheitsgurt über die Schulter und stöpsle den Kopfhörer an mein Telefon. Meine Mutter steigt auf der Fahrerseite ein und wirft einen nervösen Blick in den Rückspiegel.
»Alle an Bord«, sagt mein Vater. »Wir können abheben.«
Ein Spruch, den wir vor geschätzten fünfzig Jahren alle mal ganz witzig fanden. Aber mein Vater meint es gut. Er wäre so gerne locker, der arme Kerl. Ich betrachte seine angespannten Schultern, als er sich im Beifahrersitz zurücklehnt.
Meine Mutter startet den Motor, unser Auto rollt langsam aus der Ausfahrt auf die Straße, dann bergab. Wir wohnen in einem der besseren Viertel dieser Stadt, wenn auch nicht im richtigen Nobelviertel. Es liegt am Stadtrand, etwas erhöht, sodass wir von der Terrasse aus über das graue Häusermeer sehen können und bei gutem Wetter sogar erkennen, dass drüben auf der anderen Seite der Stadt ebenfalls wieder blaue Hügel aufragen. Meine Eltern sind Leute, die es geschafft haben – das bedeutet: die ordentlich Geld gemacht haben. Mein Vater hat schon früh die kleine Firma seines Vaters übernommen und vor dem Untergang gerettet. Meine Mutter ist Immobilienmaklerin: Wenn jemand ein Haus kaufen will, zeigt sie ihm eins und zieht ihm dafür eine unverschämte Summe aus der Tasche. Je teurer das Haus, desto mehr muss der Kunde bezahlen. Ich finde das unlogisch und auch nicht ganz ehrenhaft und streite mich über dieses Thema gern und regelmäßig mit meiner Mutter und meinen Schwestern. Meine Mutter hält in Vierteln wie dem unseren mit Adleraugen nach leer stehenden Immobilien Ausschau. Jetzt dreht sie sich halb zu mir um und sagt irgendetwas, ich ziehe die Ohrstöpsel heraus und sehe sie fragend an.
»In der rosa Villa hinten beim Spielplatz habe ich lange niemanden gesehen«, wiederholt sie. »Ich glaube fast, da wohnt keiner mehr.«
Ich zucke mit den Achseln. Sie wendet sich wieder ganz nach vorne.
»Achte mal drauf«, sagt sie. Ich kehre zurück zu meiner Musik. Wenn es keine Musik gäbe, würde ich es nicht aushalten. Ich weiß nicht, was die Leute früher gemacht haben, als es noch keine Kopfhörer gab. Sie hatten keine andere Wahl, als sich ununterbrochen das Gerede von nervigen Leuten, Eltern zum Beispiel, anzuhören. Also, manchmal bin ich schon froh, dass ich im neuen Jahrtausend geboren bin.
Das Telefon piept und vibriert. WhatsApp von Lory. »Ben und Moni gestern im Red River gesehen. Traumpaar. Widerlich.«
Jetzt sind wir unten, fädeln uns in die Durchgangsstraße ein. Meine Schwester Carla und Boris, ihr Freund, haben ein Loft in der Innenstadt gemietet, in einem dieser hohen Türme, ziemlich weit oben.
Meine Mutter fängt an zu summen. Ich höre das durch meine eigene Musik hindurch. Es ist ein hohes, durchdringendes Sirren, eine Melodie, die ich irgendwoher kenne, aber nicht einordnen kann. Meine Mutter sirrt nur, wenn alle ihre Pläne aufgegangen sind.
Ich lehne mich vor.
»Mir wird schlecht«, sage ich.
Das Sirren bricht ab, meine Mutter wirft einen entnervten Blick in den Rückspiegel. Mein Vater wendet sich zu mir um.
»Warum sollte dir schlecht werden?«, fragt meine Mutter scharf. »Ich fahre wirklich nicht schnell.«
Ich zucke mit den Schultern und gucke leidend.
»Soll ich anhalten?«, fragt meine Mutter etwas sanfter.
»Nein, ist schon gut.«
»Entspann dich«, sagt mein Vater, als würde ausgerechnet er auch nur das Geringste von Entspannung verstehen.
Mir wird überhaupt nicht schlecht, jedenfalls nicht im Magen, nicht so, als ob ich mich jeden Moment übergeben müsste. Es ist mehr so ein schwummeriges Gefühl, das von den Füßen her aufsteigt, ein Schwindel, als würde jeder Muskel, jedes Gelenk, jedes Organ jetzt gerne etwas ganz anderes tun, als es gerade tun muss. Meine Füße, Beine würden gerne laufen. Meine Hände, meine Arme würden gerne etwas schleudern, eine Frisbeescheibe für Tramp zum Beispiel, er würde mit einem Satz in die Höhe springen und sie sich schnappen.
Hoffentlich fängt meine Mutter nicht gleich wieder an zu sirren. Ich kann dann für nichts mehr garantieren.
»Du bist blass«, stellt meine Mutter mit einem weiteren Blick in den Rückspiegel fest. »Kriegst du deine Tage?«
Mein Vater zieht leicht den Kopf ein, aber er protestiert nicht. Ich selbst ignoriere diese völlig indiskutable, peinliche Frage einfach und sehe aus dem Fenster. Wie die Leute, die hier unterwegs sind, sich wohl mit fünfzehn ihr Leben vorgestellt haben? Hatte diese Vorstellung auch nur geringe Ähnlichkeit mit dem, was nun herausgekommen ist? Waren sie alle wie meine beiden untadeligen Schwestern, wussten immer genau, was sie wollten, steuerten unbeirrt darauf zu? Nannten ihre Familien das »Erfolg« und richteten ihnen Sektempfänge aus?
»Wo parken wir?«, fragt mein Vater.
»Um diese Zeit wird es schon was geben.« Meine Mutter biegt in eine kleine Seitenstraße ab. »Achtet darauf, ob ihr eine Parklücke seht.«
Mein Vater entdeckt nach wenigen Augenblicken einen freien Parkplatz und meine Mutter quetscht das Auto unbekümmert hinein. Sie gehört eindeutig zu jenen Frauen, die super einparken können. Na klar – sie ist sich immer sicher, dass sie Platz findet, dass notfalls alle zur Seite rücken, wenn sie kommt. Ihren beiden älteren Töchtern hat sie dieses Selbstbewusstsein eins zu eins weitervermitteln können. Bei mir hat es aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt. Wahrscheinlich, weil ich immer zur Seite gerückt bin, wenn meine Schwestern sich in meiner Nähe niederlassen wollten.
Mein Vater steigt aus und klopft sich das Jackett sauber. Er dreht sich zu mir um: »Kommst du nicht mit?«
»Mir ist immer noch schlecht«, antworte ich.
Er runzelt die Stirn.
Meine Mutter nimmt ihren Blazer vom Rücksitz, schlüpft hinein, presst die Lippen aufeinander – Lippenstifttuning.
»Wir sind spät dran«, sagen die perfekten Lippen.
»Ich komme nach«, schlage ich vor. »Erst mal gehe ich ein paar Schritte.«
Meine Mutter sieht sich misstrauisch nach Mördern und Entführern um. »Hier?«
»Nur kurz.«
Eine Gruppe von jungen Leuten stolziert in Richtung Eingangstür. Hohe Absätze, makellose Frisuren, kleine, unter die Achsel gepresste Handtaschen.
»Ruf an, wenn was ist«, sagt mein Vater und schiebt meine Mutter in Richtung Tür. Ich nicke ihm dankbar zu. Meine Mutter macht ein unzufriedenes Gesicht, aber sie bringt offenbar nicht die Geduld für eine Diskussion mit mir auf. Mein Vater drückt schon auf die Klingel. Ich atme auf, als die beiden aus meinem Gesichtsfeld verschwinden.
Ich werfe einen Blick auf meinen limonenfarbenen Fitnesstracker am Armgelenk. Erst ein Lämpchen leuchtet auf. Ich bin meinem persönlichen Fitnessziel heute noch nicht besonders nahegekommen. Wenn ich jetzt eine Weile rasch gehe, dann schaffe ich das zweite Lämpchen vielleicht noch. Gestern habe ich es auch bis abends noch nicht geschafft und bin dann extra noch mal eine Runde joggen gegangen, als ich die Statistik auf dem Bildschirm gesehen habe. Ich will ja nicht völlig abschlaffen.
Auf dem Bürgersteig nähert sich ein Typ mit zwei Schäferhundmischlingen, der Glückliche. Ich hätte darauf bestehen müssen, Tramp mitzunehmen. Ich sehe ihn selten, seit die Schule noch mal so richtig angezogen hat und ich oft erst am späten Nachmittag nach Hause komme.
Die Mischlinge schnuppern an meiner Hose, der Typ guckt mich misstrauisch an, denkt bestimmt, ich kreische jetzt gleich und zeige ihn wegen Belästigung an, aber als ich lächle, lächelt er auch und geht weiter. Die Hunde reißen sich los und folgen ihm. Mein Telefon piept und vibriert. WhatsApp von Lisa. »Jetzt Burger essen, dann Fitnessstudio und alles wieder runter.« Ich mache das Telefon aus und stecke es in meinen Rucksack, sehe in den Himmel, grau, sehe die Straße hinunter, grau, packe mein Telefon wieder aus, schalte es ein, es leuchtet in allen Regenbogenfarben. Ich wende mich um und mustere das Haus, in dem meine Schwester ihren Erfolg feiert. Mein Telefon piept und brummt. »Kommst du? Mama.« Ich tippe »JA!« Ein kleiner Junge mit Eintracht-Mütze kommt auf seinem Roller angebrettert, bremst, starrt neidisch auf mein Telefon.
»Ich schenk’s dir«, sage ich, aber da beschleunigt er, wie er nur kann, und saust davon.
Der Gedanke gefällt mir.
»Hey!«, rufe ich ihm nach. »Im Ernst! Ich schenk’s dir!«
Aber er verschwindet schon um die Ecke.
»Selber schuld«, sage ich laut und stecke das Telefon wieder ein. Es piept und brummt. Ich kümmere mich nicht darum, sondern gehe weiter. Ein dämlicher Sektempfang dauert bestimmt eine Stunde. Ich muss mich überhaupt nicht beeilen. Ich könnte wirklich noch ein Falafel essen gehen, aber in dieser Edelgegend gibt es wahrscheinlich nicht mal einen orientalischen Imbiss, bestenfalls so einen modernen Laden, der Geschäftsleuten im Schlips Edelsüppchen in abenteuerlich geformten weißen Porzellanschalen serviert. Ich sehe eine Reihe von Geschäftsmännern vor mir, deren Schlipsenden in allerlei exotische Suppen tauchen, und muss grinsen.
Mein Telefon piept.
Mein Telefon piept gleich noch einmal.
»Mann«, sage ich halblaut.
»Kommst du? Mama!«
»Date mit Jason. Morgen. Cool!!!!«
Ich lege mein Handy auf eine halbhohe Mauer und gehe weiter, marschiere, ohne mich umzuwenden, bis zur nächsten Straßenecke. Mein Herz klopft ganz laut. Ich überquere die Seitenstraße, gehe weiter, renne fast.
Eilige Schritte hinter mir.
»Hallo! Hallo, junge Frau!«
Ich bleibe stehen.
»Hallo! Sie haben etwas vergessen!«
Ich drehe mich um. Der ältere Mann hinter mir trägt Schal und eine peinliche Häkelmütze, und er schwenkt mein Telefon, strahlt ganz glücklich und, verdammt noch mal, ich bin ihm dankbar. Ich bin ihm tatsächlich dankbar, dass er mir das Teil hinterherträgt, als hätte er mich im letzten Moment daran gehindert, von einer Brücke zu springen. Ich werde vielleicht sogar rot. Fehlt nur, dass ich ihm die Füße küsse. Ich nehme das Telefon an mich und stammle irgendwas Peinliches.
Wenn Ben das gesehen hätte! Er würde mich so verachten. Er würde seine coolen, perfekt gebogenen Augenbrauen einen halben Zentimeter nach oben ziehen, seine Augen hätten dieses distanzierte Glitzern, er würde wahrscheinlich sogar lächeln. »Ist doch okay«, würde er sagen, aber zwischen unseren Füßen würde sich ein Abgrund auftun, immer weiter aufklaffen, bis wir endgültig voneinander getrennt wären, für alle Zeiten. Für immer getrennt. Nicht dass wir zusammen wären. Wir sind bloß irgendwie – verbunden.
Und es ist auch nicht so, dass ich bloß wegen Ben auf die Idee gekommen bin, dass ich zum Beispiel gar kein Handy brauche. Dass ich ganz vieles nicht brauche und dass ich eigentlich ganz anders leben will. Ich spüre das schon lang, stelle schon lange Fragen, aber es war keiner da, mit dem ich darüber reden konnte. In mir krabbelt schon lange ein Tier herum, das bisher keinen Namen hatte. Ben ist einen Schritt weiter als ich. Er fühlt nicht nur das Tier in sich, sondern er tut etwas. Ich bewundere ihn dafür und bin trotzdem selbst zu schwach, bis jetzt.
Also doch Sektempfang.
Ich werfe einen Blick auf den Fitnesstracker an meinem Handgelenk. Jepp, das zweite Lämpchen ist angegangen. Nur noch sechzig Prozent trennen mich von meinem heutigen Fitnessziel. Ich werde nicht den Lift benutzen, sondern die Treppe. Wär doch gelacht.
Nur ist mir gar nicht zum Lachen.
Ich schiebe die Hände in die Jackentaschen und stapfe entschlossen auf das Gebäude zu, in dem meine Familie gerade den großen Erfolg feiert, trage meinen eigenen, kleinen, miesen, feigen Misserfolg mit mir, immer noch mein Telefon, in regelmäßigen Abständen piepsend und brummend, in meinem abgewetzten Rucksack, als wäre es über eine lebenswichtige Blutbahn mit mir verbunden, eine Ader, die nicht durchtrennt werden kann. Der Organismus würde einfach zusammenbrechen.
2.
Manchmal sitze ich einfach nur so da.
So als gäbe es überhaupt nichts zu tun. Als würde die Zeit anhalten. Aber sie hält nicht an, nicht wegen mir. Sie dreht sich einfach weiter und alles, alle ziehen an mir vorbei, ich bleibe zurück, versinke hinter dem Horizont und keiner wird sich mehr an mich erinnern, das geht ganz schnell. Und trotzdem tue ich es. Trotzdem setze ich mich auf diesen Baumstumpf, sehe Tramp beim Spielen zu und träume vor mich hin.
Es ist eigentlich erschreckend, dass man es im Wachzustand schafft, sich selbst zurückzulassen, sich einfach wegzuträumen. Jedesmal, wenn ich das tue, kehre ich mit einer neuen Frage zu mir zurück, einer unbequemen Frage, einem Vorwurf an mich selbst, so als würde ich etwas falsch machen, als würde ich womöglich alles falsch machen.
Aber ich mache doch nicht alles falsch. Ich mache doch genau das, was alle tun, weil es so getan werden muss, wenn man einmal etwas erreichen will. Ich will doch auf jeden Fall etwas erreichen, wenn ich auch noch nicht weiß, was das sein soll. Erfolg fällt einem nicht einfach in den Schoß, das sagen meine Eltern und auch meine beiden Schwestern, die ganz anders sind als ich, aber immerhin mehr Erfahrung haben. Denk nicht so viel nach, sagen sie, du musst dein Ziel im Auge behalten. Dein Ziel, falls du das noch nicht kapiert hast, ist Schulabschluss, Berufsausbildung, Karriere, Geld, Auto, Haus, natürlich der passende Partner dazu, aber das kommt dann von alleine. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mir dieses Ziel selbst gesetzt habe, aber alle reden davon, als gäbe es gar kein anderes. Vielleicht haben sie ja recht.
Leider ist es so: Wenn ich beispielsweise auf diesem Baumstumpf sitze und Tramp beim Spielen zusehe, beschleicht mich das unbequeme Gefühl, dass das, was mir da vorgehalten wird, womöglich gar nicht mein Ziel ist. Normalerweise springe ich in so einem Moment sofort auf, rufe Tramp und renne los, um dieses Gefühl ganz schnell hinter mir zurückzulassen, weit hinter mir, dort am Baumstumpf. Ich atme gleichmäßig, konzentriert, achte nur auf das rhythmische Geräusch meiner Sohlen auf dem Pflaster.
Ich renne an der alten Frau vorbei, die in den Mülltonnen nach Pfandflaschen sucht. Ich renne an dem Obdachlosen vorbei, der unter der Blutbuche seinen Rausch ausschläft. Ich renne an der Mauer vorbei, die Jugendliche wieder vollgesprüht haben (Attac, Refugees Welcome, Free Tibet!). Ich renne an den beiden jungen Frauen vorbei, die mit Unterschriftenlisten gegen Tierversuche, gegen Fracking, gegen die Privatisierung des Wassers an die Passanten herantreten, an den Zeitungsständern, die mir Schlagzeilen entgegenschleudern: »Massaker in …«, »Lage in … spitzt sich zu …«. Ich renne und renne, als würde ich mich in einer ganz anderen, mir eigenen Welt befinden, denn das alles hat mit meinem Leben nichts zu tun, dafür ist kein Platz, und wenn ich zögern oder gar ausscheren sollte, dann werde ich von all den anderen überrannt und überrollt, die nur darauf warten, meinen Platz auf der Erfolgsseite einzunehmen. Ich muss immer auf der Hut sein, immer aufpassen, dass ich meinen Platz nicht verliere. Ich kann es schaffen, so wie meine Schwestern es geschafft haben. Ich muss nur wollen. (Kann man wollen müssen?) So schlimm war der dämliche Sektempfang gestern doch gar nicht, oder? Die anwesenden Menschen waren zwar zu 98 Prozent widerliche, aalglatte Geschäftstypen und die Musik ein ödes, belangloses Pianogeplinker; das Fingerfood war fade und viel zu wenig und die gedämpften Gespräche der Anwesenden sterbenslangweilig, aber das ist doch noch lange kein Grund, sich nicht wohlzufühlen, oder? Das ist doch noch kein Grund, am Erfolg zu zweifeln, oder? ODER?
Mein Hund hat einen Namenspaten, Alexander Supertramp. Der hieß in Wirklichkeit anders, Chris McCandless, aber er gab sich einen speziellen Namen, einen, der ihn frei machte, so frei, dass er sein ganzes Geld verbrannte, seine Kreditkarten zerschnitt, sein Auto in der Wüste stehen ließ und einfach nur durch Amerika wanderte.
Ich finde das absolut bewundernswert.
Na gut, ich habe kaum Geld, das ich verbrennen könnte, keine Kreditkarten zum Zerschneiden und noch nicht mal einen Führerschein. Mit dem Fahrrad käme ich nicht bis in die Wüste. Außerdem darf man nicht vergessen, dass Supertramp später in Alaska elendig verhungert ist. Aber er war cool. Er hat alles hingeschmissen, ohne eine Szene zu machen. Beispielsweise hätte er gestern beim Sektempfang keine Gläser zerschmissen und nicht herumgepöbelt. Er hätte, wie ich, gelächelt, wäre höflich gewesen und wäre dann, anders als ich, einfach weggegangen, in die Wüste eben oder an einen anderen Ort, wo das alles aufhört.
Seit ich den Film über Alexander Supertramp gesehen habe, »Into the Wild«, muss ich immer an ihn denken, und irgendetwas piekt in mir, so als hätte ich eine Aufgabe, ein geheimes Einverständnis mit ihm und wäre deswegen verpflichtet, etwas Bestimmtes zu tun oder nicht zu tun. Was genau das ist – ich weiß es noch nicht.
Ich bin so früh an der Schule, dass ich Ben noch treffen kann. Er wollte mir »Into the Wild« als Buch ausleihen.
Es gibt nicht viele Möglichkeiten, mit Ben in Kontakt zu kommen, weil er eine Klasse über mir ist und weil er ja kein Handy hat. Wir kennen uns seit einigen Wochen, seit einer Sitzung für die Schülerzeitung, genauer genommen. Wir waren beide zum ersten Mal dabei, wollten uns die Sache ansehen und entscheiden, ob wir im Team einen Platz haben. Wir haben uns beide dagegenentschieden. Dennoch reden wir seit diesem Tag miteinander. Meine Freundinnen sind ein bisschen neidisch, denn Ben sieht gut aus und gilt als »interessant«, wenn auch ein bisschen merkwürdig. In seiner Nähe halten sich immer sehr viele Mädchen auf.
Ich lungere bei den Fahrrädern herum. Meinen Fitnesstracker habe ich hastig abgenommen, Ben hat nie etwas darüber gesagt, aber ich wette, er findet diese Dinger völlig daneben. Fit ist er garantiert auch ohne Elektronik. In der Schule sind die Dinger sowieso zu nichts gut: Während des Unterrichts sitzt man nur herum und setzt Fett an und im Sportunterricht darf man sie nicht tragen.
Ich schlendere sehr langsam in Richtung Eingang, wobei ich versuche, jeden Blickkontakt mit Schülern aus meiner eigenen Klasse zu vermeiden. Nichts gegen Lory, Lisa, Fahra … aber ich kann die jetzt gerade überhaupt nicht gebrauchen. Endlich, als ich schon aufgeben will … mein Politiklehrer, der Waibel, kann Verspätungen überhaupt nicht leiden … saust Ben um die Kurve und knallt sein Fahrrad in den Ständer. Er schließt es nicht ab, sondern flitzt sofort auf die Treppe zu. Ich stelle mich so hin, dass er mich nicht übersehen kann, und er winkt mir zu.
»In der Pause!«, ruft er und rennt an mir vorbei. Ich komme mir ein bisschen dämlich vor, drehe mich um und trabe in meine Klasse.
Ben meint, dass man kein Handy braucht – Beweis: Tausende von Generationen menschlicher Wesen haben bereits ohne so ein Ding überlebt, sonst gäbe es uns heute nicht.
Aber er hat unrecht.
Ohne das Ding fehlt etwas.
Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich fühle mich, als würde ich auf dem Meer dahintreiben.
In der Schule wird mir jedenfalls ganz schlecht, und von Chemie kriege ich überhaupt nichts mit, kann nicht mal mitschreiben, hänge nur da rum, bis mich die Krawitzki ankeift, und danach schreibe ich auch nur jeden fünften Satz mit, es macht alles überhaupt keinen Sinn.
Ich fange an, eine Pflanze über die Seite in meinem Chemieheft zu zeichnen. Zunächst wächst sie noch ganz gerade aus dem Boden, aber dann verzweigt sie sich, verästelt sich über das ganze Blatt, und aus ihr sprießen zahlreiche Blätter und Knospen. Insekten krabbeln darauf herum, sogar ein kleiner Frosch gesellt sich dazu, und die letzte Formel, die ich gerade noch so aufgeschrieben habe, bildet das Zentrum einer gigantischen, offenen Blüte.
Wenn die Krawitzki das sieht, kriegt sie einen Anfall. Ich blättere schnell um und zwinge mich, nur noch anständige Buchstaben und Zahlen zu kritzeln.
Zehn Minuten vor Unterrichtsende stehe ich auf. In letzter Sekunde fällt mir ein, dass ich mich melden muss. Ich reiße noch schnell den Arm hoch. Die Krawitzki schleudert ein »Ja?« in meine Richtung.
»Entschuldigung … ich muss schnell …«
Sie wirft einen Blick auf die Klassenuhr (»die paar Minuten hätte sie ja noch durchhalten können …«), dann nickt sie. Ich renne in den Flur.
Ich wünschte, Ben würde zufällig gerade durch den Korridor schlendern, hätte vielleicht eine Freistunde und würde mich fragen, was Supertramp mit dem andauernden, lästigen Pieksen in mir, mit der Plastikwelt und meinem Handy zu tun hat, und vielleicht, vielleicht, vielleicht würde er mich dabei so ansehen, dass mir eine schlüssige, eindeutige Erklärung einfallen würde.