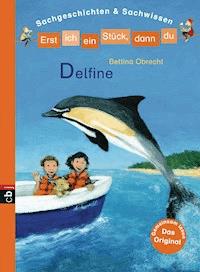2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Wenn die Schule zur Hölle wird ...
Jahrelang wurde Cedric gemobbt, mehrere Schulwechsel hat er hinter sich. Doch jetzt besucht er eine entfernte Stadtschule, hier kennt ihn niemand, hier scheint ein Neuanfang möglich. Dafür nimmt Cedric sogar die Trennung von seiner Familie in Kauf. Doch als der Schul- Liebling Lars ihn zum Spaß »Opfer« nennt, brennen bei Cedric die Sicherungen durch und die Vergangenheit holt ihn ein - gnadenlos. Nur die zurückhaltende Sinja hält noch zu ihm. Werden die beiden es schaffen, dem »Opferland« endlich zu entfliehen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
DIE AutorIN
© Isabelle Grubert
Bettina Obrecht wurde 1964 in Lörrach geboren und studierte Englisch und Spanisch. Sie arbeitet als Autorin, Übersetzerin und Rundfunkredakteurin und wurde für ihre Kurzprosa und Lyrik mehrfach ausgezeichnet. Seit 1994 schreibt sie Kinder- und Jugendbücher und hat sich seitdem in die »Garde wichtiger Kinderbuchautorinnen hineingeschrieben« (Eselsohr).
Von Bettina Obrecht ist bei cbj erscheinen:
Zwilling verzweifelt gesucht (15808)
Die kleine Hexe Ida (22432)
Laurin, das Schlossgespenst (22474)
Erst ich ein Stück, dann du – Delfine (15484)
Mein erster Schultag und der Eisbär-Schreck (22171)
Bettina Obrecht
OPFERLAND
Wenn die anderen dich kaputt machen
Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Verlagsgruppe Random House
1. Auflage
Erstmals als cbj Taschenbuch November 2014
© 2012 cbj Verlag, München
in der Verlagsgruppe Random House, München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Thinkstock/sushkonastya
CK · Herstellung: ReD
Satz: Buch-Werkstatt, Bad Aibling
Pößneck
ISBN 978-3-641-14237-7
www.cbj-verlag.de
1. Der kleine Lord haut dem Prinzen in die Fresse
Nein! Ich werde diese Rolle nicht spielen, niemals!
Warum denn ich?
Ausgerechnet ich?
Hört bloß auf, das kann doch kein Zufall sein.
Ihr macht mir nichts vor.
Geht das denn immer weiter? Wer hat Charly auf diese Idee gebracht? Keiner meiner Mitschüler, kein Lehrer weiß davon, keinem habe ich davon erzählt, ich war einer von ihnen, habe mich nie auffällig benommen, kleide mich wie sie, rede wie sie und schweige wie sie. Schweigen kann ich besonders gut – vielleicht zu gut. Das ist eine der Fähigkeiten, die ich mir in den letzten Jahren angeeignet habe. Es ist ganz leicht, etwas Falsches zu sagen, schweigen dagegen geht fast immer. Sinja behauptet, dass Schweigen keine Garantie ist. Auch wer schweigt, kann etwas Falsches machen. Man kann im falschen Moment schweigen oder einfach nur zu lange.
Sinja redet selbst nicht viel, nur manchmal, wenn die Sterne richtig stehen, im Radio ihre Lieblingslieder gespielt werden, ein besonders bunt gefärbtes Ahornblatt vor ihren Füßen dahinwirbelt, kurz, wenn sie einen dieser seltenen makellos guten Tage erlebt. An so einem Tag kann sie sogar so viel reden, dass jeder Sportmoderator blassgrün vor Neid würde. Aber das ist nicht Sinjas Normalzustand, überhaupt nicht. Im Gegenteil.
Weil sie normalerweise sehr wenig redet, ist sie der Ansicht, sie verstünde etwas vom Schweigen.
Sie denkt womöglich auch, sie verstünde etwas von mir.
Aber sie täuscht sich, sie weiß nicht wirklich, wer ich bin. Sie kennt zwar das eine oder andere Detail aus meinem Leben mehr als die Leute in meiner Klasse oder in der Theatergruppe, aber meine Geschichte kennt sie nicht und soll sie auch nicht kennen, denn ich habe diese Geschichte in eine Kiste gepackt und vergraben und werde niemandem jemals verraten, wo. Ich rede jetzt nicht von einer virtuellen Kiste, die es nur irgendwo in meiner Vorstellung gäbe, sondern von einer echten Blechkiste, in der unter anderem ein vollgekritzeltes Notizbuch ruht, von einer Kiste, die ungefähr einen Meter tief in der Erde vergraben liegt – tiefer bin ich mit dem Spaten leider nicht vorgestoßen –, die da unten auch bleiben soll für immer. Falls ich das Pech habe, dass ein zukünftiger Archäologe in ferner Zukunft mit seinem hypergalaktischen Metalldetektor auf meine Kiste stößt, ist das Papier vermutlich zerfallen – ich habe gelesen, Papier hält heutzutage nicht mehr lange, fünfzig Jahre oder so –, oder aber bis dahin ist kein lebendiges Wesen mehr in der Lage, unsere merkwürdige Schrift zu entziffern. Hallo, Herr Professor in ferner Zukunft! Ich gehe davon aus, unsere Wörterbücher haben sich zu Ihren Lebzeiten längst in Nichts aufgelöst. Nach ein paar Jahren oder nach nur einem elektromagnetischen Blitz in der richtigen Stärke sind die einfach verschwunden. Ach, in einer wunderbaren Zeit leben wir heute, sie ist besser als jede zuvor! Nichts wird mehr für die Ewigkeit festgehalten, alles existiert kurz, flackert auf und verschwindet dann im digitalen Nirwana, keiner wird sich jemals an all den ganzen Müll erinnern, der hier momentan geredet und aufgeschrieben wird, keine Zukunft muss sich davon beschmutzen lassen. Was für eine Erleichterung! Die alten Maya, die ihre Tagebücher noch in Stein meißeln mussten, werden sich ewig ärgern.
So gesehen hätte ich meine Geschichte sicherheitshalber erst gar nicht auf Papier schreiben sollen, sondern digital, hätte sie auf irgendeinen Stick speichern sollen, eine CD brennen, um sie loszuwerden. Aber man weiß ja, dass unsere Computer ständig ausspioniert werden, dass irgendein Agent garantiert mitliest, was du da gerade still und heimlich vor dich hin zu tippen glaubst, und das fehlt noch, dass ein künftiger Arbeitgeber von mir oder auch ein Mädchen, das mir gefällt, sich mit drei Klicks aus irgendeinem Archiv meine Geschichte herunterladen kann. Wäre so etwas möglich, dann würde es tatsächlich niemals aufhören. Niemals. Es würde immer so weitergehen, immer, immer weiter, selbst wenn ich nach China auswandern würde oder auf den Mond fliegen oder auf den Mars oder auf irgendeinen anderen Planeten, der vielleicht demnächst zur Neubesiedlung freigegeben wird, für alle, die es hier unten nicht mehr aushalten. Es würde immer weitergehen, bis ich sterbe, und selbst dann würde mich noch einer an meiner Beerdigung verächtlich den »Kleinen Lord« nennen, meine Urne umschubsen oder den anwesenden Beerdigungsgästen (sofern überhaupt welche kämen) irgendwelche Lügengeschichten über mich erzählen. Es gibt keinen Ausweg, nur mein Schweigen, und das hüte ich wie einen Schatz.
Man kann sogar reden, ohne das Schweigen zu brechen. Mit Sinja rede ich viel. Ich habe immer lieber mit Mädchen geredet, und glücklicherweise ist das in meinem Alter wieder okay, keiner macht sich mehr darüber lustig. Es kann natürlich sein, einer aus der Klasse oder aus der Film-AG versteht das falsch und schließt gleich daraus, dass Sinja und ich zusammen sind, aber das ist Quatsch und geht sowieso keinen etwas an.
Nein, von früher habe ich Sinja nie etwas erzählt. Sinja weiß rein gar nichts, sie kann also nicht dahinterstecken.
Das hier ist einfach ein böser Schlenker des Schicksals. Ein fieser Trick der statistischen Wahrscheinlichkeit. Ein Witz ist das, über den ich nicht lachen kann.
Ein Film zum Thema »Mobbing« und ich soll die Hauptrolle spielen. Soll ich jetzt lachen? Schreien? Weglaufen? Einfach umfallen? Meinen Therapeuten anrufen?
Sinja, die Ahnungslose, hat mich sogar begeistert in die Rippen geboxt. »Die Hauptrolle! Cool!«
Sie war es, die mich voriges Jahr zur Teilnahme an der Filmgruppe überredet hat, und anfangs bin ich eigentlich nur wegen ihr hingegangen, weil sie so glücklich war, mit so leuchtenden Augen davon erzählt hat, und natürlich weil sie mir etwas Wichtiges klargemacht hat: Ein Schauspieler kann sich aussuchen, wer er ist, sein echtes, eigentliches Leben ist überhaupt nicht mehr wichtig, keiner fragt danach. Wunderbar, was könnte mir gelegener kommen? Schauspielern habe ich ohnehin schon geübt. Als ich noch jünger war, habe ich mich lange geweigert, andere nachzuahmen. Da wollte ich immer nur ich selbst sein. Inzwischen sehe ich genau, dass die anderen ebenso schauspielern wie ich, es ist also nichts dabei, sich zu verstellen. Warum nicht gleich im Film?
Unser erster Film hatte ein ganz anderes Thema, eins von den Themen nämlich, die jeden Deutsch- oder Ethiklehrer freuen: Drogensucht. Er handelte von einem Mädchen, das an die falschen Leute gerät und von diesen mit Tabletten versorgt wird. Sinja hat das Mädchen gespielt, und wie sie es gespielt hat! Ich habe manchmal richtig Angst bekommen, wenn sie so weiß geschminkt mit schwarzen Schatten unter den Augen aus der Maske kam. Trotzdem hatten wir eine Menge Spaß mit dem Film und er ist dann auch gut ausgegangen. Charly, der Leiter unserer Gruppe, besteht nämlich darauf, dass die Filme gut ausgehen müssen, die Welt ist traurig genug, sagt er, das Happy End nehmen wir uns hier einfach heraus, weil wir es im richtigen Leben ja nicht so einfach bestimmen können. Dieses Happy End sah so aus: Das drogensüchtige Mädchen lernt einen netten Typen kennen, der sie von den Drogis wegholt. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann latschen sie noch heute Hand in Hand über die Bühne. Lars hat den netten Typen gespielt, der Sinja retten musste. Er hatte allerdings zu dem Zeitpunkt schon eine Freundin, die Sinja die Augen ausgekratzt hätte, wenn sie sich an Lars hätte vergreifen wollen. Sie, also die Freundin von Lars, war nach der ersten öffentlichen Aufführung unseres Films ziemlich schlecht gelaunt, gar nicht stolz auf ihren Typen, wie der es sich vielleicht erträumt hatte, ist wütend von dannen marschiert und dabei noch mit ihren Stöckelschuhen umgeknickt, das hat bestimmt wehgetan. Da war sie natürlich doppelt sauer, obwohl Lars für die lebensgefährlichen Schuhe nicht unbedingt verantwortlich war. Ich fand es ja eigentlich gut, dass Lars von ihr Ärger bekam – nein, er hat mir persönlich nichts getan, aber er bildet sich eindeutig etwas ein auf seine schöne Nase und sein schauspielerisches Talent. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er mit dem Mädchen nicht mehr zusammen ist, bestimmt hat sie ihn auf den Mond geschossen.
Lars ist das Gegenteil von einem Loser. Was ist das Gegenteil eines Losers überhaupt? Ein Winner? Ein Star? Die Nummer Eins? Einfach cool oder megacool? Jedenfalls steht er am anderen Ende der Skala. Dabei ist er auch nicht besser als ich, das weiß ich genau. Im Gegenteil. Er ist eitel. Ich bin wenigstens nicht eitel. Ich habe keinen Grund, eitel zu sein.
Was glänzt, hat kein eigenes Licht.*
Menschen, die nicht groß sind, machen sich gern breit.**
Ich mag Zitate und Sprichwörter. Schöner wäre es noch, wenn mir selbst in jeder Lebenslage knüppelharte weise Sprüche einfallen würden – dann könnte ich mir einbilden, ich wäre ein verkanntes Genie. Andererseits ist es auch beruhigend festzustellen, dass offenbar schon zu früheren Zeiten und an ganz anderen Orten Menschen ratlos im Leben herumstanden, versucht haben, sich einen Reim auf alles zu machen.
Lars ist jedenfalls einer, der glänzt, und wenn ich ihn glänzen sehe, sage ich mir zum Trost, dass er offenbar kein eigenes Licht hat, und daraufhin muss ich mich natürlich fragen, ob ich selbst denn wohl ein eigenes Licht habe, und wenn ja, wie hell es überhaupt leuchten kann. Bis jetzt ist da bestenfalls ein schwaches Flackern zu verzeichnen.
Lars könnte niemals einen Außenseiter spielen, ein Opfer. Dazu braucht es schon einen, der als Loser glaubhaft rüberkommt. Kein Wunder, dass sie auf mich kommen.
Es ist also immer noch da. Ich kann mir so viel Mühe geben, wie ich möchte, das Mal ist immer noch zu sehen.
»Nein, bestimmt nicht!« Ich schreie Charly beinahe an. »Mach ich nicht.«
Charly blinzelt dreimal verblüfft. Ich hab ihn noch nie angeblafft. Er trägt immer noch das breite Grinsen im Gesicht wie einer, der dir gerade was echt Gutes tun will, aber jetzt, während er meine Antwort verdaut, rutschen die Mundwinkel millimeterweise nach unten.
Lars schielt zu mir rüber. Hofft er, dass Charly ihm die Hauptrolle jetzt doch noch anbietet, wo ich mich so blöd anstelle? Vergiss es, Prinz Lars. Es gibt keine glänzenden Loser, weißt du das nicht? Loser sind matt und grau und farblos und klein und …
»Wir arbeiten das Skript erst aus«, sagt Charly langsam. Er sieht mir direkt in die Augen, während er spricht. »Du hast Einfluss auf die Rolle. Du kannst draus machen, was dir gefällt. Und dann entscheidest du.«
Einfluss? Seit wann hat ein Opfer Einfluss auf seine Rolle? Wie will Charly denn einen Film über Mobbing machen, wenn er überhaupt nicht den leisesten Schimmer hat, worum es geht? Einfluss! Was draus machen! Was stellt er sich vor? Hat er vielleicht ein »gutes Buch« gelesen? Wie bitte schön verwandelt man eine Loserrolle in eine Rolle, die man gerne spielen möchte? Nein, Charly hat keine Ahnung, wovon er spricht. Ich bin sicher, er ist einer von denen, die ihr Leben lang im Schatten der großmäuligen Alphasaurier dahintraben und stets friedlich grasen können, weil sie keinem im Weg stehen.
»Ist ein Scheißthema«, knurre ich. Ich versuche, cool zu wirken, aber meine Haut juckt überall, an den Armen, den Beinen, im Nacken, vor allem die Kopfhaut kribbelt, als würden sich meine Haare einzeln aufstellen.
Und da fällt mir Sinja in den Rücken. »Finde ich nicht«, sagt sie. »Das Thema betrifft doch viele. Mehr als man so denkt jedenfalls.«
»Na und?«, fauche ich wie ein Achtjähriger.
»Du bist aber mies drauf«, sagt Sinja und legt mir freundschaftlich die Hand auf die Schulter. »Jetzt warte doch mal ab. Vielleicht findest du’s ja doch gut.«
»Wir sollten lieber einen Film über Sport drehen«, plappere ich einfach so ins Blaue hinein.
»Was?« Sinja starrt mich an. Jetzt denkt sie bestimmt, ich habe endgültig den Verstand verloren. Ich hasse Sport, ehrlich. Ich werde nie verstehen, warum man sinnlos einem Ball hinterherrennen oder über dämliche Hindernisse springen soll oder so etwas. Ich fahre gerne mit dem Fahrrad irgendwohin, das schon. Ich schwimme gerne. Aber bitte ohne Trillerpfeife und Stoppuhr. Ich meine, man muss sich das Leben doch nicht unnötig erschweren. Ich habe kein Bedürfnis, mich mit anderen zu messen und zu vergleichen und dann unglücklich zu sein, wenn der Zeiger der Stoppuhr womöglich ein bisschen zu weit gekrochen ist, oder die Fahne auf Halbmast zu setzen, weil andere ihren Ball einmal mehr in ein Tor gekickt haben als meine Mannschaft. Früher mal habe ich versucht, das meinen Sportlehrern zu erklären, aber die meisten brüllen einfach nur, wenn man ihnen so kommt. Es widerspricht ihrem Weltbild. Ich meine, ist doch klar, sie verdienen ihr Geld damit, ein anderes Weltbild zu vertreten. Aber es gab mal eine Zeit, in der dachte ich, es ist richtig, immer zu sagen, was ich denke. Leider denke ich so oft Dinge, die den anderen – der Mehrheit – überhaupt nicht gefallen, die sie wütend machen. Also schweige ich jetzt und tue in Sport das Nötigste und kassiere ohne zu murren meine schlechte Note.
Kein Wunder also, dass Sinja meinen Alternativ-Vorschlag für ein Filmthema nicht ernst nehmen kann. Sie starrt mich mit gerunzelter Stirn an.
»Das betrifft viele«, sage ich ein bisschen boshaft. »Mehr als man denkt.«
Sinja blinzelt gekränkt und wendet den Blick ab.
»Überlegt es euch bis zum nächsten Mal.« Charly fährt sich mit der Hand durch die Haare. »Also, was diese Mobbinggeschichte angeht … ehrlich gesagt, ich hänge an der Idee …«
Ich habe es eilig, an die Garderobe zu kommen. Es ist nicht besonders kalt, aber ich fühle mich trotzdem wohler, wenn ich mir meinen Schal um den Hals geschlungen und die dicke Lederjacke übergezogen habe. Die Lederjacke ist ein Geschenk von einem Freund meines Vaters, Freddie. Freddie ist Harley-Fahrer, ein verrückter Typ, der beim Radio arbeitet, mehrmals im Jahr in die USA jettet und dort die Route 66 runterbraust. Ich übernachte die Woche über bei ihm und seiner Frau Sabine. Von daheim aus kann ich unmöglich jeden Tag die Schule erreichen.
Jedenfalls hat Freddie mir die Jacke geschenkt, weil er nicht mehr reinpasst, zu viel Bier und daher zu viel Bauch. Bikerjacken sind nicht so richtig cool, aber ich mag die hier. Sie ist mein Panzer, mein Außenskelett, keiner kann durchbeißen. Hoffentlich wachse ich nicht mehr so viel, sonst passt sie bald nicht mehr. Ich bin mit meiner Größe schon vollauf zufrieden. Guter Durchschnitt.
Ich habe gerade den Reißverschluss der Jacke hochgezogen, als Lars und Sinja ankommen. Sinja plaudert lächelnd mit Lars, ihrem glänzenden Retter. Ich schnappe mir meinen Rucksack, schwinge ihn über die Schulter.
»Da geht er hin«, sagt Lars zu Sinja und zeigt grinsend mit dem Finger auf mich. »Unser Opfer.« Er schlägt mir auf die Schulter. »Na, Opfer? Wie fühlt man sich als Loser?«
Das Nächste, was ich sehe, ist Blut an meinen Fingerknöcheln.
Es ist nicht mein Blut.
Lars liegt vor mir auf dem Boden, krümmt sich.
Blut strömt aus seiner Nase.
* Karl Heinrich Waggerl
** Friedl Beutelrock
2. Sinja
Sinja kniet neben Lars und tupft mit einem zerknüllten Tuch das Blut aus seinem Gesicht, ich hoffe bloß, es ist nicht ihr Schal, denn den habe ich ihr zum Geburtstag geschenkt. Sinja trägt den Schal oft, immer wenn er zu ihren anderen Klamotten passt, und ich bin jedes Mal ziemlich froh, wenn ich sehe, dass sie ihn anhat. Es hätte ja sein können, dass sie nichts tragen will, was von mir kommt, weil ich doch ein Loser bin – aber na gut, das weiß sie ja nicht.
Andere Schüler kommen in die Garderobe gelaufen, schließlich auch Charly. Große Aufregung, aber mich sieht keiner richtig an. Ich lehne mit dem Rücken an der kalten Wand und versuche, ruhig zu atmen. Mein Herz schlägt wie verrückt, meine Knöchel schmerzen. In meinem Kopf pulsiert irgendetwas.
Ich kann mich nicht bewegen, nicht sprechen.
Aber mich beachtet immer noch keiner. Alle kauern vor Lars, der sich jetzt aufgesetzt hat, sich mit dem Handrücken das Blut aus dem Gesicht wischt und die Hand dann anstarrt wie ein Gespenst. Hoffentlich habe ich ihm keinen Zahn ausgeschlagen.
Dann endlich dreht sich Sinja zu mir um. Ihre Augen funkeln. »Spinnst du?«, schreit sie.
Jetzt sehen mich alle an.
»Ich wollte das nicht«, krächze ich nur.
Charly hilft Lars auf die Beine. Lars klopft sich im Zeitlupentempo die Klamotten ab. Er sieht mich nicht an, aber Sinja durchbohrt mich mit Blicken.
»Ich wollte das nicht, echt«, wiederhole ich lahm. »Entschuldigung. Ich meine, echt, Entschuldigung.«
»Der hat doch einen an der Klatsche«, murmelt Lars undeutlich. Seine Oberlippe schwillt schon deutlich an. Er sieht aus wie ein Vampir, der zu fest zugebissen hat. Ich weiß nicht, warum ich solche verqueren Gedanken habe, anstatt mich schuldig zu fühlen. Doch natürlich, ich fühle mich schuldig. Ich weiß, dass ich nicht Lars schlagen wollte. Ich wollte alle gleichzeitig schlagen, sie alle.
»Das war doch nur Spaß!«, schreit Sinja.
Plötzlich fange ich an zu zittern. Ich werde jetzt doch nicht weinen? Hallo? Ich werde bald sechzehn! Nein, ich weine nicht mehr, das ist Quatsch! Das habe ich hinter mir.
Aber ich tue etwas anderes, was ich auch nie mehr tun wollte und was genauso Quatsch ist: Ich laufe weg, so wie früher. Ich renne einfach aus dem Gebäude, in die kühle Nachtluft, die schwarze Straße hinunter. Mein Fahrrad lasse ich stehen, es ist abgeschlossen. Pferde sind besser als Fahrräder, treue Pferde, die vor der Tür warten, gesattelt, jederzeit bereit, ihren Herrn im Galopp in die rettende Wüste zu tragen. Hätten Westernhelden ihre Pferde vor dem Saloon immer erst aufschließen müssen, womöglich mit einem eingerosteten Zahlenschloss, wären viele von ihnen nicht so alt geworden. Hey, drehe ich jetzt vollkommen durch?
Ich renne nicht, denn ich möchte vermeiden, dass die Leute mich ansehen. Ich gehe nur ganz schnell, und erst, als ich die Ampelkreuzung überquere, fällt mir auf, dass ich nicht einmal meinen Rucksack mitgenommen habe. Das wiederum war ganz blöd, denn in meinem Rucksack befindet sich unter anderem der Wohnungsschlüssel. Freddie und Sabine sind heute Abend mit Freunden unterwegs, weiß der Geier, wann die nach Hause kommen. Scheiße! Ich bleibe stehen. Ein paar Typen mit Sporttaschen trotten mir entgegen, starren mich an. Ich setze mich wieder in Bewegung, immer an den Schaufenstern der Geschäftsstraße entlang, in denen ich mich spiegle, aber ich sehe natürlich nicht genau hin.
Mein Handy klingelt in der Brusttasche meiner Lederjacke, es vibriert auf meiner Brust und meine Rippen vibrieren mit. Mein Herz schlägt wie verrückt. Ich kann da jetzt doch nicht drangehen. Aber meine Hand greift wie ferngesteuert in meine Jacke, umfasst das Telefon, zieht es heraus. Sinja. Wie soll ich jemals wieder mit Sinja reden? Ich habe ihren Helden, ihren Retter zu Boden geschlagen, sein makelloses Gesicht verunstaltet. Sinja hasst Gewalt, sie wird mir das niemals verzeihen. Ich klicke sie weg, stecke das Telefon wieder ein und gehe weiter. Eine Frau mit einem kleinen Hund an der Leine kommt mir entgegen, der Hund hat offenbar fest vor, mich mit seiner Leine zu Fall zu bringen, die Frau zerrt ihn an sich heran und entschuldigt sich in gebrochenem Deutsch. Ich beachte sie gar nicht. Mein Telefon klingelt erneut. Sinja. Wieder Sinja. Ich sehe sie vor mir, wie sie in der Garderobe steht, den blutbefleckten Schal noch in der Hand, umringt von Charly, Lars, den anderen, vielleicht dem einen oder anderen Polizisten?, wie sie wütend auf ihr Telefon starrt und »Jetzt geh sofort ran!« schreit.
Warum nur gehe ich ran?
Ich drücke auf den grünen Knopf, kann aber nichts sagen.
»Cedric? Bist du da? Cedric?«, höre ich Sinjas aufgeregte Stimme. »Sag doch was! Hallo! Jetzt sag was, verdammt!«
Ich drücke sie wortlos weg. Wenige Sekunden später ruft sie wieder an. Ich gehe wieder dran. Was für ein blödes Spiel!
»Lass mich in Ruhe«, sage ich zu Sinja. Ich schreie sie nicht an, ich bitte sie nur, bettle fast. »Lass mich einfach in Ruhe.«
»Wo bist du?«
»Draußen.«
»Das war mir klar. Sag mir, wo wir uns treffen können!«
»Warum?«
»Ich muss mit dir reden.«
»Vergiss es.«
Jetzt schreit Sinja doch fast. »Du kannst nicht einfach weglaufen!«
Darauf schweigen wir beide eine Weile. Dann wiederholt Sinja leise, fast beschwörend: »Sag mir, wo wir uns treffen können.«
»Ich weiß nicht.«
»Am Rathausbrunnen?«
»Vielleicht.«
»Ich komme zum Rathausbrunnen, ja? Aber pass auf die Typen auf.«
»Warum?«
»Bis gleich.«
Sie ist weg. Vor meinem inneren Auge sehe ich sie zu ihrem Fahrrad hasten. Sie wird vor mir am Rathausbrunnen ankommen, verschwitzt und mit zerzausten Haaren. Ich hätte ihr sagen sollen, dass auch sie aufpassen soll, ob da nicht irgendwelche komischen Typen herumlungern. Manchmal treffen sich am Brunnen zwielichtige Gestalten. Ich weiß nicht genau, wer sie sind, was sie vorhaben, aber sie sehen so aus, als sollte man ihnen nicht zu nahe kommen. Ich beschleunige meine Schritte, ziehe dabei den Kopf ein, als sei mir zu kalt, als würde ich nur so schnell gehen, um mich aufzuwärmen. Aber es ist gar nicht kalt, eine Art warmer, geruchloser Nebel liegt über der Stadt, der sich vielleicht bald zu Nieselregen verdichten wird.
Als ich zum Rathausplatz komme, sehe ich Sinja sofort. Sie sitzt im Schein einer dieser trüben kegelförmigen Straßenlampen auf dem Brunnenrand und starrt in meine Richtung, ohne mich in der Dunkelheit schon erkennen zu können. Ihr Fahrrad hat sie neben sich an den Brunnen gelehnt, so nah, dass sie jederzeit aufspringen und wegfahren kann. Sinja hat allein im Dunkeln Angst, und es ist ein Zeichen wahrer Freundschaft, dass sie sich trotzdem hierher gewagt hat.
Ich gehe noch ein bisschen schneller, um sie möglichst rasch zu erlösen. Als Sinja mich erkennt, steht sie auf, kommt aber nicht auf mich zu. Sie sieht mich nur an, und dann bückt sie sich und hält mir wortlos meinen Rucksack hin. Ich nehme ihn, ebenso wortlos, und schlinge ihn mir über die linke Schulter, als würde ich gleich wieder weggehen. Sinja setzt sich langsam wieder hin. Ich zögere einen Moment, dann lasse ich mich neben ihr nieder. Der Brunnen ist feucht, kalt, und Sinja trägt nur eine dünne Hose. Ich hoffe, sie erkältet sich nicht, nur wegen mir. Jetzt hält sie sich ihre beiden Handgelenke vor den Mund, als wolle sie sich an ihren Pulswärmern aufwärmen. Sinja trägt immer Pulswärmer. Sie sagt, dass sie ohne diese Dinger friert, egal, welche Temperatur gerade herrscht. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber mir macht es nichts aus, wenn Leute ein bisschen merkwürdig sind.
»Wie geht es Lars?«, frage ich schließlich fast tonlos.
Sinja zuckt mit den Schultern. »Es ist nichts kaputt«, sagt sie dann. »Nichts gebrochen. Glaube ich jedenfalls. Sah viel schlimmer aus, als es war.« Sie schweigt einen Moment lang. »Aber das heißt nicht, dass das okay war, was du gemacht hast.«
»Ich weiß!«, schnappe ich. Ich wollte nicht so ruppig klingen. Das passiert mir oft, dass ich viel ruppiger klinge, als ich eigentlich will.
»Ich hab so was noch nie gemacht«, füge ich sanfter hinzu. »Noch nie. Nur damit du nicht denkst, ich bin so ein Schlägertyp.«
»Und warum heute?«, fragt Sinja. »Warum Lars? Ich meine, es war nicht besonders originell von ihm, dich als Loser zu bezeichnen, aber Mann, es war nur dämliches Gerede, das hat er doch nicht ernst gemeint. Du bist schließlich gar kein Opfer.«
Ich schweige.
»Oder hast du gedacht, er meint es ernst?«
»Nein. Nein, habe ich nicht. Ich weiß wirklich nicht, warum ich ihn geschlagen habe. Ich wollte das gar nicht. Es ist einfach passiert. Einfach von alleine.«
Dann schweigen wir beide eine ganze Weile, während ich in meinem Kopf die Einwände abspule, die Sinja jetzt nicht äußert, die sie sich verkneift, weil sie trotz allem – zum Glück! – offenbar noch meine Freundin sein will. Dass ich für alles verantwortlich bin, was ich tue, dass man sich nicht damit rausreden kann, man habe etwas nicht gewollt. Dass ich überreagiert habe. Ich hoffe, bete fast, dass sie dieses Wort nicht ausspricht, obwohl es heute vielleicht doch das genau richtige Wort wäre. Bitte, Sinja, sag nicht, dass ich überreagiert habe. Ich weiß nicht, was ich dann tue. Ich werde dich bestimmt nicht schlagen, das nicht, aber es kann sein, dass ich einfach meinen Rucksack nehme und weggehe, und ein zweites Mal telefonierst du mir bestimmt nicht hinterher.
»Ich verstehe dich nicht«, sagt Sinja schließlich leise. Sie sagt es nicht vorwurfsvoll, eher ratlos und traurig. »Ich weiß nicht richtig, wer du bist.«
»Ich bin ein brutaler Schläger, das hast du doch gesehen«, raunze ich, bevor ich mich bremsen kann. Und dann lege ich Sinja ganz schnell die Hand auf den Arm. »Entschuldigung. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist.«
»Ist es wegen der Hauptrolle?«, fragt Sinja.
Ich ziehe meine Hand schnell wieder weg.
»Wie meinst du das?«
»Wegen der Hauptrolle. Traust du dir das nicht zu? Du musst ja nicht.« Sie zögert. »Aber ich glaube, du würdest das gut machen.«
»Du meinst, die Rolle passt zu mir? Das Opfer, der Loser?«
»So habe ich das nicht gemeint!« Jetzt wird Sinja zum ersten Mal laut. »Verdreh doch nicht immer alles! Du tust immer so, als wollten dir alle etwas Böses.«
»Entschuldigung.«
»Du musst dich bei Lars entschuldigen«, sagt Sinja jetzt wieder ruhiger. »Nicht bei mir. Schaffst du das?«
»Ja. Klar.« Ist Sinja etwa doch in Lars verknallt? Läuft da irgendetwas? Und wenn ja, was geht es mich an?
»Gut.« Sinja steht auf, klopft sich die Hose ab. »Und überleg dir das mit der Rolle. Ich meine, du kannst ja selbst mitbestimmen, wir entwickeln doch das Drehbuch erst.«
»Ich fliege doch jetzt sowieso aus der Gruppe.«
»Glaub ich nicht«, sagt Sinja. »Na ja, ich weiß nicht. Du solltest auf jeden Fall mit Charly reden.«
Ich nicke und stehe ebenfalls auf. Ich möchte nicht, dass Sinja mich jetzt alleine lässt, aber mir fällt nichts ein, womit ich sie festhalten könnte.
»Ich muss los«, sagt sie. »Meine Mutter macht sich Sorgen, wenn ich spät komme.« Sie zögert, dann legt sie mir kurz die Hand auf den Arm. »Es wäre irgendwie einfacher, wenn ich mehr von dir wüsste. Du erzählst so wenig.«
»Gibt nichts zu erzählen. Ich bin langweilig.«
»Du bist ein Idiot.« Sinja schüttelt ärgerlich den Kopf, dann reißt sie ihr Fahrrad hoch und steigt auf. »Wir sehen uns morgen.«
Erst als ich zusehe, wie ihr Rücklicht in der Dunkelheit verschwindet, fällt mir ein, dass ich sie nicht nach dem Schal gefragt habe. Hat sie ihn womöglich Lars mitgegeben, als Verband? Hat sie ihn weggeworfen, weil die Blutflecken sowieso nie mehr rausgehen? Soll ich sie anrufen und mich erkundigen? Ihr einen neuen kaufen? Nein, albern. Wie sieht das aus, wenn ich mich nur um den Schal sorge, nicht um Lars mit seiner aufgesprungenen Lippe.
Ich hoffe nur, Charly ruft nicht meine Eltern an. Auf keinen Fall möchte ich, dass die sich wieder aufregen. Die haben sich schon so oft aufgeregt über mich oder über das, was mir so alles passiert ist. Meine Mutter war immerhin die ganzen Jahre stolz darauf, dass ich kein Schläger bin, dass ich Gewalt verabscheue, trotz der ganzen üblen Erfahrungen, dass mich keine zehn Pferde zur Bundeswehr kriegen würden, dass ich nie mit Waffen gespielt habe und Ballerspiele bescheuert finde. Ihr Weltbild würde endgültig zusammenbrechen, wenn sie es erführe. Mein Vater würde mich wohl eher verstehen. Es kann gut sein, dass er in jungen Jahren dem einen oder anderen Typen auf die Nase gehauen hat. Er hätte sicher auch schon ein paarmal gerne dem einen oder anderen Lehrer oder Mitschüler von mir kräftig eine gelangt, aber er hat sich immer beherrscht, um uns nicht noch mehr Schwierigkeiten zu machen. Das hat er mir voraus. Vielleicht werde ja auch ich weise, wenn ich so alt bin wie er.
Eine Personengruppe nähert sich, Jugendliche, coole Haltung, blökende Gelächtersalven, orangefarbene Zigaretten-Glühpunkte. Es wird Zeit aufzubrechen. Ich trabe in die entgegengesetzte Richtung los in Richtung Fußgängerzone. Dort sind die Fenster noch beleuchtet, aber nach und nach werden Gitter und Läden heruntergelassen, nur noch wenige Fußgänger sind unterwegs, sammeln sich an den letzten geöffneten Imbissständen. Ich habe Hunger, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann ich denn jetzt was essen, ich, der Schläger? Soll ich mich jetzt etwa noch für meine Tat belohnen? Das ist doch krank. Ich gehe schnell an der Dönerbude vorbei, schnuppere noch ein bisschen vor dem Fischimbiss – ich mag Backfisch – und biege dann in eine Seitenstraße ein. Ein Handy klingelt, mein Klingelton, meine Hand schnellt automatisch an meine Brusttasche, aber mein eigenes Telefon rührt sich nicht, stattdessen gräbt eine Frau mittleren Alters hektisch in ihrer riesigen Handtasche herum. Merkwürdig, dass Handyklingeltöne so schwer zu orten sind. Warum bin ich enttäuscht? Habe ich ernsthaft gedacht, dass Sinja noch mal anruft?
Gerade, als ich die Treppe zu Freddies Wohnung hochstapfe – bin ich froh, dass die beiden heute Abend auf Achse sind! –, klingelt mein eigenes Handy doch noch, aber es ist nur meine Mutter. Ich kriege einen ganz trockenen Mund und Herzklopfen, aber Charly hat offenbar nicht bei ihr angerufen. Sie will nur wissen, wie mein Tag war, ob es mit der Englischarbeit geklappt hat und vor allem, wie es in der Filmgruppe gelaufen ist, ob wir ein neues Thema ausgesucht haben. Unser letzter Film hat ihr sehr gut gefallen. Sie weiß auch, dass mir die Filmgruppe momentan mehr Spaß macht als alles andere, was ich so treibe.
»Ich kriege vielleicht die Hauptrolle!«, sage ich, ehe ich richtig darüber nachgedacht habe.
»Echt! Das ist super!« Meine Mutter klingt glücklich. »Worum geht es denn?«
»Ist noch nicht raus.«
Damit gibt sie sich zufrieden, sagt mir, dass ich noch was essen soll, und legt dann auf. Meine Mutter vermisst mich sehr. Ihr wäre es viel lieber, ich würde noch in meine alte Kleinstadtschule gehen. Aber sie weiß auch, dass das nicht mehr möglich ist.
Ich trabe gleich ins Gästezimmer, das Freddie und Bine mir die Woche über zur Verfügung stellen, und klappe meinen Computer auf, ohne die Lederjacke auszuziehen. Keine Mail. Ich sitze hier mit meinem Computer auf einer Art einsamer Insel, bin nicht auf Facebook oder in sonst einem unsozialen Netzwerk. Auf meiner Insel lebe ich ganz für mich allein, also in vollkommener Sicherheit, und das soll auch so bleiben.
Mein Blick fällt auf meine Hand, die auf der Tastatur liegt. Mann, an den Knöcheln klebt ja immer noch Blut! Ich springe auf und renne ins Bad, schrubbe mir die Hände so heftig ab, dass mindestens die oberste Hautschicht mit abgeht, trockne sie gründlich und werfe das Handtuch sofort in den Wäschekorb, und dann richte ich mich auf und sehe mir mein Gesicht eine ganze Weile lang im Spiegel an, als hätte ich mich noch nie gesehen.
A
Meine Mutter ist noch viel größer, fast doppelt so groß wie ich, ihre Hand in meiner kräftig und warm. Schweiß klebt unsere Handflächen aneinander, ich weiß nicht, ob es ihr Schweiß ist oder meiner. Der Boden ist dunkelbraun gefliest, schlammige Gummisohlen haben ein Muster draufgedruckt. Es riecht nach alten Turnschuhen und Kreide. Die drei älteren Frauen, die da vor uns stehen und einander angiften, haben uns offenbar vergessen. Eine davon ist die Schulleiterin meiner neuen Schule, die ich überhaupt nicht haben will, weil es in meiner alten Schule sowieso schöner war. Die anderen beiden sind Klassenlehrerinnen der ersten Klasse. Zu einer von beiden werde ich gleich in die Klasse geschickt, aber noch streiten sie sich, weil mich keine von beiden haben will. Sie rechnen sich gegenseitig vor, wie viele Schüler sie schon aushalten müssen, und die mit den roten Haaren sagt, sie hat schon den Marek bekommen, der ist schwierig und zählt für zwei, und Mama drückt meine Hand noch fester, ich stehe so eng neben ihr, dass ich spüre, wie sie tief Luft holt.
Endlich drehen sich die drei zu uns um. Die Schuldirektorin, die eben noch ein böses Gesicht gezogen hat, lächelt mich jetzt an.
»Weißt du was«, sagt sie zu mir, »entscheide du doch selbst, zu welcher der beiden Lehrerinnen du möchtest, zu Frau Unmuth oder zu Frau Niebel.«
Ich starre die beiden Klassenlehrerinnen an, die mich jetzt ebenfalls anlächeln. Obwohl sie gerade noch gestritten haben, weil keine mich haben will, wird eine von ihnen gleich beleidigt sein, weil ich mich für die andere entscheide. Dabei will ich keine von ihnen haben. Ich will meinen richtigen, netten jungen Klassenlehrer wiederhaben, der traurig war, weil ich umgezogen bin.
Mamas Hand quetscht meine Hand jetzt so zusammen, dass meine Finger schmerzen. Ich glaube, sie würde gerne mit mir weglaufen. Aber stattdessen holt sie noch einmal tief Luft und sagt dann zu mir:
»Cedric, was meinst du, möchtest du lieber in die a oder in die b?«
Zum Glück kann ich diese Frage leicht beantworten! Ich war in meiner alten Schule in der 1a, also gehöre ich immer noch in die a. Die rothaarige Lehrerin verzieht gekränkt das Gesicht. Die andere, die mit dem Minirock, verschiebt ihr Gesicht zu einem künstlichen Lächeln und hält mir die Tür zu ihrem Klassenraum auf. Die Schulleiterin sieht auf die Uhr. Meine Mama muss mich jetzt loslassen. Sie tut es, zögernd, sagt: »Dann bis später«, und ich spüre, dass sie nicht gehen möchte, dass sie lieber auf mich aufpassen würde, um sicherzugehen, dass die Frauen nett zu mir sind.
Und dann stehe ich vor meiner neuen Klasse. Es ist eine kleine Klasse, kleiner als meine alte, und alle, wirklich alle Kinder dieser Klasse sind blond, mehr oder weniger blond, und sehr weiß, jedenfalls ist keiner mit einer ganz anderen Hautfarbe darunter, wie mein Freund Ben aus Ghana, oder auch nur mit ganz schwarzen, lockigen Haaren, wie Sengül aus dem Nachbarhaus oder Payram aus meiner alten Klasse. Ein Junge mit großen haselnussbraunen Augen und langen Wimpern mustert mich grinsend vom Kopf bis zu den Füßen. Ein Mädchen mit ganz kurzen Haaren rückt zur Seite und schlägt mit der flachen Hand auffordernd auf die freie Seite ihres Tischs.
»Setz dich neben Celina«, sagt die Lehrerin, Frau Unmuth.
Celina riecht süßlich nach Kaugummi und hat schwarze Ränder unter den Fingernägeln, aber sie guckt mich neugierig an, freundlich, ein bisschen mitleidig, vielleicht, weil ich Tränen in den Augen habe. Es ist kein Wunder, dass ich weine. Ich sitze in der falschen Klasse in einer falschen Schule und habe eine falsche Lehrerin, und das nur, weil meine Eltern unbedingt umziehen wollten. Vielleicht ist alles ein Irrtum und wir packen unsere Möbel wieder ein und tragen alles zurück in unsere schöne alte Wohnung.
»Hat jemand mal ein Taschentuch für den Cedric?«, fragt die Klassenlehrerin. Meine Mama vergisst immer, mir Taschentücher einzupacken.
»Heulsuse!«, stellt der Junge mit den Haselnussaugen zufrieden fest.
»Jetzt lass ihn doch, Marvin«, tadelt Frau Unmuth sanft. »Er muss sich erst an uns gewöhnen.«
Ich krampfe meine Finger um mein Taschentuch.
»Du wirst bald Freunde finden«, sagen meine Eltern, als ich mittags weinend in ihr Auto steige. Mama hat selbst Tränen in den Augen, sie blinzelt.
Sie haben keine Ahnung, wie sehr sie sich irren.
Ich selbst habe auch noch keine Ahnung, wie sehr sie sich irren.
Schon in der ersten Schulwoche an der neuen Schule machen wir einen Ausflug. Mama meint, da habe ich ganz schön Glück gehabt. Wir fahren alle ins Kino, und Celina setzt sich im Bus gleich neben mich und will ihr Brot mit mir teilen. Das ist nett von ihr, aber es ist Käse drauf und ich mag keinen Käse. Marvin sitzt vor mir. Immer, wenn Frau Unmuth nicht aufpasst, dreht er sich um und zieht mir eine Grimasse.
»Du bist ja ein Mädchen«, sagt er.
Ich verstehe nicht, was er meint. Celina streckt Marvin die Zunge heraus. Ich glaube noch, dass sie meine Freundin werden kann.
»Der hat doch Haare wie ein Mädchen«, sagt Marvin.
Celina runzelt die Stirn und betrachtet mich genau, als müsse sie diese Behauptung überprüfen.
Unwillkürlich fasse ich meine Haare an. Sie sind ganz glatt und fallen mir auf die Schulter.
»Mädchen, Mädchen!«, singt Marvin.
»Lass das!«, schreie ich Marvin an.
Ich habe eine sehr laute Stimme. Meine Mutter meint, das kommt daher, dass ich ein Schreibaby war und gleich zu Beginn meines Lebens meine Stimmbänder so kräftig trainiert habe. Wenn ich zum Beispiel »Lass das!« schreie, hört das der ganze Bus, auch Frau Unmuth, die ganz vorne sitzt.
»Was ist da los?«, ruft sie nach hinten.
»Der lässt mich nicht in Ruhe!«, sagt Marvin. »Der sagt dauernd blöde Sachen zu mir.«
»Er muss sich erst eingewöhnen«, sagt Frau Unmuth. »Gebt ihm ein bisschen Zeit.«
Ich will protestieren, aber da fährt der Bus los. Marvin dreht sich grinsend wieder zu mir um.
»Mädchen!«, formen seine Lippen.
Ich boxe gegen die Rückenlehne.
In den nächsten Tagen lerne ich, dass Marvin nicht nur Marvin ist. Marvin ist mehr, er ist der Chef, der darüber bestimmt, was cool ist und was uncool. Wen er auslacht, den lachen alle aus– das gilt zumindest für die Jungs. Wen er gut findet, den finden alle gut. Weil Marvin beschlossen hat, dass ich ein Mädchen bin, finden alle Jungs, dass ich ein Mädchen bin. Ich bin mir ehrlich gesagt ein bisschen unsicher, ob das überhaupt eine schlimme Beleidigung ist, denn Mädchen sind eigentlich nett. Ich finde sie oft viel netter als Jungs. Andererseits ist klar, dass Marvin es gar nicht nett meint, dass er mich vielmehr beleidigen will. Kein Wunder, dass ich mich dann doch ärgere.
In der ersten Sportstunde bei Frau Unmuth mag ich mich nicht umziehen. Ich ziehe mich überhaupt nicht gerne um, wenn andere zusehen, und wenn dann noch einer dasteht und mit halb zusammengekniffenen Augen beobachtet, wie ich mir mein T-Shirt über den Kopf streife und die Hose aufknöpfe, dann wird die Spannung schier unerträglich.
»Guck mal!«, schreit Marvin prompt, als ich aus meiner Jeans schlüpfe. »Guck mal, eine rote Unterhose!«
Alle gucken.
Ich gucke auch. Erst auf meine Unterhose, an der noch nie jemandem etwas Besonderes aufgefallen ist, dann auf die Unterhosen der anderen.
Gibt es hier an der neuen Schule keine roten Unterhosen?
Gibt es nicht. Hier gibt es nur graue, dunkelblaue, bestenfalls dunkelblau-grau gestreifte Unterhosen oder welche im Nato-Tarnmuster, als müsste man sich in der Unterhose vor Feinden verstecken.
»Mädchen, Mädchen!«, singt Marvin. Die anderen Jungs stimmen ein.
»Fettes Mädchen!«, ergänzt Marvin.
»Fettes Mädchen!«, kommt das Echo der anderen.
Ich sehe noch mal an mir herunter. Rote Unterhose, Bauch. Ja, ein ganz kleiner Bauch, ein sanfter Hügel. Ich bin nicht dick wie Melissa in meiner alten Klasse, die nur mit gespreizten Beinen laufen kann, weil ihre Schenkel gegeneinanderstoßen.
»Ich bin nicht fett«, sage ich leise. Und sehe dabei Obelix vor mir. Den dicken, fetten, runden, dummen, lieben Obelix in seiner schönen blau gestreiften Hose.
»Der ist feeeeett«, singt Marvin, und einer der anderen Jungs, dessen Namen ich mir noch nicht gemerkt habe, greift nach meiner Sporthose und reißt sie mir aus der Hand.
Ich fange an zu schreien. Ich weiß nicht, was ich schreie, aber es sind bestimmt ein paar schlimme Beleidigungen dabei, denn Frau Unmuth kommt in die Umkleidekabine gestürzt und packt mich am Arm.
»Cedric, du bist sofort still!«
»Die ärgern mich«, schluchze ich.
»Wir haben nur ein bisschen Spaß gemacht.« Marvin strahlt Frau Unmuth an. Er hat lange, dunkle Wimpern und große, glänzende braune Augen.
»Ich weiß, Marvin«, seufzt Frau Unmuth. »Aber ihr müsst ein bisschen Rücksicht auf ihn nehmen. Er versteht offenbar keinen Spaß. Er hat sich einfach noch nicht eingewöhnt.«
In der Turnhalle sitze ich auf der Bank und weine und will nicht mitmachen, wenn die anderen spielen.
Die Kinder finden mich komisch. Ich rede nicht wie sie und ich rede nicht über die gleichen Sachen wie sie. Ich kann schon lesen und schreiben und ziemlich gut rechnen, aber in den Mathestunden muss ich stundenlang Rätselbilder ausmalen, nur um zu beweisen, dass ich schon weiß, dass fünf plus zwei sieben ist, als wüsste ich das nicht schon längst, und Frau Niebel, meine Mathelehrerin, sagt mir sehr schnippisch, es interessiert sie nicht, was ich alles kann, sie behandelt nämlich alle gleich, und ich soll das machen, was alle machen.
Marvin kommt in einer Hose im NATO-Tarnmuster in die Schule, und ich sage ihm gleich, dass ich das doof finde, weil ich keine Soldaten ausstehen kann. Marvin entgegnet, dass er Soldaten cool findet, weil die so coole Waffen haben. Ich kann Waffen überhaupt nicht leiden, und Marvin erklärt, das ist der Beweis dafür, dass ich eben doch ein Mädchen bin.