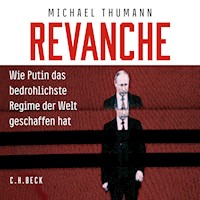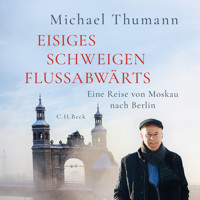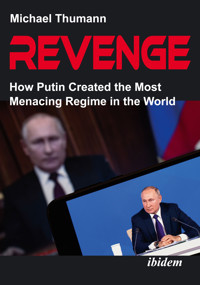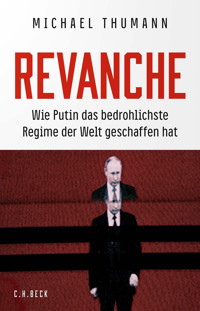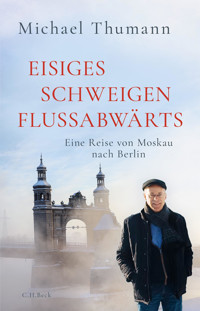
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Michael Thumann legt nach seinem SPIEGEL-Bestseller «Revanche» einen sehr persönlichen Reisebericht vor, in dem er die erneute Teilung Europas mit eigenen Augen erkundet. Er beschreibt in eindringlichen Reportagen und Augenzeugenberichten seinen Weg aus Moskau heraus über die schwer bewachten Außengrenzen Russlands, erst nach Osten Richtung Zentralasien, dann nach Westen über die baltischen Staaten und Polen nach Deutschland: von Moskau nach Berlin, mitten durch den neuen Eisernen Vorhang hindurch. Thumann nimmt uns mit zu endlosen Befragungen an Grenzübergängen, er besucht russische Flüchtlinge in den Nachbarstaaten, er kommt auf seinem Weg von Ost nach West mit Menschen aus ganz Osteuropa zusammen und schildert ihre Ängste vor Russlands Revanchismus und Kriegslust. Oder ihre vorauseilende Unterwerfung angesichts von Putins unaufhörlichem Expansionsdrang. Thumann blickt dabei auch auf die eigene Familiengeschichte, den Mauerfall und seine zerplatzten Träume in der Putin-Ära zurück. Er spürt den Gründen für das prekäre deutsch-russische Verhältnis in der Geschichte und Gegenwart nach. Thumanns Buch ist ein mitreißendes zeitgeschichtliches Zeugnis von der Suche nach einer Sicherheit, die wir alle verloren haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
Michael Thumann
Eisiges Schweigen flussabwärts
Eine Reise von Moskau nach Berlin
~
C.H.Beck
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Inhalt
Karten
Prolog
:
Europas neue Teilung
Unerwünscht
:
Korrespondentendasein in Russland
Ausweichen
:
Mit dem Fahrrad raus aus Moskau
Zurückblicken
:
Erste Reisen von Berlin nach Moskau
Zerrüttet
:
Die deutsch-russischen Beziehungen
Ausweglos
:
Putins ewiger Krieg
Alle raus! Im Nachtzug durch die Steppe
Abgeschnitten
:
Russische Flüchtlinge in Georgien
Belagert
:
Die Freunde in Moskau
Pulverisiert
:
Die Zerstörung des Westens
Eisiges Schweigen
:
Von Kaliningrad an die Memel
Ausgegrenzt
:
Wie westliche Sanktionen Europa teilen
Ausziehen
:
Von Petersburg nach Narva
Abnabeln
:
Esten und Russen am Peipussee
Unversöhnlich
:
Ein Riss geht durch Daugavpils
Ausgebombt
:
Die Russen in Nju-Jork
Westwärts
:
Von Kaunas über Danzig nach Posen
Verwundet
:
Ankunft in Ostdeutschland
Schaukelnd
:
Die Deutschen im geteilten Europa
Reiselektüre
Dank
Register
Bildnachweis
Zum Buch
Vita
Impressum
Karten
Anleger am Kurischen Haff nahe der Grenze zwischen Litauen und Russland
Prolog: Europas neue Teilung
~
Wie so oft auf dem Weg nach Russland habe ich Gegenwind. Das Leihfahrrad ist einfach gebaut und hat nur zwei Gänge. Ich muss kräftig treten und bin froh, dass die Straße auf der Kurischen Nehrung hier vergleichsweise flach ist. Auf dem Weg vom litauischen Seebad Nidden (litauisch: Nida) zur russischen Grenze spule ich die Kilometer herunter. Diese Strecke durch den dichten Wald war einmal die spektakulärste Art, um nach Russland einzureisen. Entlang der legendären Kurischen Nehrung, die bis ins 20. Jahrhundert preußisch war und die sich heute Litauen und Russland teilen. Die Kiefern links und rechts wachsen schief in den bedeckten Ostseehimmel, vom nie ermüdenden Wind gleichmäßig Richtung Osten gekämmt. In der späten Sowjetzeit war ich hier einmal in einem sehr lauten Reisebus durchgefahren. Jetzt bin ich möglichst still unterwegs, ich fahre nicht ganz gesetzeskonform in einem Sperrgebiet auf litauischer Seite. Ich lasse die Autos hinter mir, die bereits drei Kilometer vor der Grenze umdrehen oder parken müssen. Ich überhole die Fußgänger, die noch ein paar hundert Meter weitertrotten, aber dann ist auch für sie Schluss, und sie müssen durch den Wald nach rechts zum Ostseestrand abbiegen. Nur ich bin den Sicherheitskräften auf meinem schlanken Leihrad durchgerutscht. Ich bremse ab, weil auf der Straße immer mehr Kiefernzapfen liegen. Hier wird nur noch selten gereinigt. Schilder am Straßenrand warnen: «Vorsicht! Sperrgebiet!», «Vorsicht! Lebensgefahr!» und: «Vorsicht, Elche!» Dahinter steigt die gigantische weiße Düne an, deren «Eindruck des Elementarischen» Thomas Mann an die Wüsten Nordafrikas erinnerte. Von seinem Sommerhaus in Nidden machte er Ende der 1920er Jahre gern Spaziergänge zu diesem mächtigen Sandgebirge. Heute markiert die Nehrung die schönste und härteste Außengrenze der Europäischen Union. Hier Litauen, da Russland, die Grenze fest geschlossen: keine Berührung, kein Austausch, kein Winken ist mehr möglich. Ein blaues Schild informiert, dass es nach Karaliaučius nur noch 86 Kilometer sind. Darunter steht der russische Name: Kaliningrad. Von Königsberg spricht hier niemand mehr.
Unmittelbar vor dem Grenzübergang sind rechts vor einem grauen Metallzaun grüne Mülleimer angebracht, davor stehen zwei Müllcontainer. Offenbar gibt es hier viel wegzuwerfen. Ein Schild fordert die Autofahrer auf, die Kennzeichen ihrer Autos zu reinigen. Sonst kann die automatische Erkennungsanlage sie nicht erfassen. Der Grenzübergang ist sehr modern. Auf fünf Fahrspuren verbreitert, mit Glasdach und viel Verkehrsleittechnik ausgestattet für die schnelle Durchfahrt. Ein Relikt aus einer verschütteten Zeit des grenzenlosen Optimismus, als Europa dachte, es wüchse zusammen und Russland könne wie selbstverständlich dazugehören. Als viele Europäer hofften, dass Russland und vielleicht sogar die Welt wie Europa allmählich frei und demokratisch werden würden. Die Schlagbäume vor mir sind fest geschlossen, die Ampelanlage steht auf Dauerrot. Ich kann keinen Menschen entdecken, der Übergang wirkt wie verwaist. Eine menschenleere Grenze, denke ich mir, sagt alles über die Sprachlosigkeit, die zwischen Europa und Russland wie eine unüberwindliche Mauer steht. Aber man nimmt mich wahr, denn Kameras gibt es genug. Ganz still werde ich von allen Seiten gefilmt. Hier an dieser Grenzstation ist auch für mich Schluss. Ich kehre um und sehe vor mir das Straßenschild: «Nida – vier Kilometer». Jetzt habe ich Rückenwind.
Als Eisernen Vorhang bezeichneten die Europäer die Grenze zwischen Ost und West im Kalten Krieg von 1946 bis 1989. Den Begriff hatte Winston Churchill geprägt. Der britische Premierminister hatte im März 1946 die radikale Teilung Europas in einer Rede in Fulton im US-Bundesstaat Missouri vorausgesagt. «Von Stettin an der Ostsee bis hinunter nach Triest an der Adria zieht sich ein ‹Eiserner Vorhang› über den Kontinent.» Mit Russlands vollumfänglichem Überfall auf die Ukraine 2022 und Putins hybridem Krieg gegen die EU hat sich ein neuer Vorhang über Europa gesenkt. Nur dass er diesmal weiter östlich fällt, vom Polarkreis in Norwegen entlang der Ostgrenzen von Finnland, der baltischen Staaten, Polens, mitten durch die Ukraine und weiter bis an die Küsten Rumäniens und Bulgariens. Die Ukraine ist von der russischen Armee in Stücke zerrissen. Die Länder der Europäischen Union haben seit 2022 Visabeschränkungen und Reisesanktionen gegen die russischen Eliten verhängt, die den Krieg gegen die Ukraine, Verbrechen, Vertreibungen, Morde, Kindesentführungen und Besetzung organisieren. Die russische Regierung nimmt vielen ihrer eigenen Bürger Pässe und Ausreiseerlaubnisse weg, verrammelt die Grenzen und erteilt nur noch sehr selektiv Visa für EU-Bürger. Russland, das lange Zeit Teil von Europa sein wollte, schottet sich von Europa ab.
Europas Teilung – das ist das Thema dieses Buches. Für einen Boomer wie mich, der mit der scharfen Trennung des Kontinents in zwei Teile aufgewachsen ist, der sich 1989 als Student an der Sprengung der Mauer und der Fusion der Einzelteile Europas erfreute, der dreißig Jahre lang lächelnd diesem Urknall des Optimismus und Humanismus nachhorchte, der von der Vereinigung ganz Europas als Mensch und als Journalist profitierte, der nicht mehr aufhörte, zwischen dem Westen und Osten zu reisen und hier wie dort zu wohnen – für mich ist diese neue Teilung eine Niederlage, ein Bruch, eine unerträgliche Regression Europas und meines beruflichen wie persönlichen Lebens zurück in einen Zustand, den ich für unwiderruflich überwunden hielt.
Die Teilung hat viele Gründe, aber der Hauptschuldige an dieser Spaltung heißt Wladimir Putin. Der russische Herrscher versucht schon lange, sein Land gegen den Westen zu verriegeln. Im Jahr 2012 ließ er das Gesetz gegen die sogenannten «ausländischen Agenten» einführen. Über ein Jahrzehnt ließ er dieses Gesetz mit immer neuen Zusätzen zu einem scharfen Schwert gegen Journalisten, Stiftungen und die ganze Zivilgesellschaft schärfen. In einem weiteren Gesetz über «unerwünschte Organisationen» ließ er 2015 nichtstaatliche Verbände und Vereine verfolgen. Mit diesem Instrument konnten seine Vollstrecker vor allem europäische, westliche Organisationen bekämpfen, die in Russland arbeiteten. Wladimir Putin und seine Propagandisten hetzen gegen Europa, sie haben den Kontinent zu Russlands größtem Feind stilisiert. Doch ist es genau umgekehrt. Mit den Überfällen auf die Ukraine 2014 und 2022 ist Wladimir Putin zu Europas größtem Feind geworden. Russlands Kriege bedrohen die Existenz der Ukraine und den Frieden in ganz Europa. Für ihn ist der Krieg ein willkommener Anlass, Russland zu verbarrikadieren: als abgeschlossener Informationsraum, als abgeriegelter Halbkontinent, als Raum frei von westlichen Gedanken und Entwicklungen. Dem dienen das Verbot von nicht autorisierten Publikationen und die Blockade nichtrussischer Apps und Netzseiten. Russland soll keinen Einflüssen unterliegen als dem Einfluss des Herrschers höchstselbst. Der erste Leitgedanke dieses Buches ist: Der neue Eiserne Vorhang passt perfekt in Putins Weltbild, er vollendet einen Zustand, an dem er schon lange gearbeitet hat.
Putin hat Russland von Europa entfernt wie kein russischer Führer vor ihm, das ist mein zweiter Kerngedanke. Putin bringt sein Land in Abhängigkeit von China, er schmiedet Militärbündnisse mit Nordkorea und Iran, er forciert Russlands Orientierung nach Osten. Damit betritt er historisches Neuland. In der Vergangenheit lag Russland oft mit anderen europäischen Staaten im Clinch oder im Krieg. Aber es hatte immer Verbündete in Europa, es wollte stets Teil des Kontinents sein. Zar Peter I. kämpfte gegen Schweden, aber zog im Nordischen Krieg von 1700 bis 1721 Dänemark mit Norwegen und Sachsen samt Polen auf seine Seite. Alexander I. kämpfte bis 1815 gegen Napoleon und hatte sich zeitweise mit England, Österreich und Preußen gegen Frankreich verbündet. Nikolaus II. führte 1914 Krieg gegen Deutschland, Seite an Seite mit Frankreich und England. Stalin verteidigte sich in der Anti-Hitler-Koalition mit Großbritannien und den USA gegen Deutschlands Angriff. Und die Sowjetunion war im Warschauer Pakt mit halb Europa verbündet. Heute hat sich Russland mit dem belarussischen Diktator Lukaschenko zusammengetan. Der russische Blick auf Europa reduziert sich auf die Frage, was sich bei den Nachbarn zerstören ließe. Der Zusammenhalt der EU, indem man Nationalisten wie Viktor Orbán Angebote macht. Die europäische Zivilgesellschaft, indem man sie verwirrt und unterwandert. Der innere Frieden, indem man die Rechtsextremisten aller Art fördert. Warschau, Riga, Prag und Berlin, von deren Eroberung Militärblogger und Propagandisten schwadronieren. Oder den ganzen Kontinent, indem man ihn nuklear pulverisiert. So fern von Europa und zerstörungsbesessen wie heute war Russland nie in seiner Geschichte. Und so hoffnungslos abhängig von China auch nicht. Das ist Putins Werk.
Der russische Herrscher hat Deutschland im Visier, das ist mein dritter Leitgedanke. Er tut alles, um die deutsch-russische Aussöhnung seit der Wiedervereinigung zu zerrütten. Systematisch zerstört er die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland, die kulturellen, zivilgesellschaftlichen, persönlichen und wirtschaftlichen Bindungen. Er löscht die gemeinsame Erinnerung. Auf einer Reise nach Kaliningrad fällt mir auf, wie Putin einen vor 220 Jahren gestorbenen deutschen Philosophen für Russland erobern lässt. Geschichtswerkstätten, Veteranenbegegnungen, doppelstaatlich organisierte Museen weichen einem Erinnerungskrieg über die 1990er Jahre, der in dem Versuch gipfelt, die Wiedervereinigung als Unrecht zu verdammen und Deutschland erneut zu spalten.
Mit dem Auslöschungskrieg gegen die Ukraine hat sich Russland eine Schreckensgestalt gegeben, die es bei seinen Nachbarn ebenso gefürchtet wie verhasst macht. Meine vierte Beobachtung. Ein Land, das mich und viele Studenten der Osteuropäischen Geschichte und slawischer Sprachen vor Jahrzehnten anzog und faszinierte, zerstört die Ukraine und droht ganz Europa mit nuklearer Vernichtung. Mittlerweile verabscheuen viele Menschen in den Nachbarländern die russische Sprache, die russische Kultur und Zivilisation, obwohl sie damit aufgewachsen sind und Russisch wie die Russen sprechen. Nicht nur in der Ukraine und in den baltischen Staaten, auch in Kasachstan und in Georgien entsorgen viele die kulturellen Gemeinsamkeiten und suchen Distanz. Die russische Elite beklagt die «Russophobie» und ergötzt sich zugleich an der Angst der europäischen Nachbarn vor Putins Revanche.
Mein letzter Leitgedanke: Russland ist nur ein sehr extremes Beispiel für eine weltweite Entwicklung. Das Zeitalter der Globalisierung endet nicht, aber es geht über in eine Phase der fortschreitenden Regression. Die Allmachtsfantasien von autoritären Führern, die Abschottungs-Paranoia von Wladimir Putin, Donald Trump und Xi Jinping sind ansteckend. Viele Länder auf der ganzen Welt folgen dem Beispiel dieser neuen Nationalisten. Um sich vor Aggressionen und Unterminierung zu schützen, schließen auch die westlichen Gesellschaften ihre Grenzen, errichten Zäune und verschärfen Visaregeln. Wir leben in einem Zeitalter der nationalen Selbstvergewisserung weltweit. Auch Europa riegelt sich ab. Das Zeitalter des freien Reisens geht dem Ende zu. Russland zeigt das nur in einer extremen Weise.
Als Korrespondent erlebe ich das in krasser Form an den russischen Grenzen, bei den Visa-Bestimmungen, den Einreisehürden, den Repressionen gegen ausländische Besucher, mit denen ich diese Reiseerzählung beginnen will. Paradoxerweise ist es heute in vielen Ländern einfacher, als Tourist einzureisen denn als Journalist. Der Tourist kann derzeit noch mit geringem Aufwand in die Türkei, nach Aserbaidschan, Katar oder Indien kommen. Der Journalist muss antichambrieren, beantragen, korrespondieren, nachfragen, bitten, betteln. Geld ist erwünscht, Berichterstattung nicht. Trotzdem sind Journalisten privilegiert. Viele Menschen können gar nicht reisen. Es gibt nützliche und weniger nützliche Pässe. Der deutsche Pass gehört derzeit zu den wertvollsten Exemplaren seiner Art, weil man mit ihm vergleichsweise problemlos in fast alle Länder der Welt reisen kann. Die Frage ist, wie lange noch. In Russland ist der deutsche Pass schon heute eine Belastung. Umgekehrt geht es meinen russischen Freunden längst so. Mit ihrem Pass können sie viele europäische Länder nicht mehr bereisen, nur noch in Ausnahmefällen. Europa schottet sich ab, und Russland mauert sich ein.
Dieses Buch erzählt von einer staatlich verordneten Entfremdung von Russland, einer geistigen und physischen Abkehr, einem Auszug aus Moskau. Nach mehreren Reiseversuchen aus dem Land mache ich mich auf eine lange Fahrt von Osten nach Westen, von Moskau nach Berlin. Ich beginne mit den Gründen, warum so viele Menschen Russland verlassen: Putins ewiger Krieg und die Repressionen, die Zerrüttung der deutsch-russischen Beziehungen, die Abkehr vom Westen und die Zerstörung der Zukunft. Ich beschreibe den psychologischen Druck, die Enttäuschungen und Sorgen über meinen dritten Aufenthalt als Korrespondent in Moskau. Westliche Berichterstatter und Korrespondentinnen beschäftigen sich stark mit der Organisation ihrer eigenen Sicherheit vor Ort. Dazu gehört auch die Frage, was passiert, wenn der Aufenthalt auf einmal unmöglich werden sollte und wir sehr schnell das Land verlassen müssen. Wenn Flughäfen dichtmachen, wie es in Moskau schon heute regelmäßig geschieht. Wenn Züge ausgebucht sind. Wenn Grenzen schließen und nur noch wenige Auswege bleiben. Manche Korrespondenten haben Dienstwagen, andere haben sich einen Fahrer reserviert für den katastrophischen Fall der Fälle. In den folgenden Kapiteln zeichne ich eine Bewegung nach, raus aus Russland in die Nachbarländer, die ihre Grenzen noch nicht geschlossen haben. Ich beschreibe meine Reisen über die letzten offenen Übergänge ins Ausland, zunächst mit der Eisenbahn von Russland nach Zentralasien, dann über den Kaukasus nach Georgien, über eisige Flüsse in die baltischen Staaten. Es ist eine Wanderung durch den Eisernen Vorhang quer durch Europa, mit dem Fahrrad, mit dem Bus, zu Fuß, mit dem Zug, mit dem Taxi, mit verschiedenen Fahrern. Meine Grenzfahrt führt mich schließlich von St. Petersburg über Estland, Lettland, Litauen und Polen nach Deutschland. Ich kehre zurück in mein Heimatland, das mich nach der Ankunft zunehmend befremdet. Noch fühle ich mich nicht in einem Zustand permanenter Flucht, aber ich bin getrieben von der Suche nach Weltvertrauen und einer Sicherheit, die wir alle verloren haben. Dieses Buch ist ein Abschied auf Reisen von Russland, das zu Putins Russland geworden ist, ein Abschied von einem Zeitalter, in dem ich mich wohlgefühlt habe, in dem Europa in weiten Teilen in einem ungekannten Frieden, Offenheit und in einem präzedenzlosen Wohlstand gelebt hat. Jetzt kommt etwas Neues. Bitte anschnallen.
Bei der Siegesparade zum 9. Mai auf dem Roten Platz in Moskau
Unerwünscht: Korrespondentendasein in Russland
~
Die Grenzbeamtin am Moskauer Flughafen Wnukowo zieht meinen Reisepass unter der Trennscheibe hervor. Fragt mich, mit welchem Flugzeug ich gekommen bin. Schaut mich streng an. Fordert mich auf, die Brille abzunehmen. Nimmt eine große Lupe und studiert mein Visum für Russland. Legt den Pass auf ein Lesegerät. Liest in ihrem Rechner alles, was da über mich steht. Schaut mich noch einmal streng an und greift dann zu einem Festnetztelefon mit Wählscheibe.
Für deutsche Korrespondenten ist die Prozedur des Einreisens nach Russland niemals Routine und manchmal eine Riesenshow. Bei jedem Warten in der Schlange vor der Passkontrolle frage ich mich: Liegt gegen mich irgendetwas vor? Lassen sie mich noch rein? Werden sie mich festhalten? Und: Lassen sie mich wieder raus? Oft fallen den Grenzschützern, die dem Geheimdienst FSB angehören, neue Haken und Stolperfallen ein. Zumindest für Bürger aus sogenannten «unfreundlichen Ländern», zu denen Deutschland zählt. Als Deutscher in Russland wird man zur Projektionsfläche der Paranoia und zum Pappkameraden für die Rache des Regimes. Revanchieren sie sich für Leopard-Panzer an die ukrainische Armee, für Iris-T und Patriot-Abwehrraketen für die ukrainischen Städte, für die Sanktionen gegen Russland? All das geht mir durch den Kopf, während ich an der Passkontrolle stehe.
Die Grenzschützerin legt den Hörer auf und schiebt meinen Pass noch gefühlte zehn Mal hintereinander auf das Lesegerät. Ich drehe mich um, hinter mir ist schon eine Schlange entstanden. Nach fünf Minuten kommt ihr Vorgesetzter. Ein Mann mit dunkler Uniform und einer Kamera in einem Mikrofon, das ihm vor der Brust baumelt. Der Offizier nimmt meine Papiere, schüttelt den Kopf und bittet mich mitzukommen. Er führt mich an einer Gruppe von zentralasiatischen Männern vorbei, die offenbar auch warten müssen. Sie sind Pendler oder Migranten, die für Arbeit nach Moskau wollen. Im Saal vor der Passkontrolle haben sie sich auf mehrere Bänke verteilt. Mich geleitet der Offizier eine Treppe hinunter, zeigt auf eine Tür. «Dahinein!», weist er mich an. Ich betrete einem Raum mit einem alten Aktenschrank, einem Bett mit einer fleckigen alten Sprungfedermatratze und einem Schreibtisch. Ich denke mir nur, hoffentlich verbringe ich hier nicht die Nacht. Der Offizier nimmt hinter dem Schreibtisch Platz und zeigt auf einen Stuhl, den ich mir aus einer verstaubten Ecke heranziehe. Dann hat er Fragen:
Wo wohnen Sie?
In Moskau.
Mit welchem Ziel reisen Sie in die Russische Föderation?
Berichterstattung.
Worüber schreiben Sie?
Politik, Wirtschaft, Gesellschaft.
Wohin reisen Sie in Russland?
Nach Moskau, vielleicht nach St. Petersburg, das hängt von den aktuellen Ereignissen ab.
Was denken Sie über die militärische Spezialoperation?
Dass schon sehr viele Menschen gestorben sind.
Haben Sie Kontakte zum Bundesnachrichtendienst?
Nein.
Sind Sie verheiratet, haben Sie Kinder?
Ich beantworte keine Fragen, die mein persönliches Leben betreffen. Ich bin hier zum Arbeiten.
Der Offizier schweigt. Mir fällt auf, wie eiskalt dieser Kellerraum ist. Er schweigt immer noch. Nach gefühlten zehn Minuten nickt er und klappt sein Notizbuch zu.
Keine Fragen mehr, warten Sie bitte.
Eine halbe Stunde sitze ich noch auf einer Bank neben den Männern aus Zentralasien. Dann kommt ein anderer Beamter auf mich zu, gibt mir meinen Pass und sagt: «Sie können gehen.» Ich gehe zu der Passkontrolleurin zurück, sie bestempelt meinen Pass und gibt mir eine sogenannte Migrationskarte, ein Extrapapier der russischen Grenzbehörden. Und schon ist die sogenannte «Sonderüberprüfung» vorbei.
Die Einreise ist die erste Berührung in Russland mit Vertretern des Geheimdienstes, und ich setze in Moskau immer viel daran, sie zum letzten Kontakt bis zur nächsten Ausreise werden zu lassen. Es ist ein Gradmesser, wie willkommen ich hier als Korrespondent bin. Es ist aber auch eine Übung im Spiel von Einschüchterung und innerer Resilienz, weil solche Kellergespräche natürlich auch ein Test sind, wie ich auf Druck und eisiges Schweigen reagiere. Die Notiz des Offiziers darüber ist am Ende in den Akten womöglich wichtiger als meine Antworten. Auf jeden Fall aber verfolgen die russischen Behörden das Ziel, das Leben für westliche Korrespondentinnen und Korrespondenten möglichst unberechenbar und strapaziös zu gestalten.
Aus Moskau zu berichten, war nie einfach. Das muss man bei allen Schikanen wissen, die westliche Berichterstatter heute über sich ergehen lassen müssen. Als die ZEIT mich 1996 das erste Mal nach Moskau schickte, waren die Zeiten unübersichtlich und voller Überraschungen. Ich fuhr nach Tschetschenien, um über den Krieg Russlands gegen die abtrünnige Republik zu berichten. Mehrere Journalisten kamen dort ums Leben. Ich ging eines Abends an einem Restaurant vorbei, in dem gerade eine Schießerei stattfand. Ich war auf der Hut vor Bürokraten, die nicht den Gesetzen Geltung verschafften, sondern auf Raubzügen in eigener Sache unterwegs waren. 1998 rief mich ein FSB-Offizier an und fragte, ob er nicht mal zum Tee vorbeikommen könne. Ich sagte etwas zögerlich: «Ja, warum nicht», war natürlich sehr nervös, räumte das ZEIT-Büro auf, entsorgte Zettel und Cassetten mit Interview-Aufnahmen, die ich für kompromittierend hielt, und empfing ihn. Er schaute sich neugierig in unserem kleinen Büro um. Wahrscheinlich hatte er ein repräsentativeres Ambiente erwartet. Dann fragte er nach meinem Befinden und meinem Alltag, so als hätten wir uns zufällig auf der Straße gesprochen. Nippte am Tee und bat um mehr Zuckerstücke. Aß alle Kekse auf. Völlig harmlos eigentlich. Am Ende verabschiedete er sich freundlich und ließ nie wieder von sich hören. So gefiel mir der FSB.
Unangenehmer war ein Anruf vom Zoll 1999. Ich hatte damals noch einen Dienstwagen, den mein Vorgänger hinterlassen hatte, einen weißen Mercedes 180, das Einsteigermodell ohne Klimaanlage, mit Fensterkurbel und graukarierten Sitzen. Aber ein Mercedes in Weiß, das weckte Aufmerksamkeit. Der Zollbeamte am Telefon forderte mich auf, mit dem Wagen bei der Moskauer Zollbehörde vorzufahren. Auf dem Parkplatz begrüßte mich ein Mann in schwarzen Designerklamotten mit Goldkettchen von Versace. Der Beamte hatte es offenbar auf westliche Edelmarken abgesehen. «Die Gesetze haben sich geändert», erklärte er mir maliziös lächelnd. Die Autos von Ausländern würden zollrechtlich neu eingestuft, ich müsse für den Wagen nachträglich Zoll bezahlen. Er nannte eine Summe, die den ursprünglichen Kaufpreis des Wagens deutlich überstieg. Ich lehnte ab. «Na, dann lassen Sie ihn hier gleich stehen», sagte er und strich mit den Fingern über die Motorhaube. Mir war klar, dass der Mann den Wagen umgehend in sein Privateigentum überführt hätte. Ich schüttelte den Kopf, bedeutete ihm höflich, seine Hand von der Haube zu nehmen – und fuhr aufgewühlt vom Zollhof. Im Büro angekommen, telefonierten meine Assistenten und ich die deutsche Botschaft, Anwaltsbüros und Behörden ab. Keiner wusste Rat.
Aber mein Fahrer suchte beharrlich einen Ausweg. Er stellte sich vor die Zollbehörde, sprach mit anderen Fahrern, die alle das gleiche Problem hatten. Bekam den Tipp, dass vor kurzem mehrere Beamte der Zollbehörde den Dienst quittiert hätten. Lernte einen davon kennen, den er mir alsbald vorstellte. Wir nannten ihn «Pascha Mercedes», in Anlehnung an den General der Westgruppe der sowjetischen Streikkräfte, der 1994 einen schwunghaften Handel mit gebrauchten Mercedes-Limousinen für Russland betrieb. Unser Pascha hatte bei Dienstende nicht nur offizielle Stempel der Zollbehörde mitgehen lassen, mit denen er nun Zollopfern helfen konnte, er hatte auch einen Plan, über den er nicht sprechen wollte. Wenige Tage darauf fuhren mein Fahrer und Pascha mit dem weißen Mercedes aus Moskau raus Richtung Ukraine, ohne mich. Kurz vor der russisch-ukrainischen Grenze zog Pascha die Stempel aus der Aktentasche, brachte Laptop und Nadeldrucker in Stellung, druckte die nötigen Ausfuhrbescheinigungen aus und bestempelte sie. Mit diesen Papieren rollte unser weißer Mercedes formgerecht über die Grenze. In der Ukraine kaufte mein Fahrer dem Verlag den längst abgeschriebenen Wagen für umgerechnet eine Mark ab. Pascha Mercedes ließ die Zollpapiere für die Wiedereinfuhr nach Russland aus seinem Nadeldrucker rattern, darüber ließ er die nötigen Stempel und Unterschriften regnen. Als russischer Staatsbürger durfte mein Fahrer den gebrauchten Wagen ohne Zollgebühren ins Land bringen – und beide fuhren mit dem frisch entzollten Wagen wieder zurück nach Moskau. So erzählten sie es mir hinterher. Niemand wurde bestochen, niemand kam zu Schaden, niemand vermisste etwas, außer vielleicht der korrupte Zöllner mit dem Goldkettchen. Wir konnten den Wagen noch jahrelang benutzen, ohne dass der Zoll uns noch einmal behelligte. Das war so eine typische Neunziger-Jahre-Lösung. Kreativer Umgang mit Formularen und Stempeln sind heute im paragraphengesättigten Putin-Staat nur noch den führenden Schichten vorbehalten.
Der große Unterschied zwischen den 1990er und den 2020er Jahren: Damals konnte ich unbeschwert aus Russland berichten. Ich war willkommen und noch kein Vertreter eines «unfreundlichen Landes». Ich schaute mich bei Recherchen nicht dauernd um, ob mir jemand folgte. Ich musste meine Akkreditierung nur einmal im Jahr und nicht alle drei Monate verlängern. Persönlich bedroht waren damals nicht Korrespondenten, sondern Geschäftsleute, die anderen Geschäftsleuten in die Quere kamen. Gewiss, die Berichterstattung aus dem Tschetschenienkrieg war risikoreich, aber keineswegs gefährlicher als meine Korrespondentenjahre vor 1996 im kriegszerrütteten Ex-Jugoslawien. Damals in den 1990er Jahren waren westliche Korrespondenten in Moskau genauso wie alle russischen Bürger der allgemeinen Unübersichtlichkeit des Lebens ausgesetzt. Heute sind wir dauerhaft im Visier der Geheimdienste und eines zunehmend totalitären Staates, wir sind mögliche Geiseln im hybriden Krieg, den Russland gegen den Westen führt.
Kein Fall macht das auf furchtbarere Weise deutlich als die Geschichte von Evan Gershkovich. Evan ist ein sympathischer und scharfsinniger Kollege, ein aufstrebender Korrespondent für das Wall Street Journal, der zuvor für die lokale Zeitung Moscow Times gearbeitet hatte. Als Sohn russischer Emigranten in den USA geboren, hatte er in Russland seine große Chance gefunden. Nach dem Überfall auf die Ukraine stellte ihn das Wall Street Journal an. Evan Gershkovich machte eine Blitzkarriere und fuhr wie viele von uns in die russische Provinz. Er brachte großartige Geschichten zurück, die in den USA ein breites Echo fanden. Als er im März 2023 verhaftet wurde, ein gutes Jahr nach Russlands neuerlichem Überfall auf die Ukraine, war er wieder unterwegs im Land. Er wurde bei einer Recherche über die russische Rüstungsindustrie in Jekaterinburg am Ural wegen Spionage verhaftet. Kurz zuvor war in den USA ein russischer Staatsbürger, Sergej Tscherkassow, wegen Spionage angeklagt worden. War es eine Racheaktion der russischen Behörden? Oder ging Gershkovich dem Geheimdienst wegen seiner Recherche bei der Rüstungsindustrie ins Netz? Womöglich beides. Auf jeden Fall machte Wladimir Putin ein Jahr später klar, dass Gershkovich seine persönliche Trophäe war, die der russische Herrscher gegen seiner Ansicht nach gleichwertige Inhaftierte im Westen einzutauschen gedachte. In einem Interview mit dem rechtsradikalen amerikanischen YouTuber Tucker Carlson erklärte Putin im Februar 2024, dass Russland mit den USA über einen möglichen Austausch von Gershkovich im Gespräch sei. Aber Tscherkassow war ihm offenbar nicht wertvoll genug für seine Trophäe. Putin erwähnte ausdrücklich den Tiergartenmörder als Austauschkandidaten. Wadim Krassikow hatte 2019 einen tschetschenischen Oppositionellen mitten in Berlin ermordet und saß seitdem als verurteilter Mörder in einem deutschen Gefängnis. So sieht es Putin: «Diese Person hat aus patriotischem Antrieb einen Banditen in einer europäischen Hauptstadt beseitigt.» Was Putin sich in einem Dreierdeal zwischen Russland, den USA und Deutschland vorstellen konnte, lehnte die deutsche Regierung ab. Seither war klar, was alle ohnehin vermuteten: dass Putin den russischen Geheimdienstmann und Auftragskiller Krassikow freipressen wollte und Gershkovich eines seiner Faustpfänder dafür war. Und genau zu diesem Deal kam es Ende Juli 2024, als Gershkovich mit 16 anderen westlichen Geiseln und russischen politischen Gefangenen gegen russische Kriminelle und Spione in westlicher Haft ausgetauscht wurde.
Für die deutschen Korrespondenten war Gershkovichs Schicksal ein doppelter Schock. Er war der erste westliche Korrespondent seit dem Ende des Kalten Krieges, der wegen Spionage angeklagt wurde. Und da Wadim Krassikow in einem deutschen Gefängnis saß, schien die Gefahr besonders hoch zu sein, dass Putin auch einen deutschen Korrespondenten als Geisel nehmen könnte. Damit war die rote Linie eines sicheren Aufenthalts in Russland überschritten. Im Krieg, in Krisen berichten Journalisten unter großen Gefahren, doch betrifft diese Gefahrenlage alle Menschen vor Ort. Journalisten teilen die Risiken mit der lokalen Bevölkerung. In kriegerischen Auseinandersetzungen gab es schon viele Attacken, in denen Journalisten gezielt getötet wurden. In den meisten Fällen jedoch sind sie nicht Opfer eines Angriffs, weil sie Journalisten sind, sondern weil an ihrem Aufenthaltsort viele Menschen zwischen die Fronten geraten. Heute in Russland dagegen sind Journalisten, egal an welchem Ort, das Ziel der Aggression und der von der Regierung ausgehenden Gefährdung. Und das macht ihre Arbeit zum persönlichen Risiko, das sie nur mit wenigen anderen Menschen teilen. Für russische Oppositionelle, Journalisten und Aktivisten sieht es noch viel ernster aus.
Genau das sind die Gründe, warum ich in Moskau stets darauf achte, nicht unnötig irgendwelchen Beamten in die Arme zu laufen. Warum ich vor dem Zebrastreifen vom Rad springe, weil es verboten ist, über den Zebrastreifen zu fahren. Warum ich bei Reisen in die russische Provinz extrem vorsichtig bin, um nicht mit Polizisten in Kontakt zu kommen, die nicht wissen, was sie mit mir tun sollen, einem Korrespondenten aus einem «unfreundlichen Land», wie die russische Regierung Deutschland nennt. Warum ich mich in der Provinz ständig umsehe, ob mir nicht jemand folgt. Warum ich nicht mit einem Tross von Helfern und Fotografen reise, wodurch ich für jeden aus der Ferne sofort als Journalist erkennbar bin. Das können Korrespondenten für Fernsehen und Hörfunk leider oft nicht vermeiden.
Gerade die Reisen in die Provinz sind ein besonderes Risiko. Kollegen vom Fernsehen berichten von massiven Versuchen, Dreharbeiten zu verhindern. Wenn sie Interviews auf Plätzen und Straßen führen, laufen lokale Störer ins Bild, fragen: «Ach, Sie sind aus Deutschland?» Bleiben stehen und fragen die russischen Interviewpartner: «Warum reden Sie mit Medien aus unfreundlichen Ländern?» Fragen die westlichen Journalisten: «Warum liefert Deutschland Waffen an die Ukraine?» Solche Störer können die Vorboten von Schlimmerem sein. Zum Beispiel einer Befragung durch die Polizei und den örtlichen Geheimdienst, mit unabsehbaren Folgen.
Doch auch bei der Rückkehr nach Moskau kann es zu Überraschungen kommen. Als ich eines Abends die Wohnungstür aufschließe, wundere ich mich etwas über meine Jacke, die ziemlich schief an der Garderobe baumelt. Ich hänge die immer gerade hin. Das Licht ist an. In der Küche steht auf dem Glastisch die Papiertüte eines Moskauer Luxus-Supermarkts. Solche Tüten kaufe ich nie, ich habe immer meine eigenen Taschen dabei. Ich schaue hinein und sehe mehrere Packungen Kekse. Nicht von mir, ich mag keine Zuckerkekse. «Da haben sie schlecht recherchiert», denke ich mir. Kein Zweifel, dass jemand während meiner Reise in die Wohnung eingedrungen ist. Ein Jemand, der mich wissen lassen will, dass er hier war. Natürlich habe ich die Kekse nicht angerührt, sondern fotografiert und entsorgt. Ich informierte meinen Vermieter und die Concierge am Eingang. So ein Fall kam nicht wieder vor. Ich glaube nicht, dass sie damit zu tun hatten. Aber ich fühlte mich von diesem Tag an in der eigenen Wohnung nicht mehr zuhause.
Inmitten der Gefahren gibt es aber auch eine Art Moskauer Alltagsnormalität, die, von außen betrachtet, viel mehr einem Bürojob als einem Actionfilm gleicht. Hier besteht der Schmerzreiz eher in einer dauerhaften Berührung mit der russischen Bürokratie. Ich gehe sehr gern ins Büro der ZEIT in Moskau, aber ich rechne stets damit, dass meine Assistentin eine unangenehme Überraschung für mich bereithält. Neuigkeiten von der Bank, von der Registrierungsbehörde, vom Außenministerium – alles kann einem den Tag verderben oder gleich die ganze Woche. Für die Kontoführung verschärfen sich von Jahr zu Jahr die Bedingungen. Erst wollte die Bank nur eine Unterschrift des Chefredakteurs, natürlich notariell beglaubigt. Dann verlangte sie zusätzlich eine Apostille vom Amt, eine Beglaubigung höheren Ranges, mit Siegellack feierlich aufs Dokument gedrückt. Dazu bitte auch noch die Gründungsurkunde der Zeitung von 1947, mit Apostille bitte schön. Und das Statut, das wir gar nicht haben und eigens für diesen Anlass produzieren. Mit Apostille und Siegel sieht es zu meiner Überraschung ziemlich gut aus. Den Auszug aus dem Handelsregister nicht zu vergessen. Schließlich reicht der Chefredakteur nicht mehr aus, es muss alles vom Verlagsleiter unterschrieben werden. Mit privater Anschrift, persönlichen Daten und Kopie des Ausweises. Meine Assistentin, die Verlagsmitarbeiterinnen und ich verbringen Wochen damit, alle nötigen Dokumente zu sammeln, zu bestempeln, zu besiegeln und nach Moskau zu bringen. Unsere Bank in Moskau verfügt mittlerweile über einen Datenschatz der ZEIT, den nicht einmal das Hamburger Verlagshaus so gesammelt hat.
Listenreicher noch ist die Prozedur der Verlängerung von Visum und Akkreditierung, mit dem das Außen- und das Innenministerium die westlichen Korrespondentinnen und Berichterstatter alle drei Monate peinigen. Russische Journalisten in Deutschland haben mindestens ein Jahr Zeit bis zur nächsten Verlängerung. Das hatten wir auch. Doch nach dem Überfall auf die Ukraine verkürzten die Behörden die Frist für Berichterstatter aus unfreundlichen Ländern auf drei Monate. Leider haben die Regierungen der EU-Länder und Deutschlands darauf nie mit Gegenmaßnahmen reagiert. Im Alltag sieht das dann so aus:
Viele Wochen vor Ablauf des Visums reichen meine Assistentin und ich die Bitte um Neu-Akkreditierung beim Außenministerium ein. Dann hören wir wochenlang nichts und warten. Wenige Tage vor Ablauf des Visums rückt das Außenministerium die Akkreditierung endlich heraus. Kaum halten wir sie in der Hand, hetzen wir zum Innenministerium, bewehrt mit Dokumenten, notariellen Beglaubigungen, der Einreisekarte, einer Registrierung, dem Visum, dem Einreisestempel der Akkreditierung und dem Reisepass. Alles kopiert und unterschrieben. Dazu eine formelle Entschuldigung dafür, dass der Antrag auf Visumverlängerung so spät gestellt wird, mit höflichem Hinweis auf die Prozeduren des Außenministeriums. In der Visumstelle studiert die Beamtin stundenlang die Papiere und bittet, übermorgen wiederzukommen, am letzten Tag der Gültigkeit des Visums. In der Nacht des Abholtages liefe es ab, und ich wäre illegal im Land. Gefährlich. Also muss es klappen mit dem Visum. Doch mittags ist es immer noch nicht da. Der behördliche Drucker streikt angeblich. Ich buche ein Flugticket nach Istanbul, der schnellste Weg raus aus dem Land. Meine Assistentin belagert die Visumstelle des Innenministeriums. Gibt es keine andere Behörde, wo der Drucker funktioniert? Ich telefoniere mit der Botschaft, mit anderen Korrespondentinnen, die Ähnliches erlebt haben. Stelle mich darauf ein, dass ich heute Nacht ohne neues Visum das Land verlasse, endgültig. Kurz vor Dienstschluss die Nachricht: Das Visum sei fertig, wir können es abholen. Auf Wiedersehen in drei Monaten. So oder ähnlich läuft es öfter. Sisyphos in Moskau: Man sammelt einen Wust von Papier, rollt ihn den Berg hinauf, bevor der Wust plötzlich wegrutscht, wieder herunterrollt und man von vorn anfängt.
Einmal vermisste ich eines der zahlreichen Papiere: die Migrationskarte. Ich versäumte bei der Einreise, sofort am Schalter zu überprüfen, ob der Grenzbeamte die Migrationskarte ordnungsgemäß neben den Visumstempel in den Reisepass gelegt hatte. Hatte er leider nicht. Als ich die Registration beantragen wollte, fehlte mir die dafür unabdingbare Migrationskarte. Ein Abgrund tat sich vor mir auf. Ohne Migrationskarte ist man als Ausländer in Moskau ein Nichts. Ich informierte mich als Erstes im Netz, wo die Folgen eines Verlusts der Migrationskarte als nervtötend bis furchterregend beschrieben wurden. Monatelange Behördengänge, lautete die gutmütige Voraussage, Festnahme und Verfahren wegen illegalen Aufenthalts war die härtere Variante. Schließlich ging ich zur Polizei, bekannte mich als journalistischer Migrant ohne Migrationskarte und wartete auf mein Urteil. Ich hatte Glück. Nach kurzer Zeit schon durfte ich auf eine weitere Polizeistation gehen, wo ich den Verlust der Karte handschriftlich auf einem Formular erklärte. Ohne Abschrift, Apostille oder notarielle Beglaubigung – das rechnete ich der Polizei hoch an. Damit ging ich zur Migrationsbehörde und bekam eine Zweitschrift der Migrationskarte. Und schon konnte ich wiederum meine Registrierungskarte beantragen. Draußen brach die Sonne hinter den Wolken hervor, ich glaubte, ganz Moskau liege mir zu Füßen.
Aber ich kann mir vorstellen, was Sie denken: Wenn ich in Moskau so viel mit der Organisation meiner eigenen Sicherheit beschäftigt bin, warum lasse ich mich überhaupt darauf ein? Wenn es so gefährlich ist, warum kommen noch deutsche Korrespondentinnen und Korrespondenten nach Russland? Warum tun wir uns das an?
Eine Antwort ist: Weil Russland das Land ist, das Europas Schicksal in den kommenden Jahrzehnten wesentlich mitbestimmen wird. Weil Reden und Entscheidungen in Moskau regelmäßig Schockwellen um die ganze Welt senden. Weil sich die Grenzen in Europas Schicksalsland auch für Journalisten schließen können. Weil jeder Tag in dieser Stadt der letzte vor der endgültigen Ausreise sein kann. Weil wir uns im Westen viele falsche Vorstellungen von diesem Land machen. Weil es neben Zeiten maximalen Drucks auf die Korrespondenten auch Zeiten gibt, in denen man ruhiger arbeiten kann, je nach Laune des Regimes. Weil es wichtig ist, die Stimmung in der Bevölkerung aufzufangen, die kleinen Fluchten des Alltags, die Sehnsucht nach Normalität, die Besessenheiten der Bürokraten, die Selbstlügen der normalen Bürger, die Ressentiments gegen Ausländer und die revanchistischen Gefühle zu verstehen. Die Vorstellung, man dürfe mit niemandem mehr reden und würde deshalb nichts mehr herausfinden, ist falsch. Der Aufenthalt vor Ort öffnet dem Berichterstatter das Land auf ganz andere Weise als die Beobachtung im Internet und über soziale Netzwerke. Genau deshalb hat der russische Staat so vielen westlichen Experten, Forscherinnen, Politikern und Korrespondentinnen ein offenes oder faktisches Einreiseverbot erteilt.
Es gibt zwei Befindlichkeiten, die mich bei meinen Aufenthalten in Moskau die ganze Zeit begleiten. Hier die Vorsicht und Zurückhaltung, die mein Handeln und die Bewegung im Land bestimmen. Dort das Eintauchen in Moskau als einer anregenden und aufregenden Stadt. Es mag widersprüchlich wirken: Für Korrespondenten, gerade für jene, die Russisch sprechen, ist diese Stadt wie ein aufgeschlagenes Bilderbuch. Ich fahre mit weit aufgesperrten Augen und Ohren Metro, laufe in Parks, fahre Rad, spreche mit Menschen – und höre und staune. Moskau ist nicht nur die größte Stadt in Europa, sondern auch die monumentalste. Ich kann mich nicht an ihr sattsehen: an den breiten Prospekten und den verzweigten Wohnstraßen mit den grünen Hinterhöfen dahinter, an den kühnen konstruktivistischen Bauten der 1920er Jahre von Konstantin Melnikow und Moisei Ginsburg, an den Zuckerbäckerhochhäusern aus der Stalinzeit, an den geduckten Kapellen und den lächerlich monströsen Denkmälern regimekonformer Künstler, am Marmorklotz der wiedererbauten Christi-Erlöser-Kathedrale mit Goldkuppel – und zur Erlösung von so viel Prunk an der kleinen Art-déco-Tankstelle gegenüber. Nicht sattsehen an den vielen Menschen, die aus allen Teilen Russlands unaufhörlich in diese Stadt strömen. Moskau ist die Stadt der Aufsteiger in ihren Luxuslimousinen und die Stadt der Gefallenen, die von der Polizei abgeräumt werden, sobald sie straucheln. Moskau ist auch die Stadt der russischen Mittelklasse, die nicht von Krieg und Tod belästigt werden möchte. Restaurants und Kristalllüster-Cafés, Sommergärten und Tanzparketts am Moskwa-Ufer bieten den Moskauern Rückzugsräume, in denen sich vergessen lässt, was alles in diesem Land an Furchtbarkeiten passiert und wie seine Führung die Ukraine, Russland und Europa ins Unglück stürzt. Wer nichts lesen, hören und sehen will, kann die Stadt in vollen Zügen genießen. Das ist die Scheinwelt von Normalität, die Inszenierung einer westlichen Großstadt, die das Regime seinen Bürgern bietet, damit sie stillhalten.
Ich selbst halte mich in Moskau auf, um unter anderem Wladimir Putin und seine Politik zu beschreiben. Im russischen Fernsehen ist der Herrscher allgegenwärtig, er füllt die Nachrichtensendungen in zensierten Clips, aber für ausländische Berichterstatter ist es heute nahezu unmöglich, ihn zu treffen. Korrespondenten aus «unfreundlichen Ländern» wie Deutschland gibt er keine Interviews. Dabei hatte ich ihn schon vor über zwanzig Jahren zum Interview getroffen – und danach bei einigen Konferenzen und Diskussionen. Heute ist das kaum noch möglich. Bei der Maiparade auf dem Roten Platz 2022 musste ich zwar davor drei Corona-Tests machen, um ihn auf keinen Fall anzustecken, kam ihm aber nur bis auf 150 Meter nahe. Sehen konnte ich ihn nicht, da er aus meiner Perspektive von großen Propagandaplakaten verdeckt war. Zur alljährlichen Pressekonferenz um die Zeit des westlichen Weihnachtsfestes wurde ich nicht eingeladen. So wie ich zu vielen Veranstaltungen, Wirtschaftsforen und internationalen Konferenzen keinen Zutritt bekomme. Und wenn ich Putin aus der Ferne sehe und schon beinahe winken will, fährt er einfach immer weiter.
An einem Wintertag sitze ich mit einer Kollegin in einem Café in der Nähe meines Büros. Wir schauen auf den Kutusowskij-Prospekt, eine zehnspurige Straße, deren Verlängerung direkt zum Kreml führt. Plötzlich Martinshörner, flackerndes Blaulicht, dann tauchen Polizeiwagen auf. Danach eine Kolonne aus schwarzen Wagen, alle aus der staatlichen Autoschmiede Aurus, die eine Art russischen Rolls-Royce mit deutscher Technik baut. Drei normale Limousinen, eine Stretch-Limousine, fünf Minivans, alle schwarz wie die Nacht – das ist die Präsidentenkolonne von Wladimir Putin! Mit hoher Geschwindigkeit rasen sie stadteinwärts zum Kreml.
Aber in welchem Fahrzeug sitzt er nun? In der Propagandashow Moskwa-Kreml-Putin höre ich, er fahre nicht unbedingt immer in der Stretch-Limousine, sondern abwechselnd in verschiedenen Karossen. Und die einander ähnlichen Autos wechseln ständig die Nummernschilder. Die Wagenbelegung sei streng geheim. So wisse man nie, wo er sitzt, sagt der Reporter. Hätte ich mir auch denken können: Geheimagent eben.
Tage später scheint es mir, ich hätte doch eine Chance, Putin wenigstens aus der Ferne im Profil zu sehen. Die präsidiale Aurus-Kolonne muss auf dem Kutusowskij-Prospekt wegen Regens und langsam fahrender Autos abbremsen. Die Polizeiwagen vorneweg räumen den Weg frei. Ich bin auf dem Rad unterwegs und trete in die Pedale, um zur Kolonne aufzuschließen. Für einige Sekunden bin ich tatsächlich auf Höhe der Aurus-Limousinen. Doch wo sitzt Putin? Die verdunkelten Fenster sind so undurchdringlich wie die Kreml-Mauern. Dann hat die Polizei die Straße freigeräumt, und die Kolonne gibt wieder Gas.
War es überhaupt Putin? Er soll regelmäßig Leerfahrten durch Moskau machen lassen. Zum Beispiel damit naive Korrespondenten wie ich denken, er sei auf dem Kutusowskij-Prospekt unterwegs, und sich dafür einen abstrampeln. Dabei sitzt er in Wirklichkeit im Kreml und befiehlt gerade, Kraftwerke in Kyjiw zu bombardieren. Oder die Kolonne fährt nur zur Ablenkung in Moskau herum, und Putin fliegt listig mit seinem Mi-8-Hubschrauber von seiner Residenz vor der Stadt direkt in den Kreml. Er hat vor Jahren speziell dafür einen Hubschrauber-Landeplatz im Kreml anlegen lassen. Im Weltkulturerbe-Areal hinter der roten Mauer zum Moskwa-Fluss.
Es gibt Leute, die warten vor der Kreml-Mauer am Roten Platz darauf, dass Putins Limousine aus dem historischen Spasskij-Tor herausrollt. Anfängerfehler. Da fährt er, wenn überhaupt, nur zu ganz besonderen Anlässen durch. Wenn er den Kreml im Auto verlässt, dann durch das Borowitzkij-Tor nahe der Lenin-Bibliothek. Ich wohne in der Nähe und muss auf dem Weg zum Roten Platz immer wieder an der Fußgängerampel vor dem Tor warten. Die zeigt an, wie viele Sekunden man zu warten hat.
An einem Wintertag stehe ich in einer Traube von Fußgängern am Borowitzkij-Tor. Die rote Ampel zeigt 120 Sekunden, das geht noch. Alle warten brav. Nach zwei Minuten schaltet die Ampel nicht auf grün, sondern bleibt einfach rot, ohne Zeitangabe. Rechts sehe ich, wie sich das Borowitzkij-Tor öffnet. Mit der Zeit sind alle etwas genervt. Blicken die Polizisten an, die die Kreuzung überwachen. Die taxieren die Fußgänger. Keine Kolonne, kein Auto kommt aus dem Tor. Weiter warten. Plötzlich hat ein Fußgänger die Faxen dicke und geht los. Die Polizisten sind überrascht, fassen sich an die Ohrstöpsel und scheinen auf einen Befehl über Funk zu warten. Aber bevor der kommt, sind alle Fußgänger losgegangen, bestimmt vierzig Menschen. Zwischenfall am Kreml! Die Autoampel für das Borowitzkij-Tor schaltet kurz auf Rot, die Polizisten sprechen über Funk, ein Offizier gestikuliert. Als alle Fußgänger die Kreuzung überquert haben, kommen endlich die Autos aus dem Borowitzkij-Tor. Schwarze Aurus-Limousinen, eine davon die Stretch-Limousine. Ob wir Fußgänger Putin gezwungen haben zu warten? Aber wahrscheinlich sitzt er gar nicht in der Kolonne, der Fuchs.