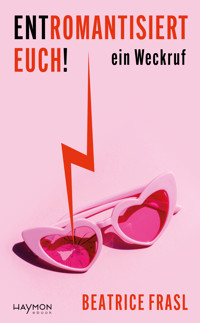
19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Märchen von der großen Liebe Kaum etwas wird mehr romantisiert als romantische Liebe … Die Liebe – sie wird seit Jahrhunderten leidenschaftlich in Liedern besungen, in der Literatur wird ihr gelobhudelt, und in Filmen wird sie selbst in ihren toxischsten Ausformungen glorifiziert. Wir haben die romantische Liebe trotz ihrer Volatilität und meist relativ kurzen Dauer zu einem zentralen gesellschaftlichen Organisationsmodell gemacht. Romantische Liebe ist das, was uns pausenlos und von klein auf als unerlässlicher Bestandteil von Lebensglück und Erfüllung ins Hirn gehämmert wird. Dabei ist ihre Realität alles andere als romantisch – und das vor allem für Frauen. … kaum etwas hat diese Romantisierung weniger verdient! Heteroromantische Beziehungen bilden den Rahmen dafür, dass Frauen zwei Drittel der unbezahlten Arbeit übernehmen, weniger verdienen und in Abhängigkeiten rutschen. Unverheiratete Frauen ohne Kinder sind dagegen die glücklichste und gesündeste Bevölkerungsgruppe. Sie haben eine höhere Lebenserwartung als verheiratete, während verheiratete Männer länger leben als unverheiratete. Romantische Beziehungen mit Männern schaden Frauen: gesundheitlich, emotional und wirtschaftlich. Eine provokante Wutschrift aus feministischer Perspektive In diesem großartigen Essay arbeitet Beatrice Frasl diese Ungerechtigkeiten auf und plädiert für ein Umdenken. Denn: Romantische Liebe ist eine patriarchale Indoktrinationskampagne, deren Narrativ sich seit Jahrhunderten durchsetzt. Wie gut, dass wir sie nicht brauchen. Dass wir selbstbestimmt entscheiden können, was Liebe für uns bedeutet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Beatrice Frasl
Entromantisiert euch!
ein Weckruf zur Abschaffung der Liebe
Für Michi und Michi
Ein feministisches Buch, das sich nicht mit der Liebeauseinandersetzt, wäre ein politischer Fehlschlag.
Denn die Liebe ist – wahrscheinlich mehr noch als dasKinderkriegen – der Schlüssel zur Unterdrückungder Frauen heute. Ich weiß, daß dies eine erschreckendeFrage beinhaltet: Wollen wir die Liebe abschaffen?
Shulamith Firestone –Frauenbefreiung und sexuelle Revolution
Inhalt
Vorwort
I. Die große Liebe
0. „Wenn ich an Liebe denke, denke ich an meine Freund*innen.“
1. Nur Freunde
Amatonormativität und die Abwertung platonischer Liebe
2. Nur Freundinnen
Freundschaft als weiblicher Beziehungsmodus
3. Über das schönste Gefühl der Welt
Warum wir „Verliebtheit“ entromantisieren sollten
4. Zweisame Einsamkeit
Warum die romantische Zweierbeziehung einsam macht
5. Der Markt regelt
Die romantische Liebe und der Konsumkapitalismus
6. Sex, oder: Bitte lasst uns endlich in Ruhe damit.
Zur Zentrierung von Sexualität und dem Verlust körperlicher Nähe überall sonst
II. Das Elend der heterosexuellen Paarbeziehung
0. „Wie kannst du nicht wollen, was jeder Mensch auf diesem Planeten will?“
1. Arbeit. Aus Liebe
Ungleiche Arbeitsverteilung in heterosexuellen Paarbeziehungen
2. Bis dass der Tod uns scheidet
Gewalt in (heterosexuellen) Paarbeziehungen
3. Aber wenigstens der Sex ist schlecht.
Schlechter Sex in heterosexuellen Paarbeziehungen
4. Unglück im Glück
Warum die heterosexuelle Paarbeziehung Frauen unglücklich macht und sie trotzdem darauf sozialisiert werden, sie zu wollen
III. Danke, nein!
1. Die neue Unverfügbarkeit
Die Abwendung von der romantischen Liebe
2. Das Zeitalter der Postromantik
Auf dem Weg von der Liebe zur Liebe
Danksagung
Lieder zur Abschaffung der Liebe – der Soundtrack zum Buch
Hilfe
Anmerkungen
Quellen
Über die Autorin
Impressum
Vorwort
Sie werden mich hassen für dieses Buch über Liebe. Vielleicht werden Sie beim Lesen auch sich selbst hassen, für Ihre bisherigen Lebensentscheidungen zum Beispiel, oder die Person, neben der Sie jeden Tag einschlafen (wenn Sie das nicht ohnehin schon insgeheim tun).
Es gibt kaum etwas, mit dem sich frau unbeliebter machen könnte als mit einem Buch, das die Liebe schlechtredet. Aber keine Angst: Ich muss sie nicht schlechtreden, sie ist schon schlecht. Kaum etwas löst mehr nervöses Unbehagen aus als ein Weckruf zur Abschaffung der Liebe. „Das Gefühl der Panik, das uns ergreift, sobald die Liebe bedroht wird, ist ein klarer Hinweis auf ihre politische Bedeutung“1, schreibt Shulamith Firestone schon in den 1970ern. Das Gefühl der Panik ist allerdings nicht nur ein Hinweis auf ihre politische Bedeutung, sondern auch auf ihre politischen Funktionen, auf die ganz konkret patriarchalen Aufgaben, die die romantische Liebe gesellschaftlich und politisch erfüllt.
Nun habe ich in meinem Leben schon viel geschrieben, bei dem schon während des Schreibens davon auszugehen war, dass ich mir damit keine Freunde mache und vielleicht auch nur wenige Freundinnen – ich bin nicht erst seit gestern Feministin und ich bin nicht erst seit gestern Feministin in der Öffentlichkeit. Aber selten hat mich etwas auch selbst nervöser gemacht als die Veröffentlichung des Textes, den Sie hier gerade lesen. Weil ich die Reaktionen auf ihn bereits antizipiere.
Ich antizipiere zum einen den üblichen frauenfeindlichen Unsinn: Man wird mir erklären, wie man das immer tut, wenn Frauen es wagen, etwas Unliebliches, Unromantisches, womöglich sogar etwas Feministisches zu sagen, womöglich sogar öffentlich, womöglich sogar in einer unziemlichen Lautstärke, dass mein Aufruf zur Abschaffung der Liebe aus einer ganz persönlichen Frustration mit ebendieser Liebe und ganz persönlicher Reue über ganz persönliche schlechte liebesbezogene Lebensentscheidungen heraus entstünde. Wenn Frauen etwas zu sagen haben, wird das in aller Regel nicht für ein Ergebnis ihres Denkens gehalten, sondern für das Ergebnis ausschließlichen Fühlens. Weiters wird man mir erklären, diese meine Frustration sei auf einen Mangel an heterosexuellem Geschlechtsverkehr zurückzuführen. Dies wird immer wieder und immer gerne gegen feministische Argumente ins Feld gebracht, indem man die Feministinnen, die sie artikulieren, beispielsweise als „sexuell frustrierte Emanze“ bezeichnet, als wäre es nicht gerade Heterosex in seiner häufigsten Erscheinungsform, der Frauen vorrangig sexuell frustriert. Auf feministische Argumente reagiert wird auch, indem man die Frauen, die sie äußern, als „ungefickt“ oder dergleichen bezeichnet, als hätte Gefickt-Werden oder Ficken irgendeine disruptive Wirkung auf das Patriarchat, das die eigentliche Ursache für die meist tatsächlich vorhandenen Frustrationen (und den frustrierend schlechten Heterosex) darstellt. Ich habe beides versucht, und sowohl der Gender-Pay-Gap als auch männliche Gewalt gegen Frauen als auch ungerechte Arbeitsverteilung als auch Diskriminierung in der Medizin als auch Religion als auch sämtliche andere Pfeiler des Patriarchats waren danach unangekratzt weiter vorhanden. Meine Frustrationen über die Verhältnisse ebenso.
Dann wird man möglicherweise noch sagen, dass meine Beschäftigung mit dem Thema daher rühre, dass ich nur noch nicht den richtigen Mann getroffen oder mir nur irgendwelche Falschen ausgesucht hätte. (Dass sich eine Frau romantisch oder sexuell gar nicht für Männer interessieren könnte, entweder aufgrund von Homosexualität oder aufgrund guten Geschmackes oder aufgrund von Vernunft, ist ohnehin erst gar keine Denkmöglichkeit.) Wohlwollendere Patriarchen als jene, die Feministinnen als „ungefickt“ bezeichnen oder ihnen ausrichten, dass sie keinen Sex mit ihnen haben würden (was meist das Einzige ist, in dem sich Feministinnen und genannte Männer uneingeschränkt einig sind), werden vielleicht anmerken, der Richtige (Mann) würde mich schon noch von einer antiromantischen feministischen Zynikerin zu einer hingebungsvollen Romantikerin (und folglich Ehefrau und Mutter) machen, die alsbald den Wert der wunderschönsten Sache der Welt, nämlich der (natürlich romantischen und heteroromantischen) Liebe erkennen und in ihr aufgehen wird. Dieses Buch wird unter anderem zeigen, dass es keine „Richtigen“ gibt. Es gibt weder den Richtigen oder (Gott bewahre, die Option kommt in der Gleichung erst recht gar nicht vor!) die Richtige. Weil die gesamte Ideologie der romantischen Liebe, in deren Rahmen die Illusion des einen richtigen Menschen für einen anderen, eingespannt ist, falsch ist.
Ich antizipiere aber auch, und das ist dann schon die schwierigere Sache, dass selbst jene Menschen, die meine Texte sonst gern lesen und ihnen tendenziell zustimmen, die Entromantisierung der Liebe, na ja … nicht so gut finden werden. Und die Forderung ihrer Abschaffung erst recht nicht. Der Glaube daran, dass die Liebe eine gute und schöne und erstrebenswerte Sache sei, wird selten kritisch befragt, auch in feministischen Kontexten nicht. Und das, obwohl die romantische Liebe, insbesondere in ihrer heteroromantischen Normvariante, und die Ideologie, die sie umgibt, einen der wichtigsten Grundpfeiler im Patriarchat darstellen: Sie zentrieren Paarbeziehung und Kleinfamilie als gesellschaftliches Organisations-instrument und sozialisieren Frauen von klein auf zur Erfüllung männlicher Bedürfnisse und drängen sie dann ihnen gegenüber in eine dienende Rolle. „Denn die Liebe ist – wahrscheinlich mehr noch als das Kinderkriegen – der Schlüssel zur Unterdrückung der Frauen heute“, schreibt Shulamith Firestone. „Frauen und Liebe sind der Unterbau; werden sie analysiert, dann wird dadurch schon die gesamte Struktur der Kultur bedroht“, fährt sie fort. Wie sehr eine kritische Analyse der romantischen Liebe die „gesamte Struktur der Kultur bedroht“, spüre ich immer dann, wenn ich sie, in Gesprächen innerhalb von progressiven, feministischen Kreisen, sanft kritisiere. Von einem Aufruf zu ihrer Abschaffung ist noch gar keine Rede, da bekomme ich schon entgegnet, was für ein wunderschönes Gefühl es doch sei, sich zu verlieben, wie schön romantische Beziehungen seien, und dass man doch nicht, auf gar keinen Fall, dass man auf gar keinen Fall auf sie verzichten wollen könnte, auf die holde Liebe, die wunderwunderschöne Liebe, die wahre und echte und große. Das höre ich auch von jenen Frauen, die unter romantischen Beziehungen, vor allem unter romantischen Beziehungen mit Männern, chronisch leiden (und das tun die meisten Frauen in heterosexuellen Beziehungen).
Sie leiden, weil diese Beziehungen vor allem Arbeit bedeuten, weil sie oft tiefe Einsamkeit bedeuten, weil sie asymmetrisch sind, weil Frauen in ihnen in der Regel rund um die Uhr geben und wenig bis nichts zurückbekommen. Nicht einmal jene, die fürchterliche Gewalt in romantischen Beziehungen erfahren haben, können sich von der Illusion lösen, dass vielleicht doch irgendwann die große und wahre Liebe auf sie wartet, halten mit einer besessenen Verzweiflung am falschen Glauben fest, dass all die schlechten Erfahrungen bislang eine Anomalie seien, eine Perversion der Liebe gewissermaßen, und dass die Liebe selbst, in ihrer nicht-pervertierten Form, sie irgendwann finden und dann glücklich machen wird. Insgeheim beschleicht einen vielleicht schon die beklemmende Erkenntnis, dass es möglicherweise kein Zufall ist, dass so gut wie jede Erfahrung, die man mit der Liebe macht, am Ende dann doch eine schlechte ist (im besten Fall) oder eine hochgradig traumatisierende (im schlimmsten Fall), und dass das Schlechte eventuell ein viel immanenterer Bestandteil der romantischen Liebe ist als das Gute, dass die schlechte Erfahrung nicht die Ausnahme darstellt, sondern die Regel. Aber diese sich androhende Erkenntnis, diese ungeschönte Realitätswahrnehmung, die sich mit zunehmender Lebenserfahrung immer mehr in einem ausbreitet, schiebt man dann so schnell es geht wieder beiseite, zieht sich eine Romcom rein oder ein Liebeslied, meldet sich auf Tinder an oder auf Bumble oder auf Hinge. Schließlich hat man ein Leben lang ins Gehirn gehämmert bekommen, wie schön die Liebe sei, die große und wahre zumindest, schließlich wurde alles kritische Nachdenken über sie erfolgreich ausgemerzt, da wird man jetzt, auf seine alten Tage, nicht mit dem Denken beginnen. Wenn in der romantischen Liebe etwas nicht klappt, ist das immer ein Hinweis darauf, dass es nur in diesem einen Fall nicht geklappt hat. Wenn sie einem schadet, dann ist das nur ein Hinweis darauf, dass sie in diesem einen Fall geschadet hat. Und wenn sie jedes einzelne Mal schadet und jedes einzelne Mal nicht klappt, dann ist eben jedes einzelne Mal ein Einzelfall. Keineswegs ist mit der Liebe an und für sich irgendwas falsch, wo kämen wir da hin? Keinesfalls lässt sich hier eine Struktur erkennen, wo kämen wir da hin? Die romantische Liebe zu kritisieren, kommt Gotteslästerung gleich, und dementsprechend empört fallen auch die Reaktionen auf diese Kritik in aller Regel aus. Wenn die romantische Liebe nicht gutgeht (was sie im Grunde nie tut), dann darf es darauf nur zwei Antworten geben. Entweder es war doch nicht die große, die wahre Liebe, nicht die echte (zu deren Suche man fortan beauftragt ist), oder die Liebe war eben schon echt und man hat leider etwas falsch gemacht (das gilt vor allem für Frauen, die in der Liebe grundsätzlich die Aufgabe haben, als Liebesdienstleisterinnen zu fungieren, während Männer die Aufgabe haben, als Liebesdienstleistungsempfänger zu fungieren, also keine). Vielleicht hätte man mehr Beziehungsratgeber lesen sollen, besser kommunizieren lernen, gemeinsam in Therapie gehen, vielleicht hätte man sich nicht so gehen lassen sollen und sich öfter mal schick machen für den Ehemann und einmal mehr sexy Lingerie tragen und sich einmal weniger darüber beschweren, dass er im Haushalt keinen Finger gerührt hat. Vielleicht hätte man die eigenen Bedürfnisse klarer artikulieren sollen oder sich gemeinsame Sexdates in den Kalender schreiben, wie das die Beziehungscoaches auf Instagram sagen, weil in einer Langzeitbeziehung ist das immer so schwierig, vor allem, wenn dann Kinder auch noch da sind. Sie wissen Bescheid.
Man könnte all das aber auch einfach lassen. Und zwar von Anfang bis Ende.
Man könnte Tinder und Bumble und Hinge deinstallieren, aufhören, die romantische Liebe zu suchen, aufhören, auf die Liebe zu warten, aufhören, sie zu zentrieren, aufhören, das eigene Leben um die eigene Paarbeziehung zu organisieren oder um den Wunsch nach einer Paarbeziehung, und sich stattdessen auf all die Liebe abseits der Romantik konzentrieren, die man im eigenen Leben hat: auf die von Familienmitgliedern beispielsweise oder auf die der eigenen Wahlfamilie, der Freund*innen, die einen begleiten.
Denn die romantische Liebe führt dazu, dass uns die Liebe abhandenkommt: all die Liebe, die nicht romantischer Natur ist, nämlich. Die Fokussierung auf romantische Liebe, ihre Priorisierung und Privilegierung auf allen Ebenen (gesellschaftlich, kulturell, persönlich und rechtlich) und die Organisierung von Gesellschaft um sie herum lassen uns all die Liebe geringschätzen und vernachlässigen, die ihren Ausdruck jenseits von Romantik und Sexualität findet. Wir können nur gewinnen, auch an Liebe, wenn wir uns gegen diese Hierarchisierung und gegen das Romantikprimat wehren.
Zuvor allerdings, im ersten Teil dieses Buches, wird es um die romantische Liebe im Allgemeinen gehen – zuerst darum, wie sie ideologisch und sprachlich zur Norm wurde, wie sie unser ganzes Denken und Sprechen, all unseren Ausdruck von Liebe für sich beansprucht, wie andere Formen der Liebe durch sie marginalisiert oder bagatellisiert und unbesprechbar wurden. Danach folgt eine Auseinandersetzung mit der Frage, was diese Marginalisierung und Bagatellisierung mit Geschlechterverhältnissen, mit Patriarchat, patriarchalen Beziehungsnormen und der Dominanz und Normsetzung des Männlichen zu tun haben, wie die Herabsetzung nichtromantischer Bindung mit der Herabsetzung von Frauen und allem Weiblichem und Als-weiblich-Konnotiertem zusammenhängt. Wir machen uns also daran, das Primat der Romantik zu entromantisieren, die Privilegierung der romantischen Liebe gegenüber allen anderen Lieben und die Zentrierung der romantischen Beziehung als Ordnungsinstrument in unseren Leben auf einer individuellen und strukturellen Ebene zu hinterfragen.
Danach werden wir die Verliebtheit entromantisieren, darüber sprechen, was sie wirklich ist (ein hochgradig disruptiver, destabilisierender Zustand), und darüber, was sie nicht ist (ein metaphysisches Ereignis, Liebe, eine geeignete Grundlage für Lebensplanung, Lebensentscheidungen oder Familienbildung). Anschließend folgt die Entromantisierung der Zweisamkeit mit einer Auseinandersetzung darüber, wie uns die romantische Liebe in kleine Beziehungsinseln hinein- und aus anderen Bindungen herausreißt, kurz gesagt: darüber, wie einsam uns die romantische Liebe macht. Im Folgenden entromantisieren wir (post)modernes Dating als konsumistisches Menschen-Shopping und sehen, wie die romantische Liebe in ihrer derzeitigen Form uns und unseren Bezug zueinander sehr unromantisch zu Waren macht. Auch sexuelle Intimität wird entromantisiert, ihre Priorisierung über alle anderen Formen von Intimität, auch über alle anderen Formen von körperlicher Intimität, hinterfragt und aufgeworfen, was das Romantikprimat mit dem Verlust von Berührung jenseits des Sexuellen zu tun hat.
Der zweite Teil des Buches widmet sich vorrangig der romantischen Liebe in ihrer heterosexuellen Normvariante und der Frage, wie sie Männern nutzt und Frauen schadet: der ungleichen Arbeitsverteilung in ihr, der Gewalt in ihr und dem schlechten Sex in ihr. Anschließend stellen wir uns gemeinsam die Frage, warum Frauen trotzdem (oder vielleicht gerade deswegen) von klein auf hin zur (hetero)romantischen Liebe sozialisiert werden: darauf, sie zu wollen, darauf, sich für sie zurechtzumachen, darauf, sie zu erhalten, sie als Nonplusultra des eigenen Lebensglückes zu betrachten, und wem es nützt, dass weibliche Subjektkonstitution in einem solchen Ausmaß durch die Zurichtung zur Liebesdienstleisterin geprägt ist.
Der heterosexuellen Paarbeziehung wird nicht deshalb ein eigenes Kapitel gewidmet, weil sie mehr Besprechung verdienen würde als lesbische oder schwule Beziehungen oder weil ich Letztere unsichtbar machen wollen würde, sondern im Gegenteil, weil sie ein besonderes und besonders großes Übel darstellt. Und weil genau dieses Übel der heteroromantischen Paarbeziehung nicht nur die Mehrheit aller romantischen Beziehungen überhaupt darstellt, also nicht nur „normal“ im Sinne einer Normverteilung ist, sondern auch als gesellschaftlich normativ, also „normal“ im Sinne eines Ideals und im Sinne eines Werturteils (und einer Abwertung allen anderen und allen anderen Beziehungen gegenüber), gesetzt wird.
Im dritten und letzten Teil geht es darum, zu all dem „Nein“ zu sagen, und um die Frage, was dieses Nein bedeutet. Im Fokus stehen die Subversivität des weiblichen Neins, seine Rolle in feministischen Bewegungen und aktuelle Entwicklungen hin zu diesem Nein. Zu guter Letzt möchte ich dazu anregen, über ein Jenseits der Romantik nachzudenken: darüber, wie Beziehungen, wie Familie, wie Bindung, wie Liebe und letztendlich wie Gesellschaft und gesellschaftliche Organisation gestaltbar sind, ohne die romantische Liebe ins Zentrum zu stellen. Sie werden in diesem Teil wenige konkrete Lösungen finden, aber möglicherweise Anregungen.
Sollten Sie beim Lesen das Gefühl haben, über so manche Aussage schon mal gestolpert zu sein, ist das durchaus Absicht. Wenn ich Ihnen hier wiederholt erkläre, was an der romantischen Liebe schädlich oder abträglich oder gefährlich ist, tue ich das aus gutem Grund: Sie wurden Ihr Leben lang mit der immergleichen Leier, den immergleichen Worthülsen in immergleichen Filmplots und immergleichen Songlyrics darauf gedrillt, die romantische Liebe für das Höchste zu halten – für das Beste und Schönste und Erfüllendste, das einem Menschen widerfahren kann. Bevor Sie dieses Buch zur Hand genommen haben, hat man Ihnen bereits tausendfach eingetrichtert, wie sehr Sie diese Liebe zu wollen haben. Und vermutlich haben Sie bislang kaum Widerspruch zu dieser Erzählung gehört. Je öfter ein patriarchales Märchen erzählt wird und je mehr der Inhalt der Erzählung durch die Wiederholung zu einem vermeintlich unveränderlichen Naturzustand verklärt wird, desto notwendiger ist es, den Widerspruch ebenso zu wiederholen und die Erzählung endlich geradezurücken.
Am Ende finden Sie, wenn Sie das möchten, einen Soundtrack: Dort sind einerseits jene Lieder (sowohl Liebeslieder als auch Anti-Liebeslieder) versammelt, deren Lyrics im Buch zitiert werden, sowie andererseits eine Liste mit Liedern zur Abschaffung der Liebe.
Weil kein Buch über romantische Liebe ohne eine solche Ergänzung auskommen kann, finden Sie dort außerdem eine Auflistung an Adressen und Telefonnummern, an die Sie sich wenden können, falls Sie in einer Beziehung Gewalt erfahren.
Dieses Buch wird darlegen, was wir durch das Romantikprimat alles verlieren, was uns die romantische Liebe und die Ideologie, die sie als zentralen Orientierungspunkt in unser Leben presst, rauben: unsere tragendsten Beziehungen etwa, indem sie uns in Paarbeziehung und Kleinfamilie hinein vereinzelt. Sie nimmt uns eine Sprache, um über Liebe und Beziehung abseits der Romantik zu sprechen. Sie beraubt uns der Solidarität und Beziehung unter Frauen, indem durch das Zusammenspiel von Romantikprimat und Heteronormativität Frauen von klein auf auf Männer, ihre Bedürfnisse und ihre Bedürfniserfüllung orientiert und konditioniert werden – mit dem Ziel einer heterosexuellen Beziehung, in der Frauen diesen Männern gegenüber als Gratishaushälterinnen, Gratispflegerinnen und Gratistherapeutinnen in eine dienende Rolle gedrängt werden. Frauen in heteroromantischen Beziehungen wird nicht selten auch ihr Lebensglück geraubt.
Dieses Buch möchte allerdings auch eine Idee davon geben, was wir gewinnen können, wenn wir das Romantikprimat überwinden.
Wenn wir uns von der romantischen Liebe emanzipieren.
Wenn wir die Liebe und uns selbst entromantisieren.
Das Beste an der romantischen Liebe ist nämlich, dass wir sie nicht brauchen.
I. Die große Liebe
The power of love
A force from above
Cleaning my soul
Flame on, burn desire
Love with tongues of fire
Purge the soul
Make love your goal
Frankie Goes to Hollywood –
„The Power of Love“2
0. „Wenn ich an Liebe denke, denke ich an meine Freund*innen.“
Einer meiner besten Freunde und ich haben vor einiger Zeit die Tradition ausgiebiger gemeinsamer Nachtspaziergänge eingeführt (wir sind beide nachtaktiv, was unserer Freundschaft sehr zuträglich ist). Ausgiebige Spaziergänge sind schließlich die beste Grundlage für ausgiebige Gespräche und bei einem solchen, in dem ich ihm davon erzählte, dass mich das Thema dieses Buches gerade umtreibt, und in dem ich mit ihm ein paar Gedanken zum Thema Liebe wälzte, darüber, was sie ist und was nicht, sagte er den Satz: „Wenn ich an Liebe denke, denke ich an meine Freund*innen.“
Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich das noch nie jemanden in dieser Klarheit sagen gehört (und seitdem auch nicht wieder): dass Freundschaft Liebe ist. Nicht eine zweitbeste oder drittbeste Liebe, nicht Liebe, die darauf wartet, durch eine größere, wahre Liebe abgelöst zu werden, nicht Liebe Minus (denn wenn Freundschaft Plus die Freundschaft plus Sex ist, muss Freundschaft ja Liebe minus irgendetwas sein). Dass Freundschaft nicht die geringere Liebe ist, nicht weniger wichtig, nicht weniger wahr, nicht weniger echt als die angeblich einzig echte, große und wahre romantische Liebe, dass freundschaftliche Liebe nicht die ist, mit der man sich halt notgedrungen zufriedengeben muss, weil die echte, wahre, große Liebe, die eigentliche, gerade nicht zu haben ist. Ich freute mich sehr darüber, dass unser Denken über Freundschaft in ähnlichen Bahnen verlief: dass Freundschaft eben nicht ein „Nur“ ist, nicht ein „Weniger“ als die romantische Liebe, dass romantische Liebe nicht ein „mehr als Freund*innen“ ist und dass Freund*innen nicht „nur Freunde“ sind im Vergleich zur viel wertvolleren romantischen Liebe, sondern dass platonische Liebe eben: Liebe ist.
Die Liebe zu seinen Freund*innen brauchte für meinen Freund keinen Spezifikator: Sie ist schlichtweg Liebe, Punkt. Wenn er an Liebe denkt, denkt er an seine Freund*innen.
Ich glaube, dieser Satz war eine der entscheidenden Initialzündungen für meine tiefergehendere Auseinandersetzung damit, was wir als „Liebe“ bezeichnen und wie wir sie bewerten. Er hingegen meint, dass ich ihn dazu gebracht hätte, über die Hierarchisierung und Privilegierung bestimmter Beziehungsformen gegenüber anderen nachzudenken. Wir sind uns also nicht sicher, wer von uns wen auf diese Gedanken gebracht hat. Vielleicht ist es sogar ein gutes Zeichen, wenn man sich in Gesprächen so sehr verliert, dass man am Ende nicht mehr weiß, wer welche Idee ursprünglich geäußert hat.
„Wenn ich an Liebe denke, denke ich an meine Freund*innen“ ist in jedem Fall ein Satz, der mir seitdem nicht wieder aus dem Kopf gegangen ist. Auf einer intellektuellen Ebene nicht, da er das Primat der Romantik infrage stellt und mit ihm einige der tiefsten und in aller Regel unhinterfragten Grundüberzeugungen über Liebe und Beziehung herausfordert, indem er die nicht-romantische, die platonische Liebe als Liebe anerkennt. Doch auch auf einer emotionalen Ebene berührte mich der Satz tief – denn letztlich sagte er damit ja auch, dass er mich liebt. Das Gespräch erinnerte mich also auch daran, wie viel Liebe ich in meinem Leben habe. Und es erinnerte mich daran, wie wichtig es ist, den eigenen Freund*innen oft und regelmäßig zu sagen, dass man sie liebt.
Ich jedenfalls habe danach sehr proaktiv damit begonnen.
We loved we laughed and we cried
Then suddenly love died
The story ends
And we’re
Just friends
Chet Baker – „Just Friends“3
1. Nur Freunde
Amatonormativität und die Abwertung platonischer Liebe
Sind Sie in einer Beziehung oder Single? Haben Sie eine*n Partner*in oder sind Sie alleine? Sind Sie in einer Partnerschaft oder ungebunden? Haben Sie die Liebe bereits gefunden oder die Liebe Sie? Und wenn ja, war es die große Liebe? War es die wahre Liebe? Seid ihr zusammen oder seid ihr nur Freunde? Wie ist Ihr Beziehungsstatus?
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit haben Sie bei all diesen Fragen an jenen Beziehungstyp gedacht, der alles Sprechen, und damit auch viel zu viel unseres Denkens und Fühlens, über Liebe, Beziehung, Verbindung und Verbundenheit für sich eingenommen hat. Der neben sich keinen Platz lässt und über sich sowieso nicht. Alles, was in unserem Leben an In-Beziehung-Sein abseits von ihm stattfindet, muss sich ihm klar unterordnen. Sie haben vermutlich an jenen Beziehungstyp gedacht, der alle anderen Beziehungstypen durch seine parasitäre Platznahme erstickt und jenen, die sich in ihm befinden, allzu oft keine Luft mehr zum Atmen lässt. Es ist jene Form der zwischenmenschlichen Beziehung, die von erotoromantischem Begehren geprägt ist, nennen wir sie „romantische Liebesbeziehung“. Niemand würde schließlich auf die Frage „Bist du in einer Beziehung?“ antworten mit: „Ich habe zwei beste Freunde, einen etwas loseren Freundeskreis von etwa zehn Personen, eine Schwester und eine Mutter, mit der ich sehr eng bin.“ Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum das eigentlich so ist? Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob Sie das so wollen? Haben Sie sich schon einmal gefragt, was dabei zu kurz kommt? Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob Ihnen das schadet?
Die romantische Beziehung ist so dominant und normativ, dass sie in unserem Sprachgebrauch synonym mit dem Wort „Beziehung“ an und für sich verwendet wird. Gleiches gilt für „Partnerschaft“. Unser*e „Partner*in“ ist jener Mensch, mit dem wir uns in einer romantischen Paarbeziehung befinden, das ist völlig klar und braucht keine näheren Erläuterungen. Aber: Sind nicht auch unsere besten Freund*innen Partner*innen, mit denen wir unser Leben teilen, die uns begleiten, stützen, und mit denen wir in einer liebevollen, von Fürsorge geprägten Verbindung stehen, und das oft länger als mit unseren romantischen Partner*innen, die in der Tat meist Lebensabschnittspartner*innen sind, nicht Lebenspartner*innen? Was ist mit unseren Geschwistern, die schließlich jene Menschen sind, die uns neben unseren Eltern am längsten kennen, mit denen wir oft die längsten Beziehungen unseres Lebens führen, die uns durch alle Phasen unseres Lebens begleiten, von klein auf und oft bis an unser Lebensende? Was ist mit all den anderen Menschen, die uns nicht durch unser ganzes Leben, aber durch Lebensphasen begleiten, warum sind sie keine Lebensabschnittspartner*innen, aber Personen, mit denen wir ein Jahr lang ein Bett teilen, schon? Was ist zum Beispiel mit unseren Mitbewohner*innen, die uns bei Liebeskummer Eiscreme ans Bett liefern und Suppe, wenn wir krank sind? Mit unseren Lieblingsarbeitskolleg*innen, die wir jeden Tag sehen und ohne die wir unseren elenden Job und den schrecklichen Chef nicht ertragen würden? Was ist mit all den platonischen Lieben, all den Freund*innenschaften, den ganz verschiedenen, die uns im Leben begegnen und uns durch dieses Leben tragen?
Wir leben in einer Welt, in der verschiedene Beziehungstypen in einer starren Hierarchie zueinander stehen, zueinander gestellt wurden. An der Spitze thront die romantische Paarbeziehung, idealerweise in ihrer heterosexuellen Form und in ihrer monogamen Form (zumindest für die Frau). Alles andere wird irgendwo darunter einsortiert, ist mit wesentlich weniger Wichtigkeit, Bedeutung, mit weniger Beachtung und Besprechung, aber auch mit weniger (de facto mit keiner) ökonomischer oder rechtlicher Absicherung belegt.
Wer in keiner romantischen Beziehung ist, ist deshalb „Single“, auch wenn dieser „Single“-Mensch ein dichteres Netz an engen, liebenden Beziehungen hat als viele andere, die in einer Beziehung sind (Ich werde in diesem Buch das Wort „Single“ deshalb auch, wann immer es geht, unter Anführungszeichen setzen). Wer „Single“ ist, ist alleine, wer „Single“ ist, ist alleinstehend, auch wenn er drei beste Freund*innen hat und vier Geschwister, mit denen er eng in Beziehung steht. Wer keine romantische Beziehung hat, ist ungebunden, da alles an Beziehung abseits der Romantik-Norm nicht als eng verbunden, nicht als verbindlich oder „committed“ gedacht wird. Wer hingegen in einer romantischen Beziehung ist, ist mit seinem*r Partner*in in einer festen Beziehung, oder wie man auf Wienerisch sagt „fix zam“, auch wenn diese romantische Beziehung gerade mal drei Monate dauert, während man mit seinen engsten Freund*innen nicht fix zam ist, obwohl man einander zwanzig Jahre kennt und einander treu zur Seite steht. Mit Freund*innen ist man nicht zusammen, mit ihnen sind wir nicht in einer festen Beziehung, sondern eben nur Freunde. Ist man in einer romantischen Beziehung, ist man mehr als nur Freunde. Wenn sich Menschen aus einer romantischen Bindung schälen wollen, aber nicht so ganz wissen, wie, schlagen sie gerne vor, Freunde zu bleiben, denn das ist, so die implizite Überzeugung, die geringere Beziehung, die wenigere Beziehung – die weniger wichtige, die weniger Zeit kostende, die weniger relevante, die einfachere, die weniger nahe. Als würde die mühsame Beziehungsarbeit nicht erst in dem Moment so richtig beginnen, in dem man sich (idealerweise gemeinsam) entscheidet, den Beziehungstyp, in dem man sich zueinander befindet, zu verändern. „Lass uns Freunde bleiben“ ist ein Versuch, sich vor Verantwortung zu drücken, als würde man nicht genau in dem Moment vor- und füreinander die Verantwortung haben, Verletzungen und Enttäuschungen aufzuarbeiten, um die neue, andere Beziehung auf ein tragfähiges Fundament zu stellen. Es funktioniert als Cop-out deshalb, weil Freundschaften als Beziehungen nicht ernst genommen werden, weil sie mit der Idee belegt sind „low maintenance“ zu sein – ein Begriff, der oft in Bezug auf Freundschaften verwendet wird, sich aber ursprünglich auf die Wartungsintensität von Maschinen und Geräten bezieht, also darauf, wie pflegeleicht Gegenstände sind. Bereits in der Begrifflichkeit ist also implizit, wie sehr Freundschaft geringgeschätzt wird und wie sehr Freund*innen in dieser Geringschätzung entlang von Nutzbarkeit und Benutzbarkeit vergegenständlicht werden. Die Erwartungshaltung ist, dass Freund*innen bedürfnislos zu sein haben, dass sie keine Ansprüche haben dürfen, dass „Freundschaft“ bedeutet, man müsse nun keine ernsthafte Beziehungsarbeit mehr betreiben, weil Freundschaft eben nur Freundschaft ist und nicht Beziehung.
Wenn misogyne Männer Frauen als potenzielle Sex-partnerinnen klassifizieren und diese aber – Gott bewahre – nur mit ihnen befreundet sein wollen, sprechen ebendiese Männer gerne von der Friendzone, in die sie bedauerlicherweise verfrachtet werden, als wäre es die schlimmste Strafe der Welt, dass ein anderer Mensch mit ihnen befreundet sein will. An der Stelle muss natürlich angemerkt werden: Der Affront besteht selbstverständlich auch darin, dass die Frau ja eben nicht als Mensch, sondern als Sexobjekt verstanden wird, und dann aber die schockierende Frechheit besitzt, als Objekt einen eigenen Willen zu artikulieren, und darüber hinaus darin, dass Frauen von genannten Männern kein Wert jenseits ihres Wertes als Sexobjekt zugesprochen wird, keine Funktion jenseits ihrer Funktion als sexuelle Bedürfniserfüllerin – Frauen sind keine Menschen, sondern Sexautomaten in Menschengestalt, in die man Freundlichkeit reinwirft, bis Sex herausfällt. Wenn der Automat die Lieferung verweigert, ist das selbstverständlich höchst ärgerlich.
Freundschaft, in jedem Fall, wird gerne und oft und in vielen Kontexten vom Wort nur begleitet. Wir sind nur Freunde, nicht zusammen, nicht in einer Beziehung.
Selbstverständlich ist man in einer engen, tragenden Freundschaft alles davon: Man ist in einer Beziehung, man ist zusammen, sogar fix, man ist einander Partner*in, man liebt, man ist alles, nur nicht nur.
Unser Sprechen über Beziehung und Liebe spiegelt das allerdings nicht wider, sondern ist von einer ständigen Abwertung von Freundschaft und von einer ständigen Zentrierung, Romantisierung, Privilegierung und einer Überzeichnung mit Bedeutung der romantischen Beziehung geprägt. Wir haben kaum ein sprachliches Repertoire zur Verfügung, um über Liebe jenseits der Romantik überhaupt auch nur sprechen zu können, denn all unser Sprechen, all unsere Worte über Liebe und Verbindung und Beziehung sind von Letzterer eingenommen. Und so ist jeder, der keine feste Beziehung hat, ungebunden, unabhängig davon, wie verbunden und verpflichtet er oder sie sich den Menschen in seinem Leben fühlt.
Was für „Beziehung“ gilt, gilt auch für „Liebe“ – wenn von Liebe ohne weiteren Zusatz gesprochen wird, ist so gut wie immer die romantische Liebe gemeint. Sie ist die eigentliche Liebe, alles andere muss gesondert benannt werden, muss spezifiziert werden. Da wäre zum Beispiel die Mutterliebe oder die platonische Liebe oder die Geschwisterliebe. Nur die romantische Liebe darf Liebe an und für sich sein, ganz ohne Modifikator. Love Actually. Romantische Liebe ist demnach sprachlich gewissermaßen die Urform der Liebe. Das ist insofern ironisch, als dass mit ihr meist erotoromantisches Begehren gemeint ist, das von Liebe in aller Regel weiter entfernt ist als ich von einer Teilnahme an den Olympischen Spielen.
Mit der großen Liebe oder der Liebe des Lebens ist also immer der Mensch gemeint, den wir heiraten, nie der Mensch oder die Menschen, die als unsere Besties, als unsere biologischen oder gewählten Geschwister schon unsere letzten drei Ehen mitgekriegt haben, nach jeder monatelang Tränen getrocknet haben und auch bei der aktuellen wieder Trauzeug*in sind. Im schlimmsten Fall erklären wir dann auf der Hochzeit auch noch stolz, wir hätten unseren besten Freund geheiratet, während der eigentliche beste Freund, der zu seinem Unglück auch die letzten drei Ehemänner oder die letzten drei festen Freunde und Lieben des Lebens schon gekannt hat, (heimlich augenrollend) als ebenjener Trauzeuge danebensteht und nicht nur den Titel „bester Freund“, sondern auch den Titel „Liebe des Lebens“ viel eher verdient, als es jeder unserer romantischen Partner je hätte. Oder die beste Freundin eben. Oder mehrere beste Freund*innen.
Romantische Partner*innen sind in der Ideologie der Romantik nicht nur nicht nur Partner*innen wie unsere Freund*innen, die mit einem „nur“ vor dem „Freund*innen“ abgewertet und geringeschätzt werden. Unsere romantischen Partner*innen müssen zusätzlich auch noch beste Freund*innen sein – die romantische Liebe muss alles auffressen, jede andere Form der Liebe und Verbundenheit von Bord werfen, nur dann ist sie echt, nur dann wahrhaftig.
Dass wir auch unsere Freund*innen als Partner*innen verstehen könnten, erscheint uns hingegen absurd. Das zeigt folgendes Beispiel, das Rhaina Cohen in The Other Significant Others ausführt:
Ich war beeindruckt von einigen Zeilen in einer Rede einer Frau, die sich als beste Freundin der Braut vorstellte (ihr Titel war bis dato unangefochten). Nach der Begrüßung der Gäste verkündete sie: „Der wichtigste Moment im Leben ist der, in dem du die Person triffst, mit der du den Rest deines Lebens verbringen möchtest. Die Person, die dich die Welt als einen schönen und magischen Ort sehen lässt, die jeden deiner Atemzüge wertschätzt – für [die Braut] geschah das vor dreiundzwanzig Jahren, als sie mich traf.“ Allgemeines Gelächter.
Der Standesbeamte fuhr fort: „Aber vor acht Jahren lernte sie [den Bräutigam] kennen.“





























