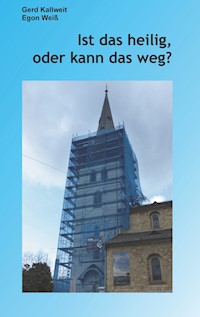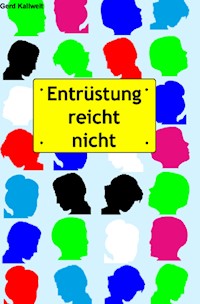
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Entrüstung reicht nicht" ist eine Aufforderung, sich aktiv in die Politik einzumischen. Staatliche Macht wird durch parteipolitisch geprägte Entscheidungen ausgeübt. Die Idee der Gewaltentrennung meint eine Abgrenzung von Legislative, Exekutive und Judikative zur gegenseitigen Kontrolle. Tatsächlich verläuft die Trennungslinie eher zwischen den Parteien als zwischen den Staatsorganen. Daran krankt die Demokratie. Die Gewaltentrennung ernst zu nehmen und die Macht der Parteien etwas zu beschneiden, könnte der Demokratie guttun. Das Wahlrecht bietet dazu eine kaum genutzte Möglichkeit: Jede/r Wahlberechtigte kann unabhängig von Parteien für den Bundestag kandidieren. Regionale Bündnisse – so der Vorschlag in diesem Buch – sollten KandidatInnen auswählen, unterstützen und begleiten. Die Aufstellung von DirektkandidatInnen sollte als Kristallisationspunkt des jeweiligen Bündnisses dienen. Darüber hinaus müssten Diskussionen und Aktionen stattfinden, die zur politischen Meinungs- und Willensbildung in der Bevölkerung beitragen. Soziale Ungerechtigkeiten abzubauen, gilt als wichtigstes Ziel. Hierzu ein konkreter Vorschlag: Die Sozialbeiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern sind durch eine umsatzbezogene Abgabe der Unternehmen zu ersetzen. Um solche Ziele zu erreichen, bedarf es der gemeinsamen Anstrengung der fünf Staatsgewalten (die Medien werden als vierte, die Kirchen als fünfte Gewalt im Staat eingestuft) und der ganzen Gesellschaft. Ein möglicher Schritt zu einer verbesserten Grundsicherung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerd Kallweit
Entrüstung reicht nicht
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort
Trennung der Staatsgewalten: Eine Idee bahnt sich ihren Weg
Gewaltenteilung pur?
Unabhängige Justiz?
Trennung pur ist nicht gewollt
Wie ticken die Parteien?
Alles in Stein gemeißelt?
Proteste und Konzepte
Ein gesetzliches Angebot
Die Macht der Kirchen
Trennung ist nicht alles
Impressum neobooks
Vorwort
In diesem Text geht es um staatliche Macht. Üblicherweise sprechen wir von drei Staatsgewalten. Als vierte werden die Medien oft bezeichnet. Die Kirchen als fünfte Gewalt im Staatsgefüge anzusehen, habe ich mir einfallen lassen, weil ihr Einfluss unübersehbar ist. Die Strukturen der Kirchen weisen diese zudem als Macht-Apparate aus. Ihren Einfluss werden wir auf absehbare Zeit hinnehmen müssen – wenn sie ihn nur nicht mit uralten Märchen begründen würden!
Über Macht im Staat zu schreiben, geht eigentlich gar nicht, ohne ausführlich auf wirtschaftliche Einflüsse einzugehen. National und international sind Konzerne, Banken und Finanzjongleure so mächtig, dass man zweifeln kann, ob die Regierungen und Parlamente überhaupt über eigene Gestaltungsspielräume verfügen. Ich habe dennoch dieses Thema ausgespart. Es ist so umfangreich, dass es hier keinen Raum hätte und ich es ohnehin nicht bewältigen könnte. Mit einer pauschalen Kapitalismuskritik wäre es ja nicht getan.
Wir Bürgerinnen und Bürger sollten uns dafür engagieren, die staatlichen Verhältnisse zu verbessern. Damit hätten wir schon mal genug zu tun. Selbstverständlich müssen wir dabei die Verflechtungen mit der Wirtschaft im Blick behalten. Der Titel „Entrüstung reicht nicht“ bezieht sich hauptsächlich auf den Vorschlag, regionale und kommunale Versammlungen zu organisieren, um damit die Parteienlandschaft zu ergänzen.
Ich bin Sozialdemokrat und habe nicht die Absicht, freiwillig aus der SPD auszuscheiden. Wenn ich dennoch dazu auffordere, den Parteien „ein Schnippchen zu schlagen“, mag das widersprüchlich erscheinen. Ich bin aber überzeugt, das würde den Parteien keineswegs schaden, Staat und Gesellschaft aber insgesamt nützen.
Die folgenden Seiten wurden geschrieben, bevor Sahra Wagenknecht öffentlich zu einer Sammlungsbewegung aufrief. Ihr Projekt „#Aufstehen“ kann möglicherweise die von mir angeregten Versammlungen überflüssig machen. Ich glaube das aber nicht.
Wagenknechts Gründungsaufruf besteht aus einer anklagenden Auflistung politischer und wirtschaftlicher Fehlentwicklungen sowie einer Auflistung ihrer Ziele. Sowohl die Kritik an den derzeitigen Zuständen, die mit dem einleitenden Satz „Wir leben in einem Land voller Widersprüche“ zusammengefasst sind, wie auch die Ziele sind so allgemein formuliert, dass wahrscheinlich die meisten Vertreter/innen der etablierten Parteien sie im Wesentlichen unterschreiben könnten.
Der Knackpunkt wird die Umsetzung in konkrete politische Schritte sein. Dazu soll mit allen Anhängern ein Programm ausgearbeitet werden. Ich vermute, es wird das Programm einer Protestpartei.
Ohne ein Programm, das bundesweit abgestimmt werden muss und dann auch bundesweit gilt, scheint mir basisdemokratisches Engagement auf regionaler und kommunaler Ebene besser funktionieren zu können.
Mainz, im Dezember 2018, Gerd Kallweit
Trennung der Staatsgewalten: Eine Idee bahnt sich ihren Weg
Man schrieb das Jahr 1690 christlicher Zeitrechnung als ein Brite anonym „Zwei Abhandlungen über die Regierung“ veröffentlichte. Das Werk sollte sich als Meilenstein erweisen: Es beeinflusste staatsrechtliche Überlegungen nachfolgender Generationen. Dennoch bekannte der Autor, John Locke (1632 – 1704) sich erst in seinem Testament zur Urheberschaft, obwohl Zeitgenossen ihn schon vorher als Verfasser ausgemacht hatten.
Locke fordert darin die Trennung von Legislative und Exekutive im Staatswesen, und die Konstituierung der legislativen Gewalt bezeichnet er als „das erste und grundlegende positive Gesetz aller Staaten“ (§ 134). Mit einer einleuchtenden Begründung plädiert er für die Trennung der beiden Gewalten: „Bei der Schwäche der menschlichen Natur, die stets bereit ist, nach der Macht zu greifen, würde es jedoch eine zu große Versuchung sein, wenn dieselben Personen, die die Macht haben, Gesetze zu geben, auch noch die Macht in die Hände bekämen, diese Gesetze zu vollstrecken. Dadurch könnten sie sich selbst von dem Gehorsam gegen die Gesetze, die sie geben, ausschließen und das Gesetz in seiner Gestaltung wie auch in seiner Vollstreckung ihrem eigenen persönlichen Vorteil anpassen. Schließlich würde es dazu kommen, daß sie von den übrigen Gliedern der Gemeinschaft gesonderte Interessen verfolgen würden, die dem Zweck der Gesellschaft und Regierung zuwiderlaufen“ (§ 143).
Anerkannte, autorisierte Richter hält Locke für notwendig (§ 136), um die Einhaltung der Gesetze zu überwachen. Auf die Idee, es könnte eine Judikative als dritte, von den beiden anderen unabhängige Staatsgewalt geben, ist er offenbar nicht gekommen. Jedenfalls erwähnt er einen solchen Gedanken nicht. Es dauerte mehr als ein halbes Jahrhundert, bis der Gedanke dann doch geboren wurde. Diesmal auf französischem Boden. Sein Urheber: Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu (1689 – 1755).
In seinem 1748 veröffentlichten Werk „Vom Geist der Gesetze“ führt Montesquieu den Begriff der richterlichen Gewalt ein. Seine Forderung einer Dreiteilung staatlicher Macht begründet er ähnlich wie Locke die Zweiteilung: „Wenn in derselben Person oder der gleichen obrigkeitlichen Körperschaft die gesetzgebende Gewalt mit der vollziehenden vereinigt ist, gibt es keine Freiheit; denn es steht zu befürchten, daß derselbe Monarch oder derselbe Senat tyrannische Gesetzte macht, um sie tyrannisch zu vollziehen. Es gibt ferner keine Freiheit, wenn die richterliche Gewalt nicht von der gesetzgebenden und vollziehenden getrennt ist.“
Vergleichbare staatsphilosophische Ansätze finden sich bereits in Schriften der Antike. Die vor allem auf Aristoteles zurückzuführende Idee der Mischverfassung erwartet eine Machtbegrenzung und gegenseitige Kontrolle durch die Zusammenführung von Elementen unterschiedlicher Staatsformen. Der griechisch/römische Historiker, Staatsmann und Feldherr Polybios, der in seinem Werk „Historien“ die Geschichte Roms von 264 bis 146 v.Chr. beschreibt, sieht den Aufstieg dieses Staates zum Weltreich in der römischen Verfassung begründet. Darin seien monarchische, aristokratische und demokratische Bestandteile in Form von Konsulat, Senat und Volksversammlung vereinigt. So finde jede politische Kraft ein Gegengewicht und alle Verfassungsorgane seien zur Kooperation gezwungen.
Der Reformator Johannes Calvin (1509 – 1564), juristisch gebildet und politisch erfahren, hielt die Verbindung von Aristokratie und Demokratie für die beste Staatsform. Auch bei ihm geht es darum, möglichen Machtmissbrauch der Regierenden – die er im Übrigen als Stellvertreter Gottes sieht – zu verhindern.
Calvinistisches Gedankengut trug maßgeblich zur Entstehung des Kongregationalismus bei. Dabei handelt es sich um eine puritanische Bewegung, die für Autonomie der einzelnen Kirchengemeinden eintrat. Eine Gruppe von Kongregationalisten, von der anglikanischen Kirche verfolgt, wanderte nach Nordamerika aus. Auf dem Schiff „Mayflower“, das sie dorthin brachte, befanden sich auch Anglikaner mit dem gleichen Ziel, eine Kolonie in der neuen Welt zu gründen. Die wegen unterschiedlichen Glaubens verfeindeten Gruppen befürchteten aneinanderzugeraten und schlossen deshalb einen Vertrag, um das künftige Zusammenleben zu regeln. Dieser so genannte Mayflower-Vertrag sollte garantieren, dass für alle Bewohner der Kolonie die gleichen Gesetze gelten. Dazu übertrugen die Kongregationalisten das in ihren Kirchengemeinden praktizierte System der repräsentativen Demokratie auf die Regelung der weltlichen Angelegenheiten. So stand die Idee der Gewaltenteilung Pate, als 1620 auf dem Boden des heutigen US-Bundesstaates Massachusetts die englische Plymouth Colony gegründet wurde: Die aus „Freien“ gebildete Generalversammlung fungierte als Legislative und Judikative, der Gouverneur und seine Assistenten als Exekutive. Andere Kolonien folgten diesem Beispiel indem sie die Verwaltung der weltlichen Angelegenheiten im Gemeinwesen nach dem Muster der kirchengemeindlichen Demokratie regelten. So beispielsweise die Massachusetts Bay Colony (1628), Rhode Island (1636) und Connecticut (1636).
Im Jahr 1776 erklärten die 13 britischen Kolonien ihre Unabhängigkeit. Das führte 1787 zur Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika. So lange hatte es gedauert, bis eine Verfassung zustande kam. Man konnte dafür zwar auf die Ausführungen Lockes und Montesquieus und auch auf die Erfahrungen mit der praktizierten Gewaltenteilung in den Kolonien zurückgreifen, aber es bildeten sich unterschiedliche Vorstellungen heraus, wie die Macht zwischen der Union und ihren Gliedern ausbalanciert werden könne. Die „Zentralisten“ verfolgten mit ihrem Virginia-Plan das Ziel einer starken Bundesgewalt. Die „Föderalisten“ hielten mit dem New-Jersey-Plan dagegen, der die einzelstaatlichen Souveränitäts-Ansprüche betonte. Man einigte sich auf dieses System: Der Kongress als Legislative besteht aus zwei Kammern, dem Senat und dem Repräsentantenhaus. Die von der Bevölkerung gewählten Parlamente der Einzelstaaten entsenden jeweils zwei Vertreter in den Senat. Das Repräsentantenhaus setzt sich aus direkt gewählten Vertretern der Einzelstaaten zusammen. Dabei entspricht die Zahl der zu wählenden Repräsentanten dem Anteil der Bevölkerung des jeweiligen Einzelstaats am Gesamtvolk. Auf dem Umweg über Wahlmänner der Einzelstaaten wählt das Volk den Präsidenten als Chef der Exekutive. Der oberste Gerichtshof, der Supreme Court, steht an der Spitze der Judikative. Seine Richter werden auf Anordnung des Kongresses durch den Präsidenten ernannt.
Benjamin Franklin, einer der Väter der US-Verfassung, bezeichnete die Geschichte der Republik der Sieben Vereinigten Niederlande als Vorbild für die Bildung der USA. Bereits im Jahr 1571 hatten die niederländischen Provinzen sich vereinigt, und das Bündnis sollte bis 1795 Bestand haben. Allerdings gab es keine gemeinsame Verfassung. Die Mitglieds-Provinzen regelten ihre Angelegenheiten autonom auf der Grundlage von Staatsformen, in denen Aristokratie und Demokratie – mit unterschiedlicher Gewichtung der beiden Seiten – gemischt waren. Hinsichtlich der Teilung der drei Gewalten Legislative, Exekutive und Judikative kann die niederländische Republik daher kaum ein Vorbild für die USA gewesen sein. Für die Balance zwischen der Union und ihren einzelnen Mitgliedern schon eher. In diesem Sinne holte sich Franklin im Jahr 1766 auch Anregungen im Deutschen Reich. Die deutschen Kleinstaaten besaßen weitgehende Souveränität, gemeinsam folgten sie aber dem Kaiser. Dieses föderale System interessierte Franklin offenbar, und er informierte sich darüber beim Göttinger Staatsrechtler Johann Stephan Pütter.
Die Französische Revolution führte zu unterschiedlichen Gewichtungen der Staatsgewalten. Die Tendenz, sich von personalisierten Herrschaftsverhältnissen zu verabschieden und die Souveränität auf das Volk zu übertragen, erhöhte zunächst die Bedeutung der Gesetze. Die Gesetze galten als unpersönliche Herrschaft des Volkes. Gerichte erschienen bald überflüssig zu sein. Ging es doch darum, nach Gutdünken gefällte herrschaftliche Entscheidungen zu verhindern. Die Richter verloren jeden Ermessungsspielraum. Sie sollten nicht mehr nach ihrer persönlichen Auslegung der Gesetze urteilen, sondern die Gesetze sollten ohne Umweg dem Willen des Volkes Geltung verschaffen. Offenbar war das ein wenig zu viel Unpersönlichkeit, jedenfalls funktionierte das System nicht so wie erhofft. So verlagerte sich der Schwerpunkt des politischen Handelns zur Legislative. Als auch das nicht lange gut ging, gewann die Exekutive in der Stimmungslage an Wertschätzung. Aus dieser Ausgangslage heraus gelang es Napoleon, sich zur Macht aufzuschwingen. Er ließ sich als Vertreter des Volkswillens definieren und grub so der Legislative das Wasser ab. Das heute in Frankreich geltende Präsidialsystem, in dem der vom Volk direkt gewählte Präsident über der Regierung steht, nahm hier seinen Ursprung.
Dem Deutschen Reich bescherte die Verfassung von 1871 eine konstitutionelle Monarchie. Das Parlament wurde direkt gewählt, hatte aber keine Hoheit über die Exekutive. Der Regierungschef war nicht vom Reichstag, sondern vom Kaiser abhängig. Und der Kaiser konnte den Reichstag auflösen. Auf der Grundlage dieser Erfahrung stärkte das nach Ende des Ersten Weltkriegs, 1919, neu verfasste System das Parlament. Der Reichstag konnte nun dem Kanzler und jedem Minister das Vertrauen entziehen. Gleichzeitig erhielt aber auch die Exekutive mehr Gewicht. Nachdem der Kaiser abgedankt hatte, trat der Reichspräsident an seine Stelle. Und der wurde direkt vom Volk gewählt. Mit einer Zweidrittelmehrheit konnte das Parlament eine Volksabstimmung zur Absetzung des Reichspräsidenten beschließen. Andererseits erhielt der Reichspräsident die Vollmacht, einen Volksentscheid zu initiieren, um bestimmte Entscheidungen des Parlaments abzulehnen. Hinzu kam die Möglichkeit, durch einen Volksentscheid Gesetzentwürfe zu fordern, wenn 10 Prozent der Stimmberechtigten das verlangten.
Dieses System der Weimarer Republik hätte wohl nicht zwangsläufig in die Katastrophe des Naziregimes führen müssen. Vielmehr dürfte die Ursache dafür zum großen Teil in der Stimmungsmache gegen den Parlamentarismus zu finden sein. Hitler hatte schon in „Mein Kampf“ gegen das Parlament gehetzt. Joseph Goebbels wollte dem Reichstag das Sterbegeläut geben, nachdem er zu dessen Präsident gewählt war. Nicht nur Nazis, Abgeordnete anderer Parteien in der rechten und der linken Ecke brachten ihre Verachtung des Parlaments ebenfalls zum Ausdruck.
Heute hält unser Grundgesetz seine schützende Hand über das Parlament und über die Gewaltengliederung: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.“ (Art. 20,2) Damit verbanden die Mütter und Väter unserer Verfassung sogar das Widerstandsrecht: „Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.“ (Art. 20,4) Der Bundespräsident gilt als „erster“ Staatsbürger der Bundesrepublik Deutschland, aber ihm wurden nahezu ausschließlich repräsentative Aufgaben übertragen. Das Amt des Bundespräsidenten unterminiert nicht die Gewaltengliederung.
Eine zweite Art der Gewaltenteilung spiegelt sich schon im Namen „Bundesrepublik Deutschland“ wider. „Die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben“, so bestimmt Artikel 30 des Grundgesetzes, „ist Sache der Länder, soweit dieses Grundgesetz keine andere Regelung trifft oder zulässt.“ Und Artikel 50 besagt: „Durch den Bundesrat wirken die Länder bei der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes und in Angelegenheiten der Europäischen Union mit.“
Gewaltenteilung pur?
Theorie und Praxis weichen nicht selten voneinander ab. Wie steht es tatsächlich mit der Gewaltenteilung in Deutschland? Sehen wir uns zunächst einmal das Verhältnis von Legislative und Exekutive an.
Die Regierung wird vom Parlament eingesetzt und ist darauf angewiesen, von diesem mehrheitlich gestützt zu werden. Fraktionen des Parlaments verabreden sich zu einer Koalition, um eine Mehrheit für das Regierungshandeln sicherzustellen. Wir wählen die Abgeordneten in den Deutschen Bundestag, und de facto steht dabei vor allem der/die Bundeskanzler/in zur Wahl.
Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages sind „an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen“ (Art. 38 GG). In der Tat können alle MdB bei Abstimmungen allein ihrem Gewissen folgen, aber wer tut das wirklich? Fraktionszwang ist die Regel, nicht die Ausnahme. Wird kein Fraktionszwang ausgeübt, bleibt es also den Mitgliedern einer Fraktion freigestellt, wie sie abstimmen, ist das eine Nachricht in den Medien wert. Freilich ist „Zwang“ nicht immer im strengen Sinn des Wortes zu verstehen; abweichendes Stimmverhalten wird schon geduldet – solange die Mehrheit für das von der Fraktionsführung gewünschte Ergebnis nicht gefährdet ist. Deshalb wird auch eher von Fraktionsdisziplin oder – aus Sicht der Parteien – von Fraktionssolidarität gesprochen.
Dabei kann es durchaus eine Gewissensentscheidung sein, sich der Mehrheitsmeinung der Fraktion anzuschließen. Schließlich können die einzelnen Abgeordneten nicht nur nicht alles wissen, sie können sich auch – bei der Fülle der Themen und des für die Behandlung zur Verfügung stehenden engen Zeitrahmens – nicht in jede Problematik hinreichend einarbeiten. Insofern sind sie nicht nur auf den wissenschaftlichen „Apparat“, sondern auch auf die jeweiligen Fachleute der Fraktion angewiesen. Und insofern kann der Fraktionszwang durchaus sinnvoll sein.
Wenig sinnvoll, um nicht zu sagen albern, mutet es hingegen an, wenn auf keinen Fall Vorschlägen „gegnerischer“ Fraktionen zugestimmt werden soll. Da mag ein Antrag noch so richtig sein, kommt er aus der Opposition, versagen die Mitglieder der regierungsstützenden Fraktion/en ihm nahezu garantiert die Zustimmung. Und umgekehrt ebenso. Zuzugeben, dass die anderen auch mal eine gute Idee haben können, tut anscheinend dem Image nicht gut. Image-Pflege heißt Wahlkampf betreiben, und das ist während der ganzen Legislaturperiode angesagt.