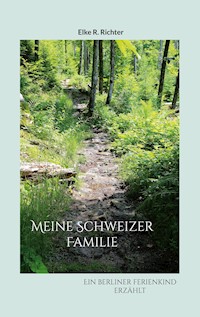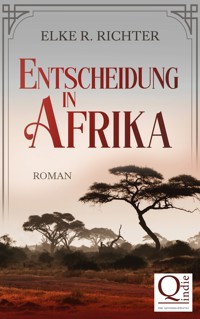
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Berlin, 1904. Der Chirurg Rudolf ist mit Leidenschaft Arzt und forscht im Robert Koch-Institut und im Moabiter Krankenhaus an Typhuserregern. Er verliebt sich Hals über Kopf in die selbstbewusste Krankenschwester Dorothea, die sich für Frauenrechte und das Frauenwahlrecht engagiert. Doch dann sieht Rudolf seine große Liebe am Arm eines anderen Mannes wieder. Für ihn bricht eine Welt zusammen. Er gibt seine Stellung im Krankenhaus auf und lässt sich auf das Abenteuer seines Lebens ein: Südwestafrika. Dort haben sich die indigenen Stämme gegen die deutsche Herrschaft erhoben. Mit der Schutztruppe zieht er durch trostlose Wüstengebiete, erlebt die Kämpfe und wird angeschossen. Im Lazarett trifft er Dorothea wieder. Inspiriert durch ein Tagebuch aus dem Nachlass eines Bekannten schildert Elke R. Richter ein dramatisches Kapitel deutscher Kolonialgeschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine Familie, die mich immer unterstützt hat.
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Nachwort und Danksagung
Medizinische Begriffe
Erklärungen
Historische Personen
Bibliografie
Vorbemerkung
Im Text wurden die historischen Begriffe von damals verwendet, also »Eingeborene« sowie »Kaffern« oder »Hottentotten« statt »Indigene«.
Kapitel 1
Berlin Februar 1904
Ein kalter Wind fegte über das Gelände, als Doktor Rudolf Kampmann nach der Visite aus der Baracke trat. Die Ausdünstungen der Kranken und die abgestandene Luft rochen früh besonders intensiv. Er war froh, für kurze Zeit draußen zu sein. Vor dreißig Jahren war die Krankenanstalt Moabit innerhalb von zwei Monaten errichtet worden. Nach der Cholera- und Typhusepidemie damals wurde dringend ein Seuchenlazarett benötigt. Um einen Rasenplatz gruppierten sich die Holzbaracken. An der Südseite befanden sich das Verwaltungsgebäude, das Portierhaus, die Koch- und Waschküche sowie die Apotheke. Fünf weitere Pavillons und ein Operationshaus waren später dazu gekommen.
Mit schnellen Schritten ging Rudolf zum Operationshaus. Obwohl er seit sechs Jahren als Chirurg arbeitete, war er jedes Mal vor Aufregung so nervös, dass ihn Bauchschmerzen plagten. Das war wie Lampenfieber vor einer Theateraufführung. Doch im Gegensatz zu den Schauspielern wussten die Chirurgen nie, wie ihre Eingriffe endeten. Unstillbare Blutungen, Infektionen oder Todesfälle konnten ihre Operationen in Tragödien verwandeln.
Doktor Kampmann zog den Kittel über den Anzug und wusch sich gründlich die Hände. Er atmete den Geruch von Desinfektionsmitteln und Äther ein und verspürte eine zunehmende innere Ruhe. Ein Krankenwärter riss ihn aus seinen Gedanken.
»Komm Se sofort in den kleinen OP. Der Oberarzt erwartet Sie.«
»Und Wassmut?«
»Kommt später dran …«
Rudolf eilte in den Operationssaal für septische Fälle. Doktor Hermes stand neben einer jungen Frau. Schwester Hildegard leitete gerade die Narkose ein. Sie kontrollierte den Puls und drückte die Äthermaske fest auf das Gesicht.
»Notfall, Frühschwangerschaft«, erklärte der Oberarzt. »Ein Masseur hat mit einer angeblich sicheren Methode eine Abtreibung durchgeführt. Gott, wie ich diese Kurpfuscher hasse. Starke Blutungen, das Übliche eben. Zum Glück hat er es mit der Angst zu tun bekommen und einen Krankenwagen gerufen.«
Doktor Hermes machte einen Längsschnitt vom Nabel bis zur Symphyse und durchtrennte sofort Faszie und Muskel. Rudolf beugte sich über das Operationsfeld, konnte aber wegen der Darmschlingen und dem Blut nicht viel sehen. Die Narkoseschwester meldete: »Blutdruckabfall.«
»Absaugen«, rief Doktor Hermes und zur Schwester gewandt, »isotonische Kochsalzlösung anlegen.«
Nachdem Rudolf das Blut abgesaugt hatte, konnte er endlich die Gebärmutter erkennen. Der Muskel war durch das Herumstochern mehrfach verletzt worden. Er war so sehr mit dem Austupfen beschäftigt, dass er fast die Anordnung des Oberarztes überhörte.
»So Kampmann, führen Sie die Gebärmutterentfernung durch. Ich assistiere.«
Mit ruhiger Hand setzte Rudolf die Ligaturen und entfernte das verstümmelte Organ.
»Puls kaum noch spürbar«, meldete Schwester Hildegard. »Blutgruppe bestimmen, weiter Kochsalzlösung geben. Dann eine Blutkonserve«, ordnete Doktor Hermes an.
Nach dem Eingriff sagte der Oberarzt: »Gut gemacht, Kampmann« und verließ den Saal. Ein Pfleger verband die Wunde und die Narkoseschwester musterte bedenklich das weiße Gesicht der Patientin. Rudolf überprüfte die Infusionslösung.
»Haben Sie die Blutprobe ins Labor bringen lassen?«
Die Schwester nickte. Im Krankenblatt las er den Namen Elsa Jacoby und stutzte. Elsa? Er betrachtete die bewusstlose Frau, was hatte sie alles erduldet? Hoffentlich vertrug sie die Bluttransfusionen. Vor drei Tagen war ein Patient nach einer Blutübertragung gestorben. Da war die ruhige Hand des Oberarztes umsonst gewesen.
»Herr Doktor Kampmann, bitte in den großen Operationssaal kommen«, holte ihn eine Stimme in die Gegenwart zurück. Rudolf zog sich einen sauberen Kittel über, wusch seine Hände und begrüßte den Patienten, der auf dem Operationstisch lag. Seit Monaten hatte er über Schmerzen im rechten Oberbauch geklagt.
»Haben Sie noch Fragen?«
»Wann bin ich wieder einsatzbereit? Ich will die Proben für die Wagner-Aufführungen im März nicht verpassen«, fragte der, ein Cellospieler des Opernhausorchesters.
»Machen Sie sich keine Sorge, Herr Wassmut, wir bekommen das schon hin«, erwiderte Doktor Kampmann aufmunternd.
»Jetzt schlafen Sie gleich und wenn Sie aufwachen, geht es Ihnen gut.«
Er nickte der Narkoseschwester zu und wandte sich an den Kollegen neben ihm, der von einem Bein auf das andere trat. »Assistieren Sie heute zum ersten Mal?«
Bevor der Assistent etwas erwidern konnte, trat der Oberarzt hinzu und Rudolf setzte den Schnitt unterhalb des rechten Rippenbogens. Hoffentlich ging heute alles gut. Gestern hatte er ein Blutgefäß im Bauch ungenügend abgeklemmt und die Blutung nur mühsam stillen können. Doktor Hermes war ziemlich ärgerlich gewesen.
»Ligaturen setzen, Gallengang unterbinden«, bestimmte der Oberarzt und hob die prall mit Steinen gefüllte Gallenblase an. »Da haben wir den Störenfried. Machen Sie weiter, Kampmann. In vier Wochen kann er wieder Cello spielen.« Doktor Hermes ging in den angrenzenden Operationssaal.
Am späten Nachmittag hing eine dunkle Wolkendecke über der Stadt und der stürmische Wind hatte zugenommen. Rudolf hastete zu den Operationsbaracken. Morgens und nachmittags machte er in zwei Baracken bei sechzig Patienten Visite und überprüfte den Heilungsverlauf.
Er war froh, als er die erste Baracke erreicht hatte und riss mit klammen Händen die Tür auf. Drinnen ertönte ein unterdrückter Schrei. Schwester Dorothea hatte von innen ebenfalls die Tür öffnen wollen, war durch den Schwung gestolpert und der Eimer mit verschmutztem Verbandsmaterial landete am Boden. Mit wenigen Schritten war Rudolf bei ihr und half ihr beim Aufstehen.
»Ist Ihnen etwas geschehen, Schwester Dorothea? Entschuldigen Sie vielmals«, erst jetzt bemerkte er, dass er sie noch festhielt.
»Es war nur der Schreck«, erwiderte sie und bückte sich, um die verstreut liegenden Binden und Tücher aufzusammeln.
Rudolf wollte sich ebenfalls herabbeugen. Doch er hielt inne und starrte sie an. Wie anmutig sie aussah! Warum war ihm das nicht schon früher aufgefallen? Als die Schwester aufschaute, bückte er sich schnell und hob zwei Tücher auf. Sie rafften alles zusammen, dann räusperte er sich: »Ich wollte Visite machen. Könnten Sie mir die Krankenunterlagen bringen?«
Er sah ihr verwirrtes Gesicht und fügte hastig hinzu: »Oder müssen Sie etwas anderes erledigen? Schwester Rosa kommt sicher auch gleich.«
»Ich packe nur das nötige Verbandszeug auf den Rollwagen, dann bin ich sofort bei Ihnen.« Schnell wandte sich die Schwester um. Stieg etwas Röte in ihr Gesicht? Was für ein Unfug, ermahnte sich Rudolf, sie ist kein Backfisch mehr.
Im Krankensaal stellte die Schwesternschülerin Elli gerade eine Bettschüssel auf dem Boden ab. Schnell deckte sie den Mann zu, ergriff die Pfanne und eilte zum Ausgang. Doktor Kampmann ging von einem Patienten zum nächsten, begutachtete die Wunden und gab seine Anordnungen, die Schwester Dorothea notierte. Bei den meisten Patienten sah der Heilungsverlauf gut aus. Doch dann musste er sich mit einem weniger erfreulichen Fall auseinandersetzen. Ein verwundeter Soldat wurde vor zwei Wochen mit einem Krankentransport aus Südwestafrika eingeliefert. Die Schussverletzung im linken Oberschenkel hatte sich infiziert und er hatte das Bein amputieren müssen. Aber statt zu heilen, entzündete sich auch diese Wunde.
»Wie geht’s? Haben Sie noch Schmerzen?«, erkundigte sich Rudolf freundlich.
Der Mann drehte den Kopf zur Seite und verzog das breite Gesicht zu einem leichten Grinsen: »Is zum Aushalten, bei der juten Behandlung jehts mir langsam besser.« Er deutete auf die Schwester, die sich über sein Bein beugte. »Ick kann och schon loofen.«
Rudolf hörte dem Droschkenkutscher Schulze schmunzelnd zu.
»Herr Doktor, schauen Sie sich bitte die Wunde an?« Schwester Dorothea entfernte den durchweichten Verband. Die Naht am Stumpf hatte sich teilweise aufgelöst und ein übel riechendes Sekret lief heraus.
»Reinigen Sie alles mit Kaliumpermanganat und dann Karbolkompressen auf die Wunde legen«, ordnete er an.
»Isses schlimm Herr Doktor? Ick will bald nach Hause zu meine Erna.« Schulze schniefte leise und ergriff Rudolfs Arm. Seine rechte Hand presste er auf den Mund, um ein Stöhnen zu unterdrücken.
Schwester Rosa und Elli betraten den Saal. Der Arzt wies sie an, beim Verbinden der anderen Patienten zu helfen und Laudanum zu holen.
»Machen Sie sich keine Sorgen. Es wird schon wieder«, beruhigte er den Kranken und versorgte mit Schwester Dorothea die Wunde, bevor er die Visite fortsetzte.
März 1904
Der Frühling wollte sich dieses Jahr nicht einstellen. Erneut ballten sich dunkle Wolken zusammen, und es begann zu stürmen und zu schneien. Im Operationshaus stand Schwester Rosa am Fenster des Warteraums für die Frauen und blickte in das Schneetreiben hinaus. Wegen ihrer kräftigen Statur und ihrem breiten, freundlichen Gesicht wirkte sie älter als dreiundzwanzig. Oberschwester Martha hatte sie zusammen mit zwei Schwesternschülerinnen zum Putzdienst eingeteilt. Vor den Operationen mussten die Räume regelmäßig gründlich gereinigt werden. Eifrig wischte sie den Fußboden, sodass der Geruch nach Seifenlauge bis in den Flur drang.
»Ihr müsst bei diesem Schmuddelwetter den Eingangsbereich auch zwischendurch putzen. Sonst wird der Dreck im ganzen Haus verteilt«, rief sie den jungen Mädchen zu. »Ich lass euch jetzt allein. Macht mir bloß keine Schande.«
Sie hängte sich einen Umhang über die Schulter und verließ das Gebäude. In wenigen Minuten begann ihr Dienst in der Operationsbaracke.
Der kalte Wind blies Rosa die Schneeflocken ins Gesicht, als sie am Vorplatz entlang hastete. Vor der Eingangstür blieb sie atemlos stehen, um zu verschnaufen. Seit drei Tagen quälte sie ein hartnäckiger Husten. Dann betrat sie den Korridor, von dem aus die Räume zur Wäschekammer, zum Bad, zum Aufenthaltszimmer für die Wärter und zur Teeküche abgingen. Geradeaus befand sich der Krankensaal, wo dreißig Männer darauf warteten, dass Rosa sich um sie kümmerte. Normalerweise half Schwester Irene dabei. Doch sie musste heute in einer anderen Baracke aushelfen, da zwei Schwestern erkrankt waren. Bevor Rosa von Bett zu Bett ging, schaute sie in die Wäschekammer, wo die Schülerinnen Elli und Dora mit Näh- und Flickarbeiten beschäftigt waren. Da der Krankenhausetat knapp bemessen war, musste ständig die zerrissene Bettwäsche ausgebessert werden.
»Wo ist Emilie?«
»Die reinigt heute im Bad die Bettpfannen und Uringläser.«
»Gut. Elli, holen Sie bitte den Rollwagen, frische Bettwäsche und Verbandsmaterial. Ich fang schon mit meiner Runde an.«
»Guten Morgen, wie geht es Ihnen?«, begrüßte sie jeden Patienten. Elli schob den Rollwagen, Rosa kontrollierte und erneuerte die Verbände, überprüfte die Temperaturen und den Puls und zog die Decken hoch.
»Haben Sie beim Essen nicht aufgepasst? Ihre Jacke ist bekleckert. Lassen Sie sich vom Krankenwärter eine Saubere geben«, rügte sie einen älteren Mann, der sie schuldbewusst anschaute.
»Jawoll, Schwester.«
Der Droschkenkutscher Schulze richtete sich mühsam auf und rief mit zittriger Stimme: »Schwester Rosa.«
Sie eilte zu ihm und hob die Bettdecke hoch. Gestank nach faulendem Fleisch quoll aus dem feuchten Verband hervor. Rosa drehte den Kopf zur Seite und unterdrückte ein aufkommendes Brechgefühl.
»Ick hab’ solche Schmerzen«, stöhnte Schulze.
»Ich versorge Sie gleich«, ein Hustenanfall überfiel sie. In diesem Augenblick betrat Schwester Dorothea den Saal, lief zu ihr und legte die Decke über den Patienten.
»Schauen Sie nach, ob Doktor Kampmann Zeit hat. Nachher bringen Sie das schmutzige Verbandszeug weg«, wies sie Elli an. Die eilte aus dem Saal. Rosa versuchte mühsam nicht zu husten und wandte sich zum nächsten Kranken.
Dorothea beugte sich über Schulze und strich ihm über die heiße Stirn.
»Es wird Ihnen gleich besser gehen.«
Ihre Stimme beruhigte den stöhnenden Mann und er schloss erschöpft die Augen.
Nach kurzer Zeit stand Doktor Kampmann am Bett. Er hatte einen Rundgang um das Rasenareal gemacht, um einen klaren Kopf zu bekommen. Der Nachtdienst saß ihm noch in den Knochen. Rudolf und Dorothea reinigten die nässende Wunde und verbanden sie frisch. Rosa kümmerte sich, leise vor sich hin hüstelnd, um die anderen Patienten. Schließlich ging der Doktor zu ihr und bat sie, mit ihm in den Korridor zu kommen. »Ihr Husten gefällt mir nicht, Schwester Rosa. Gehen Sie nachher zu Doktor Ackermann und lassen Sie sich untersuchen.«
Anschließend wandte er sich an Dorothea. »Holen Sie bitte die Karteikarten. Bevor ich ins Operationshaus zurückgehe, machen wir noch Visite.«
Nach dem Rundgang blieb er vor dem Saaleingang stehen. »Wie lange sind Sie schon hier im Krankenhaus, Schwester Dorothea?«
»Seit über einem Jahr. Ich war vorher bei den Viktoria-Schwestern im Friedrichshainer Krankenhaus.«
»Aha«, Rudolf betrachtete sie nachdenklich. »Seit Sie hier arbeiten, sind die Männer wie ausgewechselt, nicht mehr so ruppig wie früher. Mir scheint’s, die mögen Sie … Ich bin auch froh, dass Sie hier sind«, fügte er verlegen hinzu.
Dann räusperte er sich kurz und fuhr in einem sachlichen Ton fort: »Ich fürchte, Schulze überlebt den Wundbrand nicht. Geben Sie ihm jetzt und heute Abend Morphium. In den nächsten zwei Stunden bin ich im Operationshaus. Danach setzen wir unsere Visite im nächsten Pavillon fort.«
In der Unterkunft der Krankenschwestern inspizierte Dorothea ihre Schürze. Die aufgesetzte Tasche hatte sich an der Seite gelöst, als sie hastig ein Tuch hineingesteckt hatte. Ihre Mittagspause war kurz. Schnell holte sie die Nähutensilien aus der Schublade des Tisches neben dem Bett. Den Raum teilte sie sich mit ihrer Freundin Rosa und Schwester Irene. Er war klein. In den schmalen Spinden bewahrten die Frauen ihre Kleidung, ein paar Bücher und wichtige Utensilien auf.
Wie umsichtig Doktor Kampmann die Wunde von Schulze versorgt hatte. Sogar gelobt hatte er sie. Mit ihm arbeitete sie am liebsten zusammen. Sie sollte sich mehr auf die Arbeit konzentrieren und nicht ständig an den Doktor denken, ermahnte sie sich. Schließlich hatte sie noch andere Pläne. Ihre Gedanken schweiften zu Florence Nightingale, ihrem Vorbild, der sie so gern begegnet wäre.
Der Riss war vernäht und Dorothea zog die Schürze an. Im Spiegel über der Waschschüssel betrachtete sie ihr blasses Gesicht. Eine Strähne ihres dichten rötlich-blonden Haares war aus der Haube gerutscht. Sie schob sie hastig zurück und verließ das Zimmer.
Vor dem Haus prallte sie mit Rosa zusammen. »Na, hast du dich für den Doktor hübsch gemacht?«
Dorothea errötete: »So ein Unsinn. Hab nur meine Schürze ausgebessert.«
»Mach mir nichts vor. Ich seh doch, wie du ihn anhimmelst. Die meisten Schwestern schwärmen für ihn. Sieht aber auch fabelhaft aus und obendrein ist er Junggeselle. Aber der hat anderes im Kopf.«
»Was du bloß redest. Ich muss jetzt zurück in die Baracke.« Dorothea drehte sich um und sputete sich, um pünktlich zu sein.
Rosa schaute ihr kopfschüttelnd nach. Manchmal wünschte sie sich, die schlanke Gestalt ihrer Freundin zu haben. Sie betrachtete ihre klobigen Hände und Füße, wie eine Waschfrau kam sie sich vor. Auch die füllige Oberweite machte ihr zu schaffen. Ihre glatten aschblonden zu einem Knoten geflochtenen Haare waren glücklicherweise unter der Haube verborgen. Nie würde sie mit diesem Aussehen einen Mann ergattern. Bereits im Waisenhaus hatte sie sich deshalb entschlossen, Krankenschwester zu werden. Als die Heimleiterin von ihrem Berufswunsch erfuhr, hatte sie ihr die Ausbildung bei den Viktoria-Schwestern in Friedrichshain ermöglicht.
Ein kalter Windstoß blies in ihren Umhang, Rosa fröstelte. Sie musste sich beeilen, erst eine saubere Schürze holen und anschließend Doktor Ackermann aufsuchen.
Kapitel 2
Vor dem Portal des roten Backsteingebäudes am Nordufer des Spandauer Schifffahrtskanals debattierte eine Gruppe Assistenten aus dem Institut für Infektionskrankheiten. Auf einem Podium aus Obstkisten stand ein stämmiger Mann und redete. Mit seinem schmutzigen Leinwandkittel und der Baskenmütze ähnelte er einem Künstler. Er strich sich über den stoppeligen grauen Vollbart und hob den Arm, um mit dem Zeigefinger auf die Zuhörer zu deuten: »Ich kann nicht verstehen, warum die armen Tiere für Ihre bestialischen Versuche missbraucht werden. Sie haben keine Fürsprecher und müssen elend zugrunde gehen.«
Rudolf, der in einer Droschke saß, hatte die Ansammlung von Weitem beobachtet und sprang sofort hinaus.
»Was ist denn los?«, fragte er den Erstbesten.
Dieser zuckte mit den Achseln.
»Hermann aus Plötzensee hält wieder eine Rede«, er deutete auf den Redner. »Seitdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde, wettert er ständig gegen unsere Tierversuche. Dabei gäb’s ohne die keinen medizinischen Fortschritt.«
Er schob die Hände in die Kitteltaschen. Ein anderer junger Mann mit Nickelbrille, schwarzem Schnurrbart und kurz geschorenen Haaren rief gerade: »Wenn wir die Tiere nicht hätten, würdest du an Diphtherie krepieren.«
»Es gibt andere Möglichkeiten, um die Bazillen zu erforschen«, fuhr Hermann unbeirrt fort, »Gott hat sie wie die Menschen erschaffen. Schon in der Bibel steht ›Der Gerechte erbarmt sich seines Viehs, aber das Herz der Gottlosen ist unbarmherzig.‹«
Am Ende der Straße tauchten zwei berittene Polizisten auf. Langsam gingen die Assistenten in das Gebäude zurück. Hermann wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn und kletterte vom Podium. Unbeeindruckt von den Polizisten, die stehen geblieben waren, hob er die Obstkisten auf und trug sie zu einem Leiterwagen.
In Begleitung von einem Assistenten von Doktor Ehrlich stieg Rudolf die Treppe hoch.
»Uns bleibt keine andere Wahl, als die neuen Impfpräparate Tieren zu verabreichen. Später führen wir ohnehin Feldversuche durch.«
Rudolf nickte nachdenklich. Während eines Physiologie-Praktikums hatte er Versuche mit Fröschen durchgeführt. Damals hatte er sich nicht überlegt, ob diese Amphibien Schmerzen empfinden könnten. Er verabschiedete sich von dem Kollegen und betrat einen Raum im ersten Stock. Seit eineinhalb Jahren arbeitete er in der Freizeit als Assistent im Institut. Das Studium hatte ihm keine Möglichkeit geboten, sich mit den Erregern von Infektionskrankheiten zu beschäftigen. Dies holte er jetzt nach. Bakterienkunde und die Seuchenbekämpfung faszinierten ihn.
Die Gruppe um Direktor Robert Koch entwickelte neue Methoden, um Bakterien auf Nährböden zu züchten und im Wärmeschrank zu bebrüten. Durch die verbesserte Funktionsweise der Lichtmikroskope gelang es ihnen die Tuberkel-, Cholera- und Diphtheriebazillen nachzuweisen. Sie infizierten Mäuse oder Meerschweinchen mit Bakterien, suchten nach neuen Impfstoffen, arbeiteten an einem Heilmittel gegen Tuberkulose, der jedes Jahr Tausende zum Opfer fielen. Was jahrhundertelang Grundlage der Medizin war, wurde hier umgestoßen. Rudolf wollte daran mitarbeiten.
Er begrüßte Arnold Rautenberg, seinen Chef. Dieser nickte, fuhr sich durch die glatten dunklen Haare und beugte sich über ein Mikroskop. »Ich habe Typhusbakterien von Dauerausscheidern eingestellt. Schau, diese hartnäckigen Burschen. Wir müssen einen wirkungsvollen Impfstoff herstellen. Die Soldaten im Feld sind der Krankheit wehrlos ausgeliefert.«
Arnold erhob sich, überließ Rudolf seinen Platz und suchte auf dem Arbeitstisch nach weiteren Objektträgern.
»Wo sind die Milzbrand-Präparate? Muss ich mich denn um alles kümmern?«, schnauzte er den Assistenten Fischer an, der Nährböden in Petrischalen mit Bakterienstämmen beimpfte. »Es wird Zeit, dass Doktor Koch nach Berlin zurückkommt.«
Der kleinste Anlass konnte Arnold zornig werden lassen. Wahrscheinlich hatte er eine Pechsträhne beim Pferderennen gehabt. Rudolf zog sich an seinen Arbeitsplatz zurück und blätterte in dem Heft mit den Zeichnungen von Mikroben: Diphtherie-, Cholera-, Tuberkel- und Milzbranderregern, die er im Laufe der letzten Monate angefertigt hatte.
»Eine gewisse Ähnlichkeit ist nicht zu leugnen.«
Rudolf zuckte zusammen. Arnold stand hinter ihm. Immer musste er seine bissigen Kommentare abgeben. Dabei wollte Rudolf nur seine Ruhe haben, um in der kurzen Zeit, die ihm zur Verfügung stand, möglichst viel zu lernen. Ob er mit einer anderen Gruppe zusammenarbeiten sollte? Er könnte versuchen, bei Doktor Ehrlich unterzukommen, der an einem Chemotherapeutikum gegen Syphilis arbeitete. Doch ihn interessierte besonders die Entwicklung eines Impfstoffes gegen Typhus.
»Da fällt mir ein, ich habe Karten für das Schauspielhaus«, fuhr Arnold fort, »es gibt ›Götz von Berlichingen‹. Hast du Lust, mitzukommen?«
Rudolf holte tief Luft und zwang sich zu einem Lächeln, bevor er fragte: »Wann?«
»Nächsten Donnerstag. Luise interessiert sich nicht fürs Theater.«
»Hat Clara keine Zeit? Du hast doch genug Freundinnen zur Auswahl.«
»Die besucht ihre Tante«, Arnold betrachtete seine klobigen Hände und zog an den Fingergelenken, bis sie knacksten. Rudolf schob einen Objektträger unter das Mikroskop. Bei dem knackenden Geräusch zitterten seine Hände. Sein ehemaliger Schulfreund Georg hatte auch diese Angewohnheit gehabt. Er fühlte dessen Gegenwart so intensiv, dass ihm der Schweiß ausbrach.
»Was ist los mit dir?«, Arnolds Stimme verschärfte sich. »Ich hab keine Zeit, hab nächste Woche Nachtdienst.«
»Du hast wohl ständig Dienst. Letztes Jahr hast du öfter Zeit gehabt. Sonst bist du gern mit ins Theater gegangen!«
»Professor Sonnenburg hat einen Kollegen zur Fortbildung nach Hamburg geschickt. Tischendorf und ich teilen uns dessen Arbeit.«
»Na schön, vielleicht klappt es ein anderes Mal. Im April gibt es ein Konzert in der Philharmonie.«
Als Arnold keine Antwort erhielt, fuhr er missmutig fort: »Ich geh in den Hof. Kommst du mit?«
Rudolf schüttelte den Kopf.
»Muss die Meerschweinchen begutachten, denen wir die Pestbazillen verabreicht haben. Kein Interesse?«
»Nein«, brummte Rudolf kaum hörbar und atmete auf. Endlich hatte er Ruhe. Er nahm sich vor, den Umgang mit Arnold einzuschränken. Das unangenehme Gefühl in seiner Gegenwart machte ihm zu schaffen. Außerdem wollte er sich mit Karl treffen. Seit Langem hatte er für seinen Cousin keine Zeit mehr gehabt.
Im Operationssaal herrschte Stille. Doktor Hermes hatte bei einem Patienten, der über Schmerzen im rechten Unterbauch geklagt hatte, den Blinddarm entfernt. »Bei einer Appendizitis erzielt man die besten Behandlungsergebnisse mit der frühzeitigen Operation«, erklärte er Rudolf, der ihm assistierte.
»Verschließen Sie die Wunde, Kampmann.«
Plötzlich störten laute Rufe und hin- und hereilende Schritte aus dem Flur die Ruhe. »Schauen Sie nach, was draußen los ist«, wies der Oberarzt einen Krankenwärter an.
In dem Moment riss ein Pfleger die Tür auf und stürzte in den Saal: »Draußen sind Schwerverletzte. Eine Gasexplosion. Herr Oberarzt, komm Se …«
Doktor Hermes rannte hinaus und prallte auf einige Sanitäter, die Bahren mit Verletzten hereintrugen. Auf der ersten Trage lag ein Mann, der vor Schmerzen schrie. Sein Schädel war verbrannt, das Gesicht mit Blasen bedeckt, die Haare waren versengt. Die Verbrennungen erstreckten sich bis zu den Beinen, die Hände waren nur noch schwarze Krallen, Haut und Muskeln waren weggeschmolzen.
Weitere Wärter drängten sich mit Bahren im Flur, auf denen drei Frauen und zwei Kinder in verkohlter Kleidung lagen, die Augen weit aufgerissen, die Körper vor Schmerzen gekrümmt. Es stank nach verbranntem Fleisch.
Der Oberarzt deutete auf den ersten Verletzten: »Den Mann sofort in den septischen OP-Saal bringen. Und Professor Sonnenburg rufen.«
Kaum hatte Rudolf die Bauchnaht verschlossen, verband ein Pfleger die Wunde und fuhr den Kranken hinaus. Zwei Krankenwärter bereiteten den Saal für die Verletzten vor.
Für den Mann mit den Verbrennungen kam jede Hilfe zu spät. Das Körpergewebe war so stark geschädigt, dass die Schocksymptome zum Herzversagen führten.
Ein junger Bursche war durch einen herabgefallenen Balken verletzt worden und hatte eine Quetschung des Brustkorbs sowie einen komplizierten Unterschenkelbruch erlitten. Knochensplitter drangen durch die Haut. Aus der Wunde quoll das Blut hervor. Doktor Hermes operierte ihn sofort.
»Infusionen anlegen! Puls kontrollieren! Die Wunden reinigen! Laudanum geben!«
Rudolf und zwei Kollegen stillten Blutungen, entfernten Glas- und Steinsplitter aus den Muskeln und inneren Organen, amputierten verstümmelte Finger, Hände oder Arme, die nicht mehr zu retten waren.
Der Oberarzt forderte aus den umliegenden Baracken Krankenschwestern an, die Infusionen anlegten, die Brandwunden mit Tanninsäurekompressen behandelten und Schnittwunden reinigten und verbanden.
Wärter entfernten die verkohlten Kleidungsstücke, holten aus dem Vorraum die verlangten Hilfsmittel, trugen Decken herbei, um die Patienten vor Unterkühlung zu schützen, und brachten die Verstorbenen in die Leichenhalle.
Professor Sonnenburg behandelte mit seinem Team bei einer zwanzigjährigen Frau die Gesichtsverletzungen. »Zuerst die Wunde säubern und die Glassplitter entfernen«, wies er einen Assistenten an.
»Wenn der Defekt zu groß ist, nehmen wir einen Hautlappen aus dem Oberschenkel.«
Bis zum späten Nachmittag konnten alle Verunglückten versorgt und in die Baracken gebracht werden.
Das Berliner Tageblatt berichtete am nächsten Tag:
Gestern Vormittag ereignete sich in einem Mietshaus in Moabit eine Gasexplosion. Beim Eintreffen des ersten Löschzuges standen bereits die obersten Stockwerke in Flammen. Fünf Tote und zahlreiche Verletzte konnten geborgen und in den Krankenhäusern versorgt werden. Unzählige Zeugen wurden am Unfallort vernommen. Wahrscheinlich war eine undichte Gasleitung oder eine fahrlässige Behandlung des Gasometers die Ursache.
Rudolf holte aus der Kleiderkammer seinen Mantel und trat aus dem Operationshaus. Ein eisiger Nordwind fegte über das Gelände, die Wege waren nass vom Regen. Fröstelnd vergrub er die Hände in den Manteltaschen und schlug den Kragen hoch. Nach den hektischen Stunden im Operationssaal war er hundemüde, wollte aber noch seinen Schützling Elsa Jacoby besuchen.
Er betrat die Chirurgie-Baracke für Frauen. An Elsas Bett stand eine Frau. Eine Krankenschwester redete eindringlich auf sie ein, weil keine Besuchszeit war. Die Dame wandte sich um und schritt zum Ausgang. Sie trug eine dunkelgraue Pelerine, auf dem Kopf saß ein schmuckloser schwarzer Hut mit schmaler Krempe. Mit erhobenem Haupt rauschte sie an dem Arzt vorbei, ohne ihn eines Blickes zu würdigen. Die Krankenschwestern eilten unterdessen von einer Patientin zur nächsten, überprüften Wunden, Puls und Temperatur und strichen die Betttücher glatt. Bald würden sie das Abendbrot verteilen. Rudolf ging zu Elsa. Sie wischte sich hastig Tränen ab und starrte zur Zimmerdecke.
»Wie geht es Ihnen, Fräulein Jacoby?«
»Danke, gut«, schluchzte sie.
»Det is jelogen«, sagte eine Stimme vom Nachbarbett. »Ihre Mutter hat se ausjeschimpft, richtig die Leviten jelesen und det se ’n Schandfleck is.«
Elsa hob ihren Oberkörper an, um sich an die Nachbarin zu wenden, verzog ihr Gesicht und presste eine Hand auf den Unterleib. »Das stimmt nicht. Seien Sie ruhig, Frau Peters.« Elsa schaute den Doktor verängstigt an und er kam ihr zu Hilfe: »Sind Sie heute schon aufgestanden?«
»Ja, die Schwester hat mit mir eine Runde gemacht. Ich möchte bald heim.«
»Det ick nich lache«, mischte sich die Nachbarin erneut ein, grinste und zeigte dabei drei Zahnstummel. »Nach Amerika soll se, det arme Ding und …«
»Ist das wahr?«, unterbrach Rudolf den Redeschwall. »Sie sollten nach der Entlassung größere Anstrengungen vermeiden.«
Die junge Frau nickte und knetete ihr Taschentuch mit den Händen. »Ich soll zu meinem Onkel. Der besitzt eine Firma in Newyork.«
Rudolf schaute die Patientin nachdenklich an. Sie erinnerte ihn an seine ehemalige Freundin Elsa. Das gleiche zu Zöpfen geflochtene braune Haar, die dunklen Augen und das eigenwillige Kinn. Während seiner Abiturientenzeit hatte er sie geliebt – und verloren.
»Wann darf ich nach Hause, Herr Doktor?«, holte ihn Elsas Frage in die Gegenwart zurück.
»Das kommt auf die Wundheilung an. Doktor Tischendorf entscheidet das. Ich komme in zwei Tagen wieder zu Ihnen.«
Er nickte ihr und Frau Peters zu und verließ den Saal.
Vor dem Pavillon zerrte ein Windstoß an seinem Mantel. Mit eingezogenem Kopf marschierte er zur Baracke zweiundzwanzig, öffnete die Tür, die ihm der Wind beinahe aus der Hand riss und schloss sie vorsichtig. Suchend blickte er sich im Krankensaal um.
»Wo liegt Schulze?«, fragte er einen vorbeieilenden Wärter.
»Wir haben ihn in die B vierzehn verlegt.«
Rudolf begab sich zu dem angegebenen Bau. Der Kutscher lag in einem düsteren Raum. Das ehemals volle Gesicht war blass und eingefallen, die Atmung war schwach. Er schien nichts mehr wahrzunehmen. Rudolf ertastete kaum den Puls, fühlte die kalte Haut. Ein kurzes Röcheln, dann Stille. Er beugte sich über den Mann, schloss ihm die Augen und verharrte einen Moment.
Tagsüber blieb es länger hell. Die Bäume an der Hauptallee des Krankenhauses reckten die kahlen Zweige empor, an denen sich bereits die ersten grünen Blattsprossen zeigten. Eine Horde Spatzen bevölkerte die Sträucher und zwitscherte um die Wette. Auf den Bänken vor den Pavillons saßen Patienten und wandten ihre bleichen Gesichter den spärlichen Sonnenstrahlen entgegen. Rudolf schritt zügig vom Operationshaus zu den Frauen-Baracken.
»Wolln Se zu det Frollein, Herr Doktor?« Er blickte sich um und entdeckte Frau Peters, die vor dem Pavillon saß. Sie grinste ihn an: »Den Besuch könn Se sich sparen, die Mutta hat se jeholt. Wie se jedroht hat, ick sach doch immer …«
Rudolf unterbrach sie schroff: »Vielen Dank, wann wurde sie abgeholt?«
»Heute früh. Die Kleene hat noch jejammert, dat se Schmerzen hat …«
Der Arzt nickte, den Rest hörte er nicht mehr. Warum hatte er sie nicht gestern besucht? Dann hätte er die Entlassung verhindern können. Sobald er es einrichten konnte, würde er sich Elsas Adresse besorgen und zu ihr nach Hause fahren. Ob er der jungen Frau noch helfen konnte? Er steckte die Hände in die Kitteltaschen und ging zu den Männerpavillons. Dort stand Schwester Dorothea. Sie beruhigte die Eltern eines kranken Jungen. »Es geht ihm gut. Machen Sie sich keine Sorgen. Bald ist er wieder gesund.«
Rudolf blieb stehen und beobachtete sie. Reizend sah sie aus in dem dunkelblauen Kleid mit der weißen Schürze und der gestärkten Haube, die ihre Haare verbarg. Eine Strähne kringelte sich vor dem Ohr.
»Ich möchte Sie kurz sprechen, Schwester Dorothea.«
Sie entschuldigte sich bei dem Ehepaar und ging mit Doktor Kampmann auf die Seite.
»In Baracke einundzwanzig liegt Herr Fritsche, der mit der Gallenblasenoperation. Ständig regt er sich auf. Sprechen Sie mal mit ihm, auf Sie hört er sicher. Notfalls geben Sie ihm Laudanum.«
Dorothea lächelte. »Ich schau nachher bei ihm vorbei, Herr Doktor.«
»Die nächsten zwei Tage bin ich im Institut für Infektionskrankheiten. Doktor Tischendorf übernimmt dann meine Baracken.«
Rudolf sah für einen Moment Elsa vor sich, wie sie ihm zulächelte. Er schluckte.
Die Krankenschwester schaute ihn fragend an. »Kann ich noch etwas für Sie tun?«
Er schüttelte den Kopf, rieb sich verlegen die Hände und verschwand schnell in Richtung Operationsbaracke.
Dorothea suchte das Operationshaus auf. In dem Gebäude befanden sich außer den Operationssälen die Poliklinik, die Räume des Direktors sowie Behandlungs- und Vorratszimmer. Die Vorräte in den chirurgischen Baracken mussten ergänzt werden, deshalb wollte sie Verbandsmaterial und Tücher bestellen. Außerdem brauchten sie neue Spritzen. Das Übrige würde sie von einem Wärter holen lassen. Später könnte sie die Krankenhausapotheke aufsuchen, um die verordneten Arzneimittel zu besorgen.
Ein Krankentransport-Wagen fuhr an ihr vorbei. Die Krankenschwester schaute ihm flüchtig nach. Wie seltsam Doktor Kampmann sie angeschaut hatte. Was mochte er überlegt haben?
Sie erreichte den neumodischen Wagen mit Fahrradantrieb, der vor der Poliklinik stand. Zwei Wärter trugen eine Bahre mit einem Kind hinein. Eine Frau lief jammernd hinterher.
»Hier dürfen Se nich rinn«, schnauzte ein Krankenwärter. »Der Warteraum is drüben.«
Dorothea ging um das Operationshaus herum zu dem Anbau, in dem sich der Utensilienraum befand. Dort gab sie die Bestellung ab und nahm Spritzen in Empfang. Auf dem Weg zur Baracke kam sie wieder an der Poliklinik vorbei. Am Eingang stand die schluchzende Mutter: »Ick will zu meenem Jungen.«
Die Schwester trat zu ihr.
»Kommen Sie, ich bringe Sie ins Wartezimmer«, sie zog die Weinende mit sich. »Setzen Sie sich. Was ist passiert?«
»Ick war beim Einkoofen im Jemüsejeschäft. Meen Kleener hat sich losjerissen, rannte uf de Straße, es jing allet so schnell. Ick bin ihm nachjeloofen, hörte een Quietschen. Da war er schon uner de Bahn …«, die Frau schniefte und wischte mit dem Handrücken über die Nase. Dorothea holte aus der Schürze ein Taschentuch und reichte es ihr. Diese schnäuzte sich kräftig.
»Danke. Warum kann ick nich zu ihm?«
»Ich seh mal nach. Warten Sie hier.«
Als sie in den Flur hinaus lief, kam ihr Elli entgegen.
»Sie sollen zu Herrn Fritsche kommen. Doktor Kampmann …«
»Gleich«, Dorothea überreichte ihr den Korb mit den Spritzen. »Bring das schon mal rüber. Ich muss noch etwas erledigen.«
Im Untersuchungszimmer blickte sie sich suchend um. »Wo ist der Junge, der vorhin gebracht wurde?«
Ein Wärter deutete auf eine mit einem weißen Tuch bedeckte Bahre. Undeutlich zeichnete sich der Umriss eines kleinen Körpers ab. »Den bringen wir in die Leichenhalle.«
»Die Mutter wartet draußen.«
Der Mann zuckte mit den Achseln. »Jeht mich nichts an.«
Die Schwester ging in den Warteraum zurück.
»Ist er tot?«, heulte die Frau. Dann schrie sie auf:
»Er ist tot! Ick will ihn sehn!« Tränen rannen ihr die Wangen herunter. Dorothea führte sie ins Zimmer. Ein Arzt stand neben der Tragbahre.
»Frau Buda? Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Junge den Unfall nicht überlebt hat.«
Die Mutter warf sich über ihren Sohn und klammerte sich an den Körper. Dorothea wollte sie zurückhalten, doch der Arzt winkte ab.
Sie wandte sich um und hastete zur Krankenbaracke zurück. Atemlos vom Laufen, mit geröteten Wangen eilte sie durch den Saal. Doktor Kampmann stand mit Rosa am Bett von Fritsche.
»Wir haben Sie dringend gebraucht, Schwester«, der Arzt schaute verstimmt.
»Ich wollte …«, begann Dorothea kleinlaut, strich verlegen über ihre Schürze und murmelte: »Verzeihung.«
»Herr Fritsche hat eine Thrombose. Das Bein muss gewickelt und hochgelagert werden.«
Kapitel 3
In der Heilandskirche im Kleinen Tiergarten gegenüber dem Krankenhaus saß in der vierten Reihe eine junge Frau. Ein Tuch und ein Umhang verhüllten Kopf und Körper. Sie blickte zum Altar und murmelte ein Gebet: »Lieber Gott, gib mir Kraft und Geduld. Ich wünsche mir, dass meine Arbeit endlich anerkannt wird.«
Kapitel 4
Kaum hatte sich Rudolf an seinen Arbeitsplatz im Labor des Koch’schen Instituts gesetzt, trat Assistent Fischer zu ihm.
»Ich hab einen Tierstall mit dreißig Mäusen für die Versuche bestückt. Wir können …«
Die Tür flog auf und Arnold stürzte herein. Er war wieder mal zu spät nach einer sonntäglichen Eskapade. Rudolf schüttelte den Kopf.
Fischer ließ seinem Vorgesetzten Doktor Rautenberg keine Zeit zum Verschnaufen und überfiel ihn sofort: »Das Brunnenwasser aus den Typhusgebieten in Süddeutschland ist vollkommen verseucht. Wozu veröffentlichen wir Hygiene-Vorschriften, wenn sich niemand dran hält!«
Arnold erwiderte zerstreut: »Ja, es gibt viel zu tun. Holen Sie mir sofort die Unterlagen von den letzten zwei Wochen.«
Rudolf legte einige Objektträger neben sein Mikroskop und blätterte in der Veröffentlichung von Robert Koch über ›Die Bekämpfung des Typhus‹. Arnold setzte sich zu ihm, zündete eine Zigarette an und blies den Rauch in die Luft.
»Gestern war der letzte Renntag in Strausberg. Hab auf Philister gesetzt und der hat vor Convention gewonnen. Luise war nicht so begeistert. Allmählich geht sie mir auf die Nerven. Werd später Anna anrufen«, er unterbrach sich, »hörst du mir überhaupt zu?«
Gerade hatte Rudolf einen Objektträger unter das Objektiv des Mikroskops gelegt und wollte ihn ansehen.
»Entschuldige, ich versuche, die Präparate zu begutachten. Bin etwas in Eile. Muss nachmittags wieder im Krankenhaus sein.«
»Wie schaffst du es bloß, neben deiner Chirurgentätigkeit hier zu arbeiten? Hast du überhaupt Freizeit? Schaff dir eine Freundin an, dann merkst du, wie schön das Leben ist.«
»Mein Privatleben geht dich nichts an. Lass mich jetzt in Ruhe«, Rudolfs Ton verschärfte sich.
»Gut, gut, ich komm morgen im Krankenhaus vorbei. Muss die Impfreaktion bei einigen Patienten überprüfen. Wenn du Zeit hast, könnten wir uns treffen. Das war eine gute Entscheidung, dass die Verwaltung uns zwei Baracken zur Verfügung gestellt hat.«
Assistent Fischer betrat den Raum mit drei Aktenordnern und legte sie vor Arnold auf den Tisch. Dieser schaute auf und schnauzte ihn an: »Haben Sie eigentlich die weißen Mäuse in den Tierstall gebracht?«
»Ja, ich helfe Doktor Kampmann bei den Typhus-Versuchsreihen.«
Arnold runzelte die Stirn. »Haben Sie eine Erlaubnis eingeholt? Meine Anordnung lautete, dass wir erst in zwei Wochen beginnen. Der Wärmeschrank funktioniert nicht und wird noch repariert.« Er warf Rudolf einen wütenden Blick zu. Als ob er ihm am liebsten ein paar Bazillen verabreichen würde.
Rudolf schob die neben ihm liegenden Papiere in eine Mappe und erhob sich. »Ich gehe. Es ist mir heute zu unruhig. Da kann man sich nicht konzentrieren. Und was die Versuchsreihen anbelangt, Professor Gaffky hat mir die Erlaubnis gegeben. Wie ich hörte, wird er in einigen Monaten die Leitung des Instituts übernehmen. Auf Wiedersehen.«
April 1904
Schwester Dorothea betrat atemlos den Warteraum im Operationshaus. Vor einer Stunde wurde ihr Vater mit heftigen Unterbauchschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert. Der diensthabende Arzt hatte ihn sofort operiert. Die Tür öffnete sich und Doktor Kampmann kam herein. Sie ging auf ihn zu.
»Herr Doktor, wie geht es meinem Vater, ich meine, Herrn Göhler?«
»Ach, Sie sind seine Tochter? Es war eine akute Blinddarmentzündung. Doktor Cohn konnte den Eingriff ohne Probleme durchführen.«
»Vielen Dank«, Dorothea konnte vor Aufregung kaum reden.
Der Arzt schaute sie mitfühlend an. »Ihrem Vater geht es gut. Sie können ihn jederzeit besuchen.«
»Danke, Herr Doktor.«
Rudolf hätte sie gern getröstet und umarmt. Aber er wollte sich nicht wie Arnold benehmen, der die Frauen öfter wechselte als seine Hemden. Schließlich stieß er mit rauer Stimme hervor: »Ich hab heute Dienst. Später schau ich bei ihm vorbei.«
Dorothea bedankte sich und verließ das Zimmer. Rudolf schaute ihr nachdenklich hinterher.
Der Nachtdienst verlief ruhiger als sonst. In einem Mietshaus hatten sich zwei Familien gestritten und gegenseitig verprügelt. Rudolf versorgte die Verletzungen und beruhigte die Ehefrauen. Nach Mitternacht suchte er Dorotheas Vater auf. Wie aufgeregt die Krankenschwester gewesen war. Warum hatte er nicht mehr Anteilnahme gezeigt, war auf sie eingegangen? Als Arzt hatte er sich korrekt verhalten, aber diese üblichen Floskeln hätte er nicht verwenden sollen. Ob er Schwester Dorothea bei der nächsten Gelegenheit zu einem Spaziergang einladen sollte? Er fühlte sich zu ihr hingezogen. In Gedanken versunken betrat er die Baracke und ging zu Herrn Göhler.
»Es geht mir gut, Herr Doktor. Aber der Mann da drüben«, er deutete auf Herrn Fritsche, »war ziemlich aufgeregt. Dann war die Nachtschwester bei ihm und jetzt ist er ruhig.«
Rudolf drehte sich um und ging zu dem Bett des Patienten. Er nahm dessen Hand, um den Puls zu fühlen. Die Hand war schlaff und kalt. Ungläubig beugte er sich vor, Herr Fritsche atmete nicht mehr.
Doktor Kampmann stieg aus der Droschke und vergewisserte sich, dass er vor dem richtigen Gebäude stand. Ackerstraße 132 im Wedding, Elsa Jacobys Wohnung. Vor dem Haus hopsten Kinder auf dem Gehweg, flitzten zwei Arbeitern zwischen die Beine, die einen Leiterwagen mit Holz beluden. Über dem hohen Torbogen stand Erster Hof und an den Hauswänden prangten einige Schilder mit den Hinweisen:
Zur Holz u. Kohlenhandlung im Keller.
Wannen – Dampfkasten – Heißluft – Medicinische Bäder,
C. Richter, Heilgehilfe, Masseur, Bademeister.
Radfahren verboten.
Rudolf lief durch die folgenden drei Höfe, bis er auf einem stummen Portier den Namen Käthe Jacoby entdeckte, daneben li. Seitenflügel, III. Stock.
Hoffentlich traf er Elsa noch an. Mittlerweile waren fünf Tage vergangen. Vom Kollegen Cohn hatte er einen Nachtdienst übernehmen müssen. Und dann der Todesfall. Weshalb war Fritsche so plötzlich gestorben?
Ein lang gezogenes kreischendes Geräusch riss ihn aus seinen Gedanken. Im vierten Hof hatte ein Scherenschleifer seinen Wagen aufgestellt. Vier Frauen umringten ihn, in den Händen hielten sie Messer und Scheren. Sie tratschten miteinander und warfen Rudolf misstrauische Blicke zu.
»Ob er wegen des Mordes nebenan vorbeikommt?«, hörte er sie tuscheln. »Gestern hat mich jemand nach dem Leierkastenmann gefragt …«
Zwei Jungen spielten Fangen, ein Köter sprang zwischen ihnen hoch und kläffte.
Er öffnete die Tür zum Seitenflügel, bückte sich und tastete im Dunkeln nach dem Lichtschalter. Ein dünner Lichtstrahl erhellte das Treppenhaus. Die ausgetretenen Holzstufen knarrten, von den Wänden bröckelte der Putz, Kohlgeruch lag in der Luft. Weiter oben klappte eine Tür, eine Frauenstimme schrie »Scher dich zum Teufel.«
Kinder plärrten.
Im dritten Stock fand er die gesuchte Wohnung und klingelte. Nach geraumer Zeit näherten sich Schritte und die Frau, die ihm bereits im Krankenhaus begegnet war, öffnete. »Was wollen Sie? Ich kaufe nichts«, herrschte sie ihn an und wollte die Tür zuschlagen.
Doch Rudolf stellte einen Fuß in den Türspalt. »Warten Sie Frau Jacoby, ich bin Doktor Kampmann aus dem Krankenhaus Moabit. Ich möchte nach Ihrer Tochter sehen. Sie wurde …«
»Kümmern Sie sich nicht um Elsa, ihr geht’s gut.«
»Aber ich …«
»Lassen Sie meine Tochter in Ruhe oder ich hol die Polizei. Anton«, schrie sie, »hilf mir mal.«
Ein Riese von einem Mann tauchte hinter der Frau auf und Rudolf schaffte es gerade noch, den Fuß zurückzuziehen, ehe die Wohnungstür zuschlug. Er rieb seinen Arm, der die Tür abbekommen hatte. Resigniert drehte er sich um und verließ das Haus. Hoffentlich heilte Elsas Wunde gut und sie …
Neben ihm knallte ein Kutscher laut fluchend mit der Peitsche. Beinah wäre er in eine Pferdedroschke hineingelaufen. Dahinter hupte ungeduldig ein Automobil.
»Könnten Sie mich nach Alt-Moabit fahren, zur Gotzkowsky Straße?«, fragte er den Kutscher. Der nickte und ließ den unverhofften Fahrgast einsteigen.
Vor dem Eingang des Mietshauses stand sein Cousin Karl in schneidiger Uniform, vor ihm lagen drei Zigarettenstummel. Er verbrachte seine Rekrutenzeit in Berlin. Die glatten blonden Haare, die hellblauen Augen und der verschmitzte Gesichtsausdruck ließen manche Frauenherzen höherschlagen.
»Tut mir leid, dass ich mich verspätet habe. Ich hatte noch etwas zu erledigen.«
»Ist in Ordnung«, Karl drückte die Zigarette aus, klopfte die Asche von der Uniformjacke und strich sich über den dichten, nach oben gezwirbelten Oberlippenbart. Sie betraten das Haus. Im Treppenhaus roch es nach Bohnerwachs. Eine hagere Frau, Ende fünfzig, wischte den Absatz vor ihrer Tür. Auf den Schrubber gestützt, trocknete sie ihre Hände an der Kittelschürze ab und schaute ihnen nach, als sie in den vierten Stock stiegen.
Oben wartete bereits Tante Clementine und begann zu reden, bevor sie die Wohnungstür geschlossen hatte. Dabei schüttelte sie lächelnd den Kopf und gestikulierte mit den Händen.
»Du arbeitest im Moabiter Krankenhaus? Warum hast du uns nicht besucht? Vor einem Jahr haben wir dich zuletzt in Neuruppin gesehen.«
»Ich habe viel zu tun, Tante.«
»Wie geht’s deinen Eltern? Wilhelm hat lange nichts von sich hören lassen.«
»Ende April fahre ich nach Hause. Dann sage ich Vater Bescheid, dass er sich bei dir meldet.«
»Was macht Paul? Dein Bruder müsste doch bald mit dem Studium fertig sein?«
»Ja. Er genießt sein Studentenleben.«
Bevor die Tante die nächste Frage stellen konnte, fuhr Rudolf fort: »Was ist mit Grete? Ist sie verlobt?«
»Leider nicht«, Clementine sprach selten über ihre ledige Tochter. »Aber sie hat eine ordentliche Stellung bei der Post. Nun lasst euch den Kaffee schmecken. Die Pfannkuchen hab ich extra gebacken.«
»Die sehen lecker aus«, lobte Karl und betrachtete sie mit offenem Munde.
»Wo ist Onkel Ernst?«
»Er musste auf eine Stadtratssitzung. Es geht um die Etats vor Abschluss des Rechnungsjahres, hat er mir erklärt. Ich hab’s auch in der Zeitung gelesen. Stellt euch vor, die wollen in den Armenkommissionen die Hilfe der Frauen ablehnen. Dabei sind wir für gewisse Tätigkeiten besser geeignet als die Männer«, ereiferte sich Clementine, wobei sie sich über die grauen Haare strich, die in einem Knoten zusammen gebunden waren.
Rudolf nickte zustimmend, Karl starrte sehnsüchtig auf die Pfannkuchen. Es kamen keine weiteren Kommentare. Die Tante schaute prüfend auf den Tisch, ob nichts fehlte. »Wenn ihr was benötigt, ich bin in der Küche.«
Die Tür schloss sich hinter ihr, und Rudolf wandte sich an seinen Cousin. »Du hast vor, nach Afrika zu gehen?«
»Ja, eigentlich wollte ich zur ostasiatischen Besatzungsbrigade. Hat nicht geklappt. Jetzt hab ich mich freiwillig zur Schutztruppe in Südwestafrika gemeldet.«
»Ich habe ein paar Aufrufe gelesen, dass gesunde Männer gesucht werden. Vor einer Woche hat der Kaiser wieder eine Truppe nach Südwest verabschiedet.«
»Der Konflikt mit den Hereros und Witbooi ist seit einem Jahr eskaliert. Als die Deutschen nach Südwest kamen, gehörte ein großer Teil des Landes den Hereros. Sie besaßen große Viehherden und bekriegten sich mit den anderen Eingeborenenstämmen.«
»Ich denke, Deutschland hat Südwestafrika zum Schutzgebiet erklärt«, bemerkte Rudolf, während er sich das Pflaumenmus von den Fingern abschleckte.
Karl verdrückte ebenfalls einen Pfannkuchen, bevor er fortfuhr. »Erst zeigten sich die Hereros auch kooperativ und verkauften Land und Vieh an die Siedler. Die kümmerten sich um die Bewässerung, bewirtschafteten die Felder und gründeten Ortschaften. Beim Verkauf wurden die Eingeborenen allerdings übers Ohr gehauen. Sie vertranken ihr Geld und konnten Kredite nicht mehr zurückzahlen. Vor vier Monaten verbündeten sich die Herero-Häuptlinge und kauften Waren ein, ohne zu bezahlen …«