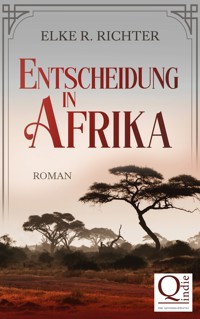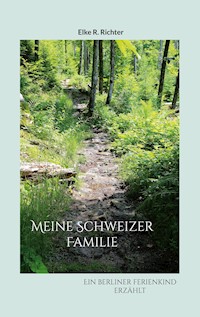
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Elke R. Richter wächst in der Nachkriegszeit in Berlin auf. 1956 hat sie das Glück, mit einem Kindertransport vom DRK in die Schweiz zu fahren. In einem Dorf im Kanton Bern findet sie bei Pflegeeltern für drei Monate Geborgenheit und ein zweites Zuhause, in das sie immer wieder gern zurückkehrt. Die Kontakte bleiben bis zum Tod der Pflegeeltern bestehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für alle Pflegefamilien in der Schweiz, die ein Ferienkind aufgenommen haben
DAHEIM
Wo ich den Fensterladen öffnete, über das Tal auf den bewaldeten Berg schaute. Wo ich ein Zimmer für mich allein hatte und nebenan regelmäßig die Standuhr erklang. Wo ich den kühlen Keller durchstreifte, aus dem Fass Sauerkraut naschte und am Eingang der Kater miaute.
Wo ich im Garten Engerlinge sammelte, für die Hühner, und Löwenzahn ohne Wurzeln ausriss, wo ich den Kaninchen den Stall öffnete und mich in der Scheune im duftenden Heu versteckte.
Wo ich auf dem Plumpsklo saß, umgeben von Fliegen und die vorbeigehenden Fußgänger zählte. Wo ich beim Bäcker knuspriges Brot holte, und für den Einkauf zehn Rappen bekam.
Wo ich in der Schule dem Lehrer lauschte und nichts verstand, wo ich die Straße herunter radelte, und dafür Schelte bekam.
Wo wir im Wald Holz holten, die trockenen Äste knackten, und wo die Bienen summten, da war ich daheim, bis der Zug pfiff, dampfte und mich fortbrachte.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
KAPITEL 1
Nach dem Tod meiner Mutter räumte ich ihren Schreibschrank aus und fand Briefe, die ich als Kind aus der Schweiz geschrieben hatte. Wie lange war das her? Ich begann zu lesen und meine Gedanken schweiften zurück zu meiner ersten Reise ins Ausland.
In der Grundschule wurden alle Schüler in meiner Klasse aufgefordert, an einer ärztlichen Reihenuntersuchung teilzunehmen. Meine Mutti erfuhr anschließend, dass ich untergewichtig war und dringend zur Erholung fahren sollte. Das Deutsche Rote Kreuz vermittelte mir einen Platz bei einer Schweizer Gastfamilie und die Schule beurlaubte mich für drei Monate.
An einem nasskalten Abend Anfang April 1956 fuhren wir zum Bahnhof Zoo in Westberlin. Auf dem Bahnsteig wimmelte es von Kindern und Erwachsenen. Schwestern in Rotkreuztrachten trugen Schilder mit Ortsnamen und sammelten die Gruppen für die einzelnen Eisenbahnwaggons zusammen. Meine Mutti hängte mir eine Karte um den Hals, auf der mein Name und der Bestimmungsort standen. Um mich drängelten sich andere Kinder, die auch nach Basel fuhren. Wir waren alle aufgeregt, manche weinten. Schließlich fuhr die Eisenbahn an uns vorbei, gezogen von einer riesigen Dampflok. Das schwarze Ungetüm stieß Rauchschwaden aus, die uns umwehten. Noch nie hatte ich solch eine Lok aus der Nähe gesehen.
Bahnbeamte kamen und drängten Neugierige von der Bahnsteigkante weg. Der Zug blieb stehen, die Türen öffneten sich, und die Schwestern halfen uns beim Einsteigen. Die Kleineren mussten sie hochheben, denn die Stufen waren hoch. Ich drehte mich um, um meiner Mutti zu winken, doch schon wurde ich weiter geschoben.
Alsdann schleppten Helfer unser Gepäck in die Waggons. Wir Kinder drängelten uns um die besten Sitzplätze. Nachdem die Transportleiterin die Personenliste kontrolliert hatte, fuhr der Sonderzug langsam aus dem Bahnhof. Die Dunkelheit verschluckte den Bahnsteig und die Angehörigen. Ich blickte aus dem Fenster, konnte aber wenig erkennen. Nur mein Spiegelbild schaute mich an.
Emsig liefen die Rotkreuzschwestern hin und her, verstauten Jacken und Mäntel im Gepäcknetz und ermahnten uns, die Plätze vorerst nicht zu verlassen. Endlich kehrte Ruhe ein. Ich hatte einen Fensterplatz ergattert und konnte mich in eine Ecke kuscheln. Eine Weile lauschte ich auf das gleichmäßige Rattern der Räder, bis mir die Augen zufielen. Zwischendurch wachte ich durch das Signal der Lokomotive auf. Draußen war es finster, man sah kaum Lichter. Da wir durch die ehemalige DDR fuhren, hielt der Zug in keiner Stadt. Er blieb nur stehen, um die planmäßigen Schnellzüge vorbeizulassen.
Morgens, kurz vor acht Uhr, erreichten wir Frankfurt am Main. Bei der Bahnhofsmission bekamen wir einen Becher Tee, dann ging die Fahrt weiter nach Basel.
Nachmittags um drei Uhr kamen wir dort an. Die Schwestern riefen unsere Namen auf, schrieben auf jede Karte, die wir weiterhin um den Hals trugen, zwei Buchstaben und teilten uns in verschiedene Gruppen ein. Ich fuhr mit einigen Kindern mit einem Zug nach Bern. Es war eine abwechslungsreiche Landschaft, Berge, schmale Täler und Dörfer. Gegen Abend erreichten wir die Stadt. Die meisten Kinder waren inzwischen ausgestiegen und von Familien abgeholt worden.
Zuletzt waren nur noch ein Junge und ich übrig. Wir befanden uns in einem Raum der Bahnhofsmission. Drei Frauen standen bei uns und ich hörte, wie eine von ihnen telefonierte: »Ein Mädchen, … ach, Sie wollten einen Buben? Dann leider nicht …«
Nach drei weiteren Telefonaten nahm eine Schwester meinen Koffer und ging mit mir zu einem Auto. Es war eine längere Fahrt, während der ich einschlief.
Als ich erwachte, hielt der Wagen vor einem Haus. In der hell erleuchteten Tür stand ein Ehepaar. Ich stieg aus. Die Frau führte mich durch einen schmalen Flur in die Küche. Der Mann zeigte auf eine Katze, die auf einer Sitzbank lag: »Das ist Chuzli!«
Doch ich war müde. Ich wurde in ein Zimmer gebracht, wo ich sofort auf ein Bett sank und einschlief.
Am nächsten Morgen lernte ich meine Pflegefamilie kennen. Sie war sehr freundlich. Die Frau erkundigte sich zunächst: »Willst du Mutti oder Tante zu mir sagen?“
Doch ich entschloss mich, sie mit Tante Anny und ihren Mann mit Onkel Robert anzureden.
«Du bist jetzt für drei Monate unser Pflegekind. Wir haben einen Sohn und eine Tochter. Beide sind verheiratet und haben kleine Kinder. Später wirst du alle kennenlernen.“
Meine Pflegeeltern zeigten mir das Haus. Sie bewohnten das Erdgeschoss eines Zweifamilienhauses, das an einen Hang gebaut war. Oben, direkt an der Straße, befand sich der Eingang, hinter dem Haus dehnte sich der große Garten aus. Dort gab es einen Gemüsegarten, der mit einem Zaun umgeben war, ein Gehege für Hühner und einen Kaninchenstall. Eine weitläufige Rasenfläche, auf der auch Obstbäume standen, fiel steil zur unten gelegenen Hauptstraße herab.
Zum Obergeschoss des Hauses führte außen eine Holztreppe. Dort wohnte der Sohn Fred mit seiner Frau Ruth und dem kleinen Kurtli. Die Tochter Vreni lebte mit ihrem Mann und dem wenige Wochen alten Baby bei den Schwiegereltern in einem Bauernhaus an der Hauptstraße direkt gegenüber dem Garten. Der Bernhardiner Blässi stand am Eingang Wache. Als ich ihm das erste Mal begegnete, beschnupperte er mich und wedelte mit dem Schwanz. Als er seine Schnauze an meinen Körper drückte, fiel ich fast um. Wir schlossen sofort Freundschaft und ich besuchte ihn oft während der folgenden Wochen.
Häufig ging ich zu Vreni hinüber. Sie hatte stets Zeit für mich. Mir gefiel außerdem ihre aufmerksame Art, zuzuhören. So konnte ich mich mit ihr angenehm unterhalten. Wir gingen auch gemeinsam einkaufen, oder wir spazierten durch den Ort mit der kleinen Lotti.
Das Dorf Pieterlen, in dem ich jetzt lebte, lag in einem breiten Tal am Fuß des Bözingenbergs. Die Hänge waren bewaldet und nicht allzu steil. Eine nach Biel führende Durchgangsstraße teilte die Ortschaft in ein nördliches und ein südliches Gebiet und war damals nicht sehr befahren. Meine Pflegeeltern wohnten im Osten des Dorfes. Von der Hauptstraße aus gelangte man zum Zentrum mit den Einkaufsläden, dem Bäcker, der Metzgerei, der Post und der Schule. Etwas weiter weg befanden sich an einem Hang die Kirche und der Friedhof.
Als ich mich besser auskannte, durfte ich fast jeden Tag allein das Brot holen. Der Bäcker fragte gleich: »Grüezi, bist du das Berliner Ferienkind?«
Anfangs hatte ich Schwierigkeiten mit dem Schweizer Dialekt. Viele Leute redeten mit mir jedoch Hochdeutsch, bis ich ihre Sprache besser verstand.
Für mich war es ungewohnt, in einem Zweifamilienhaus zu wohnen und ein eigenes Zimmer zu haben. In Berlin lebten meine Mutti und ich in einem Mietshaus. Aus den Fenstern unserer Einzimmerwohnung sahen wir auf einen Hinterhof, in dem es keine bepflanzten Blumenbeete gab. In der Mitte stand ein hoher Baum. Kindern war das Spielen verboten. Nur Hausierer, Scherenschleifer und gelegentlich ein Leierkastenmann sorgten für Abwechslung.