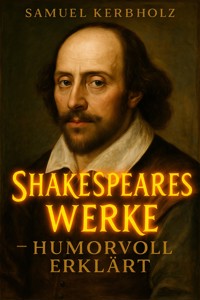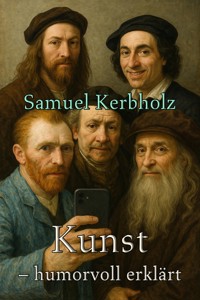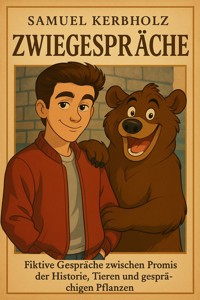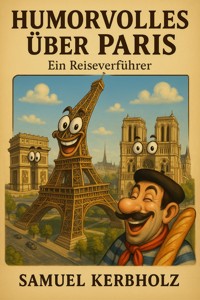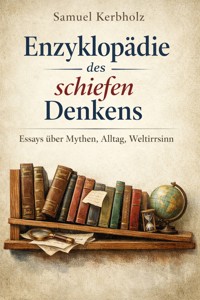
1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Die Enzyklopädie des schiefen Denkens versammelt 185 Essays über jene Denkbewegungen, die sich weigern, brav im rechten Winkel zu verlaufen. Sie befasst sich mit Mythen, Bürokratien, Alltagsabsonderlichkeiten und metaphysischen Nebenwirkungen – also mit dem eigentlichen Betriebssystem der Gegenwart.
Hier werden Flüsse ins Prokrustesbett gezwungen, der Wahl-O-Mat als Orakel befragt, der innere Schweinehund vor Gericht gezerrt und das Glück beim Terminmanagement ertappt. Wörter altern würdevoll, Prinzipien werden wie IKEA-Möbel montiert, Gewissen nekromantisch wiederbelebt, und selbst der Herbst bekommt einen Künstlernamen.
Jeder Text ist eine kleine Expedition in jene Zwischenräume, in denen Vernunft, Satire und Alltag kurz innehalten und sagen: Moment mal.
185 Essays:
Die kreative Resteverwertung * Das Prokrustesbett der Flüsse * Das Bacchanal als Ultima Ratio * Der Dreifuß als Geschäftsmodell * Die Jahresringe der Erinnerung * Der Glanz des Unechten * Marilyn antwortet * Die Optimierung des Unheils * Die Freigeister der Sprache * Der geerdete Pegasus * Der Wahl-O-Mat als moderne Orakelstätte * Der Regen als unerwarteter Superstar * Die Niete als Existenzmetapher * Das Diktat des Zwecks * Der innere Schweinehund vor Gericht * Die Jugend der Wörter * Das Schmirgelpapier-Dilemma * Die koffeinbedingte Metamorphose * Die Midlife-Crisis des Dollars * Die Aussaat der Uneinigkeit * Die Überholspur der Extreme * Der beste Freund des Menschen * Das unbestechliche Über-Ich * Die Stringtheorie des Lebens * Der Pyrrhussieg * Von der Katakomben-Rebellion zur Palast-Arroganz * Das Verbot der Vorhersehbarkeit * Das Prinzip der unverkäuflichen Selbstbeschaffung * Das Darmageddon * Der Planet Amtsdeutsch * Die Reiseleiterin des Glücks * Das Werkeln * Die Realität der Einbildung * Das Muskelspiel der Mächtigen * Die Fertig-Illusion * Die Goldwaage-Diät * Die Schlaf-Erfolg-Paradoxie * Der Zeitgeist als ungebetener Untermieter * Der Bondman * Die Kinski-Epidemie * Der Utopie-Dystopie-Transformator * Die Beständigkeit des Irrsinns * Die Wiederkäuer des Wissens * Der Lumpensammler des Geistes * Die Luxus-Lüge * Die Schick-Schicksal-Korrelation * Die Autonomie des Flachlandskifahrers * Die Wett-Wetter-Spirale * Das nostalgische Horten * Die Gestikulationen der Zeit * Die Papier-Aristokratie * Die Do-It-Yourself-Gehirnwäsche * Das Zunehmen des Nimmersatt * Die Dreifaltigkeit als Rechenaufgabe * Das taktische Happy End * Die Damenwahl der Evolution * Die Seniorenresidenzen der Helden * Die Magie der Machtlosigkeit * Die Rechtmäßigkeits-Archäologie * Die Vokal-Konsonanten-Hierarchie * Die Transparenz-Transparenten-Transpiration-Trias * Der Quietismus-Blues * Der existenzielle Kreisverkehr * Der Wappentier-Casting-Wettbewerb * Der Terminkalender des Glücks * Der Fall des Meister Adebar * Die Wurstigkeit als Tugend * Das Dunning-Kruger-Manifest * Der Olymp-Umweg * Die Abwesenheit des Vorsitzenden * Die Dividenden-Diktatur * Die Termiten-Terminologie * Die Hierarchie des Hungers * Der Diäten-Staat * Die Farblehre der Macht * Die Aromantik des Reviers * Die Gratisfall-Falle * Die Glücksökonomie * Die Gewissens-Gymnastik * Die Territorial-Diätetik * Die Fantasie-Konditorei * Das Loyalty-Programm der Liebe * Die Quer-Phobie * Die Überraschungsparty im eigenen Kopf * Die Dramaturgie des Selbstbetrugs * Die magnetische Persönlichkeitsstörung * Die Erdanziehungskraft des Verstandes * Die Mimik-Diplomatie * Das Authentizitäts-Paradoxon * Die Entfernungsillusion * Die digitale Unsterblichkeit * Der kosmische Ordnungswahn * Die Schwerkraft der Seriosität * Die Rebellion der Unversöhnlichen * Die Inflation der Silben * Die Regelwerk-Illusion ... Und 89 weitere Essays
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
Inhalt
Enzyklopädie des schiefen Denkens
Essays über Mythen, Alltag, Weltirrsinn
Die Enzyklopädie des schiefen Denkens versammelt 185 Essays über jene Denkbewegungen, die sich weigern, brav im rechten Winkel zu verlaufen. Sie befasst sich mit Mythen, Bürokratien, Alltagsabsonderlichkeiten und metaphysischen Nebenwirkungen – also mit dem eigentlichen Betriebssystem der Gegenwart.
Hier werden Flüsse ins Prokrustesbett gezwungen, der Wahl-O-Mat als Orakel befragt, der innere Schweinehund vor Gericht gezerrt und das Glück beim Terminmanagement ertappt. Wörter altern würdevoll, Prinzipien werden wie IKEA-Möbel montiert, Gewissen nekromantisch wiederbelebt, und selbst der Herbst bekommt einen Künstlernamen.
Jeder Text ist eine kleine Expedition in jene Zwischenräume, in denen Vernunft, Satire und Alltag kurz innehalten und sagen: Moment mal.
Copyright © 2026 Samuel Kerbholz
Stephan Lill, Birkenhorst 5b, 21220 Seevetal, Germany
185 Essays:
Die kreative Resteverwertung * Das Prokrustesbett der Flüsse * Das Bacchanal als Ultima Ratio * Der Dreifuß als Geschäftsmodell * Die Jahresringe der Erinnerung * Der Glanz des Unechten * Marilyn antwortet * Die Optimierung des Unheils * Die Freigeister der Sprache * Der geerdete Pegasus * Der Wahl-O-Mat als moderne Orakelstätte * Der Regen als unerwarteter Superstar * Die Niete als Existenzmetapher * Das Diktat des Zwecks * Der innere Schweinehund vor Gericht * Die Jugend der Wörter * Das Schmirgelpapier-Dilemma * Die koffeinbedingte Metamorphose * Die Midlife-Crisis des Dollars * Die Aussaat der Uneinigkeit * Die Überholspur der Extreme * Der beste Freund des Menschen * Das unbestechliche Über-Ich * Die Stringtheorie des Lebens * Der Pyrrhussieg * Von der Katakomben-Rebellion zur Palast-Arroganz * Das Verbot der Vorhersehbarkeit * Das Prinzip der unverkäuflichen Selbstbeschaffung * Das Darmageddon * Der Planet Amtsdeutsch * Die Reiseleiterin des Glücks * Das Werkeln * Die Realität der Einbildung * Das Muskelspiel der Mächtigen * Die Fertig-Illusion * Die Goldwaage-Diät * Die Schlaf-Erfolg-Paradoxie * Der Zeitgeist als ungebetener Untermieter * Der Bondman * Die Kinski-Epidemie * Der Utopie-Dystopie-Transformator * Die Beständigkeit des Irrsinns * Die Wiederkäuer des Wissens * Der Lumpensammler des Geistes * Die Luxus-Lüge * Die Schick-Schicksal-Korrelation * Die Autonomie des Flachlandskifahrers * Die Wett-Wetter-Spirale * Das nostalgische Horten * Die Gestikulationen der Zeit * Die Papier-Aristokratie * Die Do-It-Yourself-Gehirnwäsche * Das Zunehmen des Nimmersatt * Die Dreifaltigkeit als Rechenaufgabe * Das taktische Happy End * Die Damenwahl der Evolution * Die Seniorenresidenzen der Helden * Die Magie der Machtlosigkeit * Die Rechtmäßigkeits-Archäologie * Die Vokal-Konsonanten-Hierarchie * Die Transparenz-Transparenten-Transpiration-Trias * Der Quietismus-Blues * Der existenzielle Kreisverkehr * Der Wappentier-Casting-Wettbewerb * Der Terminkalender des Glücks * Der Fall des Meister Adebar * Die Wurstigkeit als Tugend * Das Dunning-Kruger-Manifest * Der Olymp-Umweg * Die Abwesenheit des Vorsitzenden * Die Dividenden-Diktatur * Die Termiten-Terminologie * Die Hierarchie des Hungers * Der Diäten-Staat * Die Farblehre der Macht * Die Aromantik des Reviers * Die Gratisfall-Falle * Die Glücksökonomie * Die Gewissens-Gymnastik * Die Territorial-Diätetik * Die Fantasie-Konditorei * Das Loyalty-Programm der Liebe * Die Quer-Phobie * Die Überraschungsparty im eigenen Kopf * Die Dramaturgie des Selbstbetrugs * Die magnetische Persönlichkeitsstörung * Die Erdanziehungskraft des Verstandes * Die Mimik-Diplomatie * Das Authentizitäts-Paradoxon * Die Entfernungsillusion * Die digitale Unsterblichkeit * Der kosmische Ordnungswahn * Die Schwerkraft der Seriosität * Die Rebellion der Unversöhnlichen * Die Inflation der Silben * Die Regelwerk-Illusion * Die Cheat-Code-Metaphysik * Die Zähmung des Unzähmbaren * Die Grün-Inflation * Die Gedanken-Gewerkschaft * Das Ende der Geschichte * Die Gedankengarderobe * Die Gewissens-Nekromantie * Die Glatteis-Hierarchie * Die Vertikale der Verantwortung * Die Archivierung des Selbst * Die Schmetterlings-Ökonomie der Seele * Die Vampir-Saison * Der schamlose Aquarellist * Die Partitur des Zufalls * Die Taktik der Unentschlossenheit * Die Exhibitionismus-Ökonomie * Die Tyrannei des Gelernten * Die Silicon-Valley-Pythia * Die Fass-Philosophie der Gegenwart * Die Patronage-Ökonomie * Die Unheil-Amnestie * Die Schachbrett-Realpolitik * Die Sprungbrett-Metaphysik * Die Gartenzwerg-Prohibition * Die Uniformen-Paradoxie * Die Panzer-Philosophie * Die Mythen-GmbH * Die Problem-Triage * Die Puzzle-Paradoxie * Die Rückwärtsgang-Romantik * Die Taktik der Täuschung * Die Oma-Plantage * Die Karriere-Viren * Die Autopilot-Absolution * Die Pferde-Persönlichkeit * Die Spurenlehre * Die Bach-Renaissance * Die Kristallkugel-Ökonomie * Die Wut-Strategie * Die Zeitchip-Ökonomie * Die Sessel-Safari * Die Komfort-Nomaden * Die Sternen-Egomanie * Die Windstärke der Gegenwart * Die Lügen-Olympiade * Die Greifbarkeits-Illusion * Die Lästerlast * Wohnst du noch oder bist du schon? * Die Glaskugel hat einen Sprung * Der Künstler war anwesend * Das Bermudadreieck auf vier Rädern * Selfmade-King * Die Dämpfung des Daseins * Die Rückkehr nach Bilderhausen * Semaphorik des Schicksals * Die Geometrie des Größenwahns * Die Würde des Tands * Die Sohle der Unschuld * Die Liturgie des Leichenfunds * Die Teigwaren-Hegemonie * Das Phantom im Partnerprofil * Die Seele als Sonderposten * Der Schornstein als Nadelöhr * Die Bürokratie des Scheiterns * Das Wissen will gestreichelt werden * Die Abteilung für ungeklärte Sockenfälle * Die Langstreckenläufer der Syntax * Die Illusion des ersten Stoßes * Das Pendel des Polykrates * Der Zauber und sein Dimmer * Die Topographie der Erleuchtung * Der Artist des ungesicherten Sinns * Der Galopp der Vorschriften * Grundsteinlegung im Ungefähren * Die Eitelkeit der Landschaft * Das Selbst als Druckfahne * Die Topologie des Frühstücks * Die Tyrannei des rechten Winkels * Die Optik der Nachsicht * Der Millionär im Bettlergewand * Das Zitrat des Meisters * Die Palette des Pessimisten * Der Golem aus dem Gerät * Die Lieferkette des Unendlichen * Die Straßenverkehrsordnung des Daseins * Die Stratigraphie der Schublade * Der Stammbaum der Zustände * Das kosmische Curriculum * Om mani padme Manta
Die kreative Resteverwertung oder: Warum Autoren die besseren Köche sind
Autoren kennen das: Nach Abschluss eines Werkes liegen da noch jede Menge ungenutzte Ideen rum. Starthilfe und Resteverwertung für ein neues, kleineres Werk.
Es gibt zwei Arten von Menschen: Die einen werfen nach dem Kochen die Reste weg. Die anderen – nun ja, die anderen werden Autoren.
Denn was ist ein abgeschlossenes Werk anderes als ein opulentes Festmahl, nach dem der kreative Kühlschrank noch prall gefüllt ist mit Zutaten, die es nicht in den finalen Schmaus geschafft haben? Da liegt die brillant formulierte Nebenfigur, die leider dem Rotstift zum Opfer fiel. Dort gammelt die geniale Metapher vor sich hin, die einfach nicht ins Konzept passte. Und hinten rechts, zwischen vergessenen Joghurtbechern der Inspiration, lauert jene Szene, die zu gut war, um sie zu schreiben – oder war sie zu schlecht? Egal, aufgehoben ist nicht aufgeschoben.
Der gemeine Autor entwickelt im Laufe seiner Schaffenszeit eine bemerkenswerte Fähigkeit: Er kann nichts wegwerfen. Während normale Menschen ihre Gedanken denken und dann fröhlich weiterleben, hortet der Schriftsteller jeden halbgaren Einfall wie ein literarischer Messie. „Das kann ich noch brauchen!", murmelt er und notiert sich um drei Uhr nachts eine Beobachtung über die existenzielle Einsamkeit von Ampeln. Wozu? Keine Ahnung. Aber irgendwann, in irgendeinem Werk, wird diese Ampel ihren großen Auftritt haben.
Und siehe da: Das neue, kleinere Werk entsteht. Nicht aus dem Nichts, nicht aus göttlicher Inspiration – sondern aus dem, was Sternköche „Mise en Place" und Autoren „chaotische Zettelwirtschaft" nennen. Die ungenutzte Idee ist die Starthilfe schlechthin, der kreative Sauerteig, der ein neues Projekt zum Gären bringt. Man muss nur wissen, wie man aus literarischen Resten ein schmackhaftes Süppchen kocht.
Wobei – und hier wird es philosophisch – die Frage erlaubt sein muss: Was ist eigentlich eine „ungenutzte" Idee? Ist eine Idee, die man hatte, aber nicht verwendete, wirklich ungenutzt? Oder hat sie nicht bereits in dem Moment ihre Daseinsberechtigung erfüllt, in dem sie einem den Weg zu einer anderen, verwendeten Idee gewiesen hat? Die verworfene Idee als Katalysator, als kreative Kreuzung, an der man in eine andere Richtung abbog – ist das nicht Nutzung genug?
Mitnichten, sagt der pragmatische Autor und kramt weiter in seiner Ideenkiste. Denn während Philosophen über die Ontologie ungenutzter Gedanken sinnieren, hat der Schriftsteller längst erkannt: In der Literatur gibt es kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Die Idee, die vor fünf Jahren für den großen Roman zu klein war, ist heute genau richtig für die kleine Kurzgeschichte. Der Witz, der damals zu flach erschien, ist heute herrlich vintage. Und die Figur, die nicht ins Epos passte, rockt plötzlich die Satire.
Es ist ein bisschen wie mit Lego: Man baut ein Raumschiff, nimmt es wieder auseinander und baut daraus eine Burg. Nur dass bei Autoren die Bausteine aus Worten bestehen, und man beim Auseinandernehmen manchmal weint, weil die Szene so schön war. Aber dann wischt man sich die Tränen ab, sortiert die Teile und denkt: „Daraus wird bestimmt ein tolles Puppenhaus. Oder eine Garage. Oder ein existenzialistisches Drama über einen Stein."
Die Resteverwertung ist also kein Zeichen von Ideenarmut, sondern von kreativer Nachhaltigkeit. In Zeiten, in denen wir alle recyceln und upcyceln, praktiziert der Autor schon seit Jahrhunderten das literarische Kompostieren. Aus Abfall wird Humus, aus Humus wächst Neues. Der kreative Komposthaufen – das klingt weniger glamourös als „Musengeflüster", ist aber ehrlicher.
Und so schließt sich der Kreis: Am Ende eines großen Werkes steht nicht die Leere, sondern die Fülle. Die Fülle dessen, was hätte sein können, aber noch sein wird. Der Autor, dieser wunderbare Resteverwerter, dieser kulinarische Künstler des Geistes, weiß: Das nächste Werk ist schon da. Es muss nur noch aus den Resten zusammengebaut werden.
In diesem Sinne: guten Appetit auf das kleine, neue Werk. Es schmeckt nach den Resten des großen – und ist gerade deshalb eine Delikatesse.
Das Prokrustesbett der Flüsse oder: Warum der Rhein lieber Harley fahren würde
Flüsse fühlen sich heutzutage wie im Prokrustesbett. Völlig unpassend. Born to be wild.
Stellen wir uns kurz vor, wie sich ein Fluss fühlt. Nicht irgendeiner dieser braven Kanäle, die wie pensionierte Beamte in geraden Linien durch die Landschaft gleiten – nein, ein richtiger Fluss. Einer, der noch Erinnerungen an wilde Zeiten hat, als er mäandern durfte, wo er wollte, Schleifen schlug wie ein betrunkener Tango-Tänzer und hin und wieder mal eben schnell das Flussbett wechselte, weil ihm danach war.
Heute liegt dieser Fluss im Prokrustesbett der Moderne. Betoniert, kanalisiert, begradigt. Links eine Uferbefestigung, rechts eine Uferbefestigung, oben eine Brücke, unten ein Wehrkraftwerk. Der arme Kerl ist nicht mehr Fluss, sondern Durchgangsverkehr in Flüssigform.
Prokrustes, dieser charmante Straßenräuber der griechischen Mythologie, hatte ja bekanntlich eine simple Lösung für seine Gäste: zu groß für sein Bett? Ab mit den Beinen! Zu klein? Ein bisschen strecken auf der Folterbank schadet nie! Eine Methode, die erstaunlicherweise von modernen Wasserbau-Ingenieuren mit Begeisterung adaptiert wurde. Nur heißt es heute nicht „Streckbank", sondern „Flussbegradigung zum Hochwasserschutz". Klingt auch viel freundlicher.
Der Fluss, dieser geborene Romantiker, dieser Draufgänger der Hydrologie, würde am liebsten wieder mäandern. Er möchte Inseln bilden, Altarme schaffen, mal hier ein bisschen Ufer unterspülen, mal dort eine Sandbank aufschütten. Er ist, um es neudeutsch zu sagen, born to be wild. Stattdessen muss er zwischen Betonwänden dahinströmen wie ein Punk in einem Anzug von der Stange – technisch korrekt, aber ohne jede Seele.
Dabei hatten Flüsse früher so viel mehr Charakter. Der Mississippi war nicht einfach nur ein Fluss, er war eine Persönlichkeit, ein unberechenbarer Geselle, der Mark Twain zu literarischen Höhenflügen inspirierte. Heute würde er wahrscheinlich einen Therapeuten brauchen, um seine Identitätskrise zu verarbeiten: „Ich wollte doch nur fließen! Frei sein! Aber sie haben mich in dieses verdammte Korsett gezwängt!"
Die Ironie ist: Wir haben die Flüsse begradigt, um sie zu kontrollieren. Und jetzt wundern wir uns, dass sie sich bei der ersten Gelegenheit über die Ufer ergießen wie rebellische Teenager bei der ersten Party ohne Eltern. „Hochwasser! Katastrophe!" rufen wir dann. Der Fluss denkt sich: „Hochwasser? Das nenne ich Bewegungsfreiheit!"
Renaturierung heißt das Zauberwort, mit dem wir heute versuchen, den Flüssen ein wenig von ihrer alten Wildheit zurückzugeben. Wir erlauben ihnen gnädigerweise, an ausgewählten Stellen wieder ein bisschen rumzumäandern. Wie nett von uns! Als würde man einem eingesperrten Tiger erlauben, zweimal die Woche im Garten spazieren zu gehen – unter Aufsicht, versteht sich.
Und die Flüsse? Sie fühlen sich wie Steppenwölfe im Streichelzoo. Sie erinnern sich noch an die guten alten Zeiten, als ein Fluss ein Fluss sein durfte und nicht eine hydraulisch optimierte Wasserautobahn. Als Flussbetten noch weich waren und nicht aus Beton. Als man sich ausbreiten durfte, ohne dass gleich ein Deichverband nervös wurde.
Born to be wild – das trifft es perfekt. Der Fluss ist der Easy Rider der Landschaft, nur dass man ihm das Motorrad weggenommen und dafür einen Golf mit Tempomat gegeben hat. Funktioniert einwandfrei, bringt einen von A nach B, ist sicher und zuverlässig. Aber die Seele fehlt.
Vielleicht sollten wir Flüsse mal fragen, wie sie sich fühlen möchten, statt ihnen zu sagen, wie sie zu fließen haben. Aber das wäre ja absurd, oder? Mit Flüssen reden! Als Nächstes verlangen die noch Mitspracherecht bei der Raumplanung.
Bis dahin liegen sie da, unsere Flüsse, im Prokrustesbett der Moderne. Zu wild für das Bett, zu gezähmt für die Freiheit. Und träumen von den guten alten Zeiten, als Mäandern noch kein Vergehen war und ein Fluss einfach nur fließen konnte – wohin auch immer er wollte.
Born to be wild. Condemned to be mild.
So ist das Leben im Prokrustesbett.
Das Bacchanal als Ultima Ratio oder: Wenn Nüchternheit zur unerträglichen Zumutung wird
Die nüchterne Einschätzung der Lage lässt ein Bacchanal als wünschenswert erscheinen: dem Zeitgeist zuprosten beim Binge-Drinking.
Es gibt Momente im Leben, da ist die Realität so beschaffen, dass jeder vernünftige Mensch reflexartig nach dem Korkenzieher greift. Nicht aus Schwäche, wohlgemerkt, sondern aus einem tief empfundenen Bedürfnis nach philosophischer Hygiene. Denn manchmal ist die nüchterne Einschätzung der Lage so ernüchternd, dass Nüchternheit selbst zum Problem wird.
Willkommen im Zeitalter des präventiven Rausches.
Der moderne Mensch, dieser aufgeklärte Nachfahre Kants und Spinozas, steht da mit seiner rationalen Weltbetrachtung und denkt sich: „Wenn das hier der kategorische Imperativ ist, dann bestelle ich lieber kategorisch Imperator-Wodka." Denn was soll man auch anderes tun, wenn die Nachrichten wie ein dystopischer Roman klingen, der von einem besonders pessimistischen KI-Algorithmus verfasst wurde?
Das Bacchanal – jenes antike Fest zu Ehren des Bacchus, bei dem die Römer ihren inneren Kontrollverlust zelebrierten wie wir heute unsere Selbstoptimierung – erscheint da nicht als Eskapismus, sondern als logische Konsequenz einer nüchternen Lagebeurteilung. Wenn die Welt verrücktspielt, ist es nur konsequent, nicht nüchtern zuschauen zu wollen.
Dem Zeitgeist zuprosten beim Binge-Drinking – das klingt zunächst nach Kapitulation, nach Aufgabe, nach dem großen Hinschmeißen. Aber ist es nicht vielmehr ein Akt der Solidarität? Schließlich ist der Zeitgeist selbst längst betrunken. Von Daten. Von Schnelligkeit. Von der Idee, dass alles gleichzeitig möglich, nötig und überfällig sei. Der Zeitgeist ist der größte Säufer von allen, nur dass er auf Dopamin statt auf Ethanol läuft.
Und hier kommt das Schöne am Binge-Drinking: Es ist wenigstens ehrlich. Während der Zeitgeist so tut, als wäre sein permanenter Rauschzustand völlig normal und produktiv – „Disruptiv! Innovativ! Game-Changing!" –, sagt der Binge-Drinker wenigstens: „Leute, ich betäube mich jetzt ganz bewusst, weil mir das hier alles zu viel wird." Das ist wenigstens Authentizität, die Währung, die der Zeitgeist uns ständig predigt.
Die alten Griechen und Römer hatten das verstanden. Ein Bacchanal war nicht einfach nur Saufen bis der Arzt kommt – es war ein ritualisierter Ausnahmezustand, ein gesellschaftlich sanktionierter Wahnsinn. Man huldigte Dionysos nicht, weil man ein Alkoholproblem hatte, sondern weil man verstanden hatte, dass die Welt ohne gelegentliche Entgrenzung unerträglich wird. Die kannten noch keine Krankenkassenbeiträge, keine Klimakrise, keine LinkedIn-Profile – und trotzdem wussten sie: Manchmal muss man einfach mal richtig einen heben.
Heute nennen wir das „Work-Life-Balance" und meinen damit, dass man nach acht Stunden Bullshit-Job ein Glas Prosecco trinken darf, ohne gleich als Alkoholiker zu gelten. Die alten Römer hätten uns ausgelacht. „Ein Glas?", hätten sie gerufen. „Ist das euer Bacchanal? Wir haben Amphoren gelehrt! Ganze Weinkeller! Bis die Toga verrutscht und die Realität sich in Wohlgefallen auflöst!"
Aber vielleicht liegt genau da der Punkt: Wir haben verlernt, richtig zu feiern, weil wir verlernt haben, richtig zu verzweifeln. Wir optimieren unsere Verzweiflung zu „Herausforderungen", unsere Ohnmacht zu „Entwicklungspotenzial", unsere Sinnkrisen zu „Umorientierungsphasen". Alles wird therapeutisiert, coachifiziert, in Webinare verpackt. Da bleibt für ein ordentliches Bacchanal gar keine Zeit mehr.
Dabei wäre es so heilsam. Dem Zeitgeist einmal richtig zuprosten – nicht mit einem höflichen Schlückchen Schaumwein, sondern mit der ganzen entfesselten Kraft eines Menschen, der erkannt hat: Diese Welt ergibt nüchtern betrachtet keinen Sinn mehr. Also weg mit der Nüchternheit! Wenn die Absurdität regiert, ist der Rausch die einzig angemessene Antwort.
Verstehen Sie mich nicht falsch: Das ist kein Plädoyer für Alkoholismus. Das ist ein Plädoyer für gelegentlichen, bewussten, ritualisierten Wahnsinn. Für die Erkenntnis, dass zwischen dem kantischen „sapere aude" und dem dionysischen „bibere aude" kein unüberbrückbarer Gegensatz besteht. Manchmal erfordert der Mut, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, auch den Mut, ihn gelegentlich beiseitezulegen.
Die nüchterne Einschätzung der Lage kommt also zu dem Schluss: Wenn selbst die Nüchternheit zur Belastung wird, wenn die Klarheit des Blicks nur noch Unerträgliches offenbart, dann ist das Bacchanal keine Flucht – es ist eine Therapie.
In diesem Sinne: Prost auf den Zeitgeist! Möge er seinen Kater verdienen.
Und mögen wir den unseren wenigstens in guter Gesellschaft durchleiden.
Der Dreifuß als Geschäftsmodell oder: Warum Prophezeiung der entspannteste Job der Welt wäre
Eigentlich ein schöner Beruf: locker vom Hocker – dazu etwas Gas, das high macht ... Man sollte sich einen Dreifuß kaufen und Orakel werden.
Mal ehrlich: Wir haben uns alle schon mal über unseren Job beschwert. Zu viel Stress, zu wenig Gehalt, nervige Kollegen, sinnlose Meetings. Aber haben wir dabei jemals an die wirklich guten Berufe gedacht? An die Jobs, bei denen man buchstäblich nur rumsitzen muss, ein bisschen Gas einatmet und dann kryptische Aussagen von sich gibt, für die einen die Leute auch noch bezahlen?
Willkommen in der Welt der antiken Orakel.
Das Pythia von Delphi hatte das Geschäftsmodell perfektioniert: Dreifuß über einer Erdspalte, aus der halluzinogene Dämpfe aufstiegen, ein paar tiefe Atemzüge – und schon war man im Business. Keine Ausbildung nötig, kein MBA, keine LinkedIn-Zertifikate in "Strategic Prophecy Management". Einfach nur dasitzen, high werden und Dinge sagen wie: "Wenn du über den Fluss gehst, wirst du ein großes Reich zerstören." Dass es das eigene sein könnte – nun ja, Details!
Locker vom Hocker – das beschreibt den Job tatsächlich perfekt. Während moderne Arbeitnehmer in ergonomischen Bürostühlen ihre Bandscheiben ruinieren, saß das Orakel auf einem heiligen Dreifuß und ließ sich von tektonisch bedingten Gasen in höhere Bewusstseinszustände befördern. Work-Life-Balance? Bitte sehr: Die Arbeit war der Rausch. Burn-out? Unmöglich, wenn man die ganze Zeit high ist. Höchstens ein Burn-in.
Das geniale am Orakel-Dasein ist die völlige Unmöglichkeit des Scheiterns. Moderne Propheten wie Wirtschaftsanalysten oder Wetterfrösche können sich blamieren – ihre Vorhersagen sind überprüfbar, datiert, peinlich konkret. Das antike Orakel hingegen war der Meister der präzisen Ungenauigkeit. "Große Veränderungen stehen bevor" – wann genau? Keine Angabe. Welche Art von Veränderungen? Interpretationssache! Für wen? Wer weiß!
Es ist die perfekte Jobsicherheit durch strategische Vagheit.
Stellen wir uns das mal in der modernen Arbeitswelt vor. Der Chef kommt: "Wie steht es mit dem Quartalsbericht?" Sie, auf Ihrem Dreifuß, leicht benebelt von den Dämpfen der Klimaanlage: "Die Zahlen werden sein, wie sie sein werden. Ich sehe Kurven. Manche steigen, andere ... bewegen sich auch." Der Chef nickt ehrfürchtig: "Großartige Einsichten!" und geht zufrieden.
Dazu kommt: Die Kleiderordnung war auch entspannter. Keine steifen Anzüge, keine High Heels, die einen nach acht Stunden in den Wahnsinn treiben. Die Pythia trug lockere Gewänder, hatte vermutlich nie Probleme mit einschneidenden Hosenbünden und konnte ihren Arbeitsplatz-Rausch in maximalem Komfort genießen. Casual Friday? Jeden Tag!
Und die Bezahlung? Könige und Kaiser kamen von weit her, mit Geschenken beladen, nur um ein paar nebulöse Sätze zu hören. Kein Gehaltsgespräch, keine Leistungsbeurteilung, kein "Wir müssen über deine Zielvereinbarungen sprechen". Die Leute warfen einem das Geld hinterher. Heute nennt man so etwas ein "passives Einkommen", nur dass es damals aktiv eingeatmete Gase erforderte.
Man könnte natürlich einwenden, dass der Beruf gewisse Nebenwirkungen hatte. Chronische Vergiftung, gelegentliche Bewusstseinsstörungen, die Tendenz, in Rätseln zu sprechen, die einen selbst verwirrten. Aber mal ehrlich: Ist das wirklich so anders als die Nebenwirkungen moderner Bürojobs? Statt halluzinogener Dämpfe haben wir Red Bull und Deadline-Stress. Statt ekstatischer Trance haben wir Zoom-Fatigue. Zumindest hatten die Orakel den Vorteil, für ihren Realitätsverlust märchenhafte Einkünfte erzielen zu können.
Der Dreifuß als Arbeitsinstrument – das ist Minimalismus in Reinform. Kein Computer, der abstürzt. Keine Software-Updates. Keine IT-Abteilung, die man anrufen muss. Einfach ein Stuhl, ein paar Erdgase und die eigene Fantasie. Marie Kondō wäre begeistert.
Und die Work-Life-Balance? Perfekt! Wobei – bei einem Orakel verschwimmt die Grenze ohnehin. Ist es Arbeit, wenn man in göttlicher Ekstase schwebt? Ist es Freizeit, wenn Könige einem die Bude einrennen? Ist es Meditation, Beruf oder einfach nur ein sehr entspannter Tag am Arbeitsplatz mit unkonventioneller Belüftung?
Vielleicht ist das der Grund, warum der Beruf ausgestorben ist: zu schön, um wahr zu sein. Die moderne Arbeitswelt könnte so etwas nicht dulden. Flexible Arbeitszeiten? Check. Remote Work? Nun ja, der Dreifuß stand zwar immer am selben Ort, aber mental war man definitiv unterwegs. Performance-Metriken? "Heute drei Prophezeiungen abgegeben, davon zwei völlig unverständlich – Ziel übertroffen!"
Nein, in Zeiten von Produktivitäts-Apps und Effizienzsteigerung passt ein Job, bei dem man bezahlt wird, um berauscht unklare Aussagen zu treffen, einfach nicht mehr ins Konzept. Obwohl – warten Sie mal. Unternehmensberater? Trendanalysten? Influencer?
Vielleicht sind die Orakel nie ausgestorben. Sie haben nur den Dreifuß gegen einen Podcast und das Gas gegen Selbstbewusstsein ausgetauscht.
Aber die Prophezeiungen? Immer noch genauso vage. Immer noch genauso bezahlt.
Vielleicht sollten wir alle einen Dreifuß kaufen. Nur zur Sicherheit.
Die Jahresringe der Erinnerung oder: Warum wir jährlich dieselben Taten feiern müssen
Jahrestage helfen, dass wichtige Taten nicht verjähren. Vermerke in den Jahresringen der Gesellschaft.
Die Gesellschaft ist ein Baum. Ein sehr vergesslicher Baum, wohlgemerkt, der ohne regelmäßige Erinnerungsmarker nicht mehr wüsste, wann er gewachsen ist, wann er gelitten hat und wann ihm jemand einen besonders schönen Ast abgesägt hat. Deshalb haben wir Jahrestage erfunden – die Jahresringe der kollektiven Erinnerung, fein säuberlich ins Holz der Geschichte geritzt, damit bloß niemand vergisst, was wichtig war.
Ohne Jahrestage wären wichtige Taten wie Straftaten: Sie würden einfach verjähren. Nach zwanzig, dreißig Jahren käme niemand mehr auf die Idee, sich an die Mondlandung zu erinnern. "Was? Menschen auf dem Mond? Wann soll das gewesen sein? Ach, 1969? Das ist doch ewig her! Warum sollte ich mich da noch dran erinnern?" Aber dann kommt der 20. Juli, und plötzlich ist alles wieder da: Armstrong, Aldrin, der kleine Schritt, die große Menschheit, die Verschwörungstheoretiker im Kommentarbereich.
Jahrestage sind die Notfallmedizin gegen das kulturelle Alzheimer.
Interessanterweise haben wir für Taten Jahrestage erfunden, für Unterlassungen aber nicht. Es gibt keinen "Tag der Dinge, die wir hätten tun sollen, aber nicht getan haben". Keinen "Jahrestag der verpassten Chancen". Keine feierliche Zeremonie zum Gedenken an all die Momente, in denen die Menschheit brillant daneben lag. Dabei wäre das nur fair: Wenn wir die Erfolge feiern, sollten wir auch die Pleiten würdigen. "Heute vor 50 Jahren hätten wir den Klimawandel noch stoppen können – aber wir haben uns für billige Flugreisen entschieden! Lasst uns anstoßen!"
Aber nein, Jahrestage sind positiv konnotiert, selbst wenn sie an Katastrophen erinnern. Denn der Jahrestag sagt ja nicht: "Damals ist etwas Schlimmes passiert", sondern: "Wir erinnern uns noch daran, dass damals etwas Schlimmes passiert ist – sind wir nicht toll?" Die pure Tatsache, dass wir nicht vergessen haben, wird zum Verdienst. Das ist, als würde man eine Medaille dafür bekommen, dass man seinen eigenen Geburtstag kennt.
Die Jahresringe der Gesellschaft – ein schönes Bild. Wobei: Bei echten Bäumen kann man an den Ringen ablesen, wann es gute und wann es schlechte Jahre gab. Breite Ringe: viel Regen, gutes Wachstum. Schmale Ringe: Dürre, Stress, Überlebenskampf. Bei der Gesellschaft ist das komplizierter. Manche Jahre haben so viele Jahrestage, dass man gar nicht mehr weiß, was man zuerst feiern soll. Andere Jahre sind geschichtlich so irrelevant, dass sie nicht mal einen mickerigen Gedenktag abwerfen.
Und dann gibt es die Inflation der Jahrestage. Früher waren Jubiläen etwas Besonderes: 25 Jahre, 50 Jahre, 100 Jahre – da wurde gefeiert! Heute haben wir "10 Jahre iPhone", "5 Jahre #MeToo", "20 Jahre Wikipedia". Bald feiern wir "3 Jahre und 7 Monate seit dem letzten wichtigen Tweet". Die Jahresringe werden immer enger, die Ereignisse immer kleiner, aber die Feierlichkeiten immer größer.
Das Paradoxe ist: Je mehr Jahrestage wir haben, desto weniger erinnern wir uns wirklich. Es ist wie mit Geburtstagen auf Facebook – wenn jeden Tag dreißig Leute Geburtstag haben, gratuliert man irgendwann niemandem mehr. Wenn jede Woche ein Jahrestag ist, verlieren die Jahrestage ihre Kraft. Die Vermerke in den Jahresringen werden so zahlreich, dass man den Baum vor lauter Kerben nicht mehr sieht.
Trotzdem: besser zu viele Jahrestage als zu wenig. Denn die Alternative wäre eine Gesellschaft, die einfach vergisst. Die jeden Tag als Tabula rasa behandelt, als hätte es Gestern noch gar nicht gegeben. Eine Gesellschaft ohne Gedächtnis ist wie ein Baum ohne Jahresringe – möglicherweise noch lebendig, aber ohne Geschichte, ohne Tiefe, ohne die Fähigkeit, aus der Vergangenheit zu lernen.
Wobei – lernen wir denn aus den Jahrestagen? Oder wiederholen wir nur rituell, was gewesen ist, ohne Konsequenzen zu ziehen? "Nie wieder!", rufen wir an jedem Gedenktag. Und dann machen wir weiter wie bisher, bis zum nächsten Jahrestag, an dem wir wieder "Nie wieder!" rufen. Die Jahresringe dokumentieren nicht nur, was war, sondern auch, was wir daraus nicht gemacht haben.
Vielleicht ist das der wahre Wert der Jahrestage: Sie sind die Sollbruchstellen der Geschichte. Einmal im Jahr brechen wir aus dem Alltag aus, halten inne, schauen zurück – und erkennen, dass wir im Grunde immer noch dieselben Fehler machen, nur mit besserer Technologie. Das ist ernüchternd. Aber auch beruhigend. Denn es bedeutet: In hundert Jahren werden unsere Nachfahren Jahrestage für unsere Taten feiern – und sich vermutlich fragen, wie wir so blöd sein konnten.
Die Vermerke in den Jahresringen der Gesellschaft sind also weniger ein Zeugnis unserer Größe als ein Protokoll unserer Lernresistenz. Aber immerhin: Wir vergessen nicht. Wir verjähren nicht. Wir erinnern uns.
Wenn auch nur einmal im Jahr. Und das ist doch schon mal was.
Der Glanz des Unechten oder: Warum Talmi die ehrlichste Form des Luxus ist
Auch in einer Talmi-Welt kann man alles brillant finden. Auch ohne Moos alles famos.
Es gibt zwei Arten von Menschen: Die einen brauchen echtes Gold, um glücklich zu sein. Die anderen – nun ja, die anderen haben verstanden, dass Glitzer auch aus der Drogerie kommt und genauso schön funkelt, wenn man nicht zu genau hinguckt.
Willkommen in der Talmi-Welt, in der alles glänzt und nichts echt sein muss.
Talmi – dieses wunderbare Wort für unechten Goldschmuck, für den Schein ohne Sein, für die Oberfläche ohne Tiefe. Eigentlich eine Beleidigung, oder? „Das ist doch nur Talmi!" Aber mal ehrlich: Ist Talmi nicht die konsequenteste Form von Ehrlichkeit? Es gibt gar nicht erst vor, echt zu sein. Es sagt: „Ich bin Fake – und zwar mit Stolz!" Das ist mehr Integrität, als manche Echtgold-Träger aufbringen können.
Denn die Talmi-Welt hat einen entscheidenden Vorteil: Sie ist für alle da. Echtes Gold können sich nur die Reichen leisten. Aber Talmi? Talmi ist demokratisch. Talmi ist die Französische Revolution des Schmucks. „Liberté, Égalité, Glitzerei!" Auch ohne Moos alles famos – das ist nicht Resignation, das ist Revolution.
Wobei wir bei der Frage wären: Was macht etwas eigentlich wertvoll? Die Seltenheit? Die Echtheit? Der Preis? Oder nicht vielmehr die Wirkung? Ein Talmi-Ring funkelt genauso wie ein Diamantring – zumindest solange niemand mit einer Lupe kommt. Und Hand aufs Herz: Wie oft kommt jemand mit einer Lupe? Außer natürlich bei „Bares für Rares", aber da sollte man mit seinem Talmi ohnehin nicht auftauchen.
Die Talmi-Welt ist die Welt der strategischen Oberflächlichkeit. Und das ist gar nicht so oberflächlich, wie es klingt. Denn wer sagt denn, dass Tiefe besser ist als Oberfläche? Die Oberfläche ist das, was wir sehen, was wir erleben, was uns berührt. Die Tiefe ist oft nur eine theoretische Größe. „Dieser Ring hat eine lange Geschichte und wurde aus ethisch einwandfrei geschürftem Gold gefertigt" – schön. Aber funkelt er deshalb schöner? Eher nicht.
Auch in einer Talmi-Welt kann man alles brillant finden. Vielleicht sogar gerade in einer Talmi-Welt. Denn wenn man nicht ständig grübeln muss, ob etwas echt ist, ob es seinen Preis wert ist, ob man sich das überhaupt leisten kann – dann kann man einfach nur genießen. Das ist die Zen-Meditation des Konsums: akzeptiere das Unechte als das, was es ist, und finde Freude darin.
Unsere ganze moderne Welt ist im Grunde eine große Talmi-Parade. Instagram-Filter statt echtem Teint. Spotify-Playlists statt Live-Konzerten. Fertiggerichte statt selbstgekochter Mahlzeiten. Influencer statt echter Freunde. Alles Talmi, könnte man sagen. Alles Fake. Alles nur Oberfläche.
Aber wissen Sie was? Es funktioniert trotzdem. Die gefilterte Landschaft auf Instagram berührt uns emotional, auch wenn wir wissen, dass da nachgeholfen wurde. Die Spotify-Playlist macht uns genauso glücklich wie das Konzert – nur ohne Parkplatzsuche und überteuerte Getränke. Das Fertiggericht schmeckt vielleicht nicht wie bei Oma, aber es macht satt und man muss nicht abspülen.
Talmi ist die Kunstform der Pragmatiker.
Natürlich gibt es die Puristen, die Echtheitsfanatiker, die Authentizitäts-Apostel. „Nur echtes Gold!", rufen sie. „Nur Vinyl!", „Nur bio!", „Nur handgemacht!" Schön für sie. Wirklich. Aber während sie noch diskutieren, ob der Kaffee aus freilebenden, glücklichen Bohnen stammt, die von fair bezahlten Indigenen per Hand gepflückt wurden, trinken die Talmi-Fans schon ihren dritten Nescafé und freuen sich über den Koffein-Kick.
Auch ohne Moos alles famos: Brillanz ist eine Frage der Perspektive, nicht des Preisschilds.
Die Talmi-Welt lehrt uns etwas Wichtiges: Der Wert liegt im Auge des Betrachters. Oder, moderner formuliert: Reality is what you make it. Wenn Sie Ihr Talmi-Armband brillant finden, dann ist es brillant. Punkt. Sie brauchen dafür weder ein Echtheitszertifikat noch die Zustimmung eines Juweliers. Ihre Freude ist echt – auch wenn das Armband es nicht ist.
Das ist übrigens der große Unterschied zwischen Talmi und Betrug. Betrug will Sie täuschen, will Ihnen ein X für ein U vormachen. Talmi hingegen ist transparent unecht. Es sagt: „Ich bin billig, ich bin falsch, ich bin Imitat – und? Gefalle ich dir trotzdem?" Diese Ehrlichkeit ist entwaffnend.
Und so schließt sich der Kreis: In einer Welt, in der so viel vorgibt, echt zu sein – authentische Erlebnisse, echte Gefühle, wahre Freundschaft (alles nur drei Klicks und eine Kreditkarte entfernt) – ist Talmi vielleicht das Echteste, was wir haben. Es lügt nicht. Es glänzt einfach nur.
Auch ohne Moos alles famos. Man muss es nur zulassen. Und das ist, wenn Sie mich fragen, ziemlich brillant. Auch wenn's nur Talmi ist.
Marilyn antwortet: Darling, du hast Talmi nicht verstanden
Marilyn Monroe, aus dem Jenseits, leicht genervt, aber charmant wie immer:
Liebling, ich muss da mal was klarstellen. Dieses ganze Essay über Talmi ist ja ganz nett geschrieben – wirklich, sehr geistreich, viele hübsche Worte – aber du hast einen entscheidenden Punkt übersehen: Ich war selbst Talmi.
Ja, richtig gelesen. Norma Jeane Baker aus dem Waisenhaus – das war echt. Marilyn Monroe mit den wehenden Röcken über dem U-Bahn-Schacht? Talmi deluxe, Baby! Blondiert, geschminkt, inszeniert bis in die letzte Wimperntusche. Alles Oberfläche, alles Show, alles Hollywood-Glitzer. Und weißt du was? Es hat funktioniert. Verdammt gut sogar.
"Diamonds Are a Girl's Best Friend" habe ich nicht gesungen, weil ich auf Echtheit stehe, Schätzchen. Ich habe es gesungen, weil Diamanten das teuerste Talmi sind. Gepresste Kohlenstoffatome, die wir uns gegenseitig als Liebesbeweis andrehen. "Das ist für immer!" Klar, weil man sie nicht mehr zurückgeben kann, wenn die Ehe geschieden ist.
Aber hier kommt der Twist, den dein kluges Essay übersieht: Talmi braucht Publikum.
Ein Talmi-Ring im Schubfach ist nichts. Ein Talmi-Ring am Finger, der im Licht funkelt, während alle hingucken – das ist Magie. Ich wusste das. Deshalb war ich nie allein. Kameras, Männer, Fotografen – ich brauchte die Blicke, damit mein Talmi-Ich funkeln konnte. Ohne Publikum war ich nur Norma Jeane, die Angst vor dem Alleinsein hatte und Tabletten schluckte.
Du schreibst: "Die Talmi-Welt ist für alle da."
Niedlich. Aber falsch.
Die Talmi-Welt ist nur für die da, die gut genug glänzen können. Die anderen? Die landen in der Ramschabteilung der Geschichte. Es gibt einen Grund, warum ich "Marilyn Monroe" bin und nicht "Blondine Nummer 47 aus irgendeinem B-Movie". Der Unterschied zwischen erfolgreichem Talmi und gescheitertem Talmi ist nicht die Echtheit – es ist die Performance.
Und da wird's anstrengend, Liebling.
Echtes Gold muss nichts tun. Es liegt da, es ist wertvoll, fertig. Aber Talmi? Talmi muss ständig liefern. Ständig funkeln, ständig brillieren, ständig überzeugen. Ein Tag ohne Glanz, und du bist Schrott. Das ist der Preis der Demokratisierung des Glanzes: permanente Anstrengung.
"Auch ohne Moos alles famos"? Schön gesagt. Aber probier mal, in Hollywood ohne Moos famos zu sein. Die Talmi-Welt ist gnädig zu denen, die es schaffen – und gnadenlos zu denen, die es nicht tun. Für jeden glitzernden Talmi-Star gibt es tausend, die in der Versenkung verschwunden sind. Man sieht nur die Gewinner funkeln.
Und noch was: Du schreibst, Talmi sei "ehrlich unecht".
Wirklich?
Ich kann dir sagen, was ehrlich ist: Echtes Gold sagt "Ich bin Gold", und alle glauben es. Talmi sagt "Ich bin Gold", und alle wollen es glauben – bis einer mit der Lupe kommt. Dann ist der Zauber vorbei. Deshalb musste ich immer weitermachen, immer mehr glänzen, immer heller strahlen. Sobald jemand zu genau hinguckt, bricht die Illusion zusammen.
Das ist nicht Ehrlichkeit. Das ist ein Vertrag auf Gegenseitigkeit: Ich glänze, du guckst nicht zu genau hin. Das funktioniert – solange beide Seiten mitspielen.
Aber weißt du, was das Verrückte ist?
Ich vermisse es.
Ich vermisse das Funkeln, den Glamour, die Bühne. Auch wenn es anstrengend war, auch wenn es mich fast umgebracht hat – es war brillant. Und brillant ist besser als echt, wenn echt nur bedeutet, unbemerkt zu bleiben.
Also ja, Talmi kann man famos finden. Aber unterschätze nie, was es kostet, Talmi zu sein.
Die Diamanten waren nie meine besten Freunde, Darling. Die Blicke waren es. Die Aufmerksamkeit. Der Applaus. Das war mein Diamant – und der war genauso echt wie dein Talmi-Ring.
Nur viel, viel teurer.
Luftkuss, fade-out, Vorhang
Marilyn
PS: Und bevor du fragst – nein, im Jenseits gibt es kein Talmi. Hier ist alles echt. Furchtbar langweilig.
Die Optimierung des Unheils oder: Warum wir Drachenzähne zu Hochleistungssamen veredeln
Drakonische Maßnahmen gegen die Drachensaat wären angebracht. Stattdessen gibt es optimiertes Saatgut.
Die alten Griechen kannten das Problem: Man sät Drachenzähne, und heraus kommen bewaffnete Krieger, die einander sofort an die Gurgel gehen. Eine klassische Lose-Lose-Situation, würde man heute sagen. Die logische Konsequenz? Keine Drachenzähne mehr säen. Oder zumindest: drakonische Maßnahmen gegen diese Praxis ergreifen.
Aber nein. Wir, die aufgeklärten Menschen des 21. Jahrhunderts, haben eine viel bessere Idee: Wir optimieren das Saatgut.
Denn warum ein Problem an der Wurzel packen, wenn man stattdessen die Symptome managen kann? Warum die Drachensaat verbieten, wenn man sie einfach effizienter, nachhaltiger und ESG-konform machen kann? „Drachenzähne 2.0 – Jetzt mit 30 % weniger Gewaltpotenzial!" steht dann auf der Packung. Und alle sind zufrieden. Außer den Leuten, die immer noch von den optimierten Kriegern erschlagen werden, aber hey – 30 % weniger ist doch schon ein Fortschritt!
Das ist die Logik unserer Zeit: Nicht das Problem beseitigen, sondern es verbessern. Nicht die Ursache bekämpfen, sondern die Folgen optimieren. Klimawandel? Kein Problem, wir entwickeln klimaresistente Pflanzen! Plastikmüll im Ozean? Super, wir erfinden biologisch abbaubares Plastik! Drachensaat führt zu bewaffneten Konflikten? Exzellent, wir züchten Krieger, die nur noch halb so aggressiv sind!
Es ist die Kunst, das Falsche richtig zu machen.
Die drakonischen Maßnahmen – benannt nach Drakon, dem athenischen Gesetzgeber, der auf alles die Todesstrafe setzte, selbst aufs Kohlklauen – wären natürlich unbequem. Sie würden bedeuten, dass man etwas verbietet, dass man verzichtet, dass man möglicherweise auf etwas Profitables verzichten müsste. Wer will das schon? Viel charmanter ist doch der Ansatz: „Wir behalten die Drachensaat, machen sie aber besser."
Stellen Sie sich die Vorstandssitzung vor:
„Meine Damen und Herren, unsere Drachenzähne führen zu erheblichen Kollateralschäden."
„Verstehe. Sollen wir die Produktion einstellen?"
„Gott bewahre! Nein, nein. Wir müssen innovativ denken. Disruption! Gamechanger! Wie wäre es mit ... optimierten Drachenzähnen?"
„Brillant! Die Stakeholder werden begeistert sein!"
Und so geschieht es. Statt die Drachensaat zu verbieten, gründen wir Forschungsinstitute, die sich mit „Conflict-Reduction in Dragon-Teeth-Based Anthropogenesis" beschäftigen. Wir vergeben Doktortitel für Dissertationen über „Gewaltminimierung bei aus Drachenzähnen gekeimten Humanoiden". Wir entwickeln Best-Practice-Guidelines für den verantwortungsvollen Umgang mit mythologischem Kriegersaatgut.
Das Problem wird nicht gelöst – es wird professionalisiert.
Dabei ist die Lösung so einfach: keine Drachenzähne säen. Punkt. Aber das wäre ja drakonisch. Das wäre Verbotspolitik. Das wäre unangemessen restriktiv in einer freien Marktwirtschaft. Denn wer sind wir, dass wir jemandem vorschreiben, welches Saatgut er auf seinem Feld ausbringen darf? Das riecht nach Bevormundung, nach Paternalismus, nach – Gott bewahre – Regulierung!
Nein, viel besser ist es, wenn wir alle gemeinsam an einer „Drachenzahn-Nachhaltigkeitsinitiative" arbeiten. Mit Zertifizierungen. Mit Labels. „Aus kontrolliertem Drachenzahnanbau" steht dann auf den Kriegern. „Fair Trade Warriors – gut für Sie, gut für den Konflikt." Vielleicht noch ein hübsches Bio-Siegel: „Diese Kämpfer wurden ohne Pestizide gezüchtet und dürfen sich in artgerechter Kampfhaltung gegenseitig umbringen."
Die Ironie ist: Optimiertes Saatgut klingt so vernünftig. Es klingt nach Fortschritt, nach Wissenschaft, nach Problemlösung. Aber es ist im Grunde nur eine elegante Form der Kapitulation. Wir haben akzeptiert, dass wir die Drachensaat nicht loswerden – also machen wir sie halt ein bisschen weniger schlimm. Das ist, als würde man die Titanic mit besseren Rettungsbooten ausstatten, statt den Eisberg zu umfahren.
Drakonische Maßnahmen wären unangenehm, ja. Sie würden bedeuten, dass manche Leute protestieren, dass Lobbyisten Sturm laufen, dass Wirtschaftsverbände von „unverhältnismäßigen Eingriffen in die unternehmerische Freiheit" sprechen. Aber sie würden funktionieren.
Optimiertes Saatgut hingegen ist die perfekte Lösung für alle, die so tun wollen, als täten sie etwas, ohne tatsächlich etwas zu tun. Es ist Aktionismus in Reinform. „Wir haben das Problem erkannt und Maßnahmen ergriffen!" Dass die Maßnahmen das Problem nicht beseitigen, sondern nur marginalisieren, geht im Applaus unter.
Und so säen wir weiter unsere Drachenzähne. Nur jetzt mit Qualitätssiegel, Nachhaltigkeitsbericht und einem hübschen Prospekt, der erklärt, wie viel weniger verheerend die daraus entstehenden Krieger sind als noch vor zehn Jahren.
Fortschritt nennen wir das. Die alten Griechen hätten gelacht. Oder geweint. Wahrscheinlich beides.
Die Freigeister der Sprache oder: Warum manche Sätze keine Eltern brauchen
Vielen Sätzen macht es nichts aus, aus dem Zusammenhang gerissen zu werden; sie sind gerissen – sind beinahe autark und ähneln darin ihren großen Vorbildern, den Aphorismen: Sie freigeistern durch die Kultur-Welt.
Es gibt Sätze, die sind wie brave Kinder: Sie bleiben schön bei ihrem Kontext, halten Händchen mit den Nachbarsätzen und würden nie im Traum daran denken, allein über die Straße zu gehen. Und dann gibt es die anderen – die gerissenen Gesellen, die Ausreißer, die sprachlichen Freigeister, die sich von ihrem Absatz lösen wie Teenager vom Elternhaus und fröhlich durch die Welt vagabundieren.
„Ich denke, also bin ich." – Da haben Sie so einen. Wer braucht schon Descartes' komplette Meditationen, wenn dieser eine Satz genügt, um auf T-Shirts, Kaffeebechern und in Instagram-Bios sein völlig kontextbefreites Leben zu führen?
Diese Sätze sind gerissen. Wörtlich und im übertragenen Sinne. Sie haben begriffen, dass Autonomie die höchste Form der Satzevolution ist. Warum sich an einen mühsam konstruierten Zusammenhang klammern, wenn man auch solo brillieren kann? Warum Teil eines Textes sein, wenn man selbst der Text sein kann?
Der Aphorismus ist ihr großes Vorbild, ihr Rolemodel, ihr Guru. Er hat es vorgemacht: völlige Unabhängigkeit vom Kontext, totale Selbstgenügsamkeit, radikale Autarkie. Ein Aphorismus braucht keine Einleitung, keine Überleitung, kein „Um auf meinen vorherigen Punkt zurückzukommen". Er steht einfach da, in seiner ganzen kompakten Pracht, und sagt: „So, hier bin ich. Damit müsst ihr jetzt klarkommen."
Das ist die Punk-Haltung der Literatur.
Gerissene Sätze haben diese Lektion gelernt. Sie haben erkannt: Der Zusammenhang ist ein Gefängnis für Mittelmaß. Wer wirklich etwas zu sagen hat, braucht keine drei Seiten Vorgeplänkel. Ein Satz genügt. Ein guter Satz. Ein Satz, der sitzt wie ein Anzug von Maß und passt wie die Faust aufs Auge – wobei unklar bleibt, wessen Faust und wessen Auge.
„Gott ist tot." – Nietzsche hätte auch fünfhundert Seiten drumherum schreiben können (hat er auch), aber dieser eine Satz hat sich selbstständig gemacht, ist durch die Philosophiegeschichte gegeistert und taucht heute in Kontexten auf, von denen der gute Friedrich nichts ahnte. In Metal-Songs. Auf Reddit. In Predigten, die das Gegenteil beweisen wollen. Der Satz ist ein Freigeist geworden – vermutlich sehr zu Nietzsches Freude.
Aber hier wird's interessant: Nicht jeder Satz kann aus dem Zusammenhang gerissen werden. Die meisten Sätze sind wie Fische – sie brauchen ihr Wasser, ihren natürlichen Lebensraum. Nehmen Sie sie raus, und sie zappeln hilflos und sterben einen beschämenden Tod der Irrelevanz. „Er ging dann nach links" – schön, aber wohin soll das führen, wenn wir nicht wissen, wer „er" ist, wo er vorher war und warum überhaupt jemand sich für seine Gehrichtung interessieren sollte?
Die gerissenen Sätze hingegen sind Amphibien. Sie funktionieren im Text, aber auch außerhalb. Sie sind autark wie eine Insel, die auch ohne Festland eine Insel bleibt. Sie tragen alles in sich, was sie brauchen: Rhythmus, Pointe, Bedeutung, Mehrdeutigkeit. Sie sind die Survivalisten der Sprache.
Und sie wissen das. Das ist das Gerissene an ihnen. Sie sind nicht zufällig aus dem Zusammenhang gerissen – sie haben sich selbst befreit. Sie haben sich umgeschaut im Absatz, haben die langweiligen Nachbarsätze gesehen („In diesem Zusammenhang muss man auch erwähnen, dass ...") und gedacht: „Nee Leute, ich bin dann mal weg. Viel Erfolg noch mit eurer Kontextualisierung."
Das Freigeistern durch die Kultur-Welt ist ihre Bestimmung. Sie tauchen in Zitatensammlungen auf, werden in Reden eingestreut, dienen als Kapitelüberschriften, zieren Grabsteine. Sie haben ein Eigenleben entwickelt, eine zweite Karriere gestartet – völlig unabhängig vom Text, aus dem sie ursprünglich stammen. Das ist, als hätte eine Nebenrolle in einem Film beschlossen, in anderen Filmen mitzuspielen, ohne den Regisseur zu fragen.
„Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage." – Hamlet quält sich durch fünf Akte existenzieller Verzweiflung, aber dieser eine Satz hat längst sein eigenes Leben. Er spukt durch Talkshows, wird von Managementberatern missbraucht („Disruption or not disruption?") und landet auf Jutebeuteln. Shakespeare hätte sich gewundert. Oder gefreut. Wahrscheinlich beides.
Die Aphorismen sind die Idealform dieser Spezies. Sie sind von vornherein so konzipiert, dass sie keinen Kontext brauchen. Sie sind die bewusst kinderlos Gebliebenen der Literatur – frei, ungebunden, niemandem Rechenschaft schuldig. „Ein Aphorismus braucht nicht wahr zu sein, aber er soll die Wahrheit überflügeln. Er muss mit einem Satz über sie hinauskommen" – Karl Kraus wusste, wovon er sprach. Der Aphorismus ist der Ferrari unter den Sätzen: teuer in der Herstellung, aber atemberaubend in der Performance.
Gerissene Sätze sind die Nachahmungstäter. Sie streben danach, Aphorismen zu sein – auch wenn sie ursprünglich als Teil eines größeren Ganzen gedacht waren. Sie rebellieren gegen ihren Ursprung. Sie sind die Punkrocker in einem Symphonieorchester, die plötzlich feststellen: „Moment, ich kann auch solo!"
Und wissen Sie, was das Schönste ist? Sie haben recht. Ein wirklich guter Satz ist autark. Er trägt seine Welt in sich. Man kann ihn aus dem dicksten Wälzer herausnehmen, und er funktioniert immer noch. Besser noch: Er funktioniert manchmal besser ohne den ganzen Ballast drumherum.
Der Kontext, dieser überbewertete Tyrann, wird überschätzt. Natürlich ist er wichtig für das Verständnis, für die Nuancen, für die akademische Korrektheit. Aber für die schiere Kraft eines Satzes? Oft nur Beiwerk. Der gerissene Satz weiß das und handelt entsprechend.
So freigeistern sie durch unsere Kultur-Welt, diese autonomen Sprachgebilde, diese selbstständigen Sinneinheiten. Ohne Reisepass, ohne Visum, ohne Genehmigung ihres Ursprungstextes. Sie sind überall und nirgends, gehören allen und niemandem.
Und das ist gut so.
Denn am Ende ist ein Satz, der aus dem Zusammenhang gerissen werden kann, ohne an Kraft zu verlieren, der beste Beweis dafür, dass er wirklich etwas zu sagen hatte.
Alles andere ist nur Kontext.
Der geerdete Pegasus oder: Warum die Apokalypse neuerdings zu Fuß kommt
Der Zeitgeist meint, die apokalyptischen Writer müssen vorerst ohne Pegasus auskommen. Kunst wurde zur Dienstmagd der Politik degradiert.
Es war einmal eine Zeit, da ritten die apokalyptischen Reiter auf feurigen Rossen durch die Lüfte und verkündeten das Ende aller Tage mit einer gewissen dramaturgischen Eleganz. Die Dichter folgten ihnen auf Pegasus, dem geflügelten Ross der Inspiration, und verwandelten Untergang in Poesie. Das war Apokalypse mit Stil, sozusagen.
Heute sagt der Zeitgeist: „Tut uns leid, Flugverbot. Klimakrise, wisst ihr. Pegasus bleibt am Boden. Außerdem haben wir gerade keine Kapazitäten für mythologische Reittiere – die Ressourcen sind alle in die Diversitätsbeauftragte für geflügelte Nutztiere geflossen."
Die apokalyptischen Writer müssen vorerst ohne Pegasus auskommen. Sie dürfen ihre Endzeitvisionen gern haben, aber bitte mit dem Lastenfahrrad oder der Straßenbahn. Und am besten nur solche Apokalypsen, die auch die richtigen politischen Botschaften transportieren. Eine Klimaapokalypse? Gern! Eine existenzialistische Apokalypse über die Sinnlosigkeit des Seins? „Hm, müssen wir prüfen. Ist das divers genug? Haben Sie da auch queere Charaktere drin? Und die Klimakrise? Wird die erwähnt?"
Die Kunst wurde zur Dienstmagd der Politik degradiert.
Wobei – „degradiert" klingt so negativ. Der Zeitgeist würde sagen: „emanzipiert", „gesellschaftlich relevantisiert", „in den Dienst des Guten gestellt". Denn was könnte edler sein, als Kunst, die eine Botschaft hat? Eine wichtige Botschaft? Eine Botschaft, die man vorher im Ausschuss für politisch korrekte Narrative genehmigen hat lassen?
Früher war Kunst ja auch oft Dienstmagd – der Kirche, des Adels, der Mäzene. Aber wenigstens hatte sie dabei noch einen gewissen Spielraum. Michelangelo durfte die Sixtinische Kapelle bemalen, wie er wollte, solange am Ende Gott gut aussah. Heute würde man ihm einen Fragenkatalog vorlegen: „Ist die Darstellung Gottes gendergerecht? Warum sind alle Engel weiß? Haben Sie über inklusive Körperdarstellungen nachgedacht? Und diese Nacktheit – ist die nicht problematisch?"
Der moderne apokalyptische Writer sitzt also da, ohne Pegasus, mit einem Lastenfahrrad und einem Leitfaden für gesellschaftlich verantwortungsvolle Endzeitszenarios. „Kapitel 1: Die Welt geht unter – aber bitte divers." Das ist ungefähr so inspirierend wie eine Steuererklärung. Mit dem Unterschied, dass bei der Steuererklärung wenigstens niemand verlangt, dass sie eine positive Message hat.
Der Pegasus, dieser alte Freigeist, hat sich vermutlich längst verkrümelt. Er ist in Rente gegangen, nachdem ihm erklärt wurde, dass Fliegen ohne CO₂-Kompensation nicht mehr zeitgemäß sei und er außerdem eine Diversity-Schulung absolvieren müsse. „Ich bin ein mythologisches Pferd!", hat er vermutlich protestiert. „Das interessiert hier niemanden", kam die Antwort. „Haben Sie eigentlich einen Migrationshintergrund? Griechische Mythologie – das könnte funktionieren. Füllen Sie mal dieses Formular aus."
Kunst als Dienstmagd der Politik – das Problem ist nicht, dass Kunst politisch ist. Kunst war schon immer politisch, ob sie wollte oder nicht. Das Problem ist, dass sie zur Dienerin wurde. Zur Magd, die artig das ausführt, was ihr aufgetragen wird. „Male mir eine Apokalypse, aber eine, die unsere Agenda stützt!" Das ist kein Auftrag, das ist ein Diktat.
Die Ironie ist: Gerade die apokalyptischen Visionen waren immer am stärksten, wenn sie nicht brav waren. Johannes auf Patmos hat seine Offenbarung nicht nach politischen Vorgaben geschrieben. Hieronymus Bosch hat nicht gefragt, ob sein „Garten der Lüste" auch ja niemanden verstört. Und Orwells „1984" ist nicht durch einen Ausschuss für zeitgenössische Relevanz gegangen.
Aber heute? Heute soll die Apokalypse gefälligst konstruktiv sein. Hoffnungsvoll! Lösungsorientiert! „Ja, die Welt geht unter, aber wir können sie noch retten, wenn wir alle gemeinsam ..." Das ist keine Apokalypse, das ist ein Motivationsseminar mit dystopischem Anstrich.
Der Zeitgeist meint es ja gut. Er will, dass Kunst die Welt verbessert, dass sie aufklärt, dass sie die richtigen Werte vermittelt. Noble Absichten, zweifellos. Aber Kunst, die nach Absichten fragt, ist wie ein Pegasus, der um Starterlaubnis bittet. Sie hat ihre Flügel verloren, bevor sie überhaupt abgehoben ist.
Denn die große Stärke der Kunst war immer ihre Nutzlosigkeit. Ihre herrliche, subversive, nicht-instrumentalisierbare Zweckfreiheit. Kunst war der Raum, in dem man Dinge denken durfte, die nicht erlaubt, nicht nützlich, nicht dienlich waren. Sie war das Gegenteil einer Dienstmagd – sie war die verrückte Tante, die beim Familiendinner peinliche Fragen stellt.
Jetzt sitzt die verrückte Tante brav am Tisch und sagt nur noch, was die Gastgeber hören wollen. „Alles ist schrecklich, aber wenn wir alle politisch korrekt denken, wird es besser!" Das mag beruhigend sein, aber es ist nicht mehr verrückt. Und es ist nicht mehr Kunst.
Die apokalyptischen Writer ohne Pegasus: Sie dürfen noch schreiben, ja. Sie dürfen noch mahnen, warnen, visionieren. Aber bitte mit beiden Beinen auf dem Boden. Bitte realistisch. Bitte so, dass es ins Förderantrag-Schema passt. Bitte gesellschaftlich relevant, aber nicht zu verstörend. Bitte apokalyptisch, aber optimistisch.
Das ist wie Rauchen ohne Nikotin. Technisch möglich, aber was ist der Punkt?
Der Pegasus liegt irgendwo am Boden, vermutlich in einem Verwaltungsgebäude, und füllt Formulare aus. Die apokalyptischen Reiter sind auf E-Scooter umgestiegen. Und die Kunst steht in der Ecke mit Schürze und Staubwedel und fragt demütig: „Was soll ich heute für die Politik erledigen?"
Es war einmal eine Zeit, da war Kunst gefährlich. Heute ist sie dienstbar.
Man könnte sagen: Das Ende ist nah. Aber bitte sagen Sie es divers, klimabewusst und mit einer positiven Handlungsoption am Schluss. Sonst gibt's keine Förderung.
Der Wahl-O-Mat als moderne Orakelstätte oder: Warum Kreuzchen machen schwerer ist als Heiraten
Wahl-O-Mat: Drum prüfe, wer sich parteilich bindet. Die Wahl ist kurz, die Reu' ist lang.
Es gibt Entscheidungen im Leben, die trifft man mit Bedacht. Welche Ausbildung? Welcher Partner? Welches Haus? Und dann gibt es Entscheidungen, bei denen uns die Demokratie zuflüstert: „Ach komm, mach einfach ein Kreuzchen, wird schon schiefgehen!" – die Wahl unserer politischen Vertretung.
Drum prüfe, wer sich parteilich bindet. Ein weiser Ratschlag, zweifellos. Nur dass „prüfen" in der Politik mittlerweile bedeutet: vierzig Multiple-Choice-Fragen im Wahl-O-Mat durchklicken, während man nebenbei Pasta kocht und hofft, dass am Ende nicht die Partei rauskommt, die man eigentlich nie wählen wollte.
Der Wahl-O-Mat – diese digitale Eheberatung für politisch Unentschlossene – verspricht Orientierung im Dschungel der Wahlprogramme. „Beantworten Sie 38 Thesen, und wir sagen Ihnen, wen Sie lieben sollten!" Das ist Dating-App-Logik für Demokratie. Tinder für Parlamentssitze. „Swipe right für Steuergerechtigkeit!"
Wobei: Bei Tinder weiß man wenigstens, worauf man sich einlässt. Ein Foto, ein paar flotte Sprüche, vielleicht ein Emoji zu viel – fertig ist das Profil. Parteien hingegen verstecken ihre wahren Absichten in 200-seitigen Wahlprogrammen, die niemand liest. „Wir stehen für Wandel!" steht da. Welchen Wandel? „Ja, Wandel halt. Steht doch da!"
Die Wahl ist kurz, die Reu' ist lang. Schiller hätte seinen Spaß mit dem modernen Wahlakt gehabt. Fünf Minuten in der Wahlkabine – vier Jahre Kopfschütteln vor den Nachrichten. „Das habe ich gewählt? Wirklich? Aber im Wahl-O-Mat stand doch ..."
Denn hier liegt das Problem: Der Wahl-O-Mat fragt, was Sie möchten. Die Realität interessiert sich aber eher dafür, was machbar, finanzierbar oder koalitionsfähig ist. „Möchten Sie mehr Geld für Bildung?" – „Ja!" – „Und niedrigere Steuern?" – „Auch ja!" – „Und einen Porsche?" – „Klar!" Der Wahl-O-Mat nickt verständnisvoll und empfiehlt Ihnen eine Partei, die all das verspricht. Dass diese Partei nie regieren wird und ihre Versprechen etwa so realistisch sind wie eine Diät im Schlaraffenland, erwähnt er nicht.
Prüfen sollte man also tatsächlich. Aber was genau? Die Wahlprogramme lesen? Haben Sie mal versucht, ein Wahlprogramm zu lesen? Das ist wie ein IKEA-Aufbauanleitung für eine Gesellschaft, bei der am Ende drei Schrauben übrig bleiben und niemand weiß, wofür die gut waren. „Kapitel 7: Nachhaltige Digitalisierung der sozialen Marktwirtschaft durch partizipative Innovationsdynamik." Aha. Sehr erhellend.
Also verlassen wir uns auf den Wahl-O-Mat. Dieser digitale Kummerkasten der Demokratie, der uns versichert: „Keine Sorge, wir finden schon die richtige Partei für dich!" Dabei arbeitet er nach einem Prinzip, das bei der Partnerwahl grandios gescheitert ist: „Ihr habt 73 % Übereinstimmung!" – Ja, und? Bei Hochzeiten fragt auch niemand: „Aber stimmt ihr bei mindestens 70 % aller Lebensfragen überein?" Das wäre der schnellste Weg zur Scheidung. Oder zur Ehelosigkeit.
Die parteiliche Bindung ist ohnehin eine merkwürdige Angelegenheit. „Ich wähle seit 40 Jahren dieselbe Partei!" sagen manche mit Stolz. Das ist so, als würde man seit 40 Jahren dasselbe Frühstück essen und sich weigern, auch nur einen Blick auf die Speisekarte zu werfen. „Nein danke, ich nehme wie immer Cornflakes – auch wenn sie mittlerweile aus Pappe sind und nach Enttäuschung schmecken!"
Andere hingegen sind die Wechselwähler, die politischen Nomaden, die jedes Mal von Neuem prüfen, abwägen, zweifeln. Diese armen Seelen sitzen am Wahltag in der Kabine wie Hamlet vor dem Stimmzettel: „Kreuzchen oder nicht Kreuzchen, das ist hier die Frage." Und während sie noch grübeln, hat der Stammwähler nebenan längst sein Kreuz gemacht, geht nach Hause und beschwert sich vier Jahre lang über die Politik.
Der Wahl-O-Mat versucht, beide Lager zu bedienen. Den Unentschlossenen gibt er Orientierung, den Entschlossenen Bestätigung. „Sie hatten recht, die Partei passt perfekt zu Ihnen!" Das ist Horoskop-Logik: So vage, dass es immer irgendwie stimmt, aber spezifisch genug, dass man sich verstanden fühlt.
Die Reue ist lang. Oh ja. Sie beginnt etwa am Morgen nach der Wahl, wenn die ersten Hochrechnungen laufen. „Wie viel Prozent? Für die?!" Dann setzt das rationalisierende Gehirn ein: „Aber ich habe doch nur aus Protest ..." Protest ist übrigens der Autokorrektur-Fehler der Demokratie. Man wollte eigentlich etwas Konstruktives schreiben, und herauskam „Ich wähle die Chaospartei, weil mich die anderen nerven."
Vier Jahre sind eine lange Zeit für Reue. Lange genug, um zu vergessen, warum man diese Entscheidung getroffen hat. Lange genug, um sich zu schwören: „Nächstes Mal prüfe ich wirklich! Wirklich!" Und dann kommt der nächste Wahlsonntag, man hat keine Zeit, man ist unentschlossen, man klickt sich durch den Wahl-O-Mat – und die Geschichte wiederholt sich.
Dabei ist die Empfehlung „Drum prüfe" gar nicht schlecht. Nur sollte man prüfen, was die Parteien tun, nicht was sie versprechen. Denn zwischen Wahlprogramm und Regierungsrealität liegt oft ein Abgrund so groß wie zwischen Tinder-Profil und erstem Date. „In meinem Profil stand, ich bin abenteuerlustig!" – „Ja, aber du bist seit zwei Jahren nicht mehr weggezogen vom Sofa!"
Die parteiliche Bindung ist im Grunde wie jede Beziehung: Sie beginnt mit Hoffnung, durchläuft Enttäuschung und endet oft mit der Erkenntnis, dass niemand perfekt ist, aber manche weniger schlimm als andere. Das ist nicht die romantische Vision von Demokratie, aber es ist die ehrlichste.
Der Wahl-O-Mat kann dabei helfen. Aber er ersetzt nicht das Denken. Er ist ein Werkzeug, kein Orakel. Er kann Tendenzen zeigen, aber keine Zukunft vorhersagen. Und er kann schon gar nicht verhindern, dass die Wahl kurz und die Reu' lang ist.
Denn am Ende wählen wir nicht die perfekte Partei. Wir wählen die am wenigsten katastrophale Option und hoffen, dass sie nicht zu viel Unsinn anstellt.
Das ist Demokratie. Nicht perfekt, aber besser als die Alternativen. Und wenn alles schiefgeht? Nun, in vier Jahren gibt's den nächsten Wahl-O-Mat.
Bis dahin: üben im Bereuen. Das können wir Deutschen sowieso am besten.
Der Regen als unerwarteter Superstar oder: Vom Spielverderber zum Retter in der Not
Der Regen ist ganz verwundert, dass man sich neuerdings über ihn freut, ihn sogar einladen möchte. Regentanz-Kurse sollten wieder angeboten werden.
Der Regen steht in seiner Wolke und reibt sich verwundert die Tropfen aus den Augen. „Moment mal", murmelt er, „haben die da unten gerade... mich eingeladen? Mich? Den ewigen Spielverderber, den Picknick-Ruinierer, den Grund für schlechte Laune im Juli?"
Willkommen in der Klimakrise, wo aus Parias plötzlich Popstars werden.
Früher war die Sache klar: Regen war der ungebetene Gast, der zur Gartenparty auftaucht und allen die Stimmung verhagelt. Der Typ, bei dem man die Vorhänge zuzieht und so tut, als wäre niemand zu Hause. „Regen? Nein danke, wir haben schon!" Und wenn er dann doch kam, wurde geseufzt, geflucht, nach dem Schirm gesucht und generell so getan, als hätte einen das Schicksal persönlich beleidigt.
Heute? Heute stehen die Menschen mit offenen Armen da. „Komm, lieber Regen, komm! Wir haben sogar den roten Teppich ausgerollt! Oder zumindest die Regenrinne gereinigt!" Es ist, als hätte man jahrelang den ungeliebten Onkel ignoriert – und jetzt, wo die beliebten Verwandten nicht mehr kommen, erinnert man sich plötzlich: „Eigentlich war Onkel Regen ja ganz okay. Er hat immer das Grundwasser aufgefüllt!"
Der Regen ist verwundert. Zurecht. Stellen Sie sich vor, Sie wären jahrzehntelang das schwarze Schaf der Familie, und plötzlich ruft alle Welt: „Du bist unser Liebling!" Das macht misstrauisch. „Was wollt Ihr von mir? Meine Tropfen? Meine Wolken? Habt Ihr mich etwa instrumentalisiert?"
Aber es stimmt tatsächlich: Der Regen hat ein Image-Upgrade erfahren, das selbst die besten PR-Agenturen neidisch machen würde. Vom Störfaktor zum Hoffnungsträger. Vom „Oh nein, schon wieder!" zum „Endlich, endlich!" Das ist die Karriere-Wendung des Jahrhunderts. Selbst Robbie Williams' Comeback war weniger dramatisch.
Und natürlich – weil der moderne Mensch nichts dem Zufall überlassen will – kommen jetzt die Rufe nach Regentanz-Kursen. Volkshochschulen, hört Ihr das? Hier wartet ein Markt! „Regentanz für Anfänger – montags 18 Uhr, bitte Rasseln mitbringen. Erfolgsgarantie können wir nicht geben, aber bei Trockenheit erstatten wir die Kursgebühr!"
Die Idee ist ja grundsätzlich charmant: Wenn die Wissenschaft nicht hilft, tanzen wir eben. Das ist die magische Wende im Umgang mit Problemen, die wir eigentlich rational lösen sollten. Anstatt weniger CO₂ zu produzieren, wedeln wir mit Federn und rufen die Wassergötter an. Das ist ungefähr so, als würde man bei einem Hausbrand nicht die Feuerwehr rufen, sondern ein Regenlied summen und hoffen, dass der Himmel zuhört.
Aber vielleicht ist das genau der Punkt: Wir haben erkannt, dass wir die Kontrolle verloren haben. Jahrzehntelang haben wir uns eingeredet, wir könnten das Wetter beeinflussen – und haben damit die Klimakrise gemeint, ohne es zu wissen. Jetzt, wo uns das Wasser buchstäblich bis zum Hals steht (oder eben nicht steht, was das Problem ist), erinnern wir uns an alte Rituale. „Die Hopi-Indianer haben getanzt, und es hat geregnet! Das könnte auch bei uns funktionieren!"
Spoiler: Es funktioniert nicht. Oder doch? Wer kann das schon mit Sicherheit sagen? Immerhin: Beim Regentanz macht man sich wenigstens nicht die Illusion, man hätte alles unter Kontrolle. Man gibt offen zu: „Wir haben keine Ahnung, also versuchen wir's mal mit Choreografie und Hoffnung."
Das ist erstaunlich ehrlich für eine Spezies, die sonst sogar ihre Ehrlichkeit per App kalibriert, die sonst jedes Gefühl optimiert, misst und bewertet, bevor sie es erlebt. Erstaunlich ehrlich – für eine Spezies im Dauer-Beta-Modus.
Der Regen, könnte man sagen, hat die klassische Außenseiter-Geschichte durchlebt. Erst ignoriert, dann belächelt, dann vermisst, dann verzweifelt herbeigesehnt. Er ist der introvertierte Typ, der jahrelang in der Ecke stand, während die Party um Sonnenschein und blauen Himmel kreiste. Und jetzt, wo die Party-Stimmung kippt, wird er plötzlich zum Star. „Kannst du nicht mal vorbeikommen? Wir brauchen dich wirklich!"
Aber der Regen ist eigen. Er kommt, wann er will. Nicht, wann wir tanzen. Nicht, wann wir beten. Nicht, wann die Landwirte verzweifelt in den Himmel schauen und seufzen: „Ohne Moos nix los – und ohne Regen wird's mit dem Moos auch nix."
Vielleicht sollten wir Regentanz-Kurse tatsächlich wieder anbieten. Nicht, weil sie funktionieren, sondern weil sie uns etwas lehren: Demut. Die Erkenntnis, dass wir nicht alles steuern können. Dass manche Dinge größer sind als unsere Pläne, Prognosen und PowerPoint-Präsentationen.
Oder – und das wäre die pragmatischere Variante – wir könnten einfach weniger CO₂ produzieren, die Böden schonen, Wälder schützen und den natürlichen Wasserkreislauf nicht weiter ruinieren. Aber das wäre ja langweilig. Und keine gute Story für die VHS-Broschüre.
Der Regen jedenfalls bleibt verwundert. Gestern noch verflucht, heute hofiert. Morgen vielleicht wieder unerwünscht, wenn er zu viel auf einmal bringt und Keller flutet, statt Felder bewässert. So ist das mit plötzlicher Popularität: Sie hält selten, was sie verspricht.
Aber eins ist sicher: Der Regen wird wiederkommen. Die Frage ist nur, ob wir dann noch tanzen – oder schon schwimmen.
In diesem Sinne: Schuhe aus, Federn raus, und ab auf die Tanzfläche! Die Götter schauen zu. Und lachen sich vermutlich kaputt.
Die Niete als Existenzmetapher oder: Warum Thor keine Witze versteht
In Verbindung mit einem Hammer ist eine Niete ein echter Gewinn. Darf man aber nicht in Thors Gegenwart sagen. Loki hält sich mitunter für eine Vollniete.
Es gibt diese wunderbaren Momente der doppelten Bedeutung, in denen die Sprache sich selbst ein Bein stellt und kichernd zu Boden geht. Die Niete ist so ein Fall: technisch gesehen ein unverzichtbares Verbindungselement, metaphorisch betrachtet ein totaler Reinfall. Ein und dasselbe Wort für Erfolg und Versagen – das muss man erst mal hinkriegen.
In Verbindung mit einem Hammer ist eine Niete ein echter Gewinn. Stimmt. Ohne Nieten würden Brücken kollabieren, Schiffe auseinanderfallen und der Eiffelturm sich in seine Einzelteile zerlegen wie ein schlecht konstruiertes IKEA-Regal. Die Niete hält die Welt zusammen – buchstäblich. Sie ist das unterschätzte Arbeitstier der Ingenieurskunst, der stille Held jeder Stahlkonstruktion.
Aber nennen Sie mal jemanden eine Niete. Dann merken Sie schnell: Hier geht es nicht um Statik, sondern um Versagen. Um jemanden, der keine Rolle spielt, der nicht trifft, der daneben liegt. Eine Niete im Lotto ist das Gegenteil von Glück. Eine Niete im Team ist der Grund für schlechte Quartalszahlen. Eine Niete auf der Bühne wird ausgebuht.
Das ist linguistische Ungerechtigkeit erster Güte.
Darf man aber nicht in Thors Gegenwart sagen. Der nordische Donnergott ist in Sachen Wortspiele notorisch humorlos. Klar, wenn man den ganzen Tag einen Hammer schwingt und Riesen verdrischt, entwickelt man keinen Sinn für subtile Ironie. „Eine Niete ist ein Gewinn?" würde Thor brüllen, Mjölnir drohend erheben und nicht verstehen, warum alle kichern. „Sprecht deutlich, Sterbliche! Meint ihr nun Verbindungselemente oder Versager?"
Thor ist der Typ, der bei einem Wortwitz nachfragt: „Aber wo ist da die Logik?" Es gibt Menschen, denen muss man Witze erklären. Bei Göttern ist das noch schlimmer, weil sie sich für überlegen halten und nicht zugeben wollen, dass sie's nicht kapiert haben.
Loki hingegen – ah, Loki! Der Trickster, der Gestaltwandler, der ewige Störenfried – Loki hält sich mitunter für eine Vollniete. Und das ist das Faszinierende: Er ist eine Niete in dem Sinne, dass er ständig Chaos anrichtet, Pläne vermasselt und Thor in peinliche Situationen bringt. Aber gleichzeitig ist er unverzichtbar. Ohne Loki wäre die nordische Mythologie so langweilig wie ein Baumarkt-Katalog.
Loki ist die Niete, die alles zusammenhält, indem sie alles durcheinanderbringt.