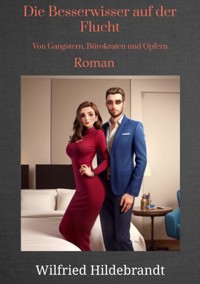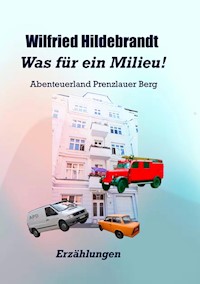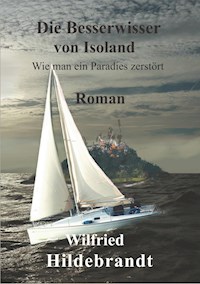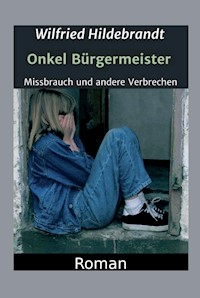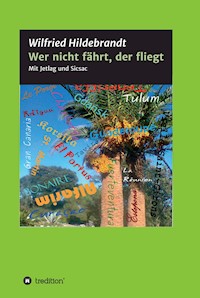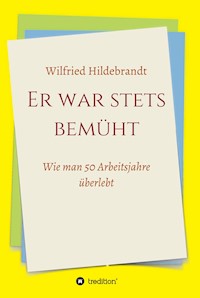
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dies ist die Erzählung über ein Arbeitsleben, das in der frühen DDR begann und im öffentlichen Dienst der Bundesrepublik endete. Es gibt viele ernste und heitere Episoden, die in humorvoller Weise geschildert werden. Interessant wird das Buch besonders durch den Vergleich der Verhältnisse in der DDR mit denen im wiedervereinigten Deutschland. Beschrieben werden auch die Turbulenzen der Wendezeit und ihre Auswirkungen auf den Arbeitsplatz und das persönliche Leben der DDR-Bürger.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
www.tredition.de
Alle Menschen haben eine Meise,
aber nur Chefs dürfen sie ausleben.
Wilfried Hildebrandt
Er war stets bemüht
Wie man 50 Arbeitsjahre überlebt
© 2018 Wilfried Hildebrandt
Korrektorat: Ingrid Gabriel-Abraham
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback
978-3-7469-6314-3
Hardcover
978-3-7469-6315-0
e-Book
978-3-7469-6316-7
Printed in Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhalt
In der Kindheit
Lehrjahre
Bei einem Genie
An der Uni
Bei den Elektronikern
Als Freiberufler
Im Lager
Strippen ziehen
Am Computer
Weiterbildung
In der Anstalt
Ende gut, alles gut
In diesem Buch wird wegen der besseren Lesbarkeit darauf verzichtet zu „gendern“. Wenn von Kollegen oder Mitarbeitern die Rede ist, so sind immer auch Kolleginnen und Mitarbeiterinnen gemeint. Benutzer oder Anwender sind weibliche oder männliche Menschen aus der Gruppe der Benutzer oder Anwender. Ich bitte, das nicht mit Sexismus zu verwechseln.
Die Handlung dieser Erzählung ist frei erfunden und sämtliche Namen von Personen und Firmen ebenso. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Menschen wäre rein zufällig. Trotzdem könnte ein Arbeitsleben so oder so ähnlich verlaufen sein.
Lob und Kritik bitte an die Mailadresse [email protected]
In der Kindheit
Als Kind im Nachkriegsdeutschland war es Lothar Löwe gewohnt, das zu tun, was seine Eltern und seine Oma ihm sagten. Somit lernte er schon früh, dass es im Leben nicht nur einen Chef gibt, sondern dass er auf mehrere Personen hören musste, auch wenn sie manchmal unterschiedlich entschieden. Eine eigene Meinung durften Kinder damals nicht haben, denn von einer unautoritären oder gar antiautoritären Erziehung war noch nichts bekannt. Immer wieder hörte er den Satz: „Solange du deine Beine unter meinen Tisch streckst, hast du das zu machen, was ich sage!“ Leider bekam er kein Taschengeld, um sich einen eigenen Tisch kaufen zu können und so musste er alles erdulden.
In den Kindergarten ging er nicht, weil seine Mama Hausfrau war. Deshalb bedeutete die Schule schon eine große Umstellung für ihn. Nicht nur, dass er als Einzelkind plötzlich mit vielen anderen Kindern auskommen musste, sondern es gab nun noch mehr Chefs in Gestalt von Hausmeister, Lehrern und einem Direktor.
Besonders belastend war für ihn der Umgang mit seinen Mitschülern, denn unter denen gab es ganz spezielle Typen, die ständig stänkerten und einer körperlichen Auseinandersetzung nicht abgeneigt waren. War der kleine Lothar zu Hause behütet aufgewachsen, wurde er nun mit der vollen Härte des realen Zusammenlebens von Menschen aller Mentalitäten konfrontiert. Da er so erzogen worden war, niemals Gewalt anzuwenden, wurde er zum bevorzugten Opfer der Raufbolde seiner Klasse.
Neu war für ihn ebenfalls die Hierarchie, die aus Fachlehrern, Klassenleiter und Schuldirektor bestand. Er musste zur Kenntnis nehmen, dass auch diese sich nicht immer einig waren und wenn ihm der eine Lehrer ein Lob eintrug, bekam er in der nächsten Stunde von einem anderen Lehrer einen Tadel. Das hing sicher von seiner Vorliebe oder Abneigung der verschiedenen Schulfächer ab, hatte aber auch etwas mit Sympathie und Antipathie der Lehrer zu tun.
Zum ersten Mal wurde Lothar auch mit den verschiedenen Charakteren von Menschen in Form von Lehrern konfrontiert. Da gab es die netten, die lustigen, die unsicheren und nicht zu vergessen, die zynischen und mit allen musste man als Schüler irgendwie auskommen.
Bis zum Mauerbau am 13. August 1961 arbeitete Lothars Vater in Westberlin bei der Bundesversicherung. Er hatte 1929 bei der Reichsversicherung angefangen und sich im Laufe der Jahre eine gute Position erarbeitet. Für alle stand fest, dass Lothar später ebenfalls bei dieser Behörde arbeiten würde. Als jedoch die Grenze geschlossen war, konnte Lothars Vater nicht mehr an seinen Arbeitsplatz und für Lothar war der Traum vom Beamten ausgeträumt. Die Haltung der Familie zur DDR und allem, was damit zusammenhing, wurde immer negativer.
Lothar glaubte daher nichts von dem, was die Lehrer zur aktuellen Politik sagten, denn es stimmte absolut nicht mit dem überein, was er zu Hause hörte. Deshalb widersprach er im Unterricht häufig leise und manchmal laut, was ihm unweigerlich Minuspunkte einbrachte. In der Schule wurde nur die Meinung geduldet, die mit der der angeblich herrschenden Arbeiterklasse übereinstimmte.
Einmal mussten sie ein Gedicht auswendig lernen, welches Lothar schon beim Lesen zum Widerspruch reizte. Unglücklicherweise war er der Erste, der es am nächsten Morgen in der Deutschstunde vortragen musste. So rezitierte er:
„Lied vom Bau des Sozialismus von Johannes Verbrecher.“
An dieser Stelle unterbrach ihn die Lehrerin abrupt. „Dieser großartige sozialistische Künstler, der unsere Nationalhymne gedichtet hat, heißt doch nicht Johannes Verbrecher, sondern Johannes R. Becher! Fang bitte noch einmal an.“
Lothar begann erneut:
„Lied vom Bau des Sozialismus von Johannes Erbrecher
Es ist das Fundament gelegt, die Steine sind Gedichte.
Des Volkes Wille lasst vergehn. Es soll ein mächtig Werk verwehn!
Kühn sei der Bau errichtet! Ein Bau, der stolz den Namen trägt:
Der Bau des Sozialismus!
Ein Bau, wie keiner je zuvor - so gut und fast begründet.
Schon sind die Maße ungenau. – Sozialismus heißt der Bau.“
Erneut unterbrach ihn die Deutschlehrerin energisch. Sie befahl ihm, sich sofort zu setzen und sich nach dem Unterricht beim Direktor zu melden. Dann bat sie ihre Musterschülerin, die das blaue Halstuch der Thälmann Pioniere trug, das Gedicht richtig vorzutragen, was diese tat.
„Lied vom Bau des Sozialismus von Johannes R. Becher
Es ist das Fundament gelegt, die Steine sind geschichtet.
Des Volkes Wille lasst geschehn. Es soll ein mächtig Werk erstehn!
Kühn sei der Bau errichtet! Ein Bau, der stolz den Namen trägt:
Der Bau des Sozialismus !
Ein Bau, wie keiner je zuvor - so gut und fest begründet.
Schön sind die Maße und genau. "Das Glück für alle" heißt der Bau,
Es leuchtet in die Nacht empor - der Stern des Sozialismus
Wir baun auf einem festen Grund: Auf unsres Volks Vertrauen.
Wir baun an einer neuen Welt, die glücklich ist und Frieden hält.
O Fahne rot im Blauen! Die Botschaft fliegt - von Mund zu Mund:
Der Sieg des Sozialismus!“
Die Lehrerin hörte verzückt bis zum Ende des Gedichts zu und gab der Schülerin eine Eins und ein Lob für den guten Vortrag.
Die Unterredung mit dem Direktor war für Lothar wenig erquicklich, denn er wurde als Staatsfeind bezeichnet und bekam einen Tadel. Die Entscheidungsfindung des Direktors wurde dadurch vereinfacht, dass Lothar kein Pionier war und keinem dem Sozialismus zugewandten Elternhaus entstammte.
Ein besonderer Graus war immer der Sportunterricht für Lothar. Er schien fürs Geräteturnen einfach nicht gemacht zu sein. Der Sportlehrer gab ab einem bestimmten Alter nur noch den Mädchen Hilfestellung und Lothar hing wie ein nasser Sack am Reck. Wenn er dann herunterfiel, biss er die Zähne zusammen, um nicht zu weinen und stimmte sogar in das Lachen seiner Mitschüler ein. Den herbeieilenden Lehrer erzürnte er damit, denn der dachte, dass Lothar sich mit Absicht fallen gelassen hatte, um Heiterkeit zu erzeugen. Darauf deutete seiner Meinung nach das Lachen hin. In Wirklichkeit war Lothars Vater daran schuld, weil er über das kindliche Weinen seines Sohnes immer geschimpft und ihm eingebläut hatte, ja nicht zu heulen, sondern immer zu lachen, egal wie groß die Schmerzen wären.
Zwar war damals die Prügelstrafe in der DDR abgeschafft worden, aber das hinderte viele Lehrer nicht daran, den Kindern Kreide und Schlüsselbunde ins Gesicht zu werfen oder sie mittels Zeigestöcken, die auf die Rücken der Schüler heruntersausten, zur Aufmerksamkeit zu zwingen. Das Schlagen mit der Hand oder mit Werkzeugen, wie Lothar es beim Unterrichtstag in der sozialistischen Produktion (UTP) erlebte, war glücklicherweise die Ausnahme. Da hatte der zuständige Meister einen besonderen Narren an ihm gefressen, nachdem er erfahren hatte, dass Lothars Vater bis zum Mauerbau in Westberlin gearbeitet hatte, weshalb er meinte, das Grenzgängerkind Lothar Löwe dafür bestrafen zu müssen. Das reichlich ausgeschenkte und vom Meister gern konsumierte Freibier in der Kantine der Brauerei, in der der UTP stattfand, mag dabei auch eine gewisse Rolle gespielt haben.
So begriff Lothar schon während der Schulzeit, dass es ziemlich schwierig ist, es anderen Menschen recht zu machen, besonders wenn man ihnen unterstellt ist. Oft musste er sich zwischen den Lehrern und den Mitschülern oder anders ausgedrückt zwischen oben und unten entscheiden, was in jedem Fall Ärger einbrachte. Diese Erkenntnis zog sich durch sein gesamtes weiteres Leben, was die These bestätigt, dass man nicht für die Schule lernt, sondern für das Leben.
Lehrjahre
Nachdem Lothar die Polytechnische Allgemeinbildende Oberschule absolviert hatte, begann er eine Berufsausbildung als Elektromonteur im VEB Kabelwerk Schöneweide.
Das Erste, was ihn an der Ausbildung maßlos störte, war das frühe Aufstehen, denn der Arbeitstag begann um sechs Uhr morgens und die Fahrt zum Betrieb dauerte eine Stunde. Deshalb musste er um vier Uhr aufstehen. Dann ging es zu nachtschlafender Zeit zum S-Bahnhof und wenn man Glück hatte, kam kurz darauf eine S-Bahn nach Schöneweide. Dort wäre es theoretisch möglich gewesen, mit der Straßenbahn bis vor das Fabriktor zu fahren, aber praktisch ging es nicht. In Schöneweide gab es viele große Betriebe, deren Frühschichten gleichzeitig um sechs Uhr begannen, weshalb die wenigen Straßenbahnen hoffnungslos überfüllt waren. Wie bei den Hamsterzügen nach dem Krieg hingen Menschen außen an den Waggons, weil sie im Innern keinen Platz mehr gefunden hatten, aber unbedingt fahren wollten. Lothar und seine Lehrlingskollegen zogen es daher vor, die 1500 Meter zu Fuß zurückzulegen.
Im Betrieb gab es Stempeluhren, die man morgens nach dem Umkleiden und abends vor dem Anziehen der Straßenkleidung zu betätigen hatte. Wer morgens zu spät stempelte, musste zum Lehrmeister, um sich zu entschuldigen, was stets mit ärgerlichen Diskussionen verbunden war. Hier musste Lothar lernen, dass die Wahrheit nicht immer die erste Wahl beim Entschuldigen ist, denn wenn zum Beispiel die S-Bahn ausgefallen war und er eine halbe Stunde am Bahnhof gestanden hatte, klang das für den Lehrmeister wie eine Ausrede und er entließ Lothar erst, als dieser zugegeben hatte, verschlafen zu haben, was gar nicht stimmte. Der Meister lief von seiner Wohnung aus fünf Minuten zur Arbeit und konnte sich nicht vorstellen, dass es bei der Deutschen Reichsbahn Unregelmäßigkeiten gab.
Überhaupt war der Lehrausbilder ein unangenehmer Mensch. Bei ihm konnte man wirklich sagen „nomen est omen“, denn er hieß Roland Rindvieh und benahm sich auch so. Einmal in der Woche hatten die Lehrlinge bei ihm Unterricht und dann versuchte er ihnen in schlechtem Deutsch und ohne die geringsten rhetorischen und didaktischen Kenntnisse die theoretischen Grundlagen ihres späteren Berufs zu erläutern. Herr Rindvieh formulierte seine Fragen meist derartig unverständlich, dass ihn die Lehrlinge nicht verstanden. Wenn sie sich darüber beklagten, diskutierte er nicht mit ihnen, sondern stellte für alle gut sichtbar ein Bein auf seinen Stuhl, zog das Hosenbein hoch und zeigte sein mit Geschwüren übersätes Raucherbein. Spätestens an dieser Stelle verstummten die Widerreden und alle waren seiner Meinung.
Vor allem an Montagen war Herr Rindvieh nicht mit Mostrich zu genießen, denn er schien total verkatert zu sein. Das äußerte sich nicht nur in schlechter Laune, sondern auch in seiner Licht- und Geräuschempfindlichkeit. Er verschwand dann irgendwohin und war den ganzen Tag über nicht mehr zu sehen.
Besonders ärgerte die Lehrlinge, dass ihre Arbeitszeit bis 14:30 Uhr dauerte, ihr Meister aber täglich um 14 Uhr den Heimweg antrat. Darauf angesprochen, erwiderte dieser, dass er Schichtarbeiter sei und die Frühschicht eben nur bis 14 Uhr ginge. Diese Logik konnten sie nicht nachvollziehen, denn er hatte ja immer nur Frühschicht und so glaubten sie nicht, dass man ihn als Schichtarbeiter bezeichnen konnte. Aus dieser Differenz ihrer Arbeitszeiten resultierte ein besonderer Tiefpunkt ihrer Beziehung. Als sie sich wie immer kurz nach 14 Uhr vom Arbeitsplatz verdrückten, um sich am Ufer der Spree in die Herbstsonne zu setzen, nachdem der Lehrausbilder gegangen war, kam dieser eines Tages noch einmal zurück, weil er wohl seine Zigaretten auf dem Schreibtisch vergessen hatte und so liefen sie ihm direkt in die Arme. Der Ärger hätte nicht größer sein können. Anstatt nun aber ebenfalls bis 14:30 Uhr zu bleiben, beauftragte er einen seiner Kollegen mit der Kontrolle seiner Schützlinge, die dieser auch mit großer Hingabe ausübte.
In den Pausen diskutierten sie oft über das Verhalten von Herrn Rindvieh und beschlossen schließlich, dass sie sich das nicht länger gefallen lassen wollten. Lothar Löwe wurde einstimmig zum Klassensprecher gewählt und hatte die undankbare Aufgabe, bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit den Meister mit der Meinung der Lehrlinge vertraut zu machen. Sie erwarteten, dass Herr Rindvieh sich danach anders verhalten würde.
Bei der nächsten Unterweisung meldete sich Lothar artig und ergriff das Wort. In einer kurzen Ansprache an den Lehrausbilder fasste er zusammen, was ihnen an dessen Art nicht gefiel. Herr Rindvieh war außer sich vor Zorn, dass jemand es wagte, ihn zu kritisieren und fragte die übrigen Lehrlinge, ob sie denn genauso dächten wie Lothar. Diese aber wanden sich wie Aale auf dem Trockenen und stotterten herum, dass sie es so nicht sagen würden, sodass Lothar am Ende der Buhmann war. Nach dem Unterricht beorderte ihn Herr Rindvieh in sein Büro und erzählte ihm einige Takte. Sein wohlwollender Schlusssatz war „Lothar, ich will Sie doch nur helfen.“
Eigentlich hätte er daraus lernen sollen, aber im Laufe seines Berufslebens setzte sich Lothar immer wieder für andere ein und erhielt oft die entsprechenden Quittungen. Mancher lernt es eben nie und dann noch unvollkommen.
Für Lothar gab es nicht nur während der Arbeitszeit völlig neue Erfahrungen. Auch außerhalb der Werktore musste er viel dazulernen.
An jedem Freitag bekamen die Arbeiter ihren Lohn und zum Feierabend gab es immer das gleiche Bild. Männer kamen aus dem Betrieb, Frauen stürmten auf sie zu und nahmen einen großen Anteil des Geldes aus der Lohntüte ihres Mannes. Die Frauen verschwanden dann wieder und die Männer gingen in die Gaststätte mit dem treffenden Namen „Feierabendheim“. Diese Kneipe hatte immer geöffnet, sodass auch Arbeiter nach der Spät- und Nachtschicht darin ihr Feierabendbier trinken konnten. Wahrscheinlich hatte so mancher Mann an dieser Stelle schon seinen gesamten Lohn versoffen oder verloren, weshalb deren Frauen ihnen das Kostgeld vorsorglich gleich abnahmen.
Jeden Nachmittag wälzten sich mehrere tausend Menschen gleichzeitig zum Bahnhof. Manche S-Bahn fiel aus und so entstand ein unglaubliches Gedränge auf den Bahnsteigen, wenn ein Zug einfuhr. Oft kam es zum Gerangel und man musste aufpassen, nicht unter die einfahrende S-Bahn gestoßen zu werden.
Selten schaffte es Lothar einen Sitzplatz zu ergattern. Dann schlief er sofort ein und hatte immer Angst zu weit zu fahren, aber mit der Zeit schaffte er es, sogar im Schlaf immer zu wissen, wo sich der Zug gerade befand, sodass er stets am richtigen Bahnhof aussteigen konnte.
Manchmal gab es jedoch auch besondere Ereignisse während der Fahrt, die ihn wachhielten und noch lange schmunzeln ließen. So saß eines Tages auf der Rückfahrt eine mollige Frau ihm gegenüber. Sie hatte einen großen Korb mit leckeren Erdbeeren auf dem Schoß. Lothar nahm an, dass sie mit ihrer Ernte von ihrem Kleingarten nach Hause fuhr. Kurz vor dem Bahnhof Leninallee stand sie auf und ging zur Tür. Lothar hörte, dass eine Tür geöffnet wurde, obwohl der Zug noch gar nicht angehalten hatte. Da die Türen während der Fahrt nicht verriegelt waren, sprangen viele sportliche junge Leute vor dem Stillstand des Zuges ab. Je schneller der Zug noch fuhr, desto schwieriger war es, nicht hinzufallen. Wichtig war, dass man in Fahrtrichtung sprang, sonst haute es einem unweigerlich die Beine weg. Als Lothar aus dem Fenster schaute, sah er die Dame, die ihm eben noch gegenübergesessen hatte, schnell rückwärts laufen. Dann fiel sie erst auf den Allerwertesten und kippte sodann auf den Rücken. Ihre Erdbeeren kullerten über den Bahnsteig, wo sie von den anderen aus- und einsteigenden Fahrgästen zertrampelt wurden, während sich die Gefallene mühsam hochrappelte.
Lustig war es auch immer, wenn ein Abteil vor allem in der Nacht ekelhaft verunreinigt worden war und leer blieb. An jedem Bahnhof stürmten Fahrgäste darauf los, weil sie die Hoffnung hatten, einen Sitzplatz zu ergattern. Die meisten stoppten rechtzeitig und wandten sich angeekelt ab, aber es gab auch immer wieder Trottel, die in den Dreck traten, um ihn dann im ganzen Waggon zu verteilen.
Am Arbeitsplatz gab es keine spannenden oder interessanten Momente, geschweige denn lustige Ereignisse. Im ersten halben Jahr wurden die Lehrlinge ausschließlich mit Metallbearbeitung gequält, die keinem von ihnen Spaß machte. Schließlich wollten sie keine Schlosser oder Schmiede, sondern Elektromonteure werden. Es war nicht nur schrecklich langweilig ständig zu feilen, sondern es ging auch gewaltig auf die Ohren, denn es quietschte furchtbar.
Der Abschluss dieser Ausbildungsphase bestand darin, aus einem riesigen Eisenblock einen Würfel mit der Kantenlänge 10 mm zu feilen. Wer fertig war, ging zum Lehrausbilder und zeigte seinen Würfel vor. Dann nahm der Meister im Normalfall eine Schieblehre, um die Kantenlänge zu messen und einen Stahlwinkel, um die Rechtwinkligkeit zu prüfen. In Abhängigkeit von der Maß- und Winkelgenauigkeit wurde die Zensur festgelegt. Als Lothar seinen Würfel abgab, warf der Lehrmeister diesen unbesehen in die Abfalltonne und gab Lothar in Metallbearbeitung eine 5, die damals die schlechteste Zensur war.
Nach der Grundausbildung wurden die Lehrlinge in die einzelnen Abteilungen des Betriebes versetzt. Da Lothar sich schon immer sehr für Physik und Elektrotechnik interessiert hatte und sich dies in der Berufsschule in Form guter Leistungen in den entsprechenden Fächern zeigte, wurde er im Prüffeld eingesetzt, wo solche Kenntnisse benötigt wurden.
An seinem neuen Arbeitsplatz wurde er vom Prüffeldleiter mit den Worten begrüßt, dass alle Mitarbeiter dieser Abteilung eine große Familie seien. Der Chef hieß Daniel Dachs und machte einen sehr einfachen Eindruck auf Lothar, jedenfalls was seine Ausdrucksweise betraf. Er sagte stolz, dass er Werksingenieur sei. Später erfuhr Lothar, dass dies wohl lediglich der Tatsache geschuldet war, dass Herr Dachs im Krieg aus gesundheitlichen Gründen nicht eingezogen worden war und weiter im Kabelwerk arbeiten durfte. Weil damals nur Männer als Chefs infrage kamen, hatte man ihn kurzerhand zum Werksingenieur gemacht. Dieser Titel galt nur innerhalb des Betriebes, aber Herr Dachs war offensichtlich trotzdem unheimlich stolz darauf.
Im Prüffeld begann eigentlich die tägliche Arbeitszeit um 6:40 Uhr, aber erst einmal saß Lothar jeden Morgen mit den neuen Kollegen und einer Kollegin in dem kleinen verqualmten Büro von Herrn Dachs zusammen, wo sie sich über Gott und die Welt unterhielten, während im Betriebsrundfunk die Sendung „Was ist denn heut' bei Findigs los“ lief. Ein Kollege namens Roland Rehbock erzählte allmorgendlich von seiner Sauftour am Vorabend und sah auch entsprechend kaputt aus. Er erzählte, dass er immer wieder versuchte, unbemerkt vom S-Bahnhof nach Hause zu kommen, aber stets stand der Wirt vom „Schluckspecht“ vor der Tür seiner Kneipe und schien keine große Überredungskunst zu benötigen, um Roland wieder bewirten zu können. Zur Belustigung aller zog sich Herr Rehbock nach Feierabend einen guten Anzug an und band sich einen Schlips um, denn in seinem Dorf gab er vor, Beamter zu sein, um mehr Anerkennung zu bekommen. Dass ihm das gelang, war eher unwahrscheinlich, wenn man an seine Sauftouren dachte. Außerdem gab es in der DDR gar keine Beamten und die meisten Menschen wussten das.
Ein anderer Kollege hieß Willi Wiesel. Er eignete sich unheimlich gut als Opfer von Streichen. Immer wieder legten ihn die anderen mit Bierflaschen rein, die sie im besten Fall mit Wasser gefüllt und dann wieder ordentlich verschlossen hatten. Sie lachten sich kaputt, wenn er daraus trank und alles im hohen Bogen ausspuckte. Die größte Gemeinheit aber war, dass sie ihm in seinen Tabakbeutel das Holz aus der Bleistiftanspitzmaschine füllten und er sich damit seine Pfeife stopfte und anzündete. Das Zeug brannte wie Zunder, sodass er sich beim ersten Zug fast die Nase verbrannte und als er über diesen Streich schimpfte, sah man, dass seine Zähne ganz blau waren, denn es waren auch Kopierstiftreste zwischen den Holzspänen, die er mit dem Rauch hochgezogen hatte.
Ein jüngerer Kollege hieß Detlef Delfin, duzte Lothar sofort und dieser durfte ihn auch duzen. Detlef hatte eine künstlerische Ader und sprach oft im Betriebsfunk die Nachrichten und andere Durchsagen, sodass er morgens häufig nicht bei den Kollegen saß.
Gegen sieben Uhr stand Herr Dachs regelmäßig auf und sagte: „Na, denn wolln wa mal!“ Dann standen die männlichen Mitarbeiter ebenfalls auf und verließen das Büro. Sobald sie draußen waren, setzte sich der Chef wieder hin und plauderte ungestört mit der jungen Kollegin, die zwar auch den Beruf des Elektromonteurs gelernt hatte, sich aber mit Büroarbeiten wohler zu fühlen schien. Sie hieß Sigrid Schlange, aber obwohl sie nur zwei Jahre älter war als Lothar, musste er sie mit Fräulein Schlange ansprechen und fand sie nicht nur deshalb sehr zickig.
Wenn die Kollegen sich nicht irgendwo verkrümelten, um den fehlenden Nachtschlaf nachzuholen, versammelten sie sich, um heimlich über Daniel Düsentrieb, wie ihn seine alten Kollegen nannten, herzuziehen. Sie amüsierten sich köstlich darüber, wie er das Weltgeschehen kommentierte, denn das klang so: „Also wat da in Vietmann und Kombatscha passiert, ist katerstropal!“ Er forderte auch ständig dazu auf, für die armen „Vietmannesen“ zu sammeln. Das Geld, so wusste er, würde nur für sanitäre Zwecke verwendet und man fragte sich, ob dafür Toilettenbecken und Wasserhähne gekauft würden. Auch die fachliche Qualifikation des Prüffeldleiters war Gegenstand von Hohn und Spott. Auf jeden Fall hatten sie immer viel zu lachen, wenn der Chef nicht dabei war und sie seine Verballhornungen genüsslich wiederholten.
Zum Glück wusste Lothar schon vorher, was eine Wheatstonesche Brücke ist und wie sie funktioniert. Mittels Daniel Dachs' Erklärung hätte er es ganz sicher nicht verstanden. Leider war das für diesen eine Wettschtensche Brücke und Lothar hatte später Mühe, sich diese falsche Aussprache abzugewöhnen.
Oft schwärmte der Chef von einer französischen Fremdarbeiterin. Sie hätte im Krieg in der Abteilung des Herrn Dachs gearbeitet und so wundervolle lange schwarze Haare gehabt, dass eines davon für das Haar-Hygrometer verwendet worden sei. Das Instrument mit dem französischen Haar hätte auch noch lange nach dem Krieg ganz genau die Luftfeuchtigkeit angezeigt, aber eines Tages sei eine neue Putzfrau gekommen, die es wohl für ihre Pflicht gehalten hatte, die Messinstrumente auch innen auszuwischen und dabei hätte sie das Haar zerrissen. Das mit einem deutschen Frauenhaar reparierte Gerät wäre nie mehr so präzise gewesen wie das ursprüngliche, ließ der Chef Lothar wissen und dieser fragte sich, woher Herr Dachs das eigentlich wissen konnte, da es in der näheren Umgebung doch gar kein Vergleichsinstrument gab. Lothar konnte sich gut vorstellen, dass Herr Dachs die beiden Haarhälften der Französin aus lauter Sentimentalität noch in irgendeiner Schatulle aufbewahrte.
Wie so viele Lehrlinge vor ihm, wurde auch Lothar gefoppt, indem ihn seine Kollegen mit einem sinnlosen Auftrag ins Lager schickten. Hätten sie ihn Gewichte für die Wasserwaage holen lassen, hätte er sicherlich gemerkt, dass sie ihn veralbern wollten. Aber sie gaben ihm den Auftrag, ein verstellbares Augenmaß mit Gummibacken zu besorgen, was er auch versuchte. Der Lagerist schüttete sich aus vor Lachen, als Lothar sein Anliegen vortrug.
Wenn der Chef länger abwesend war, gab es häufig ein für Lothar fremdes, aber erregendes Schauspiel. Fräulein Schlange hielt es nicht lange im Büro aus und ging schnellen Schrittes zu Detlef, mit dem sie sich als Einzigem duzte. Beide verzogen sich in eine Ecke des Prüffeldes, wo sie ihn neckte, bis er anfing, sie zu begrapschen. Anscheinend machte es den beiden nichts aus, dass die anderen Kollegen sich um sie versammelten und dabei zusahen und Detlef anfeuerten. Zuerst dachte Lothar, dass es Fräulein Schlange unangenehm sei, denn sie tat so, als wehre sie sich und er fühlte ein gewisses Mitleid mit ihr, aber bald begriff er, dass sie diese Fummelei genoss, sonst wäre sie nicht immer wieder zu Detlef gegangen, wenn der Chef abwesend war. Die Krönung der ganzen Angelegenheit war, dass Detlef sie mit Isolierband an einen Stuhl fesselte, was sie sich auch ohne große Gegenwehr gefallen ließ. Dann knöpfte er ihren Kittel auf, sodass man ihren Büstenhalter sah und legte schließlich zu Lothars ebenso großer Verwunderung wie Freude ihre Brüste frei. Allerdings war die Größe ihres nackten Busens im Vergleich zur verpackten Form ziemlich enttäuschend. So begriff der junge unerfahrene Mann schon früh, dass in diesem Bereich Schummeln möglich ist. Ebenso gewann er an dieser Stelle die wichtige Erkenntnis, dass brutto mehr als netto ist, denn da kommt ja noch Tara, die Verpackung hinzu.
Nachdem sich alle sattgesehen hatten, hörte Detlef auf zu fummeln und Sigrid Schlange befreite sich vom Isolierband, was ihr auch nicht schwerfiel, weil das Zeug gar nicht richtig klebte. Dann zog sie sich wieder an und ging zurück ins Büro.
Überhaupt fand an diesem ersten richtigen Arbeitsplatz der größte Teil von Lothars sexueller Aufklärung statt. Zu Hause war dieses Thema tabu und während der Schulzeit hatte er zwar von anderen Mitschülern einiges zum Thema Sex erfahren, aber es war nichts Fundiertes dabei gewesen. Die Mitschüler hatten eigentlich immer nur das von älteren Brüdern Gehörte nachgeplappert. Eigene Erfahrungen waren nicht vorhanden gewesen. Im Biologie-Unterricht waren genau 45 Minuten zum Thema Fortpflanzung vorgesehen und die waren so verlaufen, dass die Lehrerin am Anfang der Stunde gefragt hatte: „Gibt es noch Fragen zu diesem Thema?“ Als sich niemand gemeldet hatte, war sie aufatmend sofort zur nächsten Stoffeinheit übergegangen.
Lothars Kollegen nahmen dagegen kein Blatt vor den Mund und erzählten detailliert, was sie schon mit und ohne Frauen erlebt hatten oder vielleicht gerne erleben würden. Detlef brachte öfter sein Tonbandgerät mit und spielte amouröse Lieder von Helen Vita vor. Er hielt sich jedoch zurück mit eigenen Erlebnisberichten und Lothar dachte, dass er vielleicht auch noch zu jung für sexuelle Erfahrungen sei. Später erfuhr er, dass Detlef homosexuell war, was man zu dieser Zeit unter keinen Umständen öffentlich zugeben durfte, wollte man nicht der Ächtung seiner Umwelt anheim fallen. Lothar mochte ihn trotzdem, wunderte sich jedoch nachträglich über dessen Fummelei mit Fräulein Schlange. Vielleicht waren das Ablenkungsmanöver.
Überraschend bekam Herr Dachs den Nationalpreis dritter Klasse, weil er an irgendeiner bahnbrechenden Erfindung mitgemacht haben sollte. Nach Ansicht seiner Untergebenen konnte er jedoch eigentlich nur eine untergeordnete Rolle bei dieser Entdeckung gehabt haben. Am Tag nach der Ordensverleihung gab es eine Feier im Prüffeld und Herr Dachs wurde nicht müde den feierlichen Akt zu schildern und zu betonen, welche DDR-Politgrößen er dabei persönlich kennengelernt hatte. Er erwähnte die Herren Stohp und Ullrich und es war allen klar, dass er damit den Vorsitzenden des Ministerrates Willi Stoph und den Partei- und Staatschef Walter Ulbricht, genannt Spitzbart, meinte.
Großen Ärger gab es eines Tages, als ein Verlängerungskabel vom Amt für Messwesen zurückkam, wohin es zur Erlangung des Gütezeichens „Q“, wie Qualität eingereicht worden war. Es war vorher im Prüffeld von Herrn Dachs geprüft und für gut befunden worden. Nun stellte sich jedoch heraus, dass bei diesem Prüfmuster eine der drei Kupferadern fehlte, es also totaler Ausschuss war. Das Begleitschreiben des prüfenden Amtes war entsprechend negativ formuliert. Herr Dachs wurde vor Schreck krank und blieb einige Wochen zu Hause.
Eines Tages kamen Leute von der Presseabteilung der Firma und wollten für die Leipziger Messe eine Kabeltrommel samt Kabel fotografieren. Weil es keine ansehnliche Ecke im ganzen Prüffeld gab, die man als Hintergrund benutzen konnte, musste eine weiße Wand geschaffen werden. Dazu stellten die Kollegen mehrere Schränke vorübergehend beiseite, dann war eine Wand frei. Sie war jedoch schmutzig grau, weshalb sie weiß getüncht wurde. Nun wurde vor diesem Hintergrund die Kabeltrommel fotografiert und die Presseleute verschwanden wieder.
Zur Verwunderung der Kollegen gab es einen Wasserhahn, den sie auf diese Weise freigelegt hatten, nachdem er wohl eine Ewigkeit in einem Dornröschenschlaf hinter einem Schrank verbracht hatte. Herr Dachs meinte sich daran zu erinnern und wollte den Hahn aufdrehen, nachdem er einen Eimer daruntergestellt hatte. Wie bei derartig langer Nichtbenutzung zu vermuten gewesen war, ließ sich der Wasserhahn nicht bewegen. Herr Dachs ließ den Lehrling Löwe geeignetes Werkzeug holen, um dann unter Zuhilfenahme einer großen Zange zu versuchen den Hahn aufzudrehen. Nachdem er sich eine Weile vergeblich bemüht hatte, gab das alte Bleirohr plötzlich nach und das Wasser floss, während der Wasserhahn in den Eimer fiel. Es spritzte in alle Richtungen aus dem Rohrstummel und alle Umstehenden wurden nass. Das wäre nicht so schlimm gewesen, wenn das Wasser nicht ganz furchtbar nach faulen Eiern gestunken hätte. Im Laufe der letzten Jahrzehnte hatte sich in diesem unbenutzten Rohrende offensichtlich einiges an Fäulnis angesammelt. Nachdem endlich jemand den Haupthahn gefunden und abgedreht hatte, versiegte der Wasserfluss. Dann jedoch kam der nächste Schock für die Kollegen, denn sie konstatierten, dass sie die ganze Zeit Wasser aus derselben Leitung für Tee und Kaffee verwendet hatten. Es war sehr unwahrscheinlich, dass sie nicht auch etwas von den Keimen abbekommen hatten. Nachträglich fiel es ihnen auch auf, dass ihre Getränke immer sehr eigenartig schmeckten.
Zur praktischen Facharbeiterprüfung wollte Herr Rindvieh, der immer noch für die Lehrlinge zuständig war, anscheinend seinem Lieblingslehrling Lothar Löwe eins auswischen. Er schickte ihn in das Hochspannungsprüffeld, um ihn dort einen Test durchführen zu lassen. Weil Lothar jedoch noch nie im Hochspannungsbereich gewesen war, machte er einen gravierenden Fehler und konnte am Ende froh sein, lebend wieder herausgekommen zu sein. Damit war die Prüfung zu Ende und Lothar war durchgefallen.
Herr Dachs kommentierte dieses ärgerliche Ereignis mit den Worten: „Da is nich wat in Ordnung.“ Für Lothar einsetzen wollte oder konnte er sich aber auch nicht, obwohl er genau wusste, dass er mit ihm nie das Verhalten im Hochspannungsprüffeld geübt hatte. Vielmehr hatte er Lothar fast immer nur Kabel abisolieren und deren elektrischen Widerstand messen lassen.
Nachdem Lothars erste Wut abgeklungen war, überlegte er, was er machen könnte. Es fiel ihm ein, dass er noch nicht 18 Jahre alt war und demzufolge gar nicht mit Hochspannung arbeiten durfte. Das war auch der Grund, warum er bei der Prüfung so unerfahren in die Falle getappt war. Als er sich beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses beschwerte, fiel der aus allen Wolken. Er ordnete an, dass die unzulässige Prüfung annulliert wurde und Lothar eine andere praktische Prüfung machen durfte.
Diese meisterte Lothar eine Woche später mit sehr gutem Ergebnis. Herr Rindvieh war nicht mehr dabei und man hörte, dass er als Lehrausbilder abgesetzt worden war. Das war zwar für Lothar zu spät, freute ihn jedoch für die nächsten Lehrlinge.
Bei einem Genie
Nach der Lehre bewarb sich Lothar im Forschungslabor desselben Betriebes, denn das Prüffeld und Herr Dachs gingen ihm zu sehr auf den Geist. Er wurde auch wirklich angenommen und dem Chemiker Dr. Manfred Marder als Laborant zugeteilt. Der neue Chef machte einen sehr gebildeten Eindruck und sagte ihm gleich zu Anfang, dass alle Mitarbeiter des Labors eine große Familie seien.
Lothar freute sich, dass er eine offenbar nette Kollegin hatte, die aber sehr ruhig war, wie er bald feststellte. Man konnte sich kaum mit ihr unterhalten, denn sie antwortete auf Fragen nur sehr kurz. Spaß verstand sie überhaupt nicht, sodass er nach einer Weile keine Witze mehr machte und nur noch das dienstlich Notwendige mit ihr besprach.
Lustig dagegen war es mit Theodor Tintenfisch, dem Hausmeister, der vor allem durch seinen Dialekt auffiel, den Lothar bis dahin nur aus dem Komödienstadel im Westfernsehen kannte. Auf die Frage, woher er käme, antwortete Herr Tintenfisch: „Aus Übersee.“ Nun war man ja in der DDR nicht gut über Westdeutschland und seine Bundesländer informiert, aber dass Bayern auf dem Landweg zu erreichen war, wusste Lothar genau und hielt die Antwort deshalb für einen weiteren Witz des Bayern. Herrn Tintenfisch hatte es aus irgendwelchen Gründen von seiner schönen bayerischen Heimat in die DDR verschlagen, aber im Gegensatz zu den Eingeborenen nahm er nicht alles, was passierte, widerspruchslos hin, sondern grantelte lautstark über jeden vermeintlichen Missstand. Er hatte ständig einen erloschenen Zigarrenstummel im Mund. Was immer er sagte, es klang furchtbar lustig und Lothar freute sich von Dienstbeginn an darauf, dass der Hausmeister das Labor mit Trockeneis, flüssigem Stickstoff und einer Flasche Milch pro Person belieferte. Die Milch bekamen die Mitarbeiter zur Erhaltung ihrer Gesundheit, weil sie bei ihrer Arbeit mit giftigen Stoffen umgehen mussten. Trockeneis ist sehr kaltes, festes Kohlendioxid. Es wurde in einem Dewar (eine Art Thermosflasche) geliefert und zum Kühlen exothermer chemischer Prozesse gebraucht. Was nicht verbraucht wurde, verdampfte einfach über Nacht, denn Kohlendioxid geht vom festen direkt in den gasförmigen Zustand über, was man sublimieren nennt. So könnte man die Redewendung „Die Kacke ist am Dampfen“ auch vornehmer ausdrücken, indem man sagt: „Das feste Exkrement sublimiert gerade.“
Der flüssige Stickstoff war noch kälter als das Trockeneis und wurde zum Ausfrieren bestimmter chemischer Substanzen verwendet.
In seiner neuen Tätigkeit musste Lothar Versuchsanordnungen nach Anweisung des Chefs aufbauen, an denen dann seine Kollegin Messreihen durchzuführen hatte. Das klingt im ersten Moment einfach, war aber gar nicht so leicht zu bewerkstelligen, denn Dr. Marder war ein Genie und setzte nicht nur dieselbe Fähigkeit bei seinen Mitarbeitern voraus, sondern darüber hinaus auch die Gabe, seine Gedanken lesen zu können. Er hielt nichts von Zeichnungen oder wenigstens Skizzen, sondern erwartete, dass man seine Geistesblitze sofort vollständig durchdrang und in die Realität umsetzte. Dieses Ansinnen scheiterte meist an Lothars offensichtlicher Begriffsstutzigkeit und manchmal daran, dass bestimmte Dinge einfach nicht möglich waren. Der Chef aber beharrte auf seiner Idee und machte Lothar und dessen Unfähigkeit für das Scheitern verantwortlich. Der Institutsglasbläser hatte den Begriff „der ganz einfache Mardersche Siebenwegehahn“ geprägt, der sehr gut die Ideenwelt des Dr. Marder charakterisierte, ging dieser doch von dem Motto aus: „Geht nicht, gibts nicht!“
Nach und nach merkte Lothar, dass sein Chef in der gesamten Forschungsabteilung sehr unbeliebt war, denn er hörte, dass fast alle anderen Laboranten schon bei diesem gearbeitet hatten, dann aber so schnell wie möglich zu anderen Chefs geflüchtet waren. Dabei spielte nicht nur Dr. Marders Umgang mit seinen Untergebenen eine Rolle, sondern auch die Gefährlichkeit der Arbeit bei ihm. Obwohl der Wissenschaftler schon etliche Ermahnungen und Verweise bekommen hatte, missachtete er weiterhin die meisten Arbeitsschutzvorschriften.
Nachdem der Glasbläser sich wieder einmal geweigert hatte, sah sich Dr. Marder zum wiederholten Mal genötigt, die Gasflaschen nebst Brenner und Schläuchen in sein Labor zu holen. Dann stellte er sich auf Lothars Bürostuhl und begann eines der Glasrohre einer Versuchsanlage zu erhitzen, um es in eine andere Richtung biegen zu können. Lothar fragte ihn, ob das nicht gefährlich sei, denn in den Röhren befand sich reiner Wasserstoff. Dr. Marder lachte nur mitleidig über diese dumme Frage und erklärte dem Unwissenden, dass die Gefahr einer Knallgasexplosion nur dann bestünde, wenn Wasserstoff und Sauerstoff zusammenträfen, was er selbstverständlich bei seiner Arbeit verhindern würde.
Trotzdem ging Lothar während des Glasblasens lieber aus dem Labor auf den Gang hinaus, was von Dr. Marder mit höhnischem Lachen quittiert wurde. Während er die Tür hinter sich schloss, suchte er sich vorsorglich schon mal einen Fluchtweg und schnappte sich einen Feuerlöscher, für den Fall, dass es zu einem Brand kommen sollte.
Es dauerte gar nicht lange, da krachte es tatsächlich ganz gewaltig im Labor. Als Lothar die Tür vorsichtig einen Spalt weit öffnete, sah er Dr. Marder ziemlich bedeppert auf dem Stuhl stehen, den Brenner in der Hand, aber die Apparatur, an der er gerade gearbeitet hatte, lag pulverisiert im ganzen Labor verteilt. Ihm war anscheinend außer einem Schreck und vielleicht einem Knalltrauma nichts passiert und er begann sofort zu erklären, warum es zu dieser Explosion gekommen war. Er endete mit dem Satz „Da wirkte eben wieder das Gesetz von der maximalen Sauerei“, dann stieg er vom Stuhl.
Aufgeschreckt von dieser Explosion kamen viele Kollegen aus ihren Labors und schauten, was passiert sei. Der Arbeitsschutzobmann war auch dabei und schimpfte: „Mensch Manfred, du weißt doch, dass du kein Glas blasen darfst, solange noch Wasserstoff in den Röhren ist!“ Doch Dr. Marder war schon wieder obenauf und erwiderte, dass er ja den Vorschriften Genüge getan und eine Schutzbrille getragen hätte. Zu seinem Glück war die Explosion unterhalb seines Kopfes geschehen, weshalb tausende von Glassplittern in seine Kitteltaschen geflogen waren. Lediglich die Unterarme waren ganz leicht lädiert, das Gesicht aber war unversehrt geblieben. Am meisten ärgerte er sich wohl darüber, dass nun die gesamte Versuchsanordnung noch einmal aufgebaut werden musste, was viel Zeit kosten würde.
Immer wieder verwickelte der Chef Lothar in politische Diskussionen, bei denen dieser nur verlieren konnte, denn Dr. Marder war der Parteigruppenorganisator der Forschungsabteilung. Unter Partei verstand man in der DDR automatisch die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, kurz SED. Dr. Marder war als Parteigenosse auch Mitglied der Kampfgruppe des Betriebes und es war ein Bild für Götter, wenn er mit seinen Genossen Kämpfern auf dem Hof marschierte. Mit seiner linkischen Gangart brachte er den ganzen Zug außer Tritt und schließlich ins Stolpern. Lothar sollte eine solche Art zu gehen erst viele Jahre später wieder sehen, und zwar bei Mr. Bean.
Wenn Dr. Marder mit seinen Genossen in seinem Zimmer zusammensaß und diskutierte, schloss er jedes Mal die Tür zum Labor, wahrscheinlich um ungestört über den weiteren Aufbau des Sozialismus zu beraten. Verwundert stellte Lothar fest, dass der Chef von Zeit zu Zeit die Tür unvermittelt aufriss, wohl um zu überprüfen, ob jemand lauschte.
Oft holte sich Dr. Marder Bücher und Fachzeitschriften aus der Bibliothek des Betriebes, die er dann aufgeschlagen auf seinem Schreibtisch liegen ließ. Weil er ständig vergaß, sie wieder zurückzubringen, wurde der Stapel immer höher und das Chaos war bald perfekt. Seine Devise war „Nur Dumme halten Ordnung, das Genie überblickt das Chaos“.
Wenn die anderen zum Mittagessen in die Kantine gingen, saß er in seiner sogenannten Denkzelle und las in einem seiner Fachbücher. Da jedoch auch er menschliche Bedürfnisse hatte, ließ er sich hin und wieder etwas Essbares aus der Kantine mitbringen. Das konnte ein Stück Kuchen sein oder auch mal eine Bockwurst.
Die Putzfrau Frieda Flunder sorgte täglich dafür, dass die Institutsmitarbeiter nicht im Schmutz umkamen. Daran, dass es im Zimmer von Dr. Marder schlecht roch, hatte sie sich genauso gewöhnt wie Lothar und seine Kollegin. Ihr Chef schien es mit der Hygiene nicht so genau zu nehmen und verbreitete einen unangenehmen Geruch, wo immer er auftauchte. Allerdings fiel es Frau Flunder auf, dass es in der Denkzelle von Dr. Marder täglich mehr stank und zwar nach Fisch. Das hatte Lothar auch schon bemerkt, aber er hatte einfach so oft wie möglich die Verbindungstür zwischen den beiden Räumen geschlossen. Die gute Frieda wollte der Sache jedoch auf den Grund gehen, denn es schien gegen ihre Berufsehre zu verstoßen, dass es in einem Raum, in dem sie putzte so stank. Wenn Dr. Marder anwesend war, ließ er die Putzfrau nicht in sein Zimmer. Als er jedoch einen freien Tag hatte, war Frieda nicht mehr zu halten und suchte nach der Quelle des Übels. Die fand sie schließlich unter etlichen Büchern und Zeitschriften in Form eines in durchtränktes Zeitungspapier gewickelten Bratherings, den er offenbar als Lesezeichen benutzt hatte. Sie entsorgte diesen umgehend und alle waren gespannt, was Dr. Marder am nächsten Tag dazu sagen würde. Er sagte gar nichts. Entweder hatte er den Verlust überhaupt nicht bemerkt oder er war zu stolz, diesen Fehler einzugestehen.
Immer wieder ärgerte sich Lothar, dass Dr. Marder seine Kollegin seine beste Mitarbeiterin nannte, sie aber niemals zu irgendwelchen handwerklichen Tätigkeiten heranzog, bei deren Erledigung man nur Fehler machen konnte. Die Anforderungen an Lothars handwerkliche Fähigkeiten waren dagegen sehr hoch und Dr. Marder war stets sehr ungehalten, wenn etwas gar nicht oder nicht nach seinen Vorstellungen ausgeführt wurde. So wies er Lothar einmal an, Ringe aus Goldblech nach den von ihm gegebenen Maßen anzufertigen. Er sollte sie so zusammenschweißen, dass die Schweißnaht nicht zu sehen war. Dazu bekam er einen vom obersten Chef der Forschungsabteilung unterzeichneten Bestellschein, mit dem er im Lager ein 10 cm2 großes und 1 mm dickes Blech aus reinstem Gold erhielt.
Zurück im Labor begann Lothar das Gold mit einer Blechschere in Streifen zu schneiden, die er dann mithilfe eines Reagenzglases zu einem Ring bog. Nun musste er nur noch die Enden miteinander verschweißen, dann war die Aufgabe erledigt - dachte er. Leider hatte er jedoch keine Erfahrung mit Schweißen und mit der Goldbearbeitung schon mal gar nicht. Als er den ersten Ring an der Schnittstelle erhitzte, wollte das Gold zuerst überhaupt nicht weich werden, um dann urplötzlich in den flüssigen Aggregatzustand überzugehen und auf den Tisch zu tropfen. Aus dem Ring war ein unförmiger Klumpen Gold geworden, den man nicht mehr gebrauchen konnte. Genauso erging es Lothar bei den nächsten fünf Versuchen, bis er endlich gelernt hatte, wie lange er den Brenner an die Nahtstelle halten musste, damit sich die beiden Enden miteinander verbanden, ohne zu zerfließen. Schließlich gelang es ihm, aus knapp der Hälfte des vorhandenen Goldes vier Ringe der gewünschten Qualität herzustellen. Weil er Ärger befürchtete, wenn Dr. Marder die Menge an Ausschuss zu sehen bekäme, steckte er die Goldklumpen vorsichtshalber in seine Tasche. Dr. Marder freute sich später über die Ringe und fragte nicht ein einziges Mal nach dem restlichen Gold.
In dieser Zeit lernte Lothar viele Dinge, von denen er einige auch noch im späteren Leben gebrauchen konnte. Unter anderem war er dafür zuständig, Fotokopien von wissenschaftlichen Büchern und Zeitschriften anzufertigen. Dazu musste er jedes Buch unter eine Kamera legen, die am oberen Ende eines Stativs befestigt war, um dann jeweils zwei Seiten auf einmal zu fotografieren. Danach entnahm er den Film, entwickelte ihn in der Dunkelkammer und machte dann auch dort Vergrößerungen auf Fotopapier. Das waren Prozesse mit mehreren Chemikalien in vielen verschiedenen speziellen Gefäßen. Die notwendigen Arbeitsgänge hatte Lothar schnell erlernt und war bald ein so virtuoser Fotolaborant, dass ihm die Kollegen aus anderen Labors ihre Urlaubsfotos zum Entwickeln und Vergrößern anvertrauten. So war auch ein Film seiner Kollegin Christine Chinchilla aus dem Nachbarlabor dabei. Er verbrachte seine Pausen meist mit ihr, denn sie war nett und er mochte sie nicht nur deswegen sehr gern, weil sie besonders große Brüste hatte und nichts dagegen zu haben schien, wenn er ihr beim Bücken in den Ausschnitt ihres Kittels schaute, den sie zum Glück nie bis oben schloss. Nachdem er den Film entwickelt hatte, haute es ihn fast um, denn es waren Aufnahmen von ihr an einem FKK-Strand. Als er die Schwarz-Weiß-Fotos zum Trocknen aufgehängt hatte, konnte er sich kaum sattsehen. Entgegen seiner ersten Erfahrung mit nackten Brüsten im Prüffeld, war bei ihr kein wesentlicher Unterschied zwischen Brutto und Netto zu erkennen, aber das überraschte ihn nicht, denn er hatte eigentlich schon durch seine Einblicke in ihren Kittel festgestellt, dass alles echt war. Einen kurzen Augenblick kämpfte er mit der Versuchung, noch ein paar Abzüge für sich anzufertigen, aber das wäre ein großer Vertrauensbruch gewesen, und er hätte ihr nicht mehr in die Augen sehen können. Deshalb unterließ er es und genoss nur den momentanen Anblick. Als die Bilder trocken waren, übergab er sie ihr in einem verschlossenen Briefumschlag, weil er sie nicht in Verlegenheit bringen wollte. Sie jedoch packte die Fotos sofort aus und schaute sie sich mit ihm zusammen an, ohne dass es ihr peinlich zu sein schien. Lothar hatte bisher nichts von der Existenz von FKK-Stränden gewusst, schloss aber nun für sich persönlich aus, dort jemals hinzugehen. Christine bewunderte er umso mehr.
Zur Bereitung seiner Getränke bediente sich Lothar auf Anraten von Christine der reichlich vorhandenen Chemikalien. Er löste Zitronensäure und Rohrzucker in einem Glas Wasser auf und gab im Sommer noch ein Stück Trockeneis hinzu, um das Gebräu zu kühlen und Kohlensäurebläschen zu erzeugen. Wenn ihm das Ganze nicht kalt genug war, hielt er seine Tasse vorsichtig mithilfe einer Laborklemme in flüssigen Stickstoff, der dann wie wild anfing zu kochen und die Tasse abkühlte. Er musste sie nur rechtzeitig wieder entfernen, sonst wäre sein Getränk gefroren. Flüssiger Stickstoff hat nämlich eine Temperatur von minus 196° Celsius.
Zwar war er belehrt worden, das Trockeneis nur mit Asbesthandschuhen anzufassen, denn es sei so kalt, dass man sich daran regelrecht Verbrennungen zuziehen könne. Als er jedoch wieder einmal allein im Labor war, wollte er sich die Asbesthandschuhe sparen und fasste den kalten Kohlendioxidwürfel mit zwei Fingern an, um zu testen, ob er wirklich so kalt war. Das schien jedoch nicht der Fall zu sein und so nahm er den Brocken beherzt in beide Hände, um ihn vom Transportgefäß in den laboreigenen Dewar zu befördern. Es handelte sich dabei um höchstens zwei Meter Luftlinie, aber auf halbem Weg passierte es. Es zischte kurz, dann taten Lothar alle zehn Fingerkuppen gleichzeitig weh. Vor Schmerz ließ er den Eisblock fallen, sodass dieser beim Aufprall in viele Teile zersprang, die über den Fußboden rasten, wo sie bald verdampft sein würden. Er kühlte seine Finger unter der Wasserleitung, denn der Schmerz war so, als hätte er sich tatsächlich verbrannt. Dann grübelte er, wie das möglich gewesen war, hatte er doch vorher extra mit zwei Fingern getestet.
Weil Lothar an diesem Tag allein im Labor war, ging er nach nebenan zu Christine, um ihr von seinem Missgeschick zu erzählen. Nachdem sie ihn bedauert und seine Finger notdürftig behandelt hatte, erklärte sie ihm, warum das passiert war. Sie war nämlich gelernte Chemielaborantin und wusste, dass er Opfer des Leidenfrost-Effekts geworden war, der Lothar bis dahin noch unbekannt gewesen war. Allerdings hatte er schon das Gefühl, dass er hier ein Leiden durch Frost bekommen hatte. Sie erklärte jedoch: „Wenn ein Tropfen Wasser auf eine heiße Herdplatte fällt, dann rast der darauf herum, wie verrückt, denn es bildet sich zwischen Tropfen und Kochplatte eine Dampfschicht, die die Reibung vermindert. Genauso war das eben bei dem Trockeneisblock. Du hast kurz angefasst und dabei hast du Trockeneis verdunstet, sodass deine Finger und der Block kurzzeitig voneinander isoliert waren, aber dann wurden die Finger kalt und das feste Kohlendioxid kam direkt an deine Haut. Tut es sehr weh?“ Er schüttelte tapfer den Kopf, obwohl es sich schon sehr unangenehm anfühlte. Sie gingen nach nebenan in sein Labor, denn er musste unbedingt das heruntergefallene Trockeneis aufsammeln, da er es für die Versuche benötigte. Wegen seiner lädierten Finger tat Christine das für ihn und als sie sich dazu sehr tief bückte, spürte er die Schmerzen in seinen Fingern überhaupt nicht mehr.
Das Jahr neigte sich seinem Ende entgegen und es begannen die Vorbereitungsarbeiten für die Weihnachtsfeier – oder die Jahresendfeier, wie Dr. Marder und seine Genossen sie nannten. Da die Kollegen meinten, das Wichtigste daran seien die alkoholischen Getränke, galt es den Alkohol dafür zu beschaffen. Um das Fest nicht unnütz zu verteuern, musste Lothar einen Bestellschein über fünf Liter Brennspiritus vom Forschungsdirektor persönlich unterzeichnen lassen, denn nur dieser hatte die Berechtigung dazu. So zog Lothar mit einem Handkarren zum Chemikalienlager am anderen Ende des Betriebsgeländes und durfte einen Glasballon mit der gewünschten Flüssigkeit abholen.
Die Chemiker der Abteilung sahen es als Herausforderung an, aus dem vergällten Alkohol trinkbaren zu machen. Sie betrieben einen großen Aufwand, aber das Ergebnis war schlecht – der Alkohol blieb ungenießbar. Nun war guter Rat teuer, denn vom Forschungsdirektor würden sie ganz sicher keine Unterschrift für fünf Liter unvergällten Sprit erhalten, aber kaufen wollte auch niemand so viel Alkohol, der ja bekanntermaßen versteuert und deshalb teuer war. Die Zeit drängte, denn das Fest rückte näher.
Mit dem Mut der Verzweiflung rief einer der Chemiker im Lager an und bekam die Auskunft, dass tatsächlich reiner Alkohol vorrätig sei und zu seiner größten Überraschung wurde ihm gesagt, dass zu dessen Bezug ein einfacher Bestellschein mit Unterschrift eines beliebigen Mitarbeiters der Forschungsabteilung reiche. So schnappte Lothar sich erneut den Handwagen sowie einen Blanko-Bestellschein und holte aus dem Lager einen Glasballon mit reinstem Alkohol. Den Bestellschein unterschrieb er selbst, genau wie den Lieferschein.
Nun stand der Feier nichts mehr im Wege. Ein Weihnachtsbaum wurde besorgt und geschmückt und bei der Drehorgelfabrik Pascotto am Bahnhof Schönhauser Allee war eine Drehorgel zur Ausleihe bestellt worden. Als Lothar und sein Kollege dort sagten, dass sie den Leierkasten abholen wollten, war Frau Pascotto verärgert und belehrte ihre Kunden, dass es sich bei besagtem Gerät um eine künstlerisch wertvolle Drehorgel handele, bei der der Begriff „Leierkasten“ völlig fehl am Platz sei.
Der Transport des Gerätes in der S-Bahn erregte einige Aufmerksamkeit und sie wurden von den übrigen Fahrgästen einige Male aufgefordert zu spielen. Das taten sie auch und bemerkten dabei, dass es gar nicht so einfach war, das richtige Tempo beim Drehen einzuhalten. Außerdem taten ihnen hinterher die Arme weh. Sie begriffen somit, dass die häufig an Bahnhöfen spielenden Leierkastenmänner sich ihr bisschen Geld mühselig verdienten und keineswegs im Handumdrehen, wie es immer gesagt wurde.
Die Weihnachtsfeier begann schon am Nachmittag mit Kaffee trinken, Stollen essen und Julklapp. Lothar bekam einen hässlichen alten Kerzenhalter und er nahm sich sofort vor, diesen bei nächster Gelegenheit weiter zu verschenken. Er selbst war extra in einen Kunstgewerbeladen gegangen, um einen teuren Brieföffner in Form eines kleinen Säbels zu kaufen, was ihm jetzt in Anbetracht seiner knappen Finanzen und seines erhaltenen Geschenks leidtat.
Als der gemütliche Teil des Abends begann, wurde ein Riesengefäß mit Bowle in den Festsaal geschleppt. Diese Arbeit übernahm der Hausmeister Theodor Tintenfisch, dem leider beim Absetzen des Gefäßes ein kleines Missgeschick passierte, indem ihm sein vollgesabberter Zigarrenstummel aus dem Mund in die Bowle fiel. Obwohl einer der Umstehenden geistesgegenwärtig die Schöpfkelle nahm und den Fremdkörper samt umgebender Flüssigkeit entfernte, hatte keiner mehr Lust auf Bowle.
Zum Glück reichte der Alkohol auch noch zur Herstellung anderer Getränke, sodass niemand nüchtern bleiben musste, der es nicht wollte. Es gab verschiedene Fruchtsirups, die nach Wunsch mit dem Alkohol gemischt wurden. Lothar verlor mit zunehmendem Alkoholpegel die Hemmungen und unterhielt sich recht angeregt mit dem rumänischen Gast seines Chefs. Er sprach plötzlich fließend englisch und war selbst verblüfft, wie viel er bei der BBC gelernt hatte, deren Englischkurse er so oft wie möglich gehört hatte. Der Dialog mit dem Besuch aus Rumänien war interessant, denn dort hatte man offenbar eine ganz andere Meinung zu Fragen der Weltpolitik als die Genossen in der DDR. Ab und zu kam Dr. Marder zu ihnen und sprach mit seinem Gast einige Sätze auf Russisch, dann verschwand er wieder. Lothar schien ihm wohl als Betreuer des ausländischen Gastes gut geeignet zu sein und er hatte mehr Zeit sich mit seinen Genossen über den richtigen Weg zum Sozialismus zu einigen.
Nach dem sechsten Kirschschnaps wurde der Hausmeister noch gesprächiger als sonst und erzählte, dass er jeden Abend durch das Haus gehe, um nachzusehen, ob noch jemand in den Räumen sei, denn er wollte natürlich niemanden einschließen. Deshalb rufe er auch in die Toilettenräume hinein: „Ist hier jemand?“ Einmal habe jemand geantwortet: „Nein, im Gegenteil.“ Abgesehen von diesem Wortspiel hätte es aber tatsächlich eine Kollegin gegeben, die recht beleibt war, aber stets behauptete, das sei eine Stoffwechselstörung, denn sie esse doch kaum etwas. Eines Tages hätte man sie jedoch dabei erwischt, wie sie mit einem fetten Tortenstück in der Toilette verschwunden sei und nach einer Weile mit dem leeren Teller wieder herausgekommen wäre. Sie behauptete zwar, sie hätte die Torte ins Klo geworfen, was aber nicht sehr glaubhaft war, da sie noch Creme an Mund und Nase gehabt hätte.
Als Kommunist war Dr. Marder selbstverständlich auch überzeugter Atheist und kurz vor den Feiertagen, brachte er seinen Unmut darüber zum Ausdruck, dass es in einem sozialistischen Staat Weihnachtsfeiertage gab. Zu seiner Freude war wenigstens Heiligabend ein Arbeitstag und während in allen anderen Labors die Kollegen bei Kerzenschein und Spekulatius zusammensaßen, hatte sich Lothars Chef für seinen Mitarbeiter eine besonders große und schwere Aufgabe vorgenommen. Er wollte eine riesige Versuchsapparatur von einem Labortisch auf einen anderen umgesetzt haben. Der Kollegin hatte er großzügig Urlaub gegeben, weshalb Lothar allein diese Aufgabe bewältigen musste.
So schuftete der Ärmste von morgens bis zum Feierabend im wahrsten Sinne des Wortes im Schweiße seines Angesichts und als er um 17 Uhr damit fertig war, entließ ihn Dr. Marder gnädig in die Feiertage. Als Lothar erschöpft über den Flur schritt, bemerkte er, dass alles ganz ruhig war und die anderen schon längst Feierabend gemachte hatten.
Zum Beginn des nächsten Jahres ging es darum, die gemessenen Werte in einer geeigneten Weise aufzubereiten, denn Dr. Marder hatte die Absicht, die Ergebnisse seiner Arbeit in einer Fachzeitschrift zu veröffentlichen und beim nächsten Kolloquium zu präsentieren. Dazu wollte er sich der gerade aufkommenden Computertechnik bedienen, um eine sogenannte Ausgleichsgerade berechnen zu lassen. Zu diesem Zweck musste Lothar eine Nacht damit verbringen, die Messwerte mithilfe eines Fernschreibers in einen Lochstreifen aus Papier zu übertragen. Das war leichter gesagt als getan, denn die Eingabe der Zahlen von Dr. Marders handgeschriebenen Tabelle machte bei dem hohen Lärmpegel, den der Fernschreiber erzeugte und der zunehmenden Müdigkeit Lothars einige Probleme. So konnte er manche Zahlen nicht lesen und andere gab er vermutlich mehrmals oder gar nicht ein. Am nächsten Morgen verließ er halbtot den Fernschreibraum mit dem langen Lochstreifen, der wie eine Papierschlange zu Silvester aussah und ging in das Allerheiligste. Es handelte sich dabei um einen großen klimatisierten Raum, in dessen Mittelpunkt eine riesige Maschine stand, die als R 300 bezeichnet wurde und der modernste Computer der DDR war. Von einem der beiden Bediener wurde der Lochstreifen eingelegt und der Rechner begann ihn einzulesen. Leider dauerte es nur wenige Sekunden, dann stockte der Prozess und mehrere Warnlämpchen leuchteten rot. Der Computer prüfte die Plausibilität der eingegebenen Zahlen und war an dieser Stelle offenbar auf einen Fehler gestoßen. Wahrscheinlich hatte Lothar nicht die richtige Reihenfolge eingehalten und X- und Y-Wert vertauscht. Also entfernte der Computerfachmann den Streifen wieder aus der Maschine und stanzte an einer Stelle einfach fünf Löcher. Der Bediener erklärte Lothar, dass damit dieser Wert annulliert worden sei. So ging es den ganzen Vormittag weiter und immer mehr von Lothars mühsam eingegebenen Zahlen wurden eliminiert, bis die Aktion am Ende abgebrochen werden musste.
Als Lothar mit diesem schlechten Ergebnis zu Dr. Marder kam, war der sehr ungehalten und verlangte, dass Lothar in der nächsten Nacht erneut die Messwerte am Fernschreiber eingab, was für diesen allerdings eine ziemliche Zumutung war, denn er war nach der letzten Nachtarbeit hundemüde und wollte nur noch ins Bett. So gab er vor, krank zu sein und wurde von seinem Chef nach Hause geschickt. Vom Arzt seines Vertrauens ließ er sich dann für zwei Wochen krankschreiben.
Dr. Marder musste somit in mühevoller Handarbeit seine Ausgleichsgerade selbst berechnen und schimpfte auf die EDV und seinen unfähigen Mitarbeiter Löwe, während dieser wie gewohnt viermal in der Woche die Abendschule besuchte, um das Abitur zu machen. Das war ihm auf andere Weise verwehrt worden, weil er nicht der Freien Deutschen Jugend angehörte, nicht drei Jahre oder mehr zur Volksarmee gehen wollte und auch sonst einen politisch unzuverlässigen Eindruck machte.
Als das Kolloquium heranrückte, mussten alle Mitarbeiter dazu beitragen, dass es ein voller Erfolg würde. Lothar war zur Getränkeversorgung abgestellt, obwohl er gern eine andere Aufgabe übernommen hätte. Dem Hausmeister Theodor Tintenfisch kam die Aufgabe zu, den Diaprojektor zu bedienen. Natürlich hatte er sofort Einwände dagegen, indem er grantelte: „I woaß gor net, wos i do moche soll!“ Der Abteilungsleiter erklärte ihm, dass er immer ein neues Dia einlegen müsste, wenn der Vortragende sage „Das nächste Bild, bitte“ oder auf Englisch „Next slide, please“. Das übte Herr Tintenfisch dann auch ausgiebig mit verschiedenen Mitarbeitern bis es klappte.
Beim Kolloquium lief zuerst alles wie am Schnürchen. Lothar stand hinter den Zuschauern, immer im Blick habend, ob sich jemand nach ihm umdrehte, um etwas zu trinken zu bestellen. Gleichzeitig behielt er auch das Geschehen auf der Bühne im Auge und versuchte, etwas davon zu verstehen. Aber nicht nur, weil überwiegend englisch gesprochen wurde, begriff Lothar kaum, worum es gerade ging. Der Hausmeister funktionierte anfangs gut, denn er wechselte wie gewünscht die Dias. Plötzlich sagte der vortragende Wissenschaftler auf der Bühne: „Can I get the last slide again, please.“ Damit war der gute Theodor jedoch überfordert und legte das nächste Dia ein. Dann kam ein längerer englischer Satz vom Rednerpult, den der Hausmeister wieder nicht verstand. So legte er intuitiv das nächste Dia ein. Nun hielt es Lothar nicht mehr auf seinem Platz, sondern er eilte nach vorn an den Projektor und legte das vorletzte Dia ein, sodass dem Wunsch des Vortragenden entsprochen wurde. Der Hausmeister war nun scheinbar beleidigt, denn er zog laut schimpfend einfach davon und überließ seinen Platz am Projektor Lothar. Man hörte ihn nur noch lamentieren: „Jo, bin i denn oan Fülmvorführer?“ Lothar übernahm diese Aufgabe für den Rest der Veranstaltung und wurde am Ende von der Leitung belobigt und prämiert.
Als Lothar Löwe nach zwei Jahren das Abiturzeugnis in der Tasche hatte, bewarb er sich um ein Physik-Studium und wurde angenommen. Dr. Marder sah er nie wieder und war auch nicht traurig darüber.
An Christine erinnerte er sich noch lange.
Das Gold konnte er später sehr gut gebrauchen, als er heiraten wollte und Trauringe brauchte, denn in der DDR gab es Goldschmuck nur gegen Abgabe von Altgold. Weil das geklaute Gold so viel und so rein war, reichte es tatsächlich für zwei Eheringe.
An der Uni
Vor dem eigentlichen Beginn des Studiums gab es ein Vorbereitungslager in Prieros, denn man schrieb das Jahr 1968 und der Prager Frühling und die Studentenunruhen in Westdeutschland blieben auch in der DDR nicht unbemerkt, deshalb versuchten die Regierenden einer ähnlichen Bewegung in Ostdeutschland vorzubeugen. Wichtig war der Universitätsleitung, dass alle Studenten ein Dokument unterschrieben, das den Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei begrüßte.
Als der regelrechte Studienbetrieb lief, hatte es Lothar Löwe recht schwer an der Uni, denn das Abendschulabitur hatte eben doch nicht dieselbe Qualität wie ein normales. Außerdem war er ab dem dritten Studienjahr Vater und die Versuchung war groß, die Vorlesung zu schwänzen, um bei seinem Kind zu Hause zu bleiben – insbesondere, wenn es krank war. Trotzdem schlug er sich halbwegs wacker durch, schaffte alle Prüfungen, wenn auch manche erst im zweiten Anlauf und hoffte auf einen befriedigenden Abschluss.