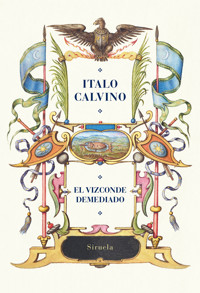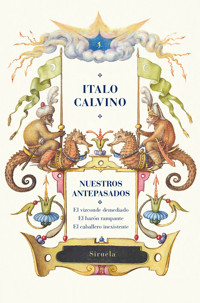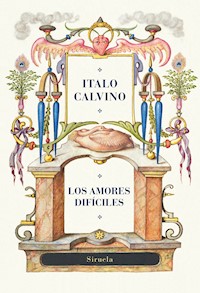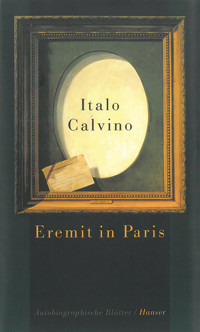
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Autobiographie des berühmten italienischen Schriftstellers in Fragmenten. Er behielt zeit seines Lebens etwas von einem Nomaden: Geboren in Kuba, aufgewachsen in San Remo, lebte er später in Turin, Paris und in Amerika. Diese Sammlung umfaßt alle Texte, die er über den eigenen Lebensweg geschrieben hat. Sie erzählen von seiner Jugend unter dem italienischen Faschismus, seinem Weg zum Schriftsteller nach dem Krieg bis hin zu den späten Jahren eines Kosmopoliten. Dabei erweist er sich als ein scharfsinniger Beobachter der großen politischen Umwälzungen seiner Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
Die Autobiographie des berühmten italienischen Schriftstellers in Fragmenten. Er behielt zeit seines Lebens etwas von einem Nomaden: Geboren in Kuba, aufgewachsen in San Remo, lebte er später in Turin, Paris und in Amerika. Diese Sammlung umfaßt alle Texte, die er über den eigenen Lebensweg geschrieben hat. Sie erzählen von seiner Jugend unter dem italienischen Faschismus, seinem Weg zum Schriftsteller nach dem Krieg bis hin zu den späten Jahren eines Kosmopoliten. Dabei erweist er sich als ein scharfsinniger Beobachter der großen politischen Umwälzungen seiner Zeit.
Italo Calvino
Eremit in Paris
Autobiographische Blätter
Aus dem Italienischen von Burkhart Kroeber und Ina Martens
Carl Hanser Verlag
In diesem Band habe ich zwölf Schriften Calvinos, die bereits an verschiedenen Orten erschienen waren, einen unveröffentlichten Text — das Amerikanische Tagebuch — und einen nur mit kleiner Auflage in Lugano erschienenen Aufsatz — Eremit in Paris — zusammengestellt.
Im August 1985, einen Monat vor der geplanten Abreise an die Harvard-Universität, war Calvino erschöpft und besorgt. Er hatte die sechs Vorträge fertigschreiben wollen, die er in Harvard halten sollte, und schaffte es nicht. Er korrigierte, stellte um, »knetete« und ließ dann doch alles fast so, wie es war. Er kam nicht voran.
Ich dachte, eine mögliche Lösung wäre vielleicht, ihn zu überreden, etwas anderes zu machen, sich auf ein anderes seiner vielen Projekte zu konzentrieren. Auf meine Frage: »Warum läßt du die Vorträge nicht eine Weile liegen und schreibst La strada di San Giovanni*1 zu Ende?« erwiderte er: »Weil das meine Biographie ist, und meine Biographie ist noch nicht…« Er ließ den Satz unvollendet. Wollte er sagen: »noch nicht zu Ende«? Oder dachte er vielleicht: »das ist noch nicht meine ganze Biographie«?
Jahre später fand ich eine Mappe mit der Aufschrift »Autobiographische Blätter«, die eine Reihe von Texten enthielt, begleitet von editorischen Anmerkungen. Es gab also noch ein anderes autobiographisches Projekt, das ganz anders geartet war als das in La strada di San Giovanni umrissene. Es ist schwierig, wenn nicht unmöglich, zu verstehen, in welcher Weise Calvino diese Schriften präsentiert hätte, die er in chronologischer Ordnung hinterlassen hat. Sie beziehen sich zweifellos auf die wichtigsten Aspekte seines Lebens, in der ausdrücklichen Absicht, seine Entscheidungen zu erläutern: die politischen, literarischen, existentiellen, das Wie, das Warum und das Wann. Sehr wichtig ist das Wann: In einer Anmerkung, die der Politischen Autobiographie meiner Jugend aus den Jahren 1960—1962 beilag, schreibt er: »Was die (…) geäußerten Überzeugungen angeht, so sind sie — wie jede andere Schrift dieser Sammlung — nur Zeugnisse dessen, was ich zu jener Zeit dachte.«
Das Material, das Calvino für dieses Buch vorbereitet hatte, geht bis Dezember 1980. Es war sein ausdrücklicher Wunsch, drei dieser Schriften in zwei Versionen nacheinander erscheinen zu lassen. Ich habe die letzten fünf Texte hinzugefügt, weil sie strikt autobiographischer Art sind und mir scheint, daß sie die anderen vervollständigen.
Als ich die Texte dann in ihrer Gesamtheit durchsah, hatte ich den Eindruck, daß in einigen von ihnen jene Unmittelbarkeit fehlt, die man in Autobiographien erwartet. Nicht nur aus diesem Grund bin ich darauf gekommen, das Amerikanische Tagebuch 1959—1960 in den Band mit aufzunehmen. Über die Bedeutung, die jene Reise in seinem Leben hatte, hat sich Calvino bei verschiedenen Gelegenheiten schriftlich und mündlich geäußert. Dennoch beschloß er, das von dieser Reise angeregte Buch Un ottimista in America [Ein Optimist in Amerika] nicht zu veröffentlichen, als es bereits in den Umbruchfahnen vorlag. Die Erklärung für diesen schroffen Sinneswandel findet sich in einem Brief an Luca Baranelli vom 24. Januar 1985: »… Ich hatte beschlossen, das Buch nicht zu veröffentlichen, weil ich es beim Wiederlesen der Fahnen als zu bescheiden für ein literarisches Werk und nicht originell genug für eine journalistische Reportage empfand. Habe ich gut daran getan? Wer weiß? Hätte ich es damals veröffentlicht, wäre es immerhin ein Dokument der Epoche und einer Phase meines Lebens gewesen…«
Das Amerikanische Tagebuch ist dagegen nichts anderes als eine Reihe von Briefen, die Calvino regelmäßig an seinen Freund und Kollegen Daniele Ponchiroli im Einaudi-Verlag schickte, der sie den anderen Mitarbeitern des Verlages zugänglich machen sollte und darüber hinaus auch jedem, wie Calvino ausdrücklich schreibt, der daran interessiert war, seine Eindrücke und Erfahrungen in Amerika kennenzulernen.
Als autobiographisches Dokument — nicht als literarisches Werk — scheint es mir essentiell; als Selbstporträt ist es sicherlich das spontanste und unmittelbarste.
Dies also könnte der Sinn dieses Buches sein: das Verhältnis des Lesers zum Autor enger zu machen, es durch diese Schriften zu vertiefen. Calvino war der Ansicht: »Was zählt, ist das, was wir sind, ist Vertiefen des eigenen Verhältnisses zur Welt und zum Nächsten, eines Verhältnisses, das zugleich Liebe zum Bestehenden und Wille zur Veränderung sein kann.«
Esther Calvino
Ich danke Luca Baranelli für seine unschätzbare Hilfe bei diesem und anderem und für seine nicht minder kostbare Freundschaft.
E. C.
Als Zugereister in Turin*2
Wahlturiner — auf dem Gebiet der Literatur — gibt es, glaube ich, nicht so viele. Wahlmailänder kenne ich eine Menge — ich behaupte: fast alle Mailänder Literaten sind es; die Wahlrömer nehmen unentwegt zu; die Wahlflorentiner weniger als früher, aber es gibt noch welche. In Turin dagegen würde man sagen, man muß dort geboren sein oder aus den Tälern des Piemont angeschwemmt mit dem natürlichen Lauf der Flüsse, die in den Po münden. Für mich ist Turin jedoch wirklich Gegenstand einer Wahl gewesen. Ich komme aus einem Land, aus Ligurien, das von einer literarischen Tradition nur Bruchstücke oder Andeutungen hat, so daß jeder — großes Glück! — eine Tradition auf eigene Rechnung für sich entdecken oder erfinden kann; aus einem Land, das keine klar definierte literarische Hauptstadt hat, so daß der ligurische Literat — ein seltener Vogel in Wirklichkeit — auch ein Wandervogel ist.
Was mich an Turin gereizt hat, waren bestimmte Tugenden, die denen meiner Leute nicht unähnlich waren und die mir die liebsten sind: das Fehlen romantischer Wallungen, das Vertrauen vor allem auf die eigene Arbeit, ein angeborenes sprödes Mißtrauen, dazu das sichere Gefühl, an der weiten, sich regenden Welt teilzuhaben und nicht an der abgeschlossenen Provinz, die Lust an einem durch Ironie gezügelten Leben, die klärende und rationale Intelligenz. Es war also ein moralisches und »ziviles« Bild von Turin, nicht ein literarisches, das mich anzog. Es war der Reiz jener Stadt dreißig Jahre zuvor, den ein anderer »Wahlturiner«, der Sarde Gramsci, entdeckt und ausgelöst hatte und den ein alteingesessener Turiner wie Gobetti in einigen seiner noch heute so anregenden Schriften definiert hat. Das Turin der revolutionären Arbeiter, die sich schon in der ersten Nachkriegszeit als führende Klasse organisierten, das Turin der antifaschistischen Intellektuellen, die sich auf keinen Kompromiß einließen. Gibt es dieses Turin noch? Macht es sich in der italienischen Realität von heute bemerkbar? Ich glaube, daß es die Fähigkeit hat, seine Kraft wie ein Feuer unter der Asche zu bewahren, und daß es lebendig bleibt, auch wenn es nicht so scheint. Mein literarisches Turin bestand vor allem aus einer Person, der nahe zu sein ich einige Jahre das Glück hatte und die mir dann zu bald fehlte: ein Mann, über den zur Zeit viel geschrieben wird, und oftmals so, daß man Mühe hat, ihn wiederzuerkennen. Wahr ist, daß seine Bücher nicht ausreichen, um ein vollständiges Bild von ihm zu geben. Denn von grundlegender Bedeutung war bei ihm das Beispiel, das er mit seiner Arbeit gab, die Tatsache, daß man bei ihm sehen konnte, wie die Kultur des Literaten und die Sensibilität des Dichters sich in produktive Arbeit umsetzten, in Werte, die dem Nächsten zur Verfügung gestellt werden, in Organisation und Ideenaustausch, in Praxis und Lehre all jener Techniken, aus denen eine moderne kulturelle Zivilisation besteht.
Ich spreche von Cesare Pavese. Und ich kann sagen, daß für mich wie auch für andere, die ihn kannten und mit ihm verkehrten, die Lehre Turins in weiten Teilen mit seiner Lehre zusammenfiel. Mein Turiner Leben war ganz von ihm geprägt; jede Seite, die ich schrieb, las er als erster; er war es, der mir einen Beruf verschaffte, indem er mich in jene Verlagstätigkeit einführte, durch die Turin noch heute ein kulturelles Zentrum von mehr als bloß nationaler Bedeutung ist; er war es schließlich auch, der mich lehrte, seine Stadt zu sehen, ihre subtilen Schönheiten zu genießen beim Spaziergang durch die Corsi und durch die Hügel.
Hier müßte ich das Thema wechseln und erklären, wie es einem Zugereisten wie mir gelingt, mit dieser Landschaft zu harmonieren; wie ich mich darin wiederfinde, ein Fisch der Klippen und ein Vogel des Waldes, verpflanzt unter diese Arkaden, um die Nebel und Fröste am Fuße der Alpen zu spüren. Aber das würde viel Zeit erfordern. Ich müßte zu definieren versuchen, was für ein heimliches Spiel von Motiven das geometrische Raster der rechtwinklig angelegten Straßen mit dem geometrischen Raster der Trockenmauern in meiner ländlichen Heimat verbindet. Und welches besondere Verhältnis von Kultur und Natur in Turin herrscht: eines nämlich, bei dem ein erneutes Grünen der Blätter an den Corsi, ein Glitzern auf dem Po oder die freundliche Nähe der Hügel genügt, um unversehens das Herz wieder aufzuschließen für nicht vergessene Landschaften, um den Menschen wieder mit der viel weiteren natürlichen Welt zu konfrontieren — kurz: um wieder spüren zu lassen, daß man lebt.
Der Schriftsteller und die Stadt*3
Wenn wir annehmen, daß die Arbeit des Schriftstellers durch die Umgebung, in der sie stattfindet, durch die Elemente der Szenerie um ihn herum beeinflußt werden kann, dann müssen wir anerkennen, daß Turin die ideale Stadt zum Schreiben ist. Ich weiß nicht, wie man es anstellt, in einer von jenen Städten zu schreiben, in denen die Bilder der Gegenwart so überwältigend und so aufdringlich sind, daß sie keinen Raum für Weite und Stille lassen. Hier in Turin kann man schreiben, weil Vergangenheit und Zukunft deutlicher als die Gegenwart sind, die Kraftlinien der Vergangenheit und das Gespanntsein auf die Zukunft geben den diskreten und geordneten Bildern des Heute Konkretheit und Richtung. Turin ist eine Stadt, die zum Starksein, zur Geradlinigkeit, zum Stil auffordert. Sie fordert zur Logik auf, und durch die Logik öffnet sie den Weg zum Wahnsinn.
Fragebogen 1956
(Antworten auf eine Umfrage der Zeitschrift »Il Caffè«*4)
Biographische Daten
Geboren wurde ich am 15. Oktober 1923 in Santiago de Las Vegas, einem Dorf in der Nähe von Havanna, wo mein Vater, ein aus San Remo stammender Agronom, eine landwirtschaftliche Versuchsstation leitete und meine Mutter, eine Botanikerin aus Sardinien, seine Assistentin war. Von Cuba habe ich leider nichts in Erinnerung behalten, da ich schon 1925 in Italien war, in San Remo, wohin mein Vater mit meiner Mutter zurückgekehrt war, um eine Versuchsstation für Blumenzucht zu leiten. Von meiner Geburt in Übersee sind mir nur ein schwer abzuschreibender Eintrag im Melderegister, ein Bündel familiärer Erinnerungen sowie mein Vorname geblieben, der sich dem frommen Gedenken der Emigranten an ihre Laren verdankt und im heimatlichen Italien eher nach Bronzestatue und Carducci klingt. Bis zu meinem zwanzigsten Lebensjahr habe ich bei meinen Eltern in San Remo gelebt, in einem Garten voll seltener exotischer Pflanzen und auf gemeinsamen Streifzügen durch die Wälder des Hinterlandes mit meinem Vater, der ein unermüdlicher Jäger war. Als ich das Alter erreicht hatte, um an die Universität zu gehen, schrieb ich mich in Agrarwissenschaft ein, aus Familientradition und ohne mich dazu berufen zu fühlen, denn mir stand der Sinn schon nach Literatur. Unterdessen kam die deutsche Besatzung, und einer alten Gefühlsregung folgend kämpfte ich mit den garibaldinischen Partisanen in denselben Wäldern, mit denen mein Vater mich schon als Junge vertraut gemacht hatte. Nach der Befreiung schrieb ich mich an der Universität Turin in Literaturwissenschaft ein und promovierte in allzu großer Eile 1947 mit einer Arbeit über Joseph Conrad. Mein Eintritt ins literarische Leben erfolgte gegen Ende 1945 in der Atmosphäre von Vittorinis »Politecnico«, der eine meiner ersten Erzählungen veröffentlichte. Aber schon meine allererste Erzählung hatte Pavese gelesen und der Zeitschrift »Aretusa« empfohlen, wo sie dann veröffentlicht wurde. Pavese, dem ich in seinen letzten Jahren täglich nahe war, verdanke ich meine schriftstellerische Ausbildung. Seit 1945 lebe ich in Turin, immer um den Einaudi-Verlag kreisend, für den ich als ambulanter Buchverkäufer zu arbeiten begann und in dessen Büros ich noch heute arbeite. In den letzten zehn Jahren habe ich nur einen kleinen Teil dessen geschrieben, was ich gern schreiben würde, und habe in den vier Büchern, die ich zum Druck gegeben habe, nur einen kleinen Teil dessen veröffentlicht, was ich geschrieben habe.
Welcher Kritiker hat Sie am positivsten beurteilt? Und welcher am negativsten?
Alle haben meine Bücher fast zu positiv behandelt, von Anfang an, von den angesehensten Kritikern (ich erinnere hier gern an De Robertis, der mich von meinem ersten Buch an begleitet hat, an Cecchi mit seiner Schrift über den Visconte dimezzato*5, an Bo, Bocelli, Pampaloni, Falqui und auch an den armen Cajumi, der mein erster Rezensent war) bis zu den jungen aus meiner Generation. Die wenigen negativen Kritiker sind diejenigen, die mich am meisten beschäftigen, von denen ich mir am meisten erwarte. Aber eine negative Kritik, die seriös und fundiert ist und mich etwas Nützliches lehrt, habe ich leider noch nie bekommen. Als Il sentiero dei nidi di ragno*6 erschienen war, gab es einen bösen Artikel von Enzo Giachino, einen absoluten, totalen Verriß, so gnadenlos, daß es einem die Haut abzieht, sehr witzig geschrieben, vielleicht war es einer der schönsten Artikel, die je über meine Bücher geschrieben worden sind, einer der wenigen, die ich ab und zu mit Vergnügen wiederlese, aber genützt, geholfen hat er mir auch nicht — er geißelte nur die Äußerlichkeiten des Buches, die ich auch von allein überwunden hätte.
Können Sie uns in wenigen Worten Ihren ästhetischen Kanon erläutern?
Einige meiner allgemeinen Ideen über die Literatur habe ich letzten Februar in einem Vortrag dargelegt, der kürzlich in einer Zeitschrift erschienen ist (Il midollo del leone*7). Dem habe ich im Moment nichts hinzuzufügen. Wobei aber klar sein sollte, daß ich mich sehr wohl hüte zu behaupten, es sei mir gelungen zu verwirklichen, was ich predige. Ich schreibe, wie es mir von Mal zu Mal eben gelingt.
In welchem Milieu, mit welchen Personen und Situationen entwickeln sie Ihre Themen am liebsten?
Das ist mir selber noch nicht recht klar, und das ist vielleicht auch der Grund, weshalb ich so oft das Register wechsle. In fast allen meinen besseren Sachen ist der Schauplatz die Riviera, und deshalb verbinden sie sich oft mit einer Welt der Kindheit und Jugend. Unter dem Aspekt der Treue zu meinen Themen betrachtet, hat mir die Entfernung von den Orten meiner Kindheit und meiner Vorfahren eine sichere Nahrung entzogen, aber andererseits kann man nichts erzählen, wenn man noch mittendrin steckt. Über Turin, die Stadt, die aus vielen tiefliegenden Gründen meine Wahlheimat ist, versuche ich oft zu schreiben, aber es gerät mir nie recht. Vielleicht werde ich erst wegziehen müssen, ehe es mir gelingt. Was die sozialen Klassen angeht, so kann ich nicht behaupten, ich wäre eher ein Schriftsteller der einen als der anderen von ihnen. Solange ich über Partisanen schrieb, war ich mir sicher, daß es gutging; von den Partisanen verstand ich einiges, und durch sie war ich auch mit einigen Schichten am Rand der Gesellschaft in Berührung gekommen. Die Arbeiter, die mich sehr interessieren, kann ich noch nicht darstellen. Es ist ja ein Unterschied, ob man sich für etwas interessiert oder ob man es darstellen kann. Aber ich habe den Mut nicht verloren, früher oder später werde ich es schon noch lernen. In meiner eigenen Klasse, also der Bourgeoisie, habe ich nicht viele Wurzeln, da ich aus einer nonkonformistischen Familie stamme, die sich von den üblichen Gebräuchen und Traditionen gelöst hat; und ich muß sagen, daß mich die Bourgeoisie auch nicht sehr interessiert, nicht einmal als Gegenstand der Polemik. Alle diese Überlegungen stelle ich hier an, weil ich mich darauf eingelassen habe, die Frage zu beantworten, nicht weil es Probleme wären, die mir den Schlaf rauben. Die Geschichten, die zu erzählen mich interessiert, sind immer Geschichten von einer Suche nach menschlicher Ganzheit und Vollständigkeit, nach einer Vervollständigung, die durch zugleich praktische und moralische Prüfungen zu erreichen ist, jenseits der Entfremdungen und Depravationen, die dem heutigen Menschen auferlegt werden. Hier, denke ich, ist die poetische und moralische Einheit meines Werkes zu suchen.
Welchen zeitgenössischen italienischen Erzähler mögen Sie am liebsten? Und welcher von den jüngeren interessiert Sie am meisten?
Ich glaube, daß Pavese der bedeutendste, komplexeste, dichteste italienische Schriftsteller unserer Zeit ist. Egal, welches Problem sich uns stellt, man kommt nicht umhin, sich auf ihn zu beziehen, als Literat und als Schriftsteller. Auch die von Vittorini begonnene Diskussion hat mich sehr beeinflußt. Ich sage »begonnene«, weil wir heute den Eindruck einer mittendrin abgebrochenen Diskussion haben, die weiterzuführen wir noch zögern. Später, nachdem ich die Phase des vorherrschenden Interesses an den neuen Sprachexperimenten überwunden hatte, habe ich mich Moravia genähert, der als einziger in Italien jenen Schriftstellertypus verkörpert, den ich den »institutionellen« nennen würde, das heißt einen, der in regelmäßigen Abständen Werke vorlegt, in denen moralische Definitionen unserer Zeit festgehalten werden, verbunden mit den Sitten und Gebräuchen, den Bewegungen der Gesellschaft und den allgemeinen Denkrichtungen. Meine Zuneigung für Stendhal läßt mich mit Tobino sympathisieren, obwohl ich ihm die schlechte Angewohnheit nicht verzeihen kann, daß er sich rühmt, Provinzler zu sein, noch dazu Toskaner. Eine besondere Vorliebe und Freundschaft habe ich für Carlo Levi, vor allem wegen seiner antiromantischen Polemik, aber auch, weil ich seine Art, von authentisch Erlebtem, nicht Erfundenem zu erzählen, für den seriösesten Weg einer sozialen und problemorientierten Literatur halte, auch wenn ich nicht einverstanden bin mit seiner These, daß diese Literatur heute den Roman ersetzen sollte, der meines Erachtens andere Aufgaben hat.
Nun zu den Jüngeren. Von den um 1915 Geborenen haben sich Cassola und Bassani darauf verlegt, bestimmte Brüche und Zwiespältigkeiten im bürgerlichen italienischen Bewußtsein zu untersuchen, und ihre Erzählungen sind die interessantesten, die man heute lesen kann; aber Cassola werfe ich eine gewisse Äußerlichkeit der Reaktionen in den menschlichen Beziehungen vor und Bassani seinen Untergrund an preziösem decadentismo. Von uns Jüngeren, die wir begonnen haben, am Modell eines bewegten, plebejischen, »toughen« Erzählens zu arbeiten, ist Vittorio Rea am weitesten gegangen. Jetzt ist es Pasolini, als Dichter und Literat bereits einer der ersten seiner Generation, der einen Roman geschrieben hat, gegen den ich zwar viele »poetologische« Einwände habe, den man jedoch, je mehr man’s bedenkt, als haltbar und auf seine Weise gelungen empfindet.
Welchen ausländischen zeitgenössischen Erzähler mögen Sie am liebsten?
Vor etwa einem Jahr schrieb ich über das, was Hemingway zu Anfang meiner schriftstellerischen Tätigkeit bedeutete. Seit mir Hemingway nicht mehr genügte, kann ich nicht sagen, daß es einen zeitgenössischen Schriftsteller gibt, der an seine Stelle getreten wäre. Seit fünf bis sechs Jahren erobere auch ich mir jetzt meinen Thomas Mann, und ich bin mehr und mehr verzaubert von dem Reichtum, der sich bei ihm findet. Aber ich denke immer, daß man heute anders schreiben muß. In meinem Verhältnis zu den Schriftstellern der Vergangenheit bin ich freier und überlasse mich vorbehaltloser Begeisterung; im 18. und 19. Jahrhundert habe ich eine Menge Lehrer und Freunde, die zu besuchen ich nie müde werde.
Wie sind Ihre Bücher im Ausland aufgenommen worden?
Das kann man jetzt noch nicht sagen. Il visconte dimezzato erscheint jetzt gerade in Frankreich und bald auch in Deutschland. Il sentiero dei nidi di ragno wird im Frühjahr in England erscheinen, und nach sechs Monaten wird ihm dann Ultimo viene il corvo*8 folgen.
Woran arbeiten Sie zur Zeit?
Ich verrate nichts, solange ich es nicht fertig habe.
Glauben Sie, daß die Literaten am politischen Leben teilnehmen sollen? Und wenn ja, wie? Welcher politischen Richtung gehören Sie an?
Ich glaube, alle Menschen sollten daran teilnehmen. Und die Literaten eben als Menschen. Ich glaube, das politische und moralische Bewußtsein sollte zuerst den Menschen und dann auch den Schriftsteller beeinflussen. Das ist ein langer Weg, aber es gibt keinen anderen. Und ich glaube, der Schriftsteller sollte einen Diskurs offenhalten, der in seinen Implikationen zwangsläufig auch politisch sein muß. Diesen Prinzipien bin ich in den fast zwölf Jahren meiner Zugehörigkeit zur Kommunistischen Partei immer treu geblieben, und daher sind mein Bewußtsein als Kommunist und mein Bewußtsein als Schriftsteller nicht in jene lähmenden Widersprüche geraten, an denen viele meiner Freunde zerbrochen sind, da sie glaubten, es sei unvermeidlich, sich entweder für das eine oder das andere zu entscheiden. Alles, was dazu führt, daß wir auf einen Teil von uns selbst verzichten, ist negativ. An der Politik und an der Literatur nehme ich auf unterschiedliche Weise teil, je nach meinen Einstellungen, aber beide interessieren mich als ein und derselbe Diskurs über die menschliche Gattung.
Porträt nach Maß*9
Ich komme aus einer Familie von Naturwissenschaftlern: mein Vater war Agronom, meine Mutter Botanikerin, beide Universitätsprofessoren. In meiner Familie galten nur die naturwissenschaftlichen Studien etwas; ein Onkel mütterlicherseits war Chemiker und Universitätsprofessor, verheiratet mit einer Chemikerin (ich hatte sogar zwei Onkel, die Chemiker waren und mit Chemikerinnen verheiratet); mein Bruder ist Geologe und Universitätsprofessor. Ich bin das schwarze Schaf, der einzige Literat der Familie. Mein Vater stammte aus San Remo, aus einer alteingesessenen ligurischen Familie; meine Mutter ist Sardin. Mein Vater hat zwanzig Jahre in Mexiko gelebt, wo er landwirtschaftliche Versuchsstationen leitete, und danach auch in Cuba; dorthin brachte er meine Mutter, die er durch einen Austausch wissenschaftlicher Publikationen kennengelernt und während einer Blitzreise nach Italien geheiratet hatte; ich wurde in einem Dorf bei Havanna geboren, in Santiago de las Vegas, am 15. Oktober 1923. Von Cuba habe ich leider nichts in Erinnerung, denn mit weniger als zwei Jahren war ich bereits in Italien, in San Remo, wohin mein Vater mit meiner Mutter zurückgekehrt war, um eine Versuchsstation für Blumenzucht zu leiten. Von meiner Geburt in Übersee ist mir nur ein komplizierter Eintrag im Melderegister geblieben (den ich in kürzeren biobibliographischen Abrissen durch die »wahrere« Angabe »geboren in San Remo« ersetze), ein Bündel familiärer Erinnerungen und mein Taufname, den meine Mutter mir in der Annahme, daß ich im Ausland aufwachsen würde, zum Andenken an das Land meiner Ahnen geben wollte und der in Italien eher pompös vaterländisch-nationalistisch klingt. In San Remo habe ich bis zu meinem zwanzigsten Lebensjahr bei meinen Eltern gelebt, in einem Garten voll seltener exotischer Pflanzen und auf gemeinsamen Streifzügen durch die Wälder der ligurischen Voralpen mit meinem Vater, der ein unermüdlicher Jäger war. Nach dem Gymnasium machte ich ein paar Versuche, mich in die wissenschaftliche Tradition der Familie einzufügen, aber mir stand der Sinn bereits nach Literatur, und so gab ich die Versuche bald auf. Unterdessen war die deutsche Besatzung gekommen, und einer Gefühlsregung folgend, die ich seit meiner Jugend verspürt hatte, kämpfte ich mit den Partisanen der Garibaldinerbrigaden. Der Partisanenkrieg spielte sich in denselben Wäldern ab, mit denen mein Vater mich schon als Junge vertraut gemacht hatte; so vertiefte ich meine Beziehung zu jener Landschaft und entdeckte dort zum erstenmal die Zerrissenheit der menschlichen Welt.
Aus jener Erfahrung entstanden ein paar Monate später, im Herbst 1945, meine ersten Erzählungen. Die erste schickte ich an einen Freund, der gerade in Rom war; Pavese fand sie gut und gab sie Muscetta, der die Zeitschrift »Aretusa« leitete. Die betreffende Nummer von »Aretusa« erschien erst mit großer Verspätung im folgenden Jahr. Inzwischen hatte Vittorini eine andere Erzählung von mir gelesen und sie im Dezember 1945 in seinem »Politecnico« veröffentlicht.
Ich hatte mich an der literaturwissenschaftlichen Fakultät in Turin eingeschrieben, und zwar gleich im dritten Studienjahr, was dank der Erleichterungen für Kriegsheimkehrer damals möglich war. So machte ich 1946 die Prüfungen für alle vier Jahre und bekam sogar ein paar gute Noten. 1947 promovierte ich mit einer Arbeit über das Werk Joseph Conrads. Ich habe die Universität zu rasch durchlaufen, und das bereue ich heute; aber damals stand mir der Sinn nach anderem: nach Politik, an der ich mich mit Leidenschaft beteiligte, und das bereue ich nicht; nach Journalismus, denn ich schrieb für die »Unità« Beiträge über die unterschiedlichsten Themen; und nach schöpferischer Literatur, denn in jenen Jahren schrieb ich viele Erzählungen sowie einen Roman (in zwanzig Tagen, im Dezember 1946), betitelt Il sentiero dei nidi di ragno*10, und so entstand jene poetische Welt, aus der ich mich seither, im Guten oder im Schlechten, nicht mehr weit entfernt habe. Schon 1945 und vor allem, seit Pavese 1946 nach Turin zurückgekehrt war, hatte ich begonnen, für den Einaudi-Verlag zu arbeiten, zuerst als ambulanter Buchverkäufer und dann seit 1947 als Lektor, als welcher ich noch heute tätig bin. Aber auch von Mailand und von Vittorini fühle ich mich seit den Zeiten des »Politecnico« beeinflußt. Mit Rom verbindet mich eine Beziehung, die zugleich von Gefühlen der Abwehr und des Angezogenseins bestimmt ist, sowie die Anwesenheit von Carlo Levi und anderen Kritikern wie Alberto Moravia, Elsa Morante, Natalia Ginzburg.
Ich habe Europa diesseits und jenseits des Eisernen Vorhangs bereist; aber Reisen sind keine sehr wichtigen Ereignisse.
An Arbeiten, die ein gewisses Maß an Fleiß und bibliographischen Recherchen erfordern, habe ich die Sammlung der »Italienischen Märchen« (Fiabe italiane, 1956) gemacht; ich habe mich ein paar Jahre lang damit beschäftigt und Vergnügen daran gehabt. Aber dann habe ich mich nicht weiter als Wissenschaftler betätigt. Mir liegt es mehr am Herzen, mich als Schriftsteller zu betätigen, und das bringt mich schon ganz schön ins Schwitzen.
Amerikanisches Tagebuch*11
1959—1960
An Bord, 3. Nov. 59
Lieber Daniele*12, liebe Freunde,
die Langeweile hat für mich inzwischen die Gestalt dieses Überseedampfers. Warum bloß habe ich nicht das Flugzeug genommen? Ich wäre beschwingt vom Rhythmus der Welt der großen Geschäfte und großen Politik in Amerika angekommen, statt dessen komme ich nun beschwert von einer schon starken Dosis amerikanischer Langeweile, amerikanischer Altersschwäche, amerikanischer Knappheit an vitalen Ressourcen. Zum Glück muß ich nur noch einen Abend auf diesem Schiff überstehen, nach vier Abenden voll tödlicher Langeweile. Der Hauch von »Belle Epoque«, den Überseedampfer sonst an sich haben, kann hier nicht einmal mehr ein Bild hervorrufen. Das bißchen Erinnerung an die vergangene Zeit, das Orte wie Monte Carlo oder San Pellegrino Terme noch bieten können, gibt es hier nicht, denn dieser Dampfer ist neu, eine antiquierte Angelegenheit, die prätentiöserweise neu gebaut worden ist, bevölkert mit antiquierten, alten und häßlichen Leuten. Das einzige, was man ihm abgewinnen kann, ist eine Definition der Langeweile als ein Herausgehobensein aus der Geschichte, ein Abgeschnittensein von allem anderen, aber mit dem Bewußtsein, daß alles andere weitergeht: Die Langeweile von Recanati*13 und die der Drei Schwestern unterscheiden sich nicht von der Langeweile einer Reise auf einem Überseedampfer.
Es lebe der Sozialismus.
Es lebe das Fliegen.
Meine Reisegefährten (Young creative writers)
Es sind drei, denn der Deutsche, Günter Grass, hat die medizinische Prüfung nicht bestanden und mußte wegen des barbarischen Gesetzes, dem zufolge man für die Einreise nach Amerika eine gesunde Lunge haben muß, auf das Stipendium verzichten.
Es gibt noch einen vierten, der in der Touristenklasse (der dritten) reist, da er auf eigene Kosten seine Frau und sein kleines Söhnchen mitnimmt, weshalb wir ihn nur ein einziges Mal gesehen haben: Alfred Tomlinson, ein englischer Lyriker, der traditionelle englische Akademikertyp. Er ist 32 Jahre alt, sieht aber aus wie 52.
Die drei anderen sind:
Claude Ollier, Franzose, 37, Nouveau roman, hat bislang nur ein Buch geschrieben.*14 Er wollte die Reise nutzen, um endlich Proust zu lesen, aber die mobile Bibliothek dieses Überseedampfers reicht nur bis Cronin.
Fernando Arrabal, Spanier, 27, klein, Kindergesicht mit Halskrausenbart und Ponyfransen. Lebt seit Jahren in Paris. Hat Theaterstücke geschrieben, die niemand spielen will, und einen Roman, der bei Julliard erschienen ist. Hungert. Kennt keinen spanischen Schriftsteller und haßt sie alle, weil sie ihn einen Verräter nennen und von ihm verlangen, daß er sozialistischen Realismus macht und gegen Franco schreibt, während er sich weigert, gegen Franco zu schreiben, er wisse nicht einmal, wer Franco sei, aber wenn man in Spanien nicht gegen Franco sei, könne man nichts veröffentlichen und keine Preise bekommen, weil nämlich dort alles von Goytisolo beherrscht werde, der alle zwinge, sozialistischen Realismus zu machen, also Hemingway-Dos Passos, was er, Arrabal, nie gelesen habe, und er habe auch nie Goytisolo gelesen, weil er den sozialistischen Realismus nicht lesen könne und außer Ionesco und Ezra Pound kaum etwas möge. Er ist extrem aggressiv, macht Scherze auf eine verbissene und düstere Weise und wird nicht müde, mich mit Fragen zu bombardieren, wie ich es bloß fertigbrächte, mich für Politik zu interessieren, oder was man denn bitte mit Frauen anstellen solle. Seine Polemik richtet sich gegen zwei Dinge: Politik und Sex. Er und die blousons noirs*15, zu deren Interpreten er sich macht, können überhaupt nicht begreifen, wie es Leute geben kann, die Politik und Sex interessant finden. Er interessiert sich nur fürs Kino (vor allem für Cinemascope, Technicolor und Gangsterfilme) und für Flipperautomaten. Im Priesterseminar erzogen (er hat in Spanien als Jesuit studiert), hat er nie sexuelle Kontakte gehabt, offenbar auch nicht mit seiner Frau (er ist seit drei Jahren verheiratet), und es hat ihn auch nie danach verlangt, ebensowenig wie nach Politik. Er sagt, daß die jetzt heranwachsenden blousons noirs der Politik und dem Sex noch ferner stünden als er. Er spricht kein Wort Englisch und schreibt französisch.
Hugo Claus, flämischer Belgier, 32, hat mit 19 angefangen zu publizieren und seitdem eine Menge geschrieben, er ist von den jüngeren der berühmteste Schriftsteller, Dramatiker und Lyriker des flämisch-holländischen Sprachraums. Von vielen seiner Sachen sagt er selbst, daß sie nichts taugen, darunter auch ein Roman, der in Frankreich und Amerika übersetzt worden ist, aber er ist alles andere als ein dummer Unsympath: ein großer Blonder mit einer wunderschönen Frau, einer Filmschauspielerin (ich habe sie kennengelernt, als er sich bei der Abfahrt von ihr verabschiedete), und er ist der einzige von diesen dreien, der wirklich belesen ist und auf dessen Urteil man etwas geben kann. Schon vier Stunden nach dem Start des ersten Sputnik hatte er ein Gedicht darüber geschrieben, das sofort auf der ersten Seite einer belgischen Tageszeitung erschien.
Meine neue und, ich denke, nun endgültige Adresse für die ganze Zeit meines Aufenthalts in New York, also bis etwa zum 5. Januar, ist:
Grosvenor Hotel, 35 Fifth Avenue, New York.
Aus dem Tagebuch der ersten Tage in NY
9. November 1959
Die Ankunft
Die Langeweile der Reise wird reichlich aufgewogen durch die Erregung bei der Ankunft in New York, die spektakulärste Ansicht, die es auf dieser Erde zu sehen gibt. Die Wolkenkratzer erheben sich grau in den eben erst hell gewordenen Himmel und wirken zunächst wie enorme Ruinen eines verlassenen monsterhaften New York dreitausend Jahre nach unserer Zeit. Dann treten langsam die Farben hervor, anders als in jeder Vorstellung, die man sich gemacht hatte, und eine überaus komplizierte Formenvielfalt zeichnet sich ab. Alles ist lautlos und leer, dann sieht man allmählich die Autos fahren. Durch das graue, massige, fin-de-siècle-hafte Aussehen der Häuser macht NY, wie Ollier bemerkt, den Eindruck einer deutschen Stadt.
Lettunich
Aufs Sparen versessen, will Mateo Lettunich, Head Arts Division des I. I.E.*16 (Abkömmling einer Familie aus Dubrovnik), partout nicht, daß ich einen Gepäckträger nehme. Das Van Rensselaer, wo er uns Zimmer reserviert hat, ist schmutzig, verkommen, übelriechend, a dump. Wenn er ein Restaurant empfiehlt, ist es sicher das schlechteste weit und breit. Er hat die besorgte und erschrockene Miene mancher sowjetischer Dolmetscher, die westliche Delegationen begleiten, aber ich vermisse sehr das vorurteilslose Savoir-faire, mit dem in Moskau der Funktionär und Aristokratensproß Wiktor W. unsere Delegation junger Fabrik- und Landarbeiter begleitet hatte. Wer von der Gastlichkeit der sozialistischen Länder verwöhnt worden ist, empfindet angesichts der verlegenen Schüchternheit, mit der das Paradeland des Kapitalismus die Milliarden der Ford Foundation handhabt, einen gewissen Unmut. Tatsache ist jedoch, daß man hier nicht in Delegation reist; nachdem man ein paar Formalitäten erledigt hat, kann jeder gehen, wohin, und tun, was er will, und Mateo sehe ich nicht wieder. Er ist ein avantgardistischer Stückeschreiber, dessen Stücke nicht gespielt werden.
Die Hotels
Am nächsten Tag mache ich einen Rundgang durch Greenwich Village, um mir ein anderes Hotel zu suchen, und sie sind alle so: alt, dreckig, übelriechend, mit fleckigen Tapeten, auch wenn keines den zum Selbstmord reizenden Ausblick meines Zimmers im Van R. bietet, mit einer verrosteten und dreckstarrenden Eisentreppe vor dem Fenster zu einem schlauchförmigen Hof, in den nie ein Sonnenstrahl fällt. Aber schließlich finde ich das Grosvenor, ein elegantes Hotel im Village, alt, aber sauber; ich habe ein sehr schönes Zimmer im vollkommensten Henry-James-Stil (es sind nur zwei Schritte bis zum Washington Square, der großenteils so geblieben ist, wie er damals war), und ich bezahle ganze 7 Dollar pro Tag unter der Bedingung, daß ich zwei Monate bleibe und einen Monat im voraus bezahle.
New York ist noch nicht Amerika
Diesen Satz, den ich in allen Büchern über New York gelesen habe, sagen sie einem hier zehnmal am Tag, und er ist ja auch wahr, aber was soll’s? New York ist eben New York, etwas, das weder ganz Amerika noch ganz Europa ist, das einem eine außerordentliche Ladung Energie verpaßt, in dem man sich gleich geborgen fühlt, als hätte man immer schon hier gelebt, und das einem manchmal — besonders uptown, wo man das wimmelnde Leben der großen Büros und Textilfabriken am deutlichsten spürt — auf den Kopf fällt, so daß man meint, man werde erdrückt. Natürlich denkt einer, der gerade erst angekommen ist, an alles außer an Rückkehr.
Das Village
Vielleicht mache ich einen Fehler, im Village zu bleiben. Es hat so wenig von New York, obwohl es mitten in New York liegt. Es ähnelt so sehr Paris, doch im Grunde kapiert man, daß die Ähnlichkeit unfreiwillig ist und nur alles tut, um sich für gewollt zu halten. Es gibt drei verschiedene soziale Schichten im Village: die honorige Bourgeoisie, vor allem in den neuen Gebäuden, die auch hier stehen; die eingeborenen Italiener, die sich gegen den Zustrom der Künstler wehren (der in den zehner Jahren begonnen hat, weil das Leben hier billiger ist) und die oft handgreiflich werden (im letzten Frühjahr haben Schlägereien und Massenverhaftungen durch die Polizei den sonntäglichen Touristenstrom der New Yorker aus anderen Stadtteilen verebben lassen), aber inzwischen leben sie von den Bohemiens und der Bohemien-Atmosphäre und betreiben ihre Boutiquen; und schließlich die Bohemiens, die heute allgemein Beatniks genannt werden und sämtlich, Männer wie Frauen, schmutziger und abstoßender sind als alle ihre Brüder und Schwestern in Paris. Inzwischen wird das Erscheinungsbild des Viertels von Bauspekulanten bedroht, die auch hier Wolkenkratzer hinpflanzen. Ich habe eine Petition für die Erhaltung des Village unterschrieben, bei einem unterschriftensammelnden Mädchen an einer Ecke der Sixth Avenue. Wir Villagebewohner hängen sehr an unserem Viertel. Wir haben sogar zwei Zeitungen ganz für uns: The Villager und The Village Voice.
Die Welt ist klein
Ich wohne direkt gegenüber von Orion Press, Mischa*17 wohnt einen Block weiter, Grove Press ist gleich um die Ecke, und aus dem Fenster sehe ich das große Gebäude von Macmillan.*18
Die Autos
Das amüsiert einen hier am meisten, wenn man ankommt: zu sehen, wie groß die Autos in Amerika sind, und zwar alle, es gibt nicht kleine und große, sie sind allesamt riesig auf eine manchmal schon lachhafte Weise, was wir bei uns die Wagen der Granturismo-Klasse nennen, sind hier die normalen, sogar die Taxis haben enorme Hecks. Der einzige New Yorker unter unseren Freunden, der ein kleines Auto hat, ist Barney Rosset, ein eingefleischter Antikonformist, der eines von diesen mikroskopisch kleinen Wägelchen fährt, eine rote Isetta.
Ich bin sehr versucht, mir auf der Stelle einen riesengroßen Schlitten zu mieten, auch ohne ihn zu benutzen, nur wegen des Gefühls, die Stadt zu beherrschen. Aber wenn man den Wagen am Bordstein parkt, muß man morgens früh um sieben runtergehen und die Straßenseite wechseln, weil jeden Tag eine andere Seite Parkverbot hat. Und Garagen kosten ein Vermögen.
Das schönste Bild des abendlichen New York
Zu Füßen des Rockefeller Center gibt es eine Eisbahn, auf der Jungen und Mädchen Schlittschuh laufen, mitten im abendlichen New York, zwischen Broadway und Fifth.
Das chinesische Viertel
Die Viertel der armen Nationalitäten sind eher deprimierend; das italienische ist besonders düster. Nicht so das chinesische; es hat bei aller touristischen Ausbeutung eine Atmosphäre von bürgerlich-fleißigem Wohlstand und echter Fröhlichkeit, die den anderen »typischen« New Yorker Vierteln abgeht. Die chinesische Küche bei Bo-bo ist exzellent.
Meine erste NY Times am Sonntag
Soviel man schon darüber gelesen und gehört haben mag, zum Zeitungsladen zu gehen und sich einen Packen Papier aushändigen zu lassen, den man kaum auf dem Arm halten kann, das Ganze für 25 Cent, raubt einem den Atem. Unter den diversen sections und supplements finde ich die Book Review, die wir gewöhnlich als eine eigenständige Zeitschrift ansehen, während sie in Wirklichkeit eine der vielen Beilagen der Sonntagsausgabe ist.
Die Kollegen Mitstipendiaten
In New York finden wir den englischen Dichter wieder, der in der Touristenklasse gereist war und sofort wieder zurückwill, weil er sich hier nicht zurechtfindet und lieber auf dem Land lebt; und den Israeli Megged, einen Politik- und Religionswissenschaftler, der auch einen Roman geschrieben hat, der in keine europäische Sprache übersetzt worden ist. Er ist ein ernster Typ, anders als alle, nicht sympathisch; ich verstehe ihn nicht recht, und ich glaube, daß ich ihn nicht wiedersehen werde, da auch er weggehen will, um in einer kleinen Universitätsstadt zu leben. Anstelle von Günter Grass (der Ärmste wußte gar nicht, daß er lungenkrank war; er hat es entdeckt, als er sich wegen des Visums untersuchen ließ, und nun liegt er im Sanatorium) kommt kein anderer Deutscher, sondern ein zweiter Franzose, Robert Pinget, der Autor von Le Fiston*19 (inzwischen hat er einen neuen Roman beendet).
Die Pressekonferenz
Das I. I.E. veranstaltet eine Pressekonferenz mit uns sechsen. In den biographischen Angaben, die an die Eingeladenen verteilt werden, ist die wichtigste Auskunft über mich, daß ich von der Principessa Caetani vorgestellt werde, weil sie mich so sehr schätzt. Die Pressekonferenz hat den gleichen dilettantischen und gezwungenen Charakter wie in den Volksdemokratien, mit der gleichen Sorte von Leuten, von kleinen Mädchen und dummen Fragen. Arrabal, der kein Englisch spricht und mit einer kaum vernehmbaren Stimme antwortet, schafft es nicht, Skandal zu erregen. Welchen amerikanischen Schriftstellern möchten Sie gern begegnen? Er sagt: Eisenhower, aber er sagt es leise, und Lettunich, der sich als Dolmetscher betätigt, fährt entsetzt zusammen und will es nicht wiederholen. Ollier sagt trocken (auf die Frage, ob wir pessimistisch oder optimistisch seien), er sei für eine materialistische Weltanschauung. Ich sage, daß ich an die Geschichte glaube und gegen alle Ideologien und Religionen bin, die den Menschen passiv machen wollen. Bei diesen Worten erhebt sich der Präsident des I. I.E. vom Präsidiumstisch, verläßt den Saal und ward nicht wieder gesehen.
Alkoholiker
werde ich bald, wenn ich mit den Drinks um elf Uhr morgens beginne und bis zwei Uhr nachts weitermache. Nach den ersten Tagen in New York ist eine strenge Sparpolitik im Umgang mit den eigenen Energien geboten.
Ob sich mein Buch wohl in den Buchläden findet, im Schaufenster oder auf den Tischen?
Nein, nirgends, in keinem einzigen.
Random House
Das Dumme ist, daß der managing editor Hiram Haydn, nachdem er sich für den Baron auf den Bäumen eingesetzt hatte, von Random House weggegangen ist, um den Atheneum-Verlag zu gründen, und daß Mr. Klopfer, der Gründer und Eigner, nicht an die kommerziellen Möglichkeiten meines Buches glaubt und mir die gleichen Reden hält, die Cerati*20 an Ottiero Ottieri richtet. Jeder Buchhändler hat vier oder fünf Exemplare meines Buches bekommen, habe sie verkauft oder nicht und jedenfalls keine nachbestellt, was könne der Verleger da machen? Die Amerikaner hätten eben nichts für Phantasie übrig, es fehle nicht an guten Rezensionen (eine großartige ist am Samstag in der Saturday Review erschienen), auch der Buchhändler lese sie und wisse schon, was er tun müsse. Es gelingt mir, ihm das Versprechen abzuringen, Cerati zu den Buchhändlern sprechen zu lassen, aber ich glaube nicht daran. Jedenfalls bin ich am Donnerstag bei ihm zum Lunch. Hinterher erfahre ich von den Mädchen (ich bin immer sehr zufrieden mit ihnen, als editorial department ist Random einer der seriösesten Verlage), daß es bei der Auslieferung Ärger mit den IBM-Maschinen gegeben hat, die gerade neu im sales department eingeführt worden sind: Zwei Maschinen haben gestreikt, und kleine Dorfbuchhandlungen in Nebraska haben Dutzende von Exemplaren des Barons erhalten, während in großen Buchläden an der Fifth Avenue kein einziges angekommen ist. Das Entscheidende ist aber, daß der Werbeetat meines Buches bloß 500 Dollar beträgt, also nichts; wenn man ein Buch herausbringt und nicht mindestens eine halbe Million Dollar dafür ausgibt, hat man gar nichts getan. Die Sache ist die, daß die großen kommerziellen Häuser natürlich gut funktionieren, wenn ein Buch ein Bestseller ist, aber ein Buch durchzusetzen, das erst einmal einen literarischen Erfolg bei der Elite haben muß, daran liegt ihnen nichts, ihnen genügt das Prestige, es herausgebracht zu haben. Zur Zeit haben sie hier drei Bestseller: den neuen Faulkner, den neuen Penn Warren und Hawaii, ein Buch von einem kommerziellen Autor namens …*21, und die verkaufen sie.
Orion Press
Es sind nur zwei Räume. Dieser Greenfeld ist ein tüchtiger Bursche aus reicher Familie, aber man begreift nicht ganz, was sie eigentlich wollen. Jedenfalls sorgen sie für die wenigen Bücher, die sie machen, in kommerzieller Hinsicht sehr gut, auch was die Public relations betrifft, und die Italian Fables*22 findet man überall, auch weil sie Eingang in die children’s gefunden haben, obwohl der Verlag nichts getan hat, um sie in Richtung children’s zu drücken. Am Sonntag ist die Rezension in der NY Times Book Review erschienen, sehr schmeichelhaft für das italienische Buch, aber zu Recht hart im Urteil über ihre Übersetzung.
Die Horch*23
Scheint mir eine resolute Frau zu sein, eine schreckliche Alte, sehr warmherzig und freundlich. Sie will den Visconte nicht Random geben, wo sie ihn jetzt haben wollen, und ich bin einverstanden mit einem kleineren Haus, wenn es die größere literarische Reputation hat. So wird sie es nun dem Atheneum-Verlag geben, der bald sein erstes Programm herausbringt und sicher ein großes verlegerisches Ereignis wird, denn es haben sich drei sehr angesehene editors zusammengetan, von denen einer Haydn ist, der vorher Random geleitet hatte, der andere ist Michael Bessie von Harper’s und der dritte der Sohn von Knopf. Ich habe schon ein ganz schönes Durcheinander angerichtet, weil ich das Buch zunächst Grove versprochen hatte, die sehr hinter mir her sind, und tatsächlich sind die Bücher von Grove überall zu finden und zur Zeit sehr en vogue in den avantgardistischsten Kreisen. Tatsächlich hatten sie ein mündliches Versprechen von der Horch, aber jetzt will sie es Haydn geben, und auch ich glaube, daß Atheneum wichtig sein wird.
10. Nov.
Rosset
Die Cocktailparty bei Barney Rosset von Grove war bisher die interessanteste und an unterschiedlichen Leuten reichste von all den vielen Parties, die meine Tage hier verschönern. Es bestätigt sich das Urteil, das wir in Frankfurt*24 über Rosset abgegeben haben: Er vertritt einen sehr extremen und hochgestochenen Avantgardismus, dem jedoch ein historisches und moralisches Rückgrat fehlt. Am besten versteht man Rosset (und seinen Sozius Dick Seaver, der ebenfalls in Frankfurt war und der mit seiner französischen Frau in einer Hundehütte an der Spitze von Manhattan lebt, die er innen als elegante Intellektuellenwohnung eingerichtet hat), wenn man ihn im Village sieht, im Geist des ewigen (und inkonsequenten) Protests der Village-Intellektuellen gegen den noch ewigeren amerikanischen Konformismus. So setzt er auf die Beatniks, weil sie nützlich seien, um die jungen Amerikaner aus dem Fernsehschlaf zu wecken, er setzt unterschiedslos auf alles, was in Europa als Avantgarde gilt, weil es für Amerika gut sei.
Die beat generation
Auf der Party bei Rosset ist auch Allen Ginsberg mit einem widerlichen schwarzen Zottelbart, einem weißen Unterhemd unter einem dunklen Zweireiher und Tennisschuhen. Mit ihm ein ganzes Gefolge von Beatniks, die noch bärtiger und schmutziger sind als er. Sie sind fast alle von San Francisco nach New York umgezogen, auch Kerouac, der allerdings heute abend fehlt.
Das Abenteuer Arrabals
Natürlich fraternisieren die Beatniks sofort mit Arrabal, der ebenfalls bärtig ist (der Pariser Halskrausenbart und der ungepflegte Beatnikbart), und laden ihn zu sich nach Hause ein, um ihn Verse rezitieren zu hören. Ginsberg lebt wie verheiratet mit einem anderen Bärtigen zusammen und möchte, daß Arrabal ihren Intimitäten zwischen Bärtigen beiwohnt. Bei der Rückkehr ins Hotel finde ich Arrabal entsetzt und skandalisiert darüber, daß sie ihn verführen wollten. Der blouson noir, der nach Amerika gekommen ist, um hier Skandal zu erregen, ist völlig verstört von der ersten Begegnung mit der amerikanischen Avantgarde und entpuppt sich unverhofft als der arme spanische Junge, der bis vor wenigen Jahren noch am Priesterseminar studierte.
Er erzählt, daß die Beatniks zu Hause sehr sauber seien, sie hätten eine schöne Wohnung mit Kühlschrank und Fernseher, lebten wie in einer ruhigen bürgerlichen Ehe und zögen sich nur zum Ausgehen schmutzige Kleider an.
Eine Premiere am Broadway
Hugo Claus war in der Premiere einer neuen Komödie von Chayefsky. Er erzählt, daß er hinterher zum Essen bei Sardi’s war, wo alle Autoren und die Theaterleute speisen. Angespannt warten alle auf das Erscheinen der Zeitungen, denn eine Stunde nach dem Ende der Vorstellung, gegen ein Uhr nachts, erscheinen bereits die Times und der Herald mit der Kritik (die nach der Premiere geschrieben worden ist, nicht nach der Generalprobe). Die Zeitungen treffen ein. Einer der Schauspieler liest die Kritik vor, während alle anderen still sind. Kaum hören sie, daß der Kritiker das Schauspiel gelobt hat, applaudieren alle, umarmen einander und bestellen Champagner. Das Stück bleibt für die nächsten zwei Jahre auf dem Spielplan (wenn die Kritik dagegen schlecht war, wird es bereits nach wenigen Tagen abgesetzt). Sofort melden sich die Impresarios und Agenten, die Aufführungsrechte werden in alle Welt verkauft, Leute rennen ans Telefon, und binnen einer Stunde hat sich das Schicksal des Stückes für Jahre entschieden, auf einmal ist es ein Millionengeschäft.
Die Juden
Fünfundsiebzig Prozent der Leute im Verlagswesen sind Juden. Das Theater gehört den Juden zu neunzig Prozent. In die Textilindustrie, die New Yorks Großindustrie ist, kommen praktisch nur Juden hinein. Die Banken dagegen sind ihnen völlig verschlossen, ebenso die Universitäten. Die wenigen jüdischen Ärzte gelten als die besten, denn da es den Juden so schwer gemacht wird, auf die Uni zu kommen und die Examen zu bestehen, müssen diejenigen, die einen Doktor in Medizin geschafft haben, schon besonders gut sein.
Die Frauen
Sehr attraktive sind rar. Die meisten kleinbürgerlich. Dreh’s und wende es: Turin!
11. Nov.
Das Abenteuer eines Italieners