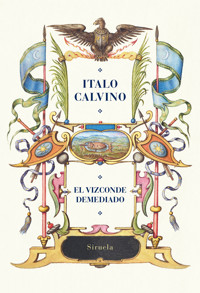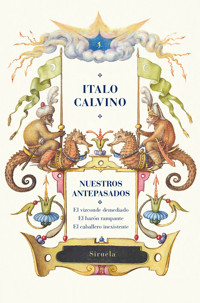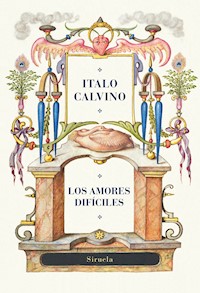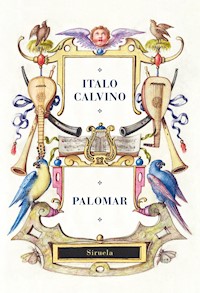16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Am 15 Juni 1767 beschließt der zwölfjährige Baron Cosimo Piovasco di Rondò, das dekadente Milieu seiner aristokratischen Familie zu verlassen, um fortan auf den Bäumen zu leben. Er erhebt sich von der Familientafel, klettert auf eine Steineiche und wird bis zu seinem Tod die Erde nicht mehr betreten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
Am 15 Juni 1767 beschließt der zwölfjährige Baron Cosimo Piovasco di Rondò, das dekadente Milieu seiner aristokratischen Familie zu verlassen, um fortan auf den Bäumen zu leben. Er erhebt sich von der Familientafel, klettert auf eine Steineiche und wird bis zu seinem Tod die Erde nicht mehr betreten.
Italo Calvino
Der Baron auf den Bäumen
Aus dem Italienischen von Oswalt von Nostitz
Carl Hanser Verlag
1
Es war der 15. Juni 1767, als Cosimo Piovasco di Rondò, mein Bruder, zum letzten Male in unserer Mitte saß. Wir befanden uns im Speisesaal unserer Villa in Ombrosa; die Fenster umrahmten die dichten Zweige der großen Steineiche des Parks. Es war Mittag, und unsere Familie saß, altem Herkommen gemäß, zu dieser Stunde bei Tische, obwohl unter dem Adel schon der Brauch aufgekommen war — er stammte von dem zum Frühaufstehen wenig geneigten französischen Hofe —, erst am vorgerückten Nachmittag zu speisen. Der Wind wehte vom Meer her, das weiß ich noch, und die Blätter bewegten sich. Cosimo erklärte: »Ich habe gesagt, daß ich nicht will, und ich will nicht!« Dann stieß er den Teller mit den Schnecken zurück. Niemals hatte man ärgeren Ungehorsam erlebt.
An der Spitze der Tafel thronte Baron Arminio Piovasco di Rondò, unser Vater, mit der langen Perücke im Stil Ludwigs XIV. über den Ohren, die veraltet war wie so viele seiner Gepflogenheiten. Zwischen mir und meinem Bruder saß der Abbé Fauchelefleur, der Kaplan unserer Familie und Erzieher von uns Jungen. Vor uns hatten wir die Generalin Corradina di Rondò, unsere Mutter, und unsere Schwester Battista, die Hausnonne. Am anderen Ende der Tafel, unserem Vater gegenüber, saß in türkischer Tracht der Cavaliere Rechtsanwalt Enea Silvio Carrega, Verwalter und Wasserbaumeister unserer Güter und zugleich unser natürlicher Onkel, denn er war ein illegitimer Bruder unseres Vaters.
Seit einigen Monaten waren wir beide, da Cosimo das zwölfte und ich das achte Lebensjahr vollendet hatten, zum Tisch unserer Eltern zugelassen; genauer gesagt, war mir diese Beförderung meines Bruders vorzeitig zugute gekommen, da sie mich nicht fortan allein speisen lassen wollten. Ich sage, sie war mir zugute gekommen, wie man so etwas dahersagt; in Wahrheit war damit für mich wie für Cosimo das Schlaraffenland zu Ende, und so trauerten wir den Mahlzeiten in unserem Kämmerchen nach, die wir beide dort allein mit dem Abbé Fauchelefleur eingenommen hatten. Der Abbé war ein vertrocknetes und runzliges altes Männlein und stand in dem Rufe, Jansenist zu sein; in der Tat war er aus der Dauphiné, seiner Heimat, geflohen, um einem Inquisitionsprozeß zu entgehen. Doch die Sittenstrenge, die alle an ihm zu rühmen pflegten, die innere Härte, die er sich und den anderen abverlangte, waren ständig auf der Flucht vor seinem eingewurzelten Hang zur Nonchalance, seiner Neigung, den Dingen ihren Lauf zu lassen; es war, als hätten die langen Meditationen, bei denen er ins Leere stierte, nur eine große Langeweile und Verdrossenheit hervorgerufen und als erblickte er in der kleinsten Schwierigkeit das Anzeichen für ein Verhängnis, gegen das jeder Widerstand müßig war. Unsere Mahlzeiten in Anwesenheit des Abbés begannen nach langen Gebeten mit gemessenen, rituellen, schweigend vollzogenen Bewegungen der Löffel, und wehe, wenn einer die Augen vom Teller hob oder beim Schlürfen der Fleischbrühe das leiseste Geräusch machte; nach Beendigung der Suppe war aber der Abbé schon müde, gelangweilt, er blickte ins Leere, schnalzte bei jedem Schluck Wein mit der Zunge, als hätten ihn nur noch die oberflächlichsten und flüchtigsten Sinneswahrnehmungen erreichen können; beim Hauptgericht konnten wir dann mit den Händen essen, und am Ende der Mahlzeit bewarfen wir uns mit Birnenresten, während der Abbé von Zeit zu Zeit träge ein »Oooo bien … Oooo alors!« von sich gab. Jetzt indessen, da wir mit der Familie bei Tisch saßen, nahmen die familiären Rankünen, dieses traurige Kindheitskapitel, Gestalt an. Ständig hatten wir dort unseren Vater und unsere Mutter vor uns: Benutzt das Besteck zum Huhn, sitzt gerade, fort mit den Ellbogen vom Tisch — so ging es ständig, und dazu kam noch unsere so unsympathische Schwester Battista.
Damals nahm eine Kette von Standpauken, Strafen, Züchtigungen, Verboten ihren Anfang, die sich bis zu dem Tage fortsetzte, an dem Cosimo die Schnecken zurückwies und beschloß, sein Schicksal von dem unseren zu trennen.
Welch ein Familiengroll sich da angesammelt hatte, wurde mir erst in der Folge klar: Damals war ich acht Jahre alt, alles kam mir vor wie ein Spiel, und der Krieg, den wir Kinder gegen die Erwachsenen führten, unterschied sich nicht von dem Krieg, der bei allen Kindern Brauch ist; ich begriff noch nicht, daß in dem Eigensinn, den mein Bruder an den Tag legte, etwas Tieferes verborgen war.
Der Baron, unser Vater, war ein unausstehlicher Mann, das steht fest, wenn er auch nicht eben böse war: Er war unausstehlich, weil sein Leben von unzeitgemäßen Gedanken beherrscht war, wie das in Übergangsperioden häufig der Fall ist. Unruhige Zeiten lassen in vielen Menschen das Bedürfnis entstehen, selber eine Unruhe zu entfalten, die allem Trotz bietet, sich abseits vom Wege vollzieht; so erhob unser Vater, während so vieles damals in den Töpfen brodelte, Ansprüche auf den Titel eines Herzogs von Ombrosa und hatte nichts anderes im Kopf als Stammtafeln und Erbfolgen und Rivalitäten und Allianzen mit benachbarten und entlegenen Potentaten.
Bei uns zu Hause lebte man daher ständig, als fände gerade Generalprobe für einen Hofbesuch statt, ich weiß nicht ob am Hofe der Kaiserin von Österreich oder des französischen Ludwig oder gar jener Turiner Bergbewohner. Wurde ein Truthahn serviert, so musterte uns unser Vater, ob wir auch beim Tranchieren und beim Ablösen des Fleisches die königlichen Vorschriften beachteten, und der Abbé nahm kaum einen Bissen, um sich nicht bei einem Vergehen erwischen zu lassen; mußte er doch unserem Vater bei seinen Strafreden sekundieren. Was den Cavaliere Rechtsanwalt Carrega anging, so blieb uns seine schwarze Seele nicht verborgen: Er ließ ganze Schenkel unter den Falten seines Türkenrocks verschwinden, um sie später, ganz wie es ihm behagte, abzunagen, während er sich im Weinberg versteckt hielt; und wir hätten unsere Hand dafür ins Feuer gelegt (obwohl es uns nie glückte, ihn auf frischer Tat zu ertappen, so behend waren seine Bewegungen), daß seine Taschen, wenn er zu Tisch kam, voller bereits abgenagter Knöchelchen waren, die er sodann an Stelle der völlig unversehrt verschwindenden Truthahnviertel auf seinem Teller zurückließ. Unsere Mutter, die Generalin, kam für das Zeremoniell nicht in Betracht, denn sie brauchte, auch wenn sie sich bei Tisch bedienen ließ, schroffe militärische Wendungen: »So! Noch ein bißchen! Gut!« — und niemand hatte etwas daran auszusetzen; aber bei uns hielt sie wenn nicht auf die Etikette so doch auf Disziplin und unterstützte den Baron tatkräftig durch ihre Befehle im Kasernenhofton: »Sitz still! Und wisch dir das Maul ab!« Die einzige, die sich in ihrem Elemente fühlte, war Battista, die Hausnonne, die das Fleisch der Masthühner Faser für Faser mit minutiöser Verbissenheit abschabte; sie benutzte hierfür bestimmte geschärfte Messerchen, die nur sie besaß, eine Art chirurgische Lanzetten. Der Baron, der sie uns doch als Beispiel hätte vorführen sollen, getraute sich nicht, sie anzuschauen, denn mit ihren hervorquellenden Augen unter den Flügeln der gestärkten Haube, mit ihren Raffzähnen in dem gelben Mäusegesichtchen jagte sie auch ihm Angst ein. Es wird daher begreiflich, weshalb die Familientafel der Ort war, an dem alle unsere Zwistigkeiten, alles, was an uns unverträglich war, und auch alle unsere Narrheiten und Heucheleien zum Vorschein kamen, und weshalb sich gerade bei Tische Cosimos Auflehnung entschied. Daher erzähle ich auch so eingehend davon; von gedeckten Tischen wird ohnedies im Leben meines Bruders nicht mehr die Rede sein, soviel steht fest.
Es war das auch die einzige Gelegenheit, bei der wir mit den Erwachsenen zusammenkamen. Den Rest des Tages verbrachte meine Mutter zurückgezogen in ihren Gemächern mit der Anfertigung von Spitzen, Stickereien und Filets; denn in Wahrheit verstand sich die Generalin allein auf diese nach altem Brauch weiblichen Arbeiten und konnte nur dadurch ihrer Leidenschaft für das Kriegswesen freien Lauf lassen. Auf diesen Spitzen und Stickereien waren in der Regel Landkarten dargestellt; unsere Mutter pflegte sie auf Kissen oder seidenen Gobelins auszubreiten und mit Nadeln und Fähnchen zu bestecken; damit markierte sie die Schlachtpläne des Erbfolgekrieges, von denen sie jede Einzelheit kannte, oder sie stickte auch Kanonen mit den verschiedenen Schußlinien, die von den Feuerschlünden ausgingen, ihren Gabelungen und Einfallswinkeln, denn sie verstand viel von Ballistik und verfügte außerdem über die ganze Bibliothek ihres Vaters mit Abhandlungen über die Kriegskunst, mit Schießtabellen und Atlanten. Unsere Mutter war eine von Kurtewitz, mit Vornamen Konradine, die Tochter des Generals Konrad von Kurtewitz, der zwanzig Jahre zuvor unsere Ländereien als Befehlshaber der Truppen Maria Theresias von Österreich besetzt hatte. Ihre Mutter war früh gestorben, weshalb sie der Vater auf seinen Feldzügen mitnahm. Daran war nichts romantisch; sie reisten mit allem Komfort, wohnten in den besten Schlössern in Begleitung eines Schwarms von Mägden, und sie selber verbrachte ihre Tage mit dem Besticken von Klöppelkissen: Wenn man erzählt, sie sei gleichfalls hoch zu Roß in die Schlacht gezogen, so sind das alles Legenden; sie ist immer ein Frauchen mit rosa Teint und Stupsnase gewesen, als welches sie in unserer Erinnerung fortlebt, aber geblieben war ihr die väterliche Passion für das Kriegshandwerk, vielleicht aus Protest gegen den Gatten.
Unser Vater gehörte zu den wenigen Edelleuten in unserer Gegend, die sich in jenem Kriege den Kaiserlichen angeschlossen hatten; den General von Kurtewitz hatte er mit offenen Armen auf seinem Gute empfangen, ihm seine Leute zur Verfügung gestellt, und um seine Hingabe an die kaiserliche Sache noch nachdrücklicher zu bekunden, hatte er Konradine geheiratet — das alles in der Hoffnung, den Herzogstitel zu erhalten, aber wie üblich hatte er auch damals kein Glück gehabt; denn die Kaiserlichen zogen bald wieder ab, und die Genuesen schröpften ihn mit Steuern. Freilich hatte er auf diese Weise eine brave Ehefrau heimgeführt: die Generalin, wie man sie nannte, nachdem ihr Vater auf dem Feldzug in die Provence gefallen war — und Maria Theresia schickte ihr ein goldenes Halsband auf einem Damastkissen. Sie war ihm eine Gattin, mit der er fast immer einigging, auch wenn sie, die in Kriegslagern groß geworden war, stets nur von Armeen und Schlachten träumte und ihm vorwarf, er sei nichts weiter als ein vom Pech verfolgter Intrigant.
Doch im Grunde lebten sie beide noch in den Zeiten des Erbfolgekrieges, sie mit all ihren Kanonen im Kopfe und er mit seinen Stammbäumen; sie, die für uns Jungen eine Offiziersstelle in irgendeinem Heer ersehnte, er, der uns statt dessen mit einer Kurfürstin des Heiligen Römischen Reiches verheiratet sah.
Dabei waren sie vortreffliche Eltern, aber so zerstreut, daß wir nahezu uns selbst überlassen aufwachsen konnten. Hatte das sein Gutes oder sein Schlechtes? Wer könnte es sagen! Cosimos Leben war derart ungewöhnlich, das meine so geregelt und bescheiden, und doch verbrachten wir gemeinsam unsere Kindheit, blieben beide gleichgültig gegenüber diesen Zornesausbrüchen der Erwachsenen und suchten unsere Wege abseits von der großen Heerstraße.
Wir kletterten auf Bäume (diese ersten unschuldigen Spiele sind jetzt in meiner Erinnerung von einem bedeutungsschwangeren prophetischen Lichte umflossen — doch wer hätte das damals gedacht?), drangen bis zu den Quellen der Bergbäche vor, indem wir von Fels zu Fels sprangen, erforschten Höhlen am Meeresufer, rutschten im Treppenhause der Villa die marmorne Balustrade hinunter. Durch eine dieser Rutschpartien kam es zu einem der ärgsten Zusammenstöße zwischen Cosimo und den Eltern, denn er wurde bestraft, zu Unrecht, wie er meinte, und seither hegte er einen Groll gegen die Familie (oder die Gesellschaft oder die Welt im allgemeinen?), der sodann in seinem Entschluß vom 15. Juni seinen Ausdruck fand.
Um die Wahrheit zu sagen, waren wir vor diesem Herunterrutschen auf der Marmorbalustrade bereits gewarnt worden, nicht aus Angst, wir könnten uns ein Bein oder einen Arm brechen, denn darum kümmerten sich unsere Eltern überhaupt nicht — und das war wohl der Grund, daß wir uns nie etwas brachen —, sondern weil wir größer und schwerer wurden und deshalb die Gefahr bestand, daß wir die Ahnenstatuen herunterrissen: Unser Vater hatte sie auf den kleinen Pfeilern, die den Abschluß jeder Treppenrampe bildeten, anbringen lassen. In der Tat hatte Cosimo bereits einen Bischof und Ururonkel mit Mitra und vollem Ornat hinuntergestürzt; er wurde bestraft und lernte seitdem zu bremsen, gerade bevor er am Ende der Rampe anlangte, und buchstäblich um Haaresbreite vor dem Anprall gegen die Statue abzuspringen. Auch ich, der ich ihm alles nachmachte, lernte diese Kunst, nur daß ich stets bescheidener und vorsichtiger war und daher schon auf der Mitte der Rampe absprang oder mit häufigen Unterbrechungen und ständigem Bremsen hinunterrutschte. Eines Tages schoß er wieder die Balustrade wie ein Pfeil hinunter, und wer kam da die Treppe herauf? Der Abbé Fauchelefleur, der gemächlich mit aufgeschlagenem Brevier einherschritt, aber starr ins Leere blickte wie ein Huhn. Hätte er doch auch jetzt vor sich hingedämmert! Doch nein, er hatte einen jener hellwachen Momente, die gleichfalls über ihn kamen und in denen ihm alle Dinge Sorge bereiteten. Er erblickt Cosimo und denkt sich: Balustrade, Statue, jetzt prallt er dagegen, dann werde auch ich ausgescholten (denn wie bei allen unseren Dummenjungenstreichen bekam auch er sein Teil ab, weil er nicht auf uns aufgepaßt hatte), und so wirft er sich auf die Balustrade, um meinen Bruder aufzufangen. Cosimo prallt gegen den Abbé, reißt ihn mit hinunter (der Abbé war ein altes Männlein, das nur aus Haut und Knochen bestand), kann nicht bremsen und stößt daher mit verdoppelter Wucht gegen die Statue unseres Ahnen Cacciaguerra Piovasco, des Kreuzfahrers ins Heilige Land, und so stürzen sie alle am Fuße der Treppe zu Boden: der Kreuzfahrer in Trümmern (er war aus Gips), der Abbé und Cosimo. Es kam zu endlosen Vorwürfen, zu Peitschenhieben, zu Strafarbeiten, zu Karzer mit Brot und kalter Suppe. Und Cosimo, der sich unschuldig fühlte, weil nicht er selbst, sondern der Abbé das Unglück hervorgerufen hatte, brach in die Schmähworte aus: »Alle Eure Ahnen können mir den Buckel hinunterrutschen, Herr Papa!«, worin sich bereits seine Berufung zum Rebellen ankündigte.
Mit unserer Schwester lag es im Grunde nicht anders. Auch sie war stets ein rebellischer und einsamer Geist gewesen, mochte ihr auch die Isolierung, in der sie lebte, nach der Geschichte mit dem Marchesino della Mela durch unseren Vater aufgezwungen worden sein. Was eigentlich damals mit dem Marchesino geschehen war, wurde nie völlig bekannt. Wie war dieser Sohn einer uns feindlichen Familie in unser Haus hineingetappt? Und warum? Um unsere Schwester zu verführen, ja, um sie zu vergewaltigen, so hieß es in dem langen Streit zwischen beiden Familien, der sich daran anschloß. In Wahrheit konnten wir uns diesen sommersprossigen Tölpel unmöglich als Verführer vorstellen, und erst recht nicht als Schänder unserer Schwester, die bestimmt stärker war als er und die berühmt dafür war, daß sie sogar mit den Stallknechten die Kraft ihrer Arme erprobte. Und außerdem: Weshalb hatte denn er solch ein Geschrei erhoben? Und wie kam es, daß ihn die Dienstboten, die zusammen mit unserem Vater herbeigeeilt waren, mit aufgerissenen Hosen antrafen, die einen Anblick boten, als hätten die Krallen einer Tigerin sie zerfetzt! Die Della Mela gaben niemals zu, daß ihr Sohn die Ehre Battistas habe antasten wollen, und lehnten es ab, ihre Zustimmung zur Heirat zu geben. So wurde unsere Schwester schließlich in unserem Hause lebendig eingesargt: in Nonnenkleidern, obwohl sie in Anbetracht ihrer zweifelhaften Berufung nicht einmal ein Gelübde als Terziarin abgelegt hatte.
Ihr boshafter Charakter fand vor allem in der Küche seinen Ausdruck. Sie kochte ausgezeichnet, da es ihr weder an Sorgfalt noch an Phantasie gebrach, den wichtigsten Gaben einer guten Köchin; aber wenn sie die Hand im Spiel hatte, wußte man nie, was für Überraschungen auf den Tisch kamen. So hatte sie einmal belegte Brote, die wirklich köstlich schmeckten, mit Mäuseleber zubereitet, was sie uns erst sagte, nachdem wir dieses Gericht schon gegessen und gelobt hatten; von Heuschreckenbeinen ganz zu schweigen, den harten, gezackten Hinterbeinchen, die mosaikartig auf einer Torte verteilt waren, und Schweineschwänzchen, die sie wie Brezeln geröstet hatte. Und ein anderes Mal ließ sie ein ganzes Stachelschwein kochen, mitsamt allen seinen Stacheln, wer weiß, warum; gewiß nur, um uns zu beeindrucken, wenn der Deckel von der Speiseplatte abgehoben wurde, denn nicht einmal sie selber, die doch sonst von all dem Zeug zu essen pflegte, das sie zubereitet hatte, wollte etwas davon versuchen, obwohl es ein knuspriges, rosa und sicherlich zartes Stachelschweinchen war. In der Tat hatte sie viele dieser grausigen Speisen mehr des Aussehens wegen ersonnen als um des Gefallens willen, den sie daran empfand, Speisen mit schaudererregendem Geschmack in unserer Gesellschaft zu verzehren. Alle diese Gerichte Battistas waren gleichsam erlesenste Kunstwerke aus tierischen und pflanzlichen Stoffen: Blumenkohlköpfe mit Hasenohren, die auf eine Halskrause aus Hasenfell gesetzt waren; oder ein Schweinskopf, aus dessen Maul, als wollte sie die Zunge herausjagen, eine rote Languste hervorkam, und die Languste hielt die Schweinszunge zwischen ihren Zangen, als hätte sie sie ausgerissen. Dann die Schnecken: Es war ihr gelungen, einer großen Zahl von Schnecken den Kopf abzutrennen, und die Köpfe, diese so weichen Schneckenköpfchen hatte sie, ich glaube mit einem Zahnstocher, jeweils auf einem kleinen Krapfen befestigt; wenn sie auf dem Tisch erschienen, glichen sie daher einem Schwarm winziger Schwäne. Und mehr noch als der Anblick dieser Leckerbissen beeindruckte der Gedanke an die fanatische Verbissenheit, die Battista bei der Vorbereitung bekundet haben mußte. Wir stellten uns ihre zarten Hände vor, während sie diese Tierkörperchen zerlegten.
Die Art und Weise, in der die Schnecken die makabre Phantasie unserer Schwester erregten, rief bei meinem Bruder und mir eine Rebellion hervor, an der sowohl unsere Solidarität mit den armen zerfleischten Tierchen wie der Abscheu vor dem Geschmack der gekochten Schnecken und unsere Unduldsamkeit gegen alles und alle beteiligt waren; so ist es denn nicht weiter verwunderlich, wenn dadurch Cosimos Tat mit allen ihren Folgen heranreifte.
Wir hatten einen Plan ausgeheckt. Sobald der Cavaliere Carrega einen Korb voller eßbarer Schnecken heimbrachte, wurden diese im Keller in ein Faß getan, damit sie dort fasten, nichts als Kleie essen und sich purgieren sollten. Wenn man die Bretter fortschob, die das Faß bedeckten, blickte man in eine Art Hölle, wo die Schnecken mit einer Langsamkeit, die schon den Todeskampf ankündigte, die Dauben heraufkrochen; sie waren umgeben von Kleieresten, Streifen geronnenen Speichels und farbigen Schneckenexkrementen, ein Andenken an die schöne Zeit in frischer Luft und im Grase. Manche hatten ihr Gehäuse völlig verlassen, streckten den Kopf vor und spreizten die Hörner, während andere ganz in sich zusammenkrochen und nur mißtrauische Fühler vorstreckten; wiederum andere bildeten ein Kränzchen wie Klatschbasen oder waren eingeschlafen und in sich verschlossen oder lagen tot da mit umgestürztem Schneckenhaus. Um sie vor der unheimlichen Köchin und uns vor ihren Gerichten zu bewahren, bohrten wir ein Loch in den Faßboden, und von dort aus zogen wir mit zerriebenen Grashalmen und Honig eine möglichst verborgene Bahn hinter Fässern und Kellergerümpel, um die Schnecken zur Flucht anzuspornen; so sollten sie zu einem Fensterchen gelangen, das auf unbestelltes und mit Gestrüpp bewachsenes Gartenland blickte.
Am nächsten Tage stiegen wir in den Keller hinunter, um die Wirkung unseres Feldzugsplans zu überprüfen, und betrachteten Wände und Zugänge im Lichte einer Kerze. »Da ist eine! … Und dort noch eine … Und schau doch, wie weit die da gekommen ist!«, denn bereits bewegte sich eine Prozession von Schnecken in kurzen Abständen auf dem Boden und an den Wänden vom Faß zum Fensterchen, wobei sie unserer Fährte folgte. »Schnell, ihr Schnecklein! Sputet euch, reißt aus!« Wir konnten nicht umhin, ihnen diese Worte zuzurufen, da wir sahen, daß sich die Tierchen ganz sachte fortbewegten, nicht ohne sinnlose Kreise auf den rauhen Kellerwänden zu ziehen — Abwege, auf die sie durch gelegentliche Ablagerungen und Schimmelpilze und Verkrustungen gelockt wurden; doch der Keller war finster, voller Gerümpel und holprig: Wir hofften, niemand könnte sie entdecken, so daß sie alle Zeit fänden zu entwischen.
Indessen durchstreifte unsere Schwester Battista, diese ruhelose Seele, des Nachts das ganze Haus, um Mäuse zu fangen, wobei sie einen Leuchter hielt und die Flinte unter den Arm geklemmt hatte. Sie kam in dieser Nacht in den Keller, und dort fiel der Schein des Leuchters auf eine Schnecke, die sich an die Decke verirrt hatte, und auf ihre Spur aus silbrigem Schleim. Ein Flintenschuß dröhnte. Wir alle sprangen in unseren Betten in die Höhe, sanken aber sogleich wieder in unsere Kissen zurück, da wir an die nächtlichen Jagden unserer Hausnonne gewöhnt waren. Doch nachdem Battista die Schnecke vernichtet hatte und ein Stück des Verputzes durch ihren unvorsichtigen Schuß herabgestürzt war, begann sie mit ihrem schrillen Stimmchen zu schreien: »Zu Hilfe! Sie entwischen alle! Zu Hilfe!« Die halbbekleideten Knechte, unser Vater, der sich mit einem Säbel bewaffnet hatte, der Abbé ohne Perücke stürzten herbei, während der Cavaliere Carrega, aus Angst vor Unannehmlichkeiten und bevor er noch irgend etwas begriffen hatte, ins Feld hinauslief, um auf einem Heuhaufen weiterzuschlafen.
Im Fackelschein machten alle Jagd auf die im Keller verstreuten Schnecken, obwohl niemand darauf erpicht war. Aber da die Hausbewohner nun einmal wach waren, erlaubte der übliche Eigendünkel es ihnen nicht, zuzugeben, daß man sie umsonst gestört hatte. Sie entdeckten das Loch im Faß und wußten sofort, daß wir die Übeltäter waren. Unser Vater eilte herbei und traktierte uns im Bett mit der Kutscherpeitsche. Schließlich — unser Rücken, unsere Hinterbacken und Beine waren mit lila Streifen bedeckt — sperrte man uns in das elende Kämmerchen, das als Karzer für uns diente.
Wir mußten darin drei Tage verbringen: mit Brot, salzigem Wasser, Ochsenschwarten und kalter Suppe (die wir zum Glück schätzten). Sodann fand, als wäre nichts geschehen, an jenem Mittag des 15. Juni das erste Familienessen statt, wobei alle pünktlich zur Stelle waren. Und was hatte unsere Schwester Battista, die Küchenaufseherin, dafür zubereitet: Schneckensuppe und Schnecken als Hauptgericht! Cosimo wollte kein einziges Schneckenhaus anrühren. »Entweder eßt ihr jetzt, oder wir sperren euch sofort wieder ins Kämmerchen!« Ich gab nach und begann diese Weichtiere hinunterzuwürgen. (Das war etwas feige von mir und hatte zur Folge, daß sich mein Bruder noch einsamer fühlte; indem er uns verließ, protestierte er auch gegen mich, der ich ihn enttäuscht hatte; aber ich war erst acht Jahre alt, und im übrigen wäre es wenig sinnvoll, meine Willenskraft — oder vielmehr die Willenskraft, die ich als kleiner Junge hätte entfalten können — mit der übermenschlichen Widerspenstigkeit zu vergleichen, die dem Leben meines Bruders das Gepräge gab.)
»Und nun?« sagte unser Vater zu Cosimo.
»Nein und nochmals nein!« rief Cosimo und stieß den Teller zurück.
»Fort von diesem Tisch!«
Doch schon hatte Cosimo uns allen den Rücken gekehrt, um den Saal zu verlassen.
»Wohin gehst du?«
Wir sahen ihm durch die Glastür nach, während er in der Vorhalle seinen Dreispitz und seinen Kinderdegen ergriff.
»Das geht euch nichts an.«
Er lief in den Garten.
Bald danach sahen wir durchs Fenster, daß er die Steineiche hinaufkletterte. Er war sehr adrett gekleidet und zurechtgemacht, so wie sein Vater wünschte, daß er trotz seiner zwölf Jahre bei Tisch erscheine: Die Haare waren gepudert, und er trug ein Band am Zöpfchen, einen Dreispitz, ein Spitzenjabot, eine grüne Joppe mit Schwalbenschwanz, malvenfarbene Strümpfchen und lange Gamaschen aus weißem Leder, die den halben Schenkel bedeckten — das einzige Zugeständnis an eine Tracht, die mehr den Bedürfnissen unseres Landlebens entsprach. (Da ich erst acht Jahre alt war, hatte man mir — außer bei festlichen Anlässen — das Pudern der Haare erlassen, desgleichen den Degen, obwohl ich ihn gern getragen hätte.) So klomm er den knorrigen Baum empor und bewegte Beine und Arme zwischen den Zweigen mit einer Sicherheit und Behendigkeit, die sich durch unsere lange gemeinsame Übung erklärte.
Ich sagte bereits, daß wir Stunden und Stunden auf den Bäumen verbrachten, und zwar nicht aus Nützlichkeitsgründen, wie so viele Jungen, die nur hinaufklettern, um Früchte oder Vogelnester zu suchen, sondern weil wir Gefallen an der Überwindung schwieriger Ausbuchtungen und Gabelungen des Stammes fanden und weil wir möglichst hoch hinauf zu gelangen und schöne Plätze zu erkunden suchten, auf denen wir verweilen konnten, um die Welt da drunten zu betrachten und den dort Vorübergehenden irgendwelche Scherze und Ausdrücke zuzurufen. Es kam mir daher ganz natürlich vor, daß — als sich der ungerechte Ingrimm gegen ihn entlud — Cosimos erster Gedanke gewesen war, die Steineiche zu erklettern, diesen uns so vertrauten Baum, der seine Zweige in Höhe der Saalfenster vorstreckte und daher die gekränkte und beleidigte Haltung meines Bruders der ganzen Familie vor Augen führte.
»Vorsicht, Vorsicht! Jetzt fällt er hinunter, der Ärmste!« rief unsere Mutter voller Angst, denn sie hätte uns zwar gerne im Artilleriefeuer gesehen, verfolgte einstweilen aber all unsere Spiele mit Sorge.
Cosimo kletterte bis zur Gabelung eines dicken Zweiges hinauf, der ihm bequem Platz bot, und dort blieb er sitzen, ließ seine Beine hinunterbaumeln, kreuzte die Arme, indem er die Hände unter die Achselhöhlen steckte, und vergrub seinen Kopf zwischen den Schultern, während ihm der Dreispitz über die Stirn rutschte.
Unser Vater neigte sich aus dem Fenster heraus. »Wenn du das Sitzen da droben satt hast, wirst du’s dir anders überlegen«, rief er ihm zu.
»Das werde ich mir nie anders überlegen«, antwortete mein Bruder von seinem Zweige.
»Sobald du herunterkommst, werde ich’s dir schon zeigen.«
»Ich komme nicht mehr herunter.« Und er hielt Wort.
2
Cosimo war auf der Steineiche. Die Zweige, hohe Brücken über dem Erdboden, bewegten sich lebhaft. Es wehte ein schwacher Wind; die Sonne schien. Die Sonne drang durch das Blätterdach, und so mußten wir die Hand vor die Augen halten, wenn wir Cosimo sehen wollten. Er aber betrachtete die Welt vom Baum aus: Alles, was man von dort oben sah, war andersartig, und schon das machte Vergnügen. Die Allee zeigte sich in einer ganz anderen Perspektive und so auch die Gartenbeete, die Hortensien, die Kamelien, das Eisentischchen, das zum Kaffeetrinken im Garten diente. Weiter in der Ferne wurde das Laubwerk der Bäume spärlicher, und das Gartenland ging in kleine stufenförmige Felder über, die von Steinmauern umschlossen waren; Ölbäume bildeten die dunkle Rückwand, dahinter erstreckten sich die verblaßten Ziegel- und Schieferdächer der Ortschaft Ombrosa, und dort, wo unter ihr der Hafen lag, kamen Rahen und Masten zum Vorschein. Im Hintergrunde dehnte sich mit hohem Horizont das Meer, auf dem langsam ein Segelschiff vorüberzog.
Jetzt traten der Baron und die Generalin nach dem Kaffee in den Garten hinaus. Sie betrachteten einen Rosenstrauch und gaben sich den Anschein, als schenkten sie Cosimo keine Beachtung. Sie reichten einander den Arm, aber dann trennten sie sich plötzlich, um sich zu besprechen und zu gestikulieren. Ich hingegen begab mich unter die Steineiche und tat, als spielte ich für mich, suchte aber in Wahrheit Cosimos Aufmerksamkeit auf mich zu lenken; er indessen grollte mir noch immer und blickte weiter von dort oben in die Ferne. So hörte ich auf und kauerte mich hinter einer Gartenbank nieder, um ihn ungesehen von dort beobachten zu können.
Mein Bruder stand da wie auf Posten. Er sah alles, und alles war wie nichts. Zwischen den Zitronenbäumen ging eine Frau mit einem Tragkorb vorüber. Den Abhang herauf kam ein Maultiertreiber, der sich am Schwanz des Maultieres festhielt. Sie erblickten einander nicht; als die Frau den Hufschlag hörte, wandte sie sich um und neigte sich zur Straße, aber es war zu spät. Darauf begann sie zu singen, aber der Maultiertreiber hatte bereits die Biegung erreicht, spitzte die Ohren, klatschte mit der Peitsche und rief dem Maultier ein »Aah!« zu. Und damit hatte alles ein Ende. Cosimo sah sie alle beide.
Der Abbé Fauchelefleur schritt mit offenem Brevier die Allee hinunter. Cosimo brach etwas von seinem Zweig ab und ließ es ihm auf den Kopf fallen; der Abbé wußte nicht, was es war: vielleicht eine kleine Spinne oder ein Stückchen Rinde; er hob es nicht auf. Cosimo stocherte sodann mit seinem Degen in einem Astloch herum. Heraus kam eine wütende Wespe; Cosimo verjagte sie, indem er seinen Dreispitz schwenkte, und folgte ihr mit den Augen bis zu einer Kürbispflanze, in der sie sich verkroch. Hurtig wie immer verließ der Cavaliere das Haus, stieg das Gartentreppchen empor und verschwand zwischen den Rebenreihen des Weinbergs. Um festzustellen, wohin er sich begab, schwang sich Cosimo auf einen anderen Zweig. Dort war ein Schwirren zwischen dem Blattwerk zu hören: Eine Amsel flog auf. Cosimo war deswegen ungehalten, da er schon so lange dort oben gehockt hatte, ohne sie zu bemerken. Er blickte weiter gegen das Licht, da er sehen wollte, ob dort noch weitere Amseln waren. Nein, es waren keine da.
Die Steineiche stand neben einer Ulme; die beiden Blattkronen berührten einander beinahe. Ein Ast der Ulme erstreckte sich im Abstande von einem halben Meter über einen Zweig des anderen Baumes; es war für meinen Bruder ein leichtes, hinüberzuspringen und auf diese Weise den Wipfel der Ulme zu erreichen, die wir noch niemals erforscht hatten; denn ihr glatter Stamm war sehr hoch, so daß sie sich vom Boden aus nur schwer erklettern ließ. Während er sodann ständig danach Ausschau hielt, wo ein Ast unmittelbar neben den Ästen eines anderen Baumes herlief, wechselte er auf einen Johannisbrotbaum und danach auf einen Maulbeerbaum über. Auf diese Weise sah ich Cosimo von einem Ast zum anderen gelangen und gleichsam schwebend den Garten überqueren.
Einige Äste des großen Maulbeerbaums stießen an die Umfassungsmauer unseres Parks oder reichten in den Garten hinein, der den Ondarivas gehörte. Obwohl wir Nachbarn waren, wußten wir nichts von den Marchesi d’Ondariva und Edelleuten von Ombrosa; da sie nämlich seit mehreren Generationen im Genuß gewisser Lehensrechte waren, auf die unser Vater Ansprüche erhob, trennte ein gegenseitiger Groll die beiden Familien, ebenso wie eine hohe Mauer, die wie eine Festungsbastion anmutete, unsere beiden Parks voneinander schied. Ich weiß nicht, ob unser Vater oder der Marchese sie hatte errichten lassen. Es kam noch hinzu, daß die Ondarivas ihren Garten wie ihren Augapfel hüteten. Wie man sich erzählte, befanden sich darin nie gesehene Pflanzenarten. In der Tat hatte bereits der Großvater des jetzigen Marchese, ein Schüler Linnés, die ganze weitverzweigte Verwandtschaft der Familie an den Höfen Frankreichs und Englands aufgeboten, um sich die kostbarsten botanischen Raritäten aus den Kolonien senden zu lassen, und jahrelang hatten daher die Schiffe Säcke mit Sämereien, Bündel von Schößlingen, in Töpfen eingepflanzte Büsche und sogar ganze Bäume, deren Wurzeln von riesigen Erdballen umgeben waren, in Ombrosa ausgeladen; so war schließlich — wie man sich erzählte — ein Wald in diesem Garten herangewachsen, der eine Mischung der Wälder Westindiens und Amerikas, ja vielleicht sogar Neuhollands darstellte.
Alles was wir hiervon zu sehen bekamen, waren dunkle Blätter, die an den Rand der Mauer stießen; sie gehörten einer Pflanze, die kürzlich aus den amerikanischen Kolonien eingeführt worden war: der Magnolie, die über schwarzen Zweigen eine fleischige weiße Blüte entfaltete. Von unserem Maulbeerbaum aus erreichte Cosimo den Mauerkranz, balancierte darauf ein paar Schritte und schwang sich sodann, indem er sich mit den Händen festklammerte, auf die andere Seite hinüber, wo sich die Blätter und die Blüte der Magnolie befanden. Dort entschwand er meinen Blicken, und das, was ich jetzt berichten werde, hat er mir später erzählt, wie vieles, was in dieser Schilderung seines Lebens enthalten ist, sofern ich es nicht selber spärlichen Zeugnissen und Hinweisen entnommen habe.
Cosimo befand sich auf der Magnolie. Trotz ihres dichten Gezweigs konnte ein Junge wie mein Bruder, der sich in allen Baumarten auskannte, sie gut erklimmen; auch trugen ihre Äste sein Gewicht. Freilich waren sie nicht sehr dick und bestanden aus weichem Holze, das Cosimos Schuhe abschälten, indem sie der schwarzen Rinde weiße Wunden schlugen. Zugleich umfing den Knaben der frische Duft der Blätter, während der Wind sie bewegte und bald das stumpfe, bald das leuchtende Grün ihrer Seiten hervorkehrte.
Doch der ganze Garten duftete, und wenn ihn Cosimo auch noch nicht überblicken konnte — so unregelmäßig war seine Dichte —, erforschte er ihn doch schon mit der Nase und versuchte, seine verschiedenen Wohlgerüche zu unterscheiden; freilich waren sie ihm bereits von den Zeiten her bekannt, da sie, vom Winde getragen, bis in unseren Garten drangen und uns mit dem Geheimnis jenes Parks unlösbar verbunden erschienen. Sodann betrachtete er das Laub und gewahrte neue Blätter: manche groß und glitzernd, als wäre ein Wasserschleier über sie hinweggelaufen, andere winzig und behaart, dazu ganz glatte und ganz schuppige Stämme.
Es war sehr still. Nur kleine Zaunkönige flogen zwitschernd auf. Und ein Stimmchen war zu hören, das sang: »O lala … o la balançoire …« Cosimo blickte hinab. An einem großen Baum in seiner Nähe war eine Schaukel befestigt, auf der ein ungefähr zehnjähriges Mädchen saß.
Es war ein blondes Mädchen mit hochgekämmtem Haar, was in Anbetracht seines Alters etwas komisch aussah; auch das blaue Kleid wirkte zu erwachsen, und der beim Schaukeln hochgeraffte Unterrock war überreich mit Spitzen besetzt. Die Kleine hatte die Augen halb geschlossen und hielt die Nase in die Luft, als sei sie gewohnt, die große Dame zu spielen; sie knabberte an einem Apfel und neigte bei jedem Biß den Kopf der Hand entgegen, die den Apfel umklammern und sich zugleich am Seil der Schaukel festhalten mußte; jedesmal, wenn die Schaukel den Tiefpunkt ihrer Bahn erreichte, stieß sie sich ab, wobei sich die Spitzen ihrer Schuhchen ins Erdreich bohrten, und blies sich die Schalenreste der verzehrten Apfelstücke von den Lippen; zugleich sang sie: »O la la la … O la balançoire …«, wie ein kleines Mädchen singt, das sich aus Schaukel und Lied und Apfel schon nichts mehr macht (wenn ihm auch der Apfel noch etwas wichtiger ist) und das bereits andere Gedanken im Kopfe hat. Cosimo hatte sich vom Gipfel der Magnolie bis zur untersten Astreihe hinuntergelassen, und nun stand er mit seinen Füßen auf je einer Astgabel und stützte beide Ellbogen auf einen vor ihm liegenden Ast, wie auf ein Fensterbrett. Die Schwünge der Schaukel trugen ihm das Mädchen bis dicht unter die Nase.
Sie gab nicht acht und hatte ihn nicht bemerkt. Auf einmal sah sie ihn dort, aufrecht auf dem Baume, mit Dreispitz und Gamaschen. »Oh!« sagte sie. Der Apfel fiel ihr aus der Hand und rollte unter die Magnolie. Cosimo zückte seinen Degen, neigte sich vom letzten Ast hinunter, erreichte den Apfel mit der Degenspitze, spießte ihn auf und streckte ihn dem Mädchen hin, das inzwischen die ganze Schaukelstrecke durchmessen hatte und sich an der gleichen Stelle wie eben befand. »Nehmen Sie ihn nur, er ist nicht schmutzig geworden, nur auf der einen Seite etwas eingedrückt!«
Das blonde Mädchen bereute bereits, daß es über den unbekannten kleinen Jungen dort auf der Magnolie so verdutzt gewesen war, und hatte seine hochnäsige Haltung wieder eingenommen. »Sind Sie ein Dieb?« fragte es.
»Ein Dieb?« sagte Cosimo gekränkt; dann dachte er darüber nach: In gewisser Hinsicht gefiel ihm der Gedanke. »Ja, das bin ich«, antwortete er und zog sich den Dreispitz über die Stirn. »Haben Sie etwas dagegen?«
»Und was wollen Sie hier stehlen?«
Cosimo betrachtete den Apfel, den er auf die Spitze seines Degens gespießt hatte; dann fiel ihm ein, daß er hungrig war und bei Tisch kaum eine Speise angerührt hatte. »Diesen Apfel«, sagte er und begann, ihn mit der Klinge seines Degens zu schälen, die er entgegen den häuslichen Verboten stets äußerst scharf zu halten pflegte.
»Dann sind Sie also ein Obstdieb«, bemerkte die Kleine.
Mein Bruder mußte an die Rotten ärmlicher Halbwüchsiger aus Ombrosa denken, die über Mauern und Zäune kletterten und Obstbäume plünderten; man hatte ihm beigebracht, diese Banden zu verachten und zu fliehen; nun kam ihm zum erstenmal die Idee, wie frei und beneidenswert dieses Dasein sein müßte. Wahrhaftig: Vielleicht könnte er sich ihnen anschließen und fortan ein solches Leben führen! »Ja«, sagte er. Er hatte den Apfel in Stücke geschnitten und begann, ihn zu kauen.
Das blonde kleine Mädchen brach in ein Lachen aus, das anhielt, während die Schaukel einmal hinauf- und hinunterschwang. »Was Sie nicht sagen! Die Jungen, die Obst stehlen, die kenn ich! Sie alle sind meine Freunde. Aber die laufen in Hemdsärmeln und unfrisiert, nicht mit Gamaschen und Perücken.«
Mein Bruder wurde so rot wie die Schale des Apfels. Daß er nicht nur wegen seiner gepuderten Haare, auf die er gar nichts gab, sondern auch wegen seiner Gamaschen, die ihm wert und teuer waren, verspottet wurde und daß man sein Aussehen abfälliger beurteilte als die Aufmachung eines Obstdiebs und jenes Gesindels, dem man noch kurz zuvor seine Verachtung bezeigt hatte, und vor allem die Entdeckung, daß dieses Dämchen, das sich im Garten der Ondarivas als Herrin aufspielte, mit allen Obstdieben auf freundschaftlichem Fuße stand, nicht aber mit ihm — das alles erfüllte ihn mit Groll, Scham und Eifersucht.
»O la la la … Mit Gamaschen und Perücke«, trällerte das Mädchen auf der Schaukel vor sich hin.
Sein Stolz begann sich wieder zu regen. »Ich bin kein Dieb, wie Sie meinen«, rief er, »ich bin überhaupt kein Dieb! Ich habe das nur gesagt, um Sie nicht zu erschrecken; denn wüßten Sie, wer ich in Wahrheit bin, Sie würden vor Angst sterben: Ich bin ein Brigant, ein schrecklicher Brigant!«
Das kleine Mädchen schaukelte weiter bis unter seine Nase; es sah so aus, als hätte es ihn mit den Fußspitzen streifen wollen. »Ach, gehn Sie doch! Und wo ist denn die Flinte? Alle Briganten haben eine Flinte oder eine Donnerbüchse! Ich hab sie gesehen! Sie haben schon fünfmal auf der Fahrt vom Schloß hierher unsere Kutsche angehalten.«
»Aber nicht ihr Hauptmann. Ich bin ihr Hauptmann. Der Brigantenhauptmann hat keine Flinte. Er hat bloß einen Degen«, und damit streckte er seinen Kinderdegen vor.
Das Mädchen zuckte abweisend die Achseln. »Der Brigantenhauptmann«, erläuterte es, »ist ein gewisser Gian dei Brughi, der uns Weihnachten und Ostern immer Geschenke bringt.«
»Ach so!« rief Cosimo, in dem plötzlich der Familiengroll aufwallte. »Dann hat mein Vater also recht, wenn er sagt, der Marchese d’Ondariva sei der Beschützer aller Briganten und Schmuggler in der ganzen Gegend!«
Die Kleine kam nah an den Boden heran, und statt sich wieder abzustoßen, bremste sie schnell mit den Beinen und sprang hinunter. Die leere Schaukel schnellte an ihren Seilen in die Luft. »Kommen Sie sofort von dort oben herunter! Wie konnten Sie sich erdreisten, unseren Boden zu betreten!« sagte sie und zeigte erbost mit dem Finger auf den Knaben.
»Ich habe ihn nicht betreten und werde nicht hinunterkommen«, erwiderte Cosimo ebenso hitzig, »und das wird auch um alles Gold in der Welt nie geschehen.«
Das Mädchen ergriff darauf gleichmütig einen Fächer, der auf einem Korbsessel lag, und fächelte sich, obwohl es nicht sehr heiß war, Kühlung zu, während es auf und ab schritt. »Jetzt werde ich die Dienstboten rufen«, bemerkte es in aller Ruhe, »und Sie ergreifen und verprügeln lassen. So werden Sie schon lernen, was das Sicheinschleichen auf unseren Grund und Boden für Folgen hat.« Ständig schlug diese Kleine einen anderen Ton an, was meinen Bruder jedesmal außer Fassung brachte.
»Wo ich bin, da ist kein Grund und Boden, und es gehört euch auch nicht!« verkündete Cosimo und fühlte sich versucht hinzuzufügen: »Und außerdem bin ich der Herzog von Ombrosa und Herr über das ganze Gebiet!«, aber er hielt an sich, denn er wiederholte nicht gern die Worte, die sein Vater ständig im Munde führte, zumal er jetzt im Streit mit ihm vom Tisch fortgelaufen war; er fand keinen Gefallen daran und hielt es auch deshalb für unangebracht, weil ihm diese Ansprüche immer als Hirngespinste erschienen waren; wie kam er, Cosimo, nunmehr dazu, sich als Herzog aufzuspielen? Aber er wollte sich nicht selber Lügen strafen und fuhr fort in seiner Rede, wie es ihm gerade in den Sinn kam. »Hier ist nicht euer Gebiet«, wiederholte er, »denn nur der Boden gehört euch, und nur wenn ich ihn betreten würde, wäre ich ein Eindringling. Hier oben aber bin ich es nicht, und so gehe ich überall hin, wo es mir gefällt.«
»Dann gehört das also dir, da oben …«
»Natürlich! Alles hier oben ist mein persönliches Gebiet« — und damit deutete er mit einer unbestimmten Geste auf die Zweige, auf die Blätter, hinter denen die Sonne stand, auf den Himmel. »Auf den Zweigen der Bäume ist alles mein Gebiet. Sag nur, sie sollen mich greifen, wenn es ihnen gelingt!«
Jetzt, nach all den Aufschneidereien, wartete er drauf, daß sie sich wer weiß wie über ihn lustig machen würde. Statt dessen zeigte sie sich überraschend interessiert.
»Ja, wirklich? Und wie weit reicht denn dein Gebiet?«
»So weit, wie man auf den Bäumen gelangen kann: bis dahin, bis dorthin, über die Mauer hinweg, in den Olivenhain, bis zu den Hügeln, bis zur anderen Seite der Hügel, bis in den Wald, in das Gebiet des Bischofs …«
»Auch bis nach Frankreich?«
»Bis nach Polen und Sachsen«, sagte Cosimo, dessen geographische Kenntnisse nur aus den Namen bestanden, die er von unserer Mutter hörte, wenn sie vom Erbfolgekrieg erzählte.
»Ich bin aber kein solcher Egoist wie du. Ich lade dich in mein Gebiet ein!«
Unterdessen waren sie beide dazu übergegangen, sich zu duzen, aber sie hatte damit begonnen. »Und wem gehört denn die Schaukel?« sagte sie und setzte sich darauf, mit dem geöffneten Fächer in der Hand.
»Die Schaukel gehört dir«, bestimmte Cosimo, »aber da sie an diesen Ast angebunden ist, untersteht sie immer mir. Wenn du also den Boden mit den Füßen berührst, bist du auf deinem Gebiet; wenn du dich in die Luft erhebst, bist du in meinem.«
Sie stieß sich ab und flog dahin, die Hände an die Seile gepreßt. Cosimo sprang von der Magnolie auf den dicken Ast, an dem die Schaukel befestigt war, und von dort aus packte er die Seile und zog an ihnen. Die Schaukel schwang immer höher.
»Hast du Angst?«
»Ich nicht! Wie heißt du denn?«
»Cosimo. Und du?«
»Violante, aber man nennt mich Viola.«
»Mich heißen sie Mino, weil Cosimo ein Name für große Leute ist.«
»Das mag ich nicht.«
»Was? Cosimo?«
»Nein, Mino.«
»Ach so. Du kannst mich ja Cosimo nennen.«
»Fällt mir nicht im Traum ein. Hör zu! Wir müssen zu klaren Abmachungen kommen.«
»Was sagst du?« fragte er und hatte wiederum ein unbehagliches Gefühl.
»Ich sage: Ich habe das Recht, zu dir hinaufzusteigen, und bin dann unverletzlich als dein Gast, einverstanden? Ich kann kommen und gehen, wann ich will. Du hingegen bist unverletzlich und unantastbar, wenn du dich auf den Bäumen, also auf deinem Gebiet, aufhältst; sobald du aber den Boden meines Gartens berührst, bist du mein Sklave und wirst in Ketten gelegt.«
»Nein, ich komme nicht in deinen Garten hinunter, und nicht einmal in meinen. Der ganze Boden ist für mich Feindgebiet. Du kannst mich hier oben besuchen, und auch deine Freunde, die Obstdiebe, vielleicht auch mein Bruder Biagio, obwohl er ein ziemlicher Feigling ist, und dann sind wir zusammen eine Armee auf den Bäumen und bringen die Erde und ihre Bewohner zur Räson.«
»Nein, nein, nichts von alledem! Laß dir erklären, wie die Dinge stehn. Du herrschst über die Bäume, aber wenn du einmal die Erde mit einem Fuß berührst, verlierst du dein ganzes Reich und bleibst der niedrigste der Sklaven. Hast du verstanden? Ach, wenn dir ein Ast zerbricht und du fällst, ist alles verloren!«
»Ich bin noch niemals im Leben vom Baum gefallen!«
»Freilich, aber wenn du fällst — wenn du fällst, wirst du zu Staub und Asche, und der Wind trägt dich fort.«
»Alles Märchen. Ich falle nicht hinunter, weil ich nicht will.«
»Ach, du bist langweilig.«
»Nein, nein, wir wollen spielen! Könnte ich zum Beispiel etwas schaukeln?«
»Gewiß, wenn’s dir gelingt, dich auf die Schaukel zu setzen, ohne daß du den Boden berührst.«
Neben Violas Schaukel befand sich, an demselben Ast befestigt, noch eine zweite, die aber mittels eines Knotens an den Seilen hochgezogen war, damit beide nicht zusammenstoßen sollten. Cosimo ließ sich vom Ast herunter, indem er eines der Seile umklammerte — eine Übung, in der er sich sehr hervortat, da ihn meine Mutter viel Gymnastik treiben ließ; so erreichte er den Knoten, knüpfte ihn auf, stellte sich mit beiden Füßen auf die Schaukel, und um in Schwung zu kommen, verlagerte er sein Gewicht, ging in die Knie und schnellte sich nach vorn. Auf diese Weise stieß er sich immer höher. Die beiden Schaukeln schwangen in entgegengesetzter Richtung; nunmehr hatten sie die gleiche Höhe erreicht und zogen auf halbem Wege aneinander vorbei. »Versuch doch mal, dich hinzusetzen und dich mit den Füßen abzustoßen, dann kommst du höher!« suchte ihm Viola einzuflüstern.
Cosimo schnitt ihr eine Grimasse.
»Komm herunter und stoß mich ab, sei doch brav!« flötete sie und lächelte ihm zu.
»Aber nein, wir hatten doch ausgemacht, daß ich auf keinen Fall herunterkommen darf …«; und wiederum blieb sie ihm unverständlich.
»Sei doch lieb …«
»Nein!«
»Na sieh doch! Beinah wärst du heruntergefallen. Mit einem Fuß auf dem Boden hättest du schon alles verloren.«
Viola sprang von ihrer Schaukel und begann Cosimos Schaukel sachte anzustoßen. »Uh!« Auf einmal hatte sie den Sitz der Schaukel, auf dem mein Bruder stand, gepackt und umgestürzt. Es war ein Glück, daß Cosimo sich unausgesetzt an den Seilen festhielt. Sonst wäre er hinuntergepurzelt wie eine Salamiwurst.
»Verräterin!« schrie er und kletterte nach oben, wobei er sich an beide Taue klammerte, aber der Aufstieg war weit schwieriger als der Abstieg, vor allem da das junge Mädchen einen seiner boshaftesten Augenblicke hatte und mit aller Macht von unten an den Stricken zog. Schließlich erreichte er den dicken Ast und setzte sich rittlings darauf. Mit seinem Spitzenkragen trocknete er sich den Schweiß von der Stirn.
»Haha, du hast es nicht geschafft!«
»Aber beinah!«
»Und ich meinte, du seist meine Freundin!«
»Hast du dir gedacht!«, und wieder begann sie sich zu fächern.
»Violante«, rief in diesem Augenblick eine scharfe Frauenstimme, »mit wem sprichst du denn da?« Auf dem weißen Treppchen, das ins Haus führte, war eine Dame erschienen: hager, in einem sehr weiten Rock; sie blickte durch eine Lorgnette. Eingeschüchtert entschwand Cosimo im Laub.
»Mit einem Jungen, ma tante«, antwortete das kleine Mädchen, »einem Jungen, der auf einem Baumwipfel geboren ist und aus Zauberei nicht den Erdboden betreten kann.«
Cosimo war ganz rot geworden und fragte sich im stillen, ob das Mädchen so sprach, um sich vor der Tante über ihn lustig zu machen, oder ob es nur das Spielen fortsetzen wollte oder ob er selber oder die Tante und das Spiel ihm völlig gleichgültig waren. Zugleich spürte er, wie ihn die Dame durch ihr Augenglas musterte; sie war näher an den Baum herangetreten, um ihn wie einen seltsamen Papagei zu betrachten. »Uh, mais c’est un des Piovasques, ce jeune homme, je crois. Viens, Violante!«
Cosimo verging fast angesichts dieser Demütigung. Daß sie ihn so ohne weiteres erkannt hatte, ohne sich auch nur die Frage zu stellen, weshalb er sich eigentlich dort befand; daß sie das Mädchen sofort in entschiedenem Ton, aber ohne Strenge zurückgerufen hatte und daß Viola bereitwillig, ohne sich auch nur umzudrehen, der Tante gehorchte — aus alledem schien ihm hervorzugehen, daß er überhaupt nicht für voll genommen wurde, sozusagen gar nicht existierte. Auf diese Weise versank dieser ungewöhnliche Nachmittag in einer Wolke der Scham.
Doch sieh da: Das Mädchen macht der Tante ein Zeichen, die Tante neigt den Kopf, das Mädchen flüstert ihr etwas ins Ohr. Die Tante richtet die Lorgnette wieder auf Cosimo. »Nun, junger Herr«, spricht sie ihn an, »wollen Sie nicht eine Tasse Schokolade mit uns trinken? So können wir beide uns kennenlernen, da Sie ja schon« — und damit blickte sie Viola von der Seite an — »ein Freund der Familie sind!«