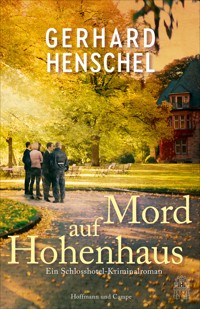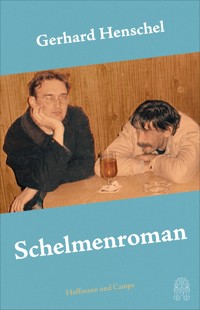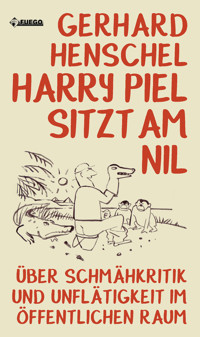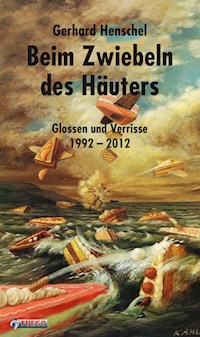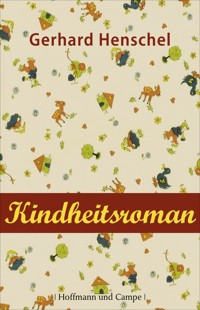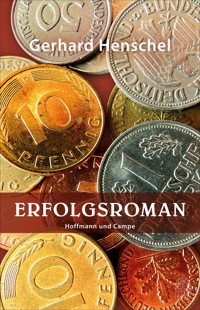
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Martin Schlosser
- Sprache: Deutsch
Sie zog Das Kapital aus dem Regal. ›Hab ich auch mal zu lesen versucht. Schön und gut, aber irgendwie hätte ich gedacht, es müssten mehr Indianer drin vorkommen …‹ Die junge Frau, die sich für Marx interessiert, ist die Anglistikstudentin Kathrin Passig aus Regensburg. Martin Schlosser lernt sie Anfang der neunziger Jahre als Gewinnerin eines von ihm selbst organisierten Preisausschreibens für das Satiremagazin Kowalski kennen. Dort ist er inzwischen als freier Mitarbeiter tätig. Und weil auch der Merkur, die Frankfurter Rundschau und konkret seine Texte drucken, kann er endlich vom Schreiben leben. Von nun an steht er nicht mehr hinter dem Tresen einer friesischen Rumpeldiscothek, sondern geht als Reporter auf Reisen: etwa zu einem Jonglierfestival in Oldenburg, zur Wiedervereinigungsfeier vor dem Berliner Reichstag oder zu einem Atheisten-Kongress in Fulda. Nebenbei kümmert er sich um seine Großmutter in Jever, besucht hin und wieder seinen Vater in Meppen oder tummelt sich auf Tantra-Workshops. Dann zieht es ihn wieder nach Berlin. Alles wendet sich jetzt, wie es scheint, zum immer Besseren: Verleger bieten ihm Buchverträge an, es gibt Einladungen zu Lesungen, die Nächte werden länger, und das Leben ist schön.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 798
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Gerhard Henschel
Erfolgsroman
Hoffmann und Campe
Erfolgsroman
Astern, Rittersporn, Levkojen, Kornblumen, Tagetes, Chrysanthemen, Löwenmäulchen, Klatschmohn, Ringelblumen, Bechermalven, Veilchen, Kapuzinerkresse und Vergißmeinnicht: Ich schüttete alle Samenkörner zusammen, rührte sie durcheinander und verstreute sie dann auf dem Acker, den ich umgegraben hatte. Eine schöne bunte Blumenwiese sollte dort erblühen.
Auf der anderen Hälfte meines Gartenstücks hatte ich Rasen ausgesät. Die Halme sprossen schon.
2948 Schortens, Stadtteil Heidmühle, Margarethenweg 121: Irgendwann würde aus einer Gedenktafel hervorgehen, daß hier der Schriftsteller Martin Schlosser Wurzeln geschlagen hatte, als Mieter einer Vierzimmerwohnung im ersten Stock. Daß ich mir diese Bleibe mit zwei tamilischen Flüchtlingen hatte teilen müssen, nachdem ich von meiner Freundin sitzengelassen worden war, brauchte auf der Tafel nicht unbedingt draufzustehen. Das gehörte in den Fußnotenapparat, den meine Biographen anlegen würden.
In den Namensregistern kämen dann auch meine Vermieter vor: Antje und Frerk Ricklef. Und Rainer Dickhoff – der Gastwirt, in dessen Disco in Jever ich noch gelegentlich kellnerte. Und natürlich Oma Jever:
Emma Lüttjes (*1906) hatte das Glück, daß ihr Enkelsohn Martin Schlosser, nachdem er 1989 in ihre Nähe gezogen war, zweimal wöchentlich für sie einkaufen ging. Sie bewohnte damals als Witwe eine Dreizimmerwohnung im jeverschen Dannhalmsweg und mußte zwei schwere Schicksalsschläge verkraften: Im April 1989 hatte ihr ältester Enkelsohn Gustav Lüttjes sich das Leben genommen, und im November des gleichen Jahres war ihre älteste Tochter, Ingeborg Schlosser, Martin Schlossers Mutter, an Krebs gestorben. Trotzdem büßte Emma Lüttjes ihre Lebensfreude nicht vollständig ein. Sie hatte oft ihre anderen vier Töchter zu Besuch – Therese, Gisela, Luise und Dagmar –, und ihr Appetit war ungebrochen. Zu ihren Leibgerichten gehörten Smoortaal, Putengulasch, Labskaus und Granat. Während die hohe Qualität ihrer Kochkunst über jeden Zweifel erhaben bleibt, deutet die Quellenlage darauf hin, daß sie eine lausige Malefizspielerin war und ihren Enkel Martin nur ungefähr jedes dreißigste Mal schlagen konnte.
So würde es im Kürschner stehen. Oder im Munzinger-Archiv. Wo dann auch ein Eintrag über Papa fällig wäre:
Richard Schlosser (*1927), Vater von Martin Schlosser, brach nach dem Tod seiner Frau Ingeborg fast alle Kontakte zu seiner Familie ab und verschanzte sich in seinem Haus in der niedersächsischen Kleinstadt Meppen. Mit dem beruflichen Erfolg seiner Töchter, der Grundschullehrerin Renate und der NDR-Sekretärin Wiebke, konnte er zwar zufrieden sein, aber es ärgerte ihn, daß sein Sohn Volker für eine Softwarefirma arbeitete, ohne sein Maschinenbaustudium abgeschlossen zu haben, und daß sein zweiter Sohn Martin sein Germanistikstudium abgebrochen hatte und sich als freier Schriftsteller zu etablieren versuchte. »Der Leichtsinn, mit dem Du heute zu Werke gehst, wird Dir eines Tages heimgezahlt werden«, schrieb Richard Schlosser seinem Sohn im Januar 1990. »Nicht mehr von mir, sondern von der Gesellschaft, in der Du dann lebst. Gesundheit ist kein unvergänglich Gut. Herr, lehre uns bedenken, daß wir sterben müssen!«
Nachdem wir jeder eine große Portion Seelachs mit Pellkartoffeln und Gurkensalat verputzt hatten, las ich Oma in ihrem Eßzimmer wieder ein paar Seiten aus Walter Kempowskis Roman »Tadellöser & Wolff« vor. Das hatte sich so eingebürgert.
Wie Walters Bruder Robert da im Kinderzimmer das Bild von einer Bauernstube mit Hühnern abgehängt und stattdessen Porträts von Jazzgrößen angepinnt hatte:
Warum er das tue, fragte meine Mutter.
»Das will ich dir ganz genau sagen«, antwortete mein Bruder, »einzig und allein aus dem einfachen Grunde, weil wir uns das lange genug angekuckt haben. Da kriegt man ja ’n ganz verqueren Blick.«
Das begriff selbst Oma, die sonst aber treu an allem festhielt, was bei ihr seit dem Miozän an den Wänden hing: die Gemälde von Arthur Eden-Sillenstede, die kleine Trompete aus den Tagen des Weltkriegs, der Jahreskalender des Ostfriesland Magazins und das Holzdings mit der Aufschrift, über die Mama sich immer so aufgeregt hatte:
Ein guter Gast ist niemals Last!
Ich kümmerte mich dann um die Küche, während Oma ihren Mittagsschlaf hielt.
Tante Hanna hatte mir zweihundert Mark überwiesen. Aus lauter Liebe. Und ich brauchte jeden Pfennig, weil es mit der Zahlungsmoral des Hamburger Satiremagazins Kowalski, für das ich schrieb, nicht zum besten bestellt war. Hin und wieder kam ein Scheck hereingeflattert, aber nicht so regelmäßig, wie ich die Redaktion mit neuen Texten versorgte.
In einem den Äther verpestenden Schlager besangen zwei dicke Wonneproppen in Trachtenjankern ihre Unentschiedenheit zwischen Wein und Weib:
Herzilein, du mußt nicht traurig sein,
ich weiß, du bist nicht gern allein,
und schuld war doch nur der Wein …
Dafür hätten ihnen die Stimmbänder gekappt gehört.
Über seine Erlebnisse im Ersten Weltkrieg hatte der Schriftsteller Georg von der Vring in den zwanziger Jahren den Roman »Soldat Suhren« geschrieben, und zwar in Jever, wo er damals als Zeichenlehrer tätig gewesen war. Jetzt sollte der Roman neu aufgelegt werden, und weil Oma sich dafür interessierte, bestellte ich ihn bei Tolksdorf. Sonst las sie immer nur Bücher von Johannes Mario Simmel und Utta Danella und ähnlichen Schmus.
Da ich inzwischen der Künstlersozialkasse angehörte (an die ich monatlich 79,32DM abführen mußte), brauchte ich nicht mehr so zu tun, als würde ich noch studieren. Ich fuhr nach Oldenburg und exmatrikulierte mich, und dann fuhr ich weiter nach Meppen und besuchte Papa im Krankenhaus Ludmillenstift. Eigentlich sollte dort nur sein gebrochener Arm behandelt werden, aber die Ärzte schienen Gefallen an Papa gefunden zu haben und wollten ihn gar nicht wieder hergeben.
»Und ist Post für mich gekommen?« fragte er.
»Nein. Bloß Reklamesendungen.«
In Marco Ferreris Verfilmung der Storys von Charles Bukowski zeigte Ornella Muti abends auf RTL plus ihre Brüste, ihr Hinterteil und ihre Muschi vor, was zwar hübsch aussah, aber schauspielkünstlerisch auch nicht mehr hermachte als die Stripteasenummern, mit denen Helmut Kohls geliebte Privatsender die geistig-moralische Wende herbeizuzwingen versuchten.
Die Lektüre der Meppener Tagespost glich einer Geisterbahnfahrt durch alle Schrecken der Provinz: »Blutzuckermeßgeräte vorgestellt«, »Müll brannte«, »Wochenmarkt verlegt«, »Sozialamt geschlossen«, »Frauengymnastik fällt aus«.
Say okay, I have had enough, what else can you show me?
Ich stattete Papa einen weiteren Besuch ab, bevor ich mich wieder nach Heidmühle aufmachte, mit seinem Jetta, an dessen Rückspiegel sich unten ein Schalter befand, mit dem sich der Spiegel so einstellen ließ, daß man dem Fahrer, der hinter einem fuhr, nicht in die Fresse zu kucken brauchte. Eine geniale Erfindung. Wenn mir irgendwas verhaßt war, dann die dämlichen Visagen der Autofahrer, denen ich nicht schnell genug fuhr.
Regnerisch war’s. Das richtige Wetter für einen Anfall von Liebeskummer. Es war mir immer noch schleierhaft, wieso Andrea sich von mir getrennt hatte. Nach fünf glücklichen Jahren. In tiefer Armut, zugegeben, aber jetzt stieg mein Glücksstern doch auf!
I can’t understand
She let go of my hand
An’ left me here facing the wall …
Und es war weit und breit kein Ersatz in Sicht für diese blöde Pute.
In dem Buch »Johannes«, dem zweiten Band seiner Autobiographie, kommentierte Horst Janssen Adolf Hitlers Ausspruch, daß die deutschen Jungen flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl sein müßten:
Da die Erben solcher Dümmlichkeit »eigentlich« heut dasselbe gerne vorsichhermurmeln (NOCH bei geschlossenen Lippen), »würde« ich denen sagen: »… und wie sieht sowas IM BETT aus? (Von mir verlangte man »zu meiner Zeit«: eher seidenzart-geschmeidig wie’ne Schnecke, ebenso glitschig wie langsam und zwischendurch mal sekundenzeigerflink, und dabei bestenfalls so hart wie ein 7 Tage abgelagerter welker Rettich – für DEN, der dafür steht).
Nicht so ganz der richtige Lesestoff, wenn man gerade vor Sehnsucht verging.
In der DDR war der Christdemokrat Lothar de Maizière zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Der neue DDR-Außenminister Markus Meckel sah wie ein Strauchdieb aus, und als Minister »für Abrüstung und Verteidigung« diente der einstige Pazifist Rainer Eppelmann, der zu Vorwendezeiten demonstrativ ein Schwert zu einer Pflugschar umgeschmiedet hatte. Nun amtierte er als Soldatenvater. Hatte der noch alle Latschen an der Kiefer?
Über Ostern kamen alle fünf Blums und auch Volker und Wiebke zu Besuch und schlugen ihr Matratzenlager bei mir auf. Da wurde es sofort so wuselig wie in der alten Fernsehserie 3 Mädchen und 3 Jungen. Die Kinder stellten alles auf den Kopf und hätten sogar meine Fotoalben zerfetzt, wenn ich nicht eingeschritten wäre.
Wiebke prunkte mit einer Frisur wie aus Miami, während Renate sich den gleichen herben Look wie die Sängerin Ina Deter zugelegt hatte. Bei Volker und Olaf fiel nur die fortschreitende Glatzenbildung auf.
In welchem Comic war das noch, wo Dagobert Duck seine ausgefallenen Federn betrachtete und sich Gedanken darüber machte, daß die Leute zu ihm sagen könnten, er müsse sich jetzt wohl mit dem Schwamm frisieren?
Volker hatte mir seinen alten Schaukelstuhl mitgebracht. Der paßte gut in mein Arbeitszimmer.
Im Sommer wollten sie alle Mann nach Italien fahren, verkündete Renate und rannte dann auf den Balkon, um Nantje von der Brüstung zu klauben.
Am Ostersonntag ging in Omas Wohnzimmer eine irre Eiersuche los, bei der die Kinder um ein Haar das Büfett zum Einsturz gebracht hätten.
Austoben konnten sie sich dann im Hallenwellenbad Hooksiel. Lisa tauchte durch die Wellen, während Julius von seinen Schwimmärmelchen über Wasser gehalten wurde und Nantje von einem riesigen Reifen mit Haltegriffen.
Schon niedlich, die Kinderchen, aber auch anstrengend. Und dann gleich drei von der Sorte!
Auf der Rückfahrt steckte Julius die Nase aus dem Fenster.
Van See her bruust de Wind in’t Land …
Das war mal was anderes als Bonn-Beuel.
Im Schloßgarten hätte ich gern eine Pfauenfeder für Nantje aufgetrieben, doch ich fand leider keine. Stattdessen kamen wieder die giftenden Höckergänse angeschossen, als sie sahen, daß wir die Enten mit Brot fütterten. Die quäkenden Höckergänse gehörten wahrlich nicht zu meinem gefiederten Freundeskreis. Welcher Dämel hatte diese Viecher überhaupt im Schloßgarten ausgesetzt?
Auf dem Friedhof erklärte Renate den Kindern am Ostermontag, wer wo begraben lag: Uropa Jever, Gustav und Oma Inge. Von den älteren Vorfahren wollten sie begreiflicherweise nichts wissen. Das hätte ich in ihrem Alter auch nicht gewollt, aber jetzt fand ich es schade, daß von den allermeisten nur die eingemeißelten Lebensdaten übrig waren und keine Briefe oder Tagebücher oder wenigstens der eine oder andere Terminkalender.
Julius blieb noch ein paar Tage bei mir. Ich sollte ihn dann in Oldenburg in den Zug nach Bonn setzen.
Als er das Halmaspielen satt hatte, nahm ich ihn in die Gemeindebücherei mit, wo er sich Bilderbücher aussuchen durfte. Eins davon las ich ihm vor. Es hieß »Erwin, das abenteuerlustige Erdferkel«. Darin verschlug es den Titelhelden ins Reich der Schweine, wo er wegen seines Aussehens ausgelacht wurde. Eines der Schweine begleitete ihn sodann ins Erdferkelreich und wurde ebenfalls ausgelacht, woraufhin Erwin die Erdferkel streng zur Ordnung rief: Niemand habe das Recht, ein Schwein wegen seines Aussehens zu beleidigen.
Da schwiegen die Erdferkel beschämt.
Und die Moral von der Geschicht:
Seit diesem Tag herrscht ein reger Schiffsverkehr zwischen den beiden Reichen. Mal kommen ein paar Erdferkel zu den rosaroten Schweinen auf Besuch, und mal segelt ein Schiff voll rosaroter Schweine über den Ozean zu den Erdferkeln. Und keiner lacht mehr über den anderen.
Wie langweilig! Ich schämte mich vor dem armen Julius für diesen faden, aber pädagogisch natürlich wertvollen Plot.
Erschienen war das Buch im Nord-Süd-Verlag. Nieder mit ihm! Und nieder mit allen Kinderbüchern, die sich als Abenteuerromane ausgaben, obwohl sie nur dazu dienten, kleine Kinder, die etwas Spannendes lesen wollten, mit dem Nord-Süd-Dialog zu belemmern!
Um Julius in eine andere Welt zu versetzen, kaufte ich eine CD, auf der Hermann Prey einige von Beethoven vertonte Gedichte von Goethe interpretierte.
Tiefe Stille herrscht im Wasser,
Ohne Regung ruht das Meer,
Und bekümmert sieht der Schiffer
Glatte Fläche ringsumher.
Julius hörte ergriffen zu.
Keine Luft von keiner Seite!
Todesstille fürchterlich!
In der ungeheuern Weite
Reget keine Welle sich.
Das sei ihm unheimlich, sagte Julius. »Ist der Mann ertrunken?«
Für Eis und Pommes war der Junge immer zu haben, und wenn ich mal Ruhe brauchte, konnte ich ihn bei Oma parken. Wegen einer Kreislaufstörung mußte sie dann jedoch ins Sophienstift eingeliefert werden. Da kam sie in ein Zimmer mit Blick auf den Schloßturm und fühlte sich pudelwohl.
Lothar de Maizière rauchte auch vor laufender Fernsehkamera. Das tat sonst nicht mal mehr Fidel Castro. Das waren noch Zeiten gewesen, als Ludwig Erhard die Zigarre zu seinem Markenzeichen erkoren hatte!
Wo der Roman »Soldat Suhren« blieb, konnten sie mir bei Tolksdorf nicht sagen. »Wenn Sie möchten, rufen wir Sie an, wenn das Buch gekommen ist …«
Die Tulpen- und die Krokuszwiebeln, die ich gesetzt hatte, schienen unterirdisch verfault zu sein. Die ließen sich einfach nicht blicken, und ich beäugte auch meinen künftigen Blumengarten mit Argwohn. Das bißchen, was da keimte, wies nur wenig Ähnlichkeit mit einem Bewuchs auf, der zu großen Hoffnungen berechtigt hätte.
In seinem Werk »Irischer Lebenslauf« schilderte Flann O’Brien das Dasein bitterarmer Kleinbauern aus der Sicht eines kummergewohnten Kindes.
Bei Sonnenuntergang wurden Binsen über den ganzen Fußboden gebreitet, und der Haushalt legte sich zur Ruhe auf ihnen nieder. Dort ein Bett mit Schweinen darauf; hier ein Bett mit Menschen; dort wieder ein Bett mit einer alten, schlanken Kuh, im Schlaf auf ihrer Flanke ausgestreckt und einen Sturmwind von Atem ausstoßend, dazu angetan, inmitten des Hauses widrige Strömungen zu erzeugen; dazu Hennen und Hühner im Schutz ihres Bauches schlummernd; und noch ein Bett zunächst der Feuerstelle, auf dem ich lag.
In diesem Haus verrottete dann ein riesenhaftes Schwein. Ein Nachbar glaubte, das Haus stehe in Flammen, doch es stiegen nur »Schwaden von Schweinedampf« auf, worüber ich so lachen mußte, daß Julius wach wurde.
Übersetzt hatte das Buch Harry Rowohlt, und zwar sehr gut, wie mir schien.
Im Waldschlößchen konnte Julius nach Herzenslust rutschen und karussellfahren, wovon er allerdings schon nach zehn Minuten die Nase voll hatte.
Ein Toto-Lotto-Reklameplakat hing dort aus, mit zwei Gedankenblasen über einem Selbstporträt von Wilhelm Busch:
Noch mehr Videorecorder
und
Jede Menge Geld!
Womit hatte Busch das verdient?
Nachdem wir eine Zeitlang im Forst Upjever herumspaziert waren, spielten wir wieder Halma, und dann gingen mir allmählich die Ideen aus, zumal ich mir eine Erkältung eingefangen hatte. Zum Glück war Julius dazu bereit, sich im Vorabendprogramm irgendeine amerikanische Arztfilmserie anzusehen. Danach füllte ich ihn mit Hähnchen und Pommes ab, gab ihm ein Asterixheft mit ins Bett und bestellte uns ein Taxi für den nächsten Morgen, denn wir mußten bereits um kurz nach sieben im Zug sitzen, und ich wollte nicht mit Julius zu Fuß zum Bahnhof krautern.
Ich verarztete mich mit einem Grippemittel namens Wick MediNait und arbeitete noch bis halb zwei Uhr morgens an einer Reportage über Meppen, die ich Kowalski verkaufen wollte. Am Ende fiel mir noch ein Clou ein:
Wer bis hierhin durchgehalten hat, wird sicherlich auch verrückt genug sein, der eigenen Betroffenheit durch eine starke Überweisung auf das von mir geführte »Notkonto für Meppengeschädigte«, Oldenburgische Landesbank, Kontonummer 9382536200, Bankleitzahl 28222208, den angemessenen Ausdruck zu verleihen.
Versuchen konnte man’s ja mal.
Als der Taxifahrer unten hupte, wurde mir klar, daß ich den Wecker im Halbschlaf ausgemacht haben mußte. Gottverdammich!
Ich rief dem Taxifahrer vom Balkon aus zu, daß wir gleich runterkämen, weckte Julius, raste zur Toilette, zog mich in Weltrekordgeschwindigkeit an, raffte die Klamotten zusammen, mit denen mein kleiner Gast die Bude übersät hatte, und sank eine Viertelstunde später schweißüberströmt neben ihm auf die Abteilbank. Und als wir hinter Sande im Anschlußzug saßen und mein Schweiß getrocknet war, dachte ich, als nächstes komme bereits Oldenburg, und scheuchte Julius hoch, obwohl wir, wie ich dann merkte, erst in Rastede einrollten …
»Was ist denn los mit dir?« fragte Julius, der sich sehr über seinen hektischen Onkel wunderte.
Nachdem ich den lieben Jungen in Oldenburg in den richtigen Zug gesetzt hatte, kaufte ich mir zwei, drei Zeitungen und tuckerte gemächlich und allein zurück ins Jeverland.
In der Süddeutschen berichtete der Literaturkritiker und Arno-Schmidt-Forscher Jörg Drews, daß er sich bei einem Besuch in Oshos Ashram in Poona »sympathetischen Träumereien« hingegeben und festgestellt habe, »daß der Laden da drüben gar keinen so hanebüchen verrückten Eindruck« mache. Der Drang, »sich über das Ganze möglichst heftig und naseweis lustig zu machen«, lasse schnell nach.
Nein, so gemein und besserwisserisch will ich nicht schreiben über den Osho. Ein Photo von ihm habe ich mir aus dem Ashram-Bookshop mitgenommen; darauf sieht er ganz frech und gerieben und wissend aus. Das alte Schlitzohr ist mir gar nicht so unsympathisch, muß ich gestehen.
Und ich hatte mich für den weltweit einzigen Arno-Schmidt-Leser gehalten, der auch Osho etwas abgewinnen konnte.
Zuhause lag ich dann wieder mit laufender Nase im Bett und versuchte, nicht an Andrea zu denken.
Most of the time
She ain’t even in my mind
I wouldn’t know her if I saw her
She’s that far behind …
In ein paar Jahren würde sie es bereuen, daß sie mir abtrünnig geworden war. Diese hohle Nuß. Aber da hätte sie halt früher drüber nachdenken sollen.
Als ich wieder auf dem Damm war und mich endlich des verranzten, seit drei Tagen liegengebliebenen Küchengeschirrs angenommen hatte, schrieb ich für Kowalski einen Aufsatz über die leidigen nahöstlichen Scharmützel zwischen Christenmilizen, Schiiten, Sunniten, Prozyprioten, Falangisten, Jesiden, Maroniten, Alawiten, Sadduzäern und Hirnanhangdrusen, die alle zu dumm waren, Frieden miteinander zu halten. Sich in eine Hängematte legen, unter Palmen, Tee trinken und Kempowski lesen, das hätten sie doch auch mal tun können, anstatt immer wieder aufeinander einzudreschen.
Nach ihrer Entlassung aus dem Sophienstift mußte Oma eine Serie von Niederlagen im Malefizspiel verarbeiten, weil sie nicht einmal dann gewann, wenn ich sie siegen lassen wollte. Sie tölpelte mit ihren Männchen auf dem Brett herum, als hätte sie erst fünf Minuten vorher die Regeln gelernt, und blieb blind für sämtliche goldenen Brücken, die ich ihr baute.
Aber dafür war sie eine begnadete Köchin. Das mußte man ihr lassen.
Irgendeine Geisteskranke hatte den SPD-Kanzlerkandidaten Oskar Lafontaine bei einer Wahlkampfveranstaltung in Köln lebensgefährlich verletzt – war mit einem Blumenstrauß auf ihn zugegangen und hatte ihm ein Messer in den Hals gerammt.
Eine kleine, dicke Frau in weißem Kleid. Mit einem irren Blick.
Die armen Psychiater, die sich mit der jetzt abgeben mußten. Was die wohl für einen Quatsch erzählte, um ihre Tat zu rechtfertigen?
Dann kam mal wieder ein Brief meiner alten Mitschülerin Astrid Kohler:
Ich wohne jetzt in ’ner vornehmen Gegend, glücklicherweise aber in einer weniger bürgerlichen Ecke von Hamburg-Eimsbüttel, Nähe U-Bahnhof Schlump. Das sollte übrigens ein diskreter Hinweis auf die Haltestelle sein, an der Du aussteigen mußt, wenn Du mich mal besuchen willst …
Ich würde sehr gerne mal wieder mit Dir reden, weiß aber nicht, ob ich in nächster Zeit im Emsland auftauche. Vielleicht machst Du ja mal aus »beruflichen Gründen« Station in Hamburg?
Diese Einladung behielt ich im Hinterkopf.
Papa lag noch immer im Krankenhaus. Seine Wunden wollten nicht heilen, sagte er mir am Telefon.
Nachdem ich ihm mitgeteilt hatte, daß Oma Jever wohlauf sei, fiel mir nichts mehr ein, was ich ihm noch hätte erzählen können, und ich wünschte ihm gute Besserung.
In seiner Titanic-Kolumne widmete Max Goldt sich Österreichs Mitgliedschaft in der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA):
Allerdings wird über die Existenz der EFTA außerhalb ihrer selbst nur wenig Wind gemacht; ich habe von ihr bislang nur selten vernommen, und ich wußte auch nicht, wer außer Österreich da noch Mitglied sein soll – neutrale Mauerblümchen-Staaten vermutlich, Länder, die keiner kennt oder haben will, solche, die abseits im Schatten stehen, Kinder von schlagenden Eltern, schorfige Lippen, Tristesse.
In den Texten von Max Goldt saß jedes Wort am rechten Platz. Ich hätte ihm ja gern mal bei der Arbeit zugesehen. Wie er das so machte. Still daheim? Oder etwa an einem Kneipentisch?
Zu meinem 28. Geburtstag erhielt ich Post von meinen beiden Patentanten: ein Oberhemd von Dagmar und einen Kartengruß der in Bad Pyrmont kurenden Gertrud. Und der Kowalski-Redakteur Günther Willen schrieb mir, daß ihnen in Hamburg meine Reportage über Meppen und die Analyse der Lage im Nahen Osten gerade noch gefehlt hätten.
Eine »Nickligkeit« (Marcel Reif) fällt mir dazu noch ein: Nachdem Harald »Toni« Schumacher den SV Meppen seinerzeit angepfiffen hatte und vielviel lieber mit Kamerad Türk spielen wollte (als in der zwoten Liga gegen die van der Püttens, Thobens und Rusches anzutreten), stellten ihm gute Anhänger des SV Meppen einen Möbelwagen vor seine Kölner Wohnung, um damit auf die schreiende Ungerechtigkeit dieser modernen Welt aufmerksam zu machen … was weiß ich.
Und ich solle ihm mal meine Telefonnummer mitteilen.
Oma Jever schenkte mir zwanzig Mark. »Und denk mal an, wer heute kommt! Gisela und Egon!«
Als kinderreiche Mutter kriegte Oma oft Besuch, obwohl es nach Jever für alle ihre Nachfahren außer mir eine halbe Weltreise war.
Gisela und Egon brachten jedenfalls Leben in die Bude, und am Abend kamen sie sogar auf einen Schoppen mit in Rainer Dickhoffs anrüchige Discothek Na Nu, um mir beim Kellnern zuzusehen.
»Du machst das ja, als hättest du das von der Pike auf gelernt!« rief Egon, als er mich an den kopfüber aufgehängten Spirituosen hantieren sah, und Gisela sagte, daß die Jugend hier ja ganz schön am Bechern sei.
Als die Feierlichkeiten ihren Höhepunkt erreichten, waren Gisela und Egon aber längst gegangen: Um halb eins trugen untereinander verfeindete Bauernsöhne auf der Herrentoilette eine Vendetta aus, die Polizei erschien mit Blaulicht, und es fuhr sogar ein Krankenwagen vor.
Mien Jeverland, wo leev ik di …
Nach diesem Zwischenfall spendierte Rainer dem Thekenpersonal, das nur noch aus der Fachkraft Steffi, mir und ihm selbst bestand, eine Runde Sambuca-Baileys, wobei ich erfuhr, daß unsere Ex-Kollegin Moni, die auch schon viele Schlachten im Na Nu überstanden hatte, von einem gesunden Jungen entbunden worden sei, und darauf tranken wir so viel, daß ich erst um halb acht Uhr morgens zum Dannhalmsweg und ins Kellerbett torkelte.
Oskar Lafontaine befand sich inzwischen außer Lebensgefahr. Von Adelheid Streidel, der Frau, die das Attentat auf ihn verübt hatte, las man, daß sie an Wahnvorstellungen leide. Es gebe, habe sie erklärt, »in Europa Menschenfabriken und unterirdische Operationssäle, wo Leute aus der Bevölkerung körperlich und geistig umfunktioniert werden«.
Nach allem, was ich in den Nachrichten von Adelheid Streidel gesehen hatte, sah sie nicht so aus, als ob sich jemals irgendwer für sie interessiert haben könnte. Weder ein seiner Sinne mächtiger Privatmann noch ein Konsortium böser Menschenfabrikanten.
»Eventuell rutscht in das Juniheft die Drusensache noch mit rein«, berichtete Günther Willen mir telefonisch. »Das wird dann ein richtiges Schlosserfestival …«
Außerdem fragte er nach Fußballtexten zur WM, und ich bot ihm einen über den Verfall der Jubelkultur an. Dafür mußte ich nur einen Text, den Michael Rutschkys Alltag ignoriert hatte, etwas umformulieren.
Einer von Omas Vettern war gestorben, Tjako Rickels, und sie wollte gern an seiner Beerdigung in Rastede teilnehmen.
Um bei der Trauerfeier gut dazustehen, borgte ich mir von meinen Vermietern ein Dampfbügeleisen aus. Das Ding hieß Siemens Portatronic 2000 oder so ähnlich, und es tropfte und zischte und stank, aber bügeln ließ sich damit absolut nichts.
In der Kirche in Rastede kamen wir viel zu spät an. Der Trauergottesdienst war schon im Gange. Alle drehten sich nach uns um, während wir uns in die letzte Reihe quetschten, und dann drehten sich noch einmal alle nach uns um, weil Omas Hörgerät so teuflisch pfiff.
Ich kannte dort niemanden, aber Oma unterhielt sich nach der Beisetzung noch äußerst angeregt mit Kusinen und Nichten und Neffen ersten oder zweiten Grades. Um da durchzublicken, hätte man ein zweihundertseitiges Personenstandsbuch mit sich führen müssen.
Mein Rasen war gut gediehen, doch mit den Blumen sah es mau aus. Wollten sie nicht? Oder konnten sie nicht? Ich hatte ihnen alle Freiheiten gelassen, und jetzt hätten sie mal zeigen können, was sie draufhatten, aber sie kriegten es nicht hin.
In der FAZ schrieb der Literaturkritiker Michael Maar:
Daß Eckhard Henscheid ein außerordentlicher Schriftsteller sei, einer der wenigen wirklich bedeutenden unserer Zeit, ist eine Auffassung, die noch weit davon entfernt, verbreitet Anerkennung zu finden, heute immerhin weniger sektiererisch anmutet als noch vor einigen Jahren.
Sie würden es schon noch begreifen, die Leute, daß es auf die Dauer keinen Spaß machte, auf dem alten Graubrot der Gruppe 47 herumzukauen.
Die Außenminister der Bundesrepublik, der DDR, der UDSSR, der USA, Großbritanniens und Frankreichs trafen sich in Bonn zu »Zwei-plus-Vier-Verhandlungen« über die deutsche Frage. Mit einem Kometenschweif aus Diplomaten, Staatssekretären, Dolmetschern und Bodyguards. Da klingelten sicherlich auch die Kassen der Bonner Edelprostituierten.
Wenn es nach Günter Grass gegangen wäre, hätten es wahrscheinlich Zwei-plus-Fünf-Verhandlungen sein müssen, mit ihm selbst als eigenständiger Supermacht.
Oma war in ihrem Fernsehsessel eingeschlafen, mit ihren orangen Plastikkopfhörern am Hals, und ich machte ein Foto von ihr.
Post von Günther Willen:
Bravo! Ihre Geschichte des Torjubels können wir vielleicht noch in der Rubrik Lötzinn unterkriegen, so daß Sie in der nächsten Nummer – wenn’s hochkommt – mit drei Beiträgen vertreten sind. Ist es da ein Wunder, wenn wir das Juni-Heft einfach »Martin Schlossers interessantes Magazin« nennen wollen? Ich bitte Sie. Der anschließende Jubel in und um Jever ist natürlich unbeschreiblich. Oder?
Im Na Nu bediente jetzt auch eine sehr resolute Frau namens Sabine, die sofort zuschlug, wenn ihr einer blöd kam, und das hatten die Gäste von der ersten Minute an begriffen. Selbst die aus der Zone, die immer noch in Scharen mit ihren saudummen Reichskriegsflaggen in den Laden hereingeschwappt kamen.
Nachdem ich die Einkäufe in Omas Küche abgestellt hatte, setzte ich mich im Wohnzimmer zum Zeitunglesen hin.
Zwar gebe es auch Schattenseiten, doch alles in allem gäben die Entdeckung, die Eroberung und die Christianisierung der Neuen Welt ein strahlendes Bild ab, sagte der Papst am zweiten Tag seines Mexiko-Besuchs in der Hafenstadt Veracruz.
Ihre Ahnen waren von den katholischen Eroberern gekillt worden, und nun huldigten diese Esel einem Pfaffen, der ihnen lauter Lügen erzählte. Ein strahlendes Bild!
Bei meiner nächsten Visite hatte Papa noch immer keinen Entlassungstermin in Aussicht. Er dämmerte im Ludmillenstift vor sich hin und musterte mit gerunzelter Stirn die Kontoauszüge, die ich mitgebracht hatte.
Im Ali-Baba-Grill hätte ich ein mit Knoblauchwurst, Schafskäse und Salat gefülltes Fladenbrot namens Meppburger bestellen können, aber ich entschied mich für zwei Schaschlikspieße.
Dann besuchte ich die Lohmanns: Mamas alte Freundin und ihren Mann, der mit Papa lange auf der E-Stelle gearbeitet hatte.
»Und wie geht’s dem Meister?« fragte Herr Lohmann und stellte zwei Flaschen Bier auf den Tisch.
Der Armbruch sei noch nicht verheilt, sagte ich.
Frau Lohmann, die beim Weißwein blieb, fragte mich auch nach Renates, Volkers und Wiebkes Ergehen, und sie sprach davon, wie wundervoll es 1977 in Venezuela gewesen sei, »mit deiner Mutter – die ist da richtig aufgeblüht!«
Wäre sie dort mal geblieben, dachte ich.
Weil im Fernsehen später wieder nur Mist lief, setzte ich mich in der Dammstraße mit einem weiteren Bier auf die Gartenterrasse und dachte an die Zeiten, in denen ich dort mit Andrea gesessen hatte. Wie lange lag das alles schon zurück.
And the crickets are breaking
His heart with their song
As the day caves in
And the night is all wrong …
Warum hatte sie mich verlassen?
Am Samstag stieg ich früh genug in den Zug nach Hannover, um noch auf den Flohmarkt gehen zu können. Ich kaufte mir einen Gedichtband von Leonard Cohen und ein Bootleg von Dylans 1966er Englandtournee – von dem Luxemburger Label Swingin’ Pig Records –, und dann ließ ich mir von Dagmar in der Baumstraße Spaghetti bolognese vorsetzen und ging abends ins Kino und sah mir den lustigen Film »Kuck’ mal, wer da spricht!« an. Wie die Spermien plappernd durch den Geburtskanal rauschen und wie die schöne Kirstie Alley sich vorstellt, daß John Travolta ihren Kindern irgendeinen Drecksfraß von der Müllkippe als Abendessen hinknallt …
Auf der Zugfahrt nach Meppen las ich am Sonntag Cohen.
I am almost 90
Everyone I know has died off
except Leonard
He can still be seen
hobbling with his love.
Womit man bei Papa nicht rechnen konnte. Er war erst 62, aber schon beinahe greisenhaft hinfällig. Und aus welchem Born hätte er in Meppen neuen Lebensmut schöpfen können?
Bevor ich mit dem Jetta wieder nach Heidmühle fuhr, besuchte ich Papa noch einmal in seinem Krankenzimmer.
»Nächste Woche lassen sie mich vielleicht raus«, sagte er. »Dann wär’s gut, wenn du kommen könntest. Für die nötigsten Besorgungen.«
In Papenburg stand eine Tramperin, und ich hielt an und fragte sie, als sie die Beifahrertür öffnete, wo’s denn hingehen solle, wobei ich jedoch nicht bedacht hatte, wie ungut es aussehen mußte, daß zwischen meinen Oberschenkeln eine Literflasche Cola stand.
»Egal«, sagte die Frau und warf die Tür wieder zu.
Dann halt nicht, dachte ich und fuhr weiter. Und da erst ging mir auf, daß es ja auch närrisch von mir gewesen war, die Frau nach ihrem Reiseziel zu fragen. Normalerweise fragten Tramper den Autofahrer, wohin er fahre.
Ich mußte der Frau verdächtig vorgekommen sein. Ein Sittenstrolch, der durch die Lande kurvt und Mädchen abzuschleppen versucht …
In Heidmühle konnte ich bei den niedersächsischen Landtagswahlen gerade noch meine Stimme für die Grünen abgeben, bevor das Wahllokal im Bürgerhaus schloß.
Die Tamilen entfernten sich augenblicklich aus der Küche, als ich ankam, und ich briet mir vier Spiegeleier und verfolgte die Hochrechnungen: Die SPD und die Grünen schienen eine knappe Mehrheit gewonnen zu haben und konnten sofort mit den Koalitionsgesprächen beginnen.
Endlich kein Ernst Albrecht mehr! Dessen Glommse hatte mich durch mein Leben begleitet, seit ich mit vierzehn zum Spiegel-Leser geworden war.
Gerhard Schröder, der Ministerpräsidentenkandidat der SPD, gefiel mir gar nicht schlecht. Der besaß einen robusten Willen zur Macht.
Auch in Nordrhein-Westfalen war gewählt worden. Dort hatte die SPD sogar fünfzig Prozent geholt, und die Grünen konnten in den Landtag einziehen.
Auf der Bootleg-CD war zu hören, wie Bob Dylan »Judas!« zugeschrien wurde, weil er mit elektrisch verstärkten Instrumenten auftrat. »I don’t believe you«, sagte Dylan. »You’re a liar!« Seiner Band rief er zu: »Play fucking loud!« Und dann spielten sie »Like a Rolling Stone«.
In dem Set hatte Dylan auch »One Too Many Mornings« gesungen. Atemberaubend. Aber dem Zwischenrufer und denen, die ihm Beifall gespendet hatten, wäre es lieber gewesen, wenn Dylan sein Leben lang nur »Blowin’ in the Wind« gesungen hätte. Zur Wandergitarre.
Wollte man bei Harms Pfandflaschen zurückgeben, stand man sich jedesmal die Beine in den Bauch, bis da jemand kam.
Dafür überraschte mich meine Stammbäckerei in Heidmühle mit einer Novität namens »AOK-Aktivbrot« (»aktiv gekaut, aktiv verdaut«). Wer mochte diesen Buchstabenmüll ausgebrütet haben?
Post von Andrea. Aus Oldenburg.
Nachdem ich heute im Supermarkt, als ich neugierig in »Kowalski« blätterte, wieder mal einen Artikel von Dir fand, beschloß ich, Dir endlich zu schreiben.
Ich hoffe, Du wirst Dir überhaupt die Mühe machen, meinen Brief zu lesen. Daß Du Dich mir gegenüber erst einmal völlig verschließen würdest, habe ich nicht anders erwartet, dazu kenne ich Dich zu gut. Aber ich würde es sehr schade finden, wenn nun ewig die absolute Funkstille zwischen uns bliebe. Ich weiß, ich habe Dich sehr verletzt, aber meine Entscheidung war ehrlich, und ich hätte Dir und mir nichts Gutes getan, wenn ich halbherzig bei Dir geblieben wäre. Mein Entschluß, mich von Dir zu trennen, ist nicht gefallen, weil ich Dich nicht mehr schätze, sondern gerade weil ich finde, daß Du keine Frau verdient hast, die schon ewig ein Bein aus der Tür hinausgesetzt hat. Ich finde es schade, fünf gemeinsame Jahre völlig vom Tisch zu wischen. Okay, okay – aus Deiner Sicht habe ich genau das getan, aber ich sehe trotzdem keinen Sinn darin, wenn wir nun auf ewig nichts mehr miteinander zu tun haben.
Sondern?
Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn die Zeit irgendwann vorbei wäre, wo Du Dich völlig von mir zurückziehen mußt, und wenn Du danach nicht einfach aus Sturheit dabei bliebest, Dich in eisiges Schweigen zu hüllen. Die Entscheidung liegt ganz bei Dir.
Ob Du Dich mal wieder meldest oder nicht – ich wünsche Dir wirklich von Herzen alles Gute.
Sollten wir jetzt »Freunde sein« oder wie? Und Nettigkeiten austauschen? Und wer hatte sich denn bitteschön zurückgezogen – sie oder ich?
Von Zeit zu Zeit konnte ich meiner Sammlung sonderbarer Nachrichten aus dem Jeverschen Wochenblatt ein neues Fundstück zuführen:
Heißes Bett in
Wilhelmshaven
Fürwahr eine die Wißbegierde weckende Überschrift.
Wilhelmshaven. Die Feuerwehr wurde gestern um 11.35 Uhr in die Gökerstraße gerufen. In einem unbewohnten Haus standen ein Bettgestell und angrenzende Stellwände in Flammen. Ein ordentlicher Wasserstrahl löschte das heiße Bett.
Schon allein für diese erzählerische Antiklimax hätte das Wochenblatt mit dem Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor ausgezeichnet werden müssen.
Noch immer kein »Soldat Suhren«. Und auch noch immer kein Honorar fürs Aprilheft von Kowalski. Gottlob hatte ich momentan genug auf der hohen Kante und mußte nicht hungern.
Ab Wiesmoor gurkte ich auf der Autofahrt nach Meppen hinter einem LKW her, auf dessen Heckklappe die Worte standen:
KitKat – die superleichte Schokopause
In Brinkum bog er endlich ab.
Die Ärzte hatten Papa aus ihrer Obhut entlassen, und er brauchte dringend neue Lebensmittel und natürlich Wein und Sekt und Zigaretten.
Ich mußte viermal zu Aldi dackeln, bis ihn die Vorratsmenge zufriedenstellte. Und den Rasen mähen.
Nachdem wir die üblichen Salamibaguettes aus der Mikrowelle gegessen hatten, dozierte Papa im Wohnzimmer über den Wissenschaftsjournalisten Hoimar von Ditfurth. Das sei ein Geist gewesen, der sich über das Niveau der Masse der uns umgebenden Holzköpfe erhoben habe. »Den schätze ich hoch. Aber nicht seine Tochter!«
Er meinte die Grüne Jutta Ditfurth, die gern Provokantes von sich gab.
»Erkenntnisgewinne kann man sich jedenfalls nur von Naturwissenschaftlern versprechen«, sagte Papa. »Und nicht von Politikern. Und schon gar nicht von Juristen! Wenn die Menschen sich an die Zehn Gebote hielten, wäre dieser Berufsstand überhaupt nicht mehr nötig …«
Dagegen brachte ich den Einwand vor, daß ein moderner Industriestaat sich nicht auf der überholten Rechtsgrundlage der Zehn Gebote verwalten lasse.
»Und was ist daran überholt?« fragte Papa. »Wenn die Leute ihren Vater und ihre Mutter ehren und nicht lügen und nicht stehlen und nicht töten und nicht ihres Nächsten Weib begehren würden, dann könnten die Juristen ihre Kanzleien allesamt dichtmachen!«
»Aber so ist es eben nicht. Und in den Zehn Geboten steht auch nichts übers Kartellrecht. Oder über die Frage, wer schadenersatzpflichtig ist, wenn irgendwo ’ne Chemiefabrik in die Luft fliegt. Wie willst du sowas denn mit dreitausend Jahre alten Gesetzestafeln aus dem Vorderen Orient regeln?«
Er bleibe dabei, sagte Papa. »Aber die Menschheit ist eben verrückt geworden. Alle versuchen sich gegenseitig aufs Kreuz zu legen. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Im Grunde kannst du mich als Aussteiger betrachten. Ich hab hier mein Haus und keinen Pfennig Schulden mehr darauf, und jetzt können mich alle mal am Arsch lecken. Die Juristen, die Politiker, die Politologen, die Nachbarn … und die Emanzen. Die erst recht!«
Ich solle ihm mal das Buch »Laßt endlich die Männer in Ruhe« besorgen, sagte er. Das würde er gern lesen.
Nach dem Frühstück chauffierte ich Papa nach Lingen zum Finanzamt, wo er sich anderthalb Stunden lang mit einem Sachbearbeiter herumstritt, während draußen die Sonne auf Gerechte und Ungerechte herabschien, auf eisschleckende Kinder, hüftkranke Gemüsehändler, verrentete Kieferorthopäden, katholische Dixielandfans, CDU-wählende Hausfrauen und irgendwo auch auf Andrea.
Don’t even remember what her lips felt like on mine …
»Die Sorge, wie man Nahrung findet, ist letztlich nicht ganz unbegründet«, sagte Papa, als er sich nach geschlagener Schlacht auf den Beifahrersitz setzte.
Den Jetta ließ ich Papa da und fuhr mit dem Zug wieder nachhause, voller Hoffnung auf den einen oder anderen Scheck, aber in meinem Briefkasten gammelte nur Reklame für Grillfleisch, Planschbecken und elektrische Zahnbürsten herum.
Ich mahnte bei der Redaktionssekretärin der Zeitschrift Der Alltag das seit Monaten ausstehende Honorar für meine Kohlfahrtreportage an, und im Vertrauen auf neue Honorarschecks überwies ich dem münsterländischen Lotus-Hof 1200 Mark für meine Teilnahme an einem zehntägigen Tantra-Workshop, der Ende Juli stattfinden sollte. Mit Vollpension.
Für die Weltpolitik hatte ich immer weniger übrig. Bürgerkrieg im Kaukasus und Sezessionsbestrebungen im Baltikum. Wollten die Leute denn alle zurück in die Steinzeit?
Die Sowjetunion löste sich auf, und der sogenannte Radikalreformer Boris Jelzin war zum russischen Parlamentspräsidenten ernannt worden. Ein schwammiger und selbstverliebter Autokrat, wie man auf den ersten Blick erkennen konnte. Armes Rußland! Als ob da nicht schon genügend Miesnickel herumregiert hätten.
Anläßlich des achtzigsten Geburtstags der Schauspielerin Inge Meysel ingemeyselte es auf allen Fernsehkanälen, und sie wurde einem als »Mutter der Nation« aufgeschwatzt, obwohl oder weil sie immer nur Inge Meysel gespielt hatte, die burschikose Putzfrau, die ihr Herz auf der Zunge trägt. Miss Dicke Lippe. Eine schaurige Person.
Probehalber stellte ich einen geliehenen Gartenstuhl auf meinen Rasen und versuchte da ein Buch zu lesen. Doch wie sollte man sich konzentrieren, wenn einem ständig Fliegen oder Käfer um die Nase surrten?
In meinem Blumenbeet hatte sich irgendeine Kletter- oder Schlingpflanze breitgemacht und alles andere überwuchert und erstickt. Von wegen Blumenmeer! Todtraurig sah’s da aus.
Wozu hätte ich dieses behämmerte Gartenstück noch weiter pflegen sollen?
Ich trat es an meine Vermieter ab und war sehr froh, dieses Kapitel abhaken zu können.
Michael Rutschky, dem ich schon vor längerer Zeit einen Bericht über meine Selbsterfahrungsworkshops angeboten hatte, antwortete mir, daß er das gern läse. Die Sache sei bloß die, daß er zu viele von meinen Sachen angenommen habe:
»Der Alltag« kommt mit dem Abdruck nicht mehr nach, Sie werden auch nicht Jahre darauf warten wollen, daß eine Geschichte endlich erscheint, deshalb sage ich besser nein.
Andererseits habe ich mit Kurt Scheel, dem Redakteur des bescheiden zahlenden, aber höchst renommierten »Merkur« über Sie gesprochen: Er wäre keineswegs abgeneigt, mit Ihnen »mal was zu machen«. Es kann Ihnen auch nicht schaden, wenn Sie, was nötig wäre, die Geschichte in einem etwas anderen Sound zu erzählen hätten – kurzum, dies ist die Adresse: Kurt Scheel/Merkur/Angertorstr. 1 A/8 München 5/089 – 2609644. Ihre Anfrage wird erwartet.
Ich schrieb noch am selben Tag nach München.
In der Juninummer von Kowalski erschien meine Reportage über Meppen, und in der Titanic glänzte Achim Greser mit einem Cartoon: Ein Mann meldet sich bei der Reparaturannahme einer Werkstatt. Neben ihm steht eine dicke alte Frau mit Hängeschultern und schlaffem Gesicht. Der Mann sagt: »Sie läßt in letzter Zeit sehr in ihrer Waschleistung nach.« Und im benachbarten »Prüfzentrum« leuchtet ein Techniker einer anderen alten Frau mit einer Taschenlampe unter den Rock.
»Stell dir vor – ich werde wieder Urgroßmutter!« rief Oma Jever. »Dein Vetter Norman und seine Frau Maxine erwarten ein Kind!«
Von mir selbst hatte Oma keinen Nachwuchs zu erwarten, wie sie wußte. Wozu hätte ich mir Neugeborene aufhalsen sollen, die mich beim Lesen, Schreiben oder Musikhören störten?
Bei meinem nächsten Meppenbesuch mußte ich mich einer Schwadron Wespen erwehren, als ich die Flaschen in den Altglascontainer schmeißen wollte. Die Wespen kamen von überallher angebraust, auch aus dem Inneren des Containers. Sie schienen in mir einen Aggressor zu wittern, und ich machte, daß ich wegkam.
Die neuen Wein- und Sektflaschen reihte ich in einem Kellerregal auf. Aus Papas Sicht waren es noch nicht genug.
Der Jetta hatte jetzt einen Knauf am Lenkrad. Der war von Herrn Lohmann dort angebracht worden, damit Papa das Herumkurbeln leichter fiel. Sein lädierter rechter Arm bereitete ihm Probleme, auch nach der langen Behandlung im Ludmillenstift.
Von dem Buch »Laßt endlich die Männer in Ruhe« von Cheryl Benard und Edit Schlaffer war Papa schon nach fünf Minuten bedient: »Da wird ja auch nur wieder auf den Männern rumgehackt …«
Er stellte dann die These auf, daß Frauen von Natur aus weniger Interesse am Sex hätten als Männer.
»Und auf welche empirischen Erhebungen stützt du diese These?«
Das sei nun mal so, sagte Papa. »Die Frauen sind da anders.«
Ach? Und wie viele Frauen hatte Papa herangezogen, um die Stichhaltigkeit seines Befunds zu überprüfen? Auf der Erde lebten rund 2,5 Milliarden Frauen, und zu den wenigsten davon hatte Papa eine nähere Beziehung unterhalten, die es ihm erlaubt hätte, einen solchen Generalverdacht zu erheben.
In einem Zeitschriftenkiosk fragte ich nach Kowalski und bekam zur Antwort: »Ausverkauft! Restlos in ganz Meppen ausverkauft! Ausverkauft bis runter nach Lingen! Aber ich hab schon fünfzig Stück nachbestellt!«
»Da steht was über Meppen drin, hab ich gehört …«
»Aber was für’n Ding!«
»Was steht denn drin?«
»Fußgängerzone, Fußballverein, Katholiken – alles! Morgen hab ich wieder welche! Morgen!«
So machte es doch Spaß, das Leben. Selbst in Meppen.
Ich versprach Papa, schon in einer Woche wiederzukommen. Dann fuhr ich mit dem Jetta gen Heidmühle und ließ unterwegs eine Kassette mit Songs von Elvis Presley laufen, die ich in einem der Geschäfte in der Meppener City entdeckt hatte.
A rose grows wild in the country …
Im Emsland war »the country« natürlich nicht das gleiche wie in Amerika.
A tree grows tall as the sky …
Was freilich auch in Papenburg vorkommen konnte.
The wind blows wild in the country,
And part of the wild, wild country am I.
Das glaubte ich Elvis nicht. So gut es auch klang. Sonst hätte er sich nicht von der amerikanischen Plattenindustrie domestizieren lassen.
Was ich nicht verstand: Wieso wurden die Spione aus der DDR nicht amnestiert? Von denen ging doch überhaupt keine Gefahr mehr aus? Und der BND hatte seinerseits ja auch Spione in die DDR entsandt. Hätte man die dann nicht ebenfalls verknacken müssen?
Endlich trudelte mal wieder ein Scheck von Kowalski ein (über 1190 Mark). Und dazu ein an mich weitergeleiteter Leserbrief:
Betr.: Ausgabe 6/1990, »Wer kennt eigentlich Meppen?«
Da war ich gespannt.
Was meinte der Autor obiger Stadtbeschreibung bei der Erläuterung der sieben Errungenschaften Meppens eigentlich mit dem hier auszugsweise zitierten Wortlaut »Dank der ungebührlich recklinghausenhaften Umgehungsstraße …«?
Meine Geburtsstadt Recklinghausen verfügt tatsächlich über einige sehr hübsche Umgehungsstraßen, deren Asphaltbelag übrigens leidlich zu ertragen ist und recht zügig befahren werden kann, es sei denn, er wird mal grad eben wieder frisch erneuert.
Sorgen hatten die Leute!
Zwischen den Tamilen und mir gab es keine Probleme. Die wisperten und knusperten in ihrem Teil der Wohnung, und wenn sie etwas kochten, machten sie hinterher alles penibel sauber.
Aus der Buchfassung der Titanic- und dann Kowalski-Kolumne »Teddy’s Trends«, die im Haffmans Verlag erschienen war, erfuhr man endlich auch offiziell, daß Teddy Hecht ein Pseudonym von Richard Kähler war. Eckhard Henscheid hatte ein Vorwort geschrieben, in dem es hieß:
Auch wenn unserem Teddy Hecht nichts ferner gelegen haben sollte, so behaupte ich meinerseits doch nahezu ungescheut dies, daß »Teddy’s Trends« durchaus so etwas wie die »Minima moralia« der achtziger Jahre abgaben.
Das war ein Ritterschlag.
Den Mittelfeldkicker Lothar Matthäus konnte ich nicht leiden, aber als er in dem WM-Spiel gegen Jugoslawien alle ausdribbelte und ein Tor schoß, stellten sich mir die Nackenhaare auf.
In der Halbzeitpause rief Dagmar an und sagte, daß ich doch mal was für den NDR schreiben könne.
Wieso nicht? Ich verfaßte drei lobende Seiten über »Teddy’s Trends« und schickte das Ganze los, und dann fuhr ich wieder nach Meppen.
Wild, wild, like the deer and the dove
Wild and free is this land that I love …
Nur daß ich das Land desto weniger liebte, je näher ich Meppen kam.
Nachdem ich den Kühlschrank, die Gefriertruhe und das Flaschenregal im Keller wieder aufgefüllt hatte, spielte Papa im Wohnzimmer die mir schon hinlänglich bekannte Volkerplatte ab: »Der hat sich mit seiner Computerwirtschaft benebelt, und jetzt glaubt er, daß er ohne Diplom durchs Leben kommt! Aber irgendwann bin ich nicht mehr da, um diesem Bruder Leichtfuß aus der Klemme zu helfen, wenn ihm die Rechnung für seine Fahrlässigkeit präsentiert wird. Dann muß er selber zusehen, wo er die Moneten herkriegt, um sich sattfressen zu können. Völlig zu schweigen von irgendeiner Form der Alterssicherung. Der drömelt einfach vor sich hin und glaubt, daß ihn der himmlische Vater schon irgendwie ernähren wird. Aber wenn man mit dem Kopf in den Wolken lebt, dann bringt man’s zu nix …«
Was natürlich auch für mich galt.
Laut Spiegel hatte der vom Pazifisten zum Verteidigungsminister aufgeschossene Pfarrer Eppelmann auf einer Kommandeurstagung erklärt, daß die Nationale Volksarmee der DDR »weiterhin« zum europäischen Frieden beitragen werde.
Eine »Demilitarisierung im Sinne einer schnellstmöglichen Auflösung der NVA« betrachte er als »nicht akzeptabel«.
Bei jenen Bürgern, die das anders sähen, sei Großzügigkeit fortan fehl am Platze, verkündete der Minister. Zivildienstleistende dürften gegenüber Wehrdienstleistenden nicht bevorzugt werden. Und die Möglichkeit, »ohne weiteres aus dem aktiven Wehrdienst heraus in den Zivildienst« zu wechseln, müsse ausgeschlossen werden.
Aber Schwerter zu Pflugscharen umschmieden! Was ritt diesen Mann? Die blanke Machtgier?
Die Zeit verging mit Rasenmähen, Einkäufen, Haushaltsgeprüttjer und dem Verspeisen von Mikrowellengerichten. Aber eigentlich verging sie gar nicht. In Meppen stand sie still. Jedenfalls in der Dammstraße 43.
Meinen Vorschlag, eine Putzfrau anzuheuern, wies Papa zurück: Das fehle ihm noch, daß irgendso’n Weibsbild hier herumzufuhrwerken beginne!
Gegen Ägypten – Ägypten! – holten die Holländer in der Vorrunde nur ein 1:1 heraus. Wie es den alten Johan Cruyff da beim Zuschauen wohl in den Beinen gezuckt haben mochte.
»Mit solchen Mohrrübenhosen können die ja auch gar nicht gewinnen«, sagte Papa.
Um seinem Nasenbluten ein Ende zu setzen, hatten die Ärzte ihm im Krankenhaus die Adern in der Nase »verödet«, wie der Fachausdruck lautete, aber am Mittwochnachmittag ging’s wieder los. Und selbstverständlich lehnte Papa jede ärztliche Hilfe ab. Stattdessen saß er mit zurückgelehntem Kopf auf dem Sofa und preßte sich ein Taschentuch unter die Nase.
Alle paar Minuten mußte ich ein neues bringen und das verbrauchte zu den anderen verbrauchten in der Wäschetonne befördern, und als die Blutung schließlich etwas nachgelassen hatte, schickte er mich in die Waschküche, die alte Plastikwanne holen, in der Renate, Volker, Wiebke und ich als Babys gebadet worden waren: Die stellte er sich auf den Schoß, um nicht versehentlich das Sofa zu beferkeln, und dann diktierte er mir einen langen Brief an seine Schwester Doro, in dem er ihr darlegte, weshalb er an der Feier ihres 60. Geburtstags nicht teilnehmen werde. Ihm stehe der Sinn »bis heute nicht nach derlei Lustbarkeiten«, weil er dafür noch immer zu traurig sei. Außerdem werde bei solchen Familientreffen unentwegt über nicht anwesende Lebende und auch über Tote gelästert, und das sei ein Verstoß gegen das vierte und das achte Gebot …
Das Diktat zog sich fast zwei Stunden lang hin. Und dann fiel Papa noch ein Nachsatz ein:
Bitte verschont mich mit Besuchen mindestens bis Weihnachten 1990. Ich bin zufrieden mit dem Besuch meiner Kinder.
Es war aber auch nicht so, als ob seine Geschwister ihm sonst die Bude eingerannt hätten.
Das Nasenblut kippte ich aus der Wanne in den Küchenausguß.
Nach vier Tagen mußte ich aus Meppen wieder raus, sonst wäre ich die Wände hochgegangen.
Zum Abschied schenkte Papa mir einen Cartoonband von Gary Larson, den er auf seiner letzten Dienstreise in Washington auf dem Dulles Airport gekauft hatte. »Bride of the Far Side« hieß das Büchlein.
Ein Zebra, das andere Zebras davon abhält, einem Löwen beim Auffressen eines erlegten Zebras zuzusehen:
»Let’s move it, folks … Nothing to see here … It’s all over … Move it along, folks … Let’s go, let’s go …«
Gary Larson war ein Guter.
Irgendein Witzbold hatte zwanzig Mark auf mein »Notkonto für Meppengeschädigte« überwiesen, aber das war auch alles.
»Dieser Lothar Matthäus ist in einer Superverfassung«, erklärte der Co-Kommentator Karl-Heinz Rummenigge während des WM-Spiels gegen die Vereinigten Arabischen Emirate, das ich mir in Omas Wohnzimmer ansah. Rummenigge mochte ja ein guter Torjäger gewesen sein, aber er hätte seinen Schnabel halten sollen.
Das 4:1 erzielte Uwe Bein. Mein deutscher Lieblingsspieler. Ein Mann ohne Allüren.
»Und? Wie steht’s?« fragte Oma, als sie mit zwei Schnittchentellern reinkam.
Da fiel gerade das 5:1.
Schon ein starkes Stück, daß die DDR, wie nun herauskam, diversen RAF-Terroristen Unterschlupf gewährt hatte.
Aber andererseits waren die dort ja ordentlichen Berufen nachgegangen. Und resozialisiert worden.
Papa rief an: Seiner Mutter gehe es sehr schlecht. »Wenn es stimmt, was Gertrud von dem Pflegepersonal gehört hat, dann muß man sich jetzt auf das Ende gefaßt machen. Ich würde jedenfalls gern nochmal nach Bielefeld fahren, bevor es zu spät ist. Und du ja vielleicht auch …«
In Bielefeld-Sennestadt kamen wir an einem grauen Montagnachmittag an und parkten vor dem von-Plettenberg-Stift.
Oma Schlosser lag in einem klinisch sauberen Zimmer auf einem Krankenbett und schlief.
»Wir wissen nicht, ob Ihre Frau Mutter noch einmal aufwachen wird«, sagte eine der Pflegerinnen zu Papa. »Aber es geht ihr gut, und sie hat keine Schmerzen. Wenn sich irgendwas in ihrem Befinden ändern sollte, rufen wir sofort Ihre Schwester Gertrud an. Die Nummer haben wir ja.«
Vom Altenheim war es nicht weit bis zum Haus von Gertrud und Edgar im Johann-Fichte-Weg. Auf der Fahrt dorthin sagte Papa, daß Oma oft genug Paul Gerhardt zitiert habe: »Mach End, o Herr, mach Ende!« Aber traurig sei es natürlich trotzdem.
Gertrud trug eine Kartoffelsuppe mit Mettwurst auf, und als wir später im Wohnzimmer saßen, schenkte Edgar uns Weißwein ein, und Gertrud erzählte von ihrer Flucht im Januar ’45. Mit Kommißbrot, Schmalz und Wurst im Proviantbeutel und aus Decken genähten Rucksäcken und mehreren übereinander angezogenen Kleidungsstücken, so sei sie mit ihrem BDM-Trüppchen durch Eis und Schnee gestapft, und hinter sich hätten sie schon die Kanonen grummeln gehört. Dann sei’s per Lazarettzug nach Küstrin gegangen, wo es Verpflegung vom Roten Kreuz und von der NS-Frauenschaft gegeben habe: »Das war vorbildlich organisiert!«
Nur daß es ohne die Nazis überhaupt nicht nötig gewesen wäre, das alles zu organisieren.
Von Küstrin sei es mit einem Fronturlauberzug nach Thüringen gegangen, in ein Lager des Reichsarbeitsdienstes in Artern an der Unstrut. »Man konnte in der Ferne das Kyffhäuserdenkmal sehen. Sagt dir das was?« fragte sie mich.
Kyffhäuser? Standen die nicht eher in Amsterdam? Hahaha …
Der Kyffhäuser sei ein thüringisches Gebirge, sagte Gertrud, und dort stehe ein Denkmal von Kaiser Wilhelm I., und Edgar ließ uns wissen, daß er jetzt mal jene Lokalität aufsuchen müsse, zu der auch der Kaiser zu Fuß gehe.
Papa und ich bekamen je ein Gästezimmer im von-Plettenberg-Stift. Da konnte man sich schon mal darauf einstimmen, wie es sich anfühlte, aufs Altenteil gesetzt zu sein, abgeschnitten von allen Quellen des Vergnügens und dafür eingewiesen in ein steriles Kabuff mit Neuem Testament und Rauchverbot.
Am Dienstagmorgen schlief Oma noch immer. Ihre Gesichtshaut war so dünn wie Pauspapier, und ihre Hände bestanden fast nur noch aus braunen Altersflecken.
Gott der Herr hat sie gezählet …
Was diese Frau alles durchgemacht hatte. Zwei Weltkriege, sechs Schwangerschaften (Fehlgeburten nicht mitgerechnet), Nazizeit, Vertreibung, Hungerwinter, Jahre voller Entbehrungen und einen langen Lebensabend im Rollstuhl. Zwischen Rheumakissen und Pantoffelkino.
Des Menschen Leben: das heißt vierzig Jahre Haken schlagen. Und wenn es hoch kommt (oft kommt es einem hoch!!) sind es fünfundvierzig; und wenn es köstlich gewesen ist, dann war nur fünfzehn Jahre Krieg und bloß dreimal Inflation.
Oma Schlosser, Jahrgang 1899, hatte es auf neunzig Jahre gebracht. Sie war unsere letzte Erinnerung an das 19. Jahrhundert.
Zum Rauchen gingen Papa und ich abwechselnd auf einen Balkon, über dem sich der farblose ostwestfälische Himmel wölbte. Aber der wölbte sich nicht einmal richtig. Der hing bloß herunter wie eine ausgeleierte Gardine.
Wieso ergriffen nicht alle Bielefelder die Flucht aus diesem Loch?
»Sie sollten besser mal hereinkommen«, sagte eine der Altenpflegerinnen zu mir. »Die Nasenspitze Ihrer Großmutter ist etwas wächsern geworden, und das ist ein Zeichen dafür, daß sie wahrscheinlich bald sterben wird.«
Da war Papa gerade zum Mittagessen in die Kantine gegangen.
Ich bat die Pflegerin, ihm Bescheid zu sagen, und eilte an Omas Bett.
Sie atmete nur noch schwach. Ihr Atmen ging in ein Röcheln über, das leiser und leiser wurde. Und immer leiser.
Papa kam herein. Und dann standen wir beide vor Omas Leichnam.
Ein Arzt hielt den Todeszeitpunkt fest: 13.31 Uhr.
»Jetzt bin ich Vollwaise«, sagte Papa, als wir zu den Erhards fuhren.
Gertrud weinte, als wir ihr die Nachricht überbrachten, und wahrscheinlich fühlte sie sich auch erlöst von ihren Tochterpflichten. Sie war selbst nicht mehr die Jüngste, und sie hatte Oma viele Jahre treulich gedient.
Dann begann eine Riesentelefoniererei mit allen möglichen Verwandten. Nach einer Stunde erreichte Papa auch Renate in Italien, und er sagte ihr, daß sie ihren Urlaub nicht abzubrechen brauche, denn davon hätte Oma auch nichts mehr.
Nur Walter und Mechthild waren nicht an die Strippe zu kriegen, weil sie sich bereits auf dem Weg nach Bielefeld befanden.
Ich wollte mir gern das WM-Spiel Deutschland – Kolumbien ansehen, und dagegen hatte niemand etwas einzuwenden.
Es kam jedoch zu keinem Kantersieg, sondern nur zu einem mühsam erzwungenen 1:1. Und es verdroß mich, daß Franz Beckenbauer in der Halbzeit Uwe Bein ausgewechselt hatte.
In der Hoffnung, Oma Schlosser noch lebend anzutreffen, sahen Walter und Mechthild sich getäuscht.
»Ihr müßt mit uns Lebenden vorliebnehmen«, sagte Edgar.
Die beiden hatten ein Hotelzimmer in Bielefeld gemietet und blieben zum Abendessen. Sie hätten auch im Johann-Fichte-Weg schlafen können, wenn das Dachgeschoß schon fertig gewesen wäre, aber dieses seit vielen Jahren verfolgte Projekt schien sich schwieriger zu gestalten als der Turmbau zu Babel.
Im April hatten Mechthild und Walter Urlaub auf Kreta gemacht. »Da haben wir uns einer deutschsprachigen Führung durch die Tempelanlagen von Knossos angeschlossen. Aber vieles war nicht sachgemäß restauriert worden. Die bemalten Ruinen haben mich eher an Disneyland erinnert«, sagte Walter. Danach habe er an einer Radfernfahrt von Dortmund nach Berlin teilgenommen und die »Buckelpisten« in der DDR kennengelernt. Besonders Magdeburg sehe schlimm aus: »Grau in grau, kaum Farben, der Dom halbverfallen und überall Plattenbauten. Wir sind auch an einem stillgelegten Stahlwerk vorbeigekommen. Die rostigen Hochöfen und die leeren Fabrikgebäude schienen mir direkt beispielhaft für den Verfall der DDR-Wirtschaft zu sein …«
Das Tischgespräch bewegte sich dann von allein in immer tiefere Schichten der Vergangenheit hinab.
Dietrich, sagte Walter, habe als kleiner Junge auf die Frage, was er mal werden wolle, angesichts der Trümmer die Äußerung getan: »Ich will Dortmund wieder aufbauen.« Und er sei ja tatsächlich Bauingenieur geworden.
Dazu merkte Papa an, daß 1945 ganz Deutschland am Hungertuch genagt habe.
»Ich weiß noch«, sagte Gertrud, »daß wir auf der Flucht in Artern an der Unstrut zum Einsatz kamen und daß ich einem alten Rentnerehepaar geholfen habe, also eingekauft, gefegt, gewischt und was so anfiel. Doch nach kurzer Zeit brach im Lager Scharlach aus, und wir wurden unter Quarantäne gestellt. Verbindung nach draußen bestand nur durch die Post. Ich hatte ja überall viele Verwandte, in Berlin, Bochum, Cottbus und Hamburg, und so erfuhr ich recht bald, wo die Eltern und Geschwister gelandet waren. Und ich erfuhr auch, daß unsere liebe Großmutter Charlotte Grote auf der Flucht gestorben war und daß der Großvater Eduard in Swinemünde im Krankenhaus lag. Der Postverkehr lief immer noch reibungslos, was zu dieser Zeit ja eigentlich an ein Wunder grenzte …«
Briefträger im Bombenhagel! Dann schon lieber Spüler auf Norderney.
Am Mittwoch kamen auch Rudi und Hilde aus Hannover nach Sennestadt und nahmen am Eßtisch Platz.
Walter hatte inzwischen bereits Traueranzeigen in drei Dortmunder Tageszeitungen geschaltet – in der Westdeutschen Allgemeinen, der Westfälischen Rundschau und den Ruhr Nachrichten, damit möglichst alle alten Bekannten aus der Zeit, in der Oma und Opa Schlosser in Dortmund gewohnt hatten, von dem Todesfall erfuhren. Walter wollte sich auch um die Abwicklung der Formalitäten kümmern und in den Federkrieg eintreten: mit dem Kreiskirchenamt, der Dortmunder Versorgungskasse für Pfarrer, der Victoria-Lebensversicherung, der Barmenia-Krankenversicherung, dem Postgiroamt und der Stadtsparkasse Bielefeld.
Der Nachlaß sei ja nicht besonders groß, sagte Gertrud. »Aber es sind eben doch ’ne Menge Bücher. Und dann die Schallplatten. Was sie da alles gehabt hat. Händel, Chopin, Telemann, Brahms, Tschaikowski, Mozart, Schubert, Bach und Beethoven und Schütz und Bruch … und natürlich die Kommoden und die Schränke und so weiter.«
Als Bundesverfassungsrichter hatte Rudi es gerade mit einem Fall zu tun, der die Titanic betraf: Ein Querschnittgelähmter, der partout zu einer Wehrübung einberufen werden wollte, hatte einen Prozeß gegen die Bundeswehr angestrengt und war in der Titanic als »geb. Mörder« bezeichnet worden. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hatte ihm dafür 12000 Mark Schmerzensgeld zugesprochen, und nun mußte das BVG entscheiden, wer recht hatte. »Die freiheitliche Ordnung, die das Grundgesetz konstituiert, schützt auch die Satire«, sagte Rudi, »aber wenn Kurt Tucholsky sagt, daß die Satire alles dürfe, muß sich das Bundesverfassungsgericht dieser Auffassung nicht vorbehaltlos anschließen, denn es kann ja nicht an der Erkenntnis vorbeigegangen werden, daß eine absolut schrankenlose satirische Betätigung von der Verfassung kaum gewollt sein dürfte.«
»Wieso muß sich denn das Bundesverfassungsgericht überhaupt damit befassen, was Tucholsky mal gesagt hat?« fragte Papa.
Solche Äußerungen, sagte Rudi, müßten in Betracht gezogen werden. »Wir leben ja nicht in einem gleichsam geschichtslosen Raum, sondern in einem Gemeinwesen, dessen Vorstellungen vom Grundrecht auf Meinungsfreiheit und vom Gewicht des Schutzes der persönlichen Ehre einer fortlaufenden Wandlung unterworfen sind, und dieser Wandlung muß das Bundesverfassungsgericht von Fall zu Fall justitiable Konturen verschaffen …«
Oma sollte am Freitag in Dortmund-Großbarop beerdigt werden, neben ihrem Mann, und Papa wollte vorher nochmal nach Meppen fahren und seinen Papierkrieg mit den Behörden weiterführen.
Also wieder zurück über die hirntote, verschissene, von Autohäusern und Kfz-Werkstätten gesäumte B 68 nach Meppen, wo alles Leben schon in der Neandertalerzeit erloschen war.
Abends diktierte Papa mir einen Brief an die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte:
Mit Vorgang 1 teilen Sie mir mit, daß der Antrag auf Hinterbliebenenrente eingegangen und in Bearbeitung sei, mit Vorgang 2, daß die erforderlichen Formulare für den Antrag nicht eingesandt worden seien …
Mit diesen Ämtern kämpfte Papa wie ein Sagenheld.
Aus der Stadt brachte ich am Donnerstag außer dem Üblichen auch eine CD mit Songs aus der Zeit Shakespeares mit, gesungen von Alfred Deller, für später, und eine Nummer der Meppener Tagespost. Darin nahm der Sozi Hermann Proske Stellung zu der Planung eines Parkhauses in der Innenstadt:
Wer wird denn dieses Parkhaus in erster Linie annehmen? Das ist doch die Frage. Und: Wer ist denn als Kurzzeitparker darauf angewiesen, nun genau an diesem Punkt, der nach unserer Meinung heute genausowenig akzeptabel ist wie vor drei Jahren, zu parken? Wer morgens um halb zehn auf den Parkplatz »Neuer Markt« geht, der wird feststellen, daß die ersten, die besten Parkreihen besetzt sind mit Wagen, die auch mittags noch dort stehen. Sinnvoll wäre es doch, hier eine wesentlich größere Anzahl von Kurzzeitparkplätzen zu schaffen …
Das hatte er davon, der Proske, daß er zu knauserig gewesen war, Hermann Gerdes und mir ein Getränk zu spendieren, als wir ihn 1980 vor der Bundestagswahl für unsere Schülerzeitung interviewt hatten. Jetzt mußte er sich mit popligen Parkplatzproblemen in Meppen herumärgern, während Rudolf Seiters, der uns eine Cola ausgegeben hatte, Weltgeschichte schrieb.
Von Meppen nach Großbarop war es wieder ein sehr langer Ritt mit Papas altem Jetta. Wir kamen um elf Uhr auf dem Friedhof an, eine ganze Stunde vor Beginn des Trauergottesdienstes, und gingen zu dem ausgehobenen Grab.
Auf dem Grabstein stand:
LASSETIHNUNSLIEBEN,
DENNERHATUNSZUERSTGELIEBT.
Im Januar 1961 war Opa Schlosser dort beerdigt worden, und danach hatte Oma Schlosser als Witwe gelebt. Mehr als 29 Jahre lang! Immer nur Gebetbücher und Arien und Leitartikel und die sich mehrenden körperlichen Gebrechen …
Vor dem Friedhof, auf der anderen Seite der Straße, wogte ein Kornfeld im Sommerwind, und auf dem Parkplatz rollten die Pkws der Verwandten ein: Walter und Mechthild mit Christiane, Tante Hanna und Fräulein Kunze, Papas Kusine aus Köln, Gertrud mit Bodo, aber ohne Edgar, und dann auch Doro und Jürgen mit zweien ihrer Trabanten.
Walter hatte schon Trauerkarten drucken lassen und versandt. Eine davon nahm ich an mich, um sie Andrea zu schicken. Auf der linken Innenseite standen Verse von Matthias Claudius:
O Du Land des Wesens und der Wahrheit.
Unvergänglich für und für,
Mich verlangt nach Dir und Deiner Klarheit,
Mich verlangt nach Dir.
Und rechts oben ein Bibelvers:
Denn wir haben hier keine bleibende Statt,
sondern die zukünftige suchen wir.
Hebr. 13,14
»Und der hiesige Pfarrer hat sich vielleicht angestellt!« sagte Walter. »Der meinte, damit Mutter hier beigesetzt werden könne, müsse erst eine Genehmigung von dem Pfarrer eingeholt werden, der für das von-Plettenberg-Stift zuständig ist. Eine total überflüssige Maßnahme. So ein Gnitzepriem!«
Dietrich erschien ohne seine Frau Jutta, weil sie mit Oma Schlosser über Kreuz gelegen hatte. Er stand dann an der Straße und hielt Ausschau nach dem Auto von Rudi und Hilde, und als endlich alle da waren, gingen wir in die Friedhofskapelle.
Vor dem aufgebahrten Eichensarg lagerten die Kränze.
Auf der linken Schleife des von Papa bestellten Kranzes stand:
Auf
Wiedersehen
liebe Mutter
Seine Geschwister hatten sich dagegen alle für ein schlichtes Kreuz als Schleifenschmuck entschieden.
Ein junger Pastor trat auf die Kanzel und hielt eine sehr dürftige Traueransprache. Hatte offenkundig keinen Dunst davon, mit wem er es zu tun hatte, aber wir ließen uns nichts anmerken.
Befiehl du deine Wege
und was dein Herze kränkt
der allertreusten Pflege
des, der den Himmel lenkt …
Als der Sarg ins Grab gelassen wurde, mußte ich aber doch wieder weinen.
»Das war alles so blaß und unpersönlich«, sagte Walter, als wir danach im Café saßen. »Dieser Pastor hat überhaupt nichts aus Mutters Leben erwähnt, sondern nur lauter Bibeltexte verlesen! Das hat sich alles angehört, als ob hier ein Mensch begraben wird, zu dem man keinerlei persönliche Beziehung gehabt hat. Schade, kann ich da nur sagen. Sehr schade …«
Und wieder hinab in die Sedimente der Familiengeschichte. Anfang 1960