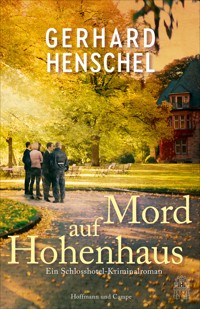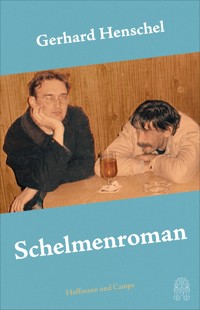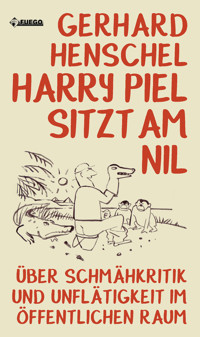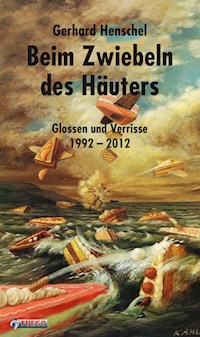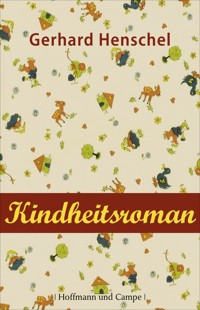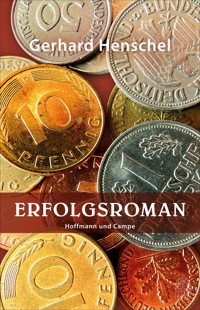15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Martin Schlosser
- Sprache: Deutsch
»Die lustigste aller BRD-Chroniken.« Ursula März, Die Zeit "Und wie ist das so in diesem Haus, das du geerbt hast?", fragte Max. "Liegt da noch das Skelett von deinem Vater rum?" Frühling 1992: In der Kreuzberger Wohngemeinschaft des dreißigjährigen Schriftstellers Martin Schlosser geht es drunter und drüber, aber seine ersten Bücher sind in Arbeit, und ihm lacht das Glück. Er zieht um die Häuser, tummelt sich mit Max Goldt und Rattelschneck auf Helgoland, freundet sich mit Eckhard Henscheid an, singt zu seiner eigenen Verwunderung eines Nachts Hand in Hand mit der Streetworkerin Domenica Niehoff im Vollmondschein einen Kanon und lernt auf seinen Lesereisen die neuen Bundesländer von ihren schwärzesten Seiten kennen. Nebenbei verliebt er sich immer öfter und bleibt trotzdem ein überzeugter Single, der die Pärchenbildung als Irrweg der Evolution betrachtet. Im Herbst 1993 tritt Martin Schlosser in Frankfurt in die Redaktion des Satiremagazins Titanic ein. Damit beginnt für ihn ein neues Leben, während seinen verwitweten Vater in der emsländischen Kleinstadt Meppen allmählich die Kräfte verlassen und ein schauerliches Ende naht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 791
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Gerhard Henschel
Schauerroman
Hoffmann und Campe
Schauerroman
In der Wohnung sah es aus wie Sau, als ich mein Katerfrühstück einnahm. Man feierte nicht ungestraft Geburtstag in einer Kreuzberger Fabriketagen-WG! Pfützen, Bierdeckel, Styroporbecher, Sektkorken, Wurstzipfel, klebriges Leergut, verknautschte Zigarettenschachteln, fettige Papierservietten und als Aschenbecher mißbrauchte Teller mit erstarrten Speiseresten kündeten von einer langen, feuchtfröhlichen Nacht, und von Sigrun durfte ich mir anhören, daß sie die Fete zwar ganz lustig gefunden habe, aber nicht dieses eine total bescheuerte Lied, das irgendein Idiot um fünf Uhr morgens aufgelegt habe: »Weischt, welches i mai?«
Oja, ich wußte, welches sie meinte: das Lied von Stephan Remmler. Das einzige, das ich selbst ausgesucht hatte:
Einer ist immer der Loser
einer muß immer verliern …
»Des hedd mi faschd zom Wahnsinn gbrachd«, sagte sie. »I war da scho halb oigschlafa!«
Zum Glück gab es in meiner Wohngemeinschaft einen extrabreiten Saalbesen. Damit förderte ich auch zwei tote Mäuse zutage, die schon eine geraume Weile unter dem Fernsehsofa gelegen hatten.
Das Aufräumen und Saubermachen dauerte Stunden, und dann lehnten drei prallvolle Müllsäcke an der Wohnhallenwand.
Heraus zum 1. Mai! Den Zinnober, den die Autonomen in dieser Nacht veranstalteten, wollte ich mir einmal näher anschauen.
Philipp kam mit. Er glaubte, daß die größte Action am Görlitzer Bahnhof abgehe. Wir kämpften uns dorthin durch und sahen uns einer starken polizeilichen Streitmacht und deren Wasserwerfern gegenüber, während vermummte Demonstranten Steine warfen und aufgescheucht herumrannten.
Was sie damit bezweckten, blieb unklar. Es war kindisch, den Staat auf diese Weise herauszufordern. Welchem Ziel sollte es dienen, daß ein paar hundert Karnevalsbrüder Schaufenster einschmissen oder Autos in Brand steckten?
»Kein einziger von denen würde sein eigenes Auto anzünden«, wollte ich zu Philipp sagen, aber da driftete er in der wogenden Volksmenge schon woandershin, und als ich nach einem Ausweg suchte, schlug eine Polizistin mir ihren Knüppel so hart aufs linke Knie, daß ich zwei Tage lang nur noch hinken konnte.
Und dennoch ging es mir besser als dem Typen in Stephan Remmlers Lied. Allein im April hatte ich mit meinen Texten mehr als fünftausend Mark eingenommen. Lesungshonorare nicht eingerechnet.
Im Benno-Ohnesorg-Theater in der Galerie am Chamissoplatz nahm Wiglaf Droste am Sonnabend Stellung zur Randale vom 1. Mai: »Ein kleiner Leckerbissen am Rande sind in jedem Jahr die Versuche des Kreuzberger alternativen Mittelstands, sozialarbeiterische Arschkriecherei als ›Vernunft‹ auszugeben und sich schlichtend zwischen die Kontrahenten zu stellen. Bisher haben sie noch immer bekommen, was sie verdienen: tüchtig Haue von beiden Seiten …«
Der Subkulturforscher Klaus Farin, der als Gast aufgetreten war, fragte mich hinterher im Heidelberger Krug bei Bier und Bouletten nach meinem politischen Standort, den ich aber selbst nicht so genau kannte. »Und du wohnst in Berlin?«
»Ja. In einer Siebener-WG in der Graefestraße.«
»Kann man das aushalten?«
Das Schlimmste sei der allmorgendlich einsetzende Baustellenlärm, sagte ich, und dann lud Marcus Weimer alias Rattelschneck mich dazu ein, auf der Rückseite eines Kilkenny-Irish-Beer-Aufstellers mit einem Kugelschreiber die Zeichnung eines »Hausfrauenhimmels« zu komplettieren, in dem ein Engel auf den Wolken staubsaugte, während eine Ratte dem lieben Gott, der in Ruhe fernsehen wollte, auf den Kopf kotzte.
Tags darauf sahen Wiglaf, Marcus und ich uns im Arsenal die Originalfassung von John Fords Western »My Darling Clementine« an, von dessen Poesie man nicht viel wußte, wenn man ihn nur aus dem Fernsehen kannte. Gemein war allerdings der von Anfang an feststehende Tod der schönen Mexikanerin Chihuahua. In klassischen Western hatten gutaussehende mexikanische Bardamen keine Überlebenschance.
Beim Bier kamen wir vom Gespräch über die Schießerei am Ende des Films auf die Waffengeilheit der RAF, und Wiglaf verriet uns, was Bommi Baumann ihm über Andreas Baader erzählt habe: Der sei immer gern mit ’ner Knarre in der Hand rumgelaufen. Und als er einmal aus dem Bad gekommen sei, habe er einer Frau ein Handtuch zugeworfen und gesagt: »Los, Fotze, abtrocknen!«
Das glaubte ich unbesehen. Es paßte zum Sound der bekanntgewordenen RAF-Kassiber.
Marcus sagte, daß er auch eine Kriegsgeschichte auf Lager habe: Er sei mal in London bei einer Familie zu Gast gewesen, in deren Wohnzimmer es nur einen einzigen Steckkontakt gegeben habe. »An den konnte man entweder den Plattenspieler anschließen oder den Zierkamin. Und es gab jeden Abend Streit deswegen …«
Richtungslose Kneipengespräche waren immer eine Wonne, und wenn Marcus dabei war, konnte man sicher sein, daß sie nicht monothematisch verliefen.
Am späteren Abend schrieb ich wieder an meinem kleinen Buch für Klaus Bittermanns Edition Tiamat (»Menschlich viel Fieses«) über das Schnulzige in den Traktaten, Predigten, Memoiren und Versen der Bürgerrechtler, die gegen die DDR-Regierung aufbegehrt hatten.
Gedicht, steig auf, flieg himmelwärts!
Steig auf, gedicht, und sei
der vogel Schmerz …
Wegen solcher Gedichte war der Poet Reiner Kunze mit einem Berufsverbot belegt und von der Staatssicherheit drangsaliert worden, was die Gedichte aber nicht besser machte.
Von der Arbeit ablassen mußte ich dann, als im Ersten Woody Allens Beitrag zu dem Episodenfilm »New Yorker Geschichten« lief. Das Komischste, was ich von Allen je gesehen hatte: Eine tyrannische Mutter taucht nach ihrem Verschwinden plötzlich als riesenhafte Himmelserscheinung über Manhattan auf und rhabarbert über die Verfehlungen ihres Sohnes, der schon geglaubt hatte, er wäre sie für immer los. Wie schrecklich!
Die Redakteure des Fußballfachblatts Kicker liebten es, die Überschriften ihrer Artikel mit Namenswitzen aufzubrezeln:
Kurz hielt Thom kurz
Saftig auf dem Trockenen
Hart wie Holz, dieser Golz
Und in bezug auf den Bundesligaspieler Mehmet Scholl:
Mehmet, was s(ch)oll das?
Eine ebenso behämmerte wie putzige Marotte.
Für die Nullnummer der Zeitschrift Schnurrende Traglast, die Kathrin Passig und ich herausgeben wollten, schickte mir der Hamburger Journalist Christian Meurer einen Text, in dem es um dänischen Leberwurstpudding und »ein halbherziges Sommergeplänkel mit einem Hildesheimer Forstassessor auf Lanzarote« ging, und das waren genau die Petitessen, an die wir gedacht hatten, denn es sollte eine Zeitschrift für das Unwichtige werden.
In Los Angeles waren bei einer Protestdemonstration von Afroamerikanern 53 Menschen ums Leben gekommen und mehr als zweitausend verletzt worden. Vier Polizisten – drei Weiße und ein Latino – hatten zuvor einen am Boden liegenden Schwarzen minutenlang mit Schlagstöcken verprügelt und mit Füßen getreten, waren aber von einem Gericht freigesprochen worden, und in der Jury hatte kein einziger Schwarzer gesessen. Rassismus wie vor einhundert oder zweihundert Jahren: als hätte der von Martin Luther King angeführte Marsch auf Washington nie stattgefunden.
Was man in den Schreibwarenläden kaufen konnte, waren Muscle-T-Shirts, Rollschuhe und Seifenblasen, aber kaum noch Schreibwaren.
»Haben Sie Aktenordner?«
»Sind aus.«
»Und Kopierpapier?«
»Vielleicht kommende Woche wieder …«
»Und Radiergummis?«
»Hatten wir mal.«
War das die von Jürgen Habermas analysierte »Neue Unübersichtlichkeit«?
Der Tod von Marlene Dietrich ließ meine Mitbewohner kalt. Torsten kannte nicht einmal ihren Namen, Sigrun verwechselte sie mit Hildegard Knef, Jochen sagte, er stehe mehr auf Julia Roberts, für Lizzy begann die Filmgeschichte überhaupt erst 1983 mit dem Film »Klassenverhältnisse« von Jean-Marie Straub und Danièle Huillet, und Philipp befand sich gerade in einem unzugänglichen Bewußtseinszustand.
Von Reinhold lag keine Stellungnahme vor. Er war seit Monaten on the road, und ich hatte ihn noch nie gesehen.
»Da isch dai Großmuadr am Delefo«, sagte Sigrun.
»Hallo, Oma!«
»Ich grüße dich, Martin! Ist mein Geburtstagsbrief jetzt da? Der mit dem vielen Geld?«
»Nein, noch nicht. Jetzt streiken hier die Postbeamten. Und dazu noch die Müllmänner …«
Ich solle ihr sofort Bescheid geben, wenn er angekommen sei, sagte sie. »Geht’s dir denn gut, mein Lieber?«
»Ja! Ich fahr übermorgen zur Leipziger Buchmesse und treff mich da mit zweien meiner Verleger …«
Unter denen meine liebe alte Oma Jever sich vermutlich arriviertere Herren vorstellte als die Kleinverleger Michael Rudolf und Gerd König aus Greiz in Thüringen.
Fünfzig Millionen Postsendungen steckten im Stau, hieß es im Radio, und ich schätzte, daß mindestens zwei Millionen davon für mich bestimmt waren.
In der Zeit lobte Harry Rowohlt »den genialen Kolumnisten Max Goldt«:
So schöne Kolumnen möchte ich auch mal schreiben können. Aber ansonsten bin ich ganz froh, daß ich ich bin und nicht er, denn seine Groupies sehen sämtlich aus wie Hitlerjunge Flex, während bei meinen Groupies … äh … sozusagen noch alles drin ist.
Mit Harry Rowohlt hätte ich auch gern mal das Glas erhoben.
Auf dem Hinweg zu einem Lokal namens Marabu, wo ich mit Lizzys Freundin Dunja verabredet war, die laut Lizzy auf mich flog, obwohl sie sich, wie ich wußte, in festen Händen befand, wurde ich weichgeregnet, und im Marabu störten uns ständig irgendwelche von Dunjas Bekannten.
Mit denen ließ ich sie schließlich allein. Eine Frau, die so genau unter Beobachtung stand, wäre sowieso nicht auf Abwege zu bringen gewesen.
Um nach Leipzig fahren zu können, mußte ich erst einmal den Bahnhof Schöneweide erreichen, was gar nicht so leicht war, weil ich das System der Ostberliner S-Bahn nicht durchschaute.
Die Lautsprecherkommandos auf den Bahnsteigen erschollen noch immer im barschen Tonfall der sozialistischen Obrigkeit, und in den Waggons der Reichsbahn stank es, wie schon vor dem Mauerfall, nach dem todbringenden Desinfektionsmittel Wofasept aus Bitterfeld. Diese chemische Keule konnte nur von Irren hergestellt worden sein.
Schwarzgeledert und kaugummikauend stand Michael Rudolf im Leipziger Hauptbahnhof parat und salutierte. »Ey! Besuch aus’m Westen!«
Irgendwo am Stadtrand hatten Gerd König und er eine kleine Wohnung angemietet, in der auch ich übernachten konnte, aber unser erstes Ziel war das Messehaus.
Im Herbst, sagte Michael, könnten wir vielleicht ein bißchen auf Lesereise gehen. »Vielleicht nach Halle, Rostock, Jena und Chemnitz. Wenn der Sammelband mit deinen Texten erschienen ist. Für den wir uns noch einen Titel ausdenken müssen …«
Michaels Kompagnon Gerd König begrüßte mich herzlich. Ein Vogtländer mit gestutztem Vollbart und hellbrauner Breitcordjacke. Er war gelernter Zerspanungsmechaniker und hatte in den achtziger Jahren im Leipziger Literaturinstitut studiert und 1991 gemeinsam mit Michael den Verlag Weisser Stein gegründet.
Unserem Versuch, im Messehaus einen Happen essen zu gehen, blieb der Erfolg versagt: Es gab nur einen säuischen Fraß, den man nicht hinunterbekam.
»Schmeckt wie zerlassene Filzsandalen«, sagte Gerd König.
Am Stand des Verlags Knaus erkundigte ich mich nach dem Befinden von Walter Kempowski, der einen Schlaganfall erlitten hatte, wie ich wußte, aber dort hatten sie alle keinen Schimmer davon, wie es ihrem wichtigsten Autor ging.
Sehr viel besser war das Essen abends im Ratskeller, und das Köstritzer Schwarzbier, das wir dazu tranken, fand auch vor Michael Gnade. Als Gärungstechnologe alter Schule stellte er an jedes Bier die höchsten Ansprüche, und dieses hier schmeckte ihm: »Das ist noch mit Liebe gehopft!«
An einem der Nebentische parlierte der strauchhaarige SPD-Spitzenpolitiker Wolfgang Thierse, der mich aber nicht so stark beeindruckte wie der weißbekittelte Bedienstete mittleren Alters, der auf der Herrentoilette der Aufgabe nachkam, die Papierhandtücher aus dem Papierhandtuchspender zu ziehen und sie den Gästen darzureichen, die sich die Hände gewaschen hatten. Was war denn das für ein kurioser Beruf?
Vom Ratskeller zogen wir in die Moritzbastei um, einen katakombenartigen Gewölbekeller mit Ausschank und regem Zulauf aus Studentenkreisen. In einem der Gelasse saßen wir schon bald vor drei Bierhumpen und sprachen gerade darüber, wie mein Buch heißen solle, als eine bildschöne dunkelhaarige Frau die Treppe neben uns herunterkam und mir dabei tief in die Augen sah.
Ich entschuldigte mich bei Michael und Gerd, lief der Frau hinterher und entdeckte sie in einer separaten Bar namens Schwalbennest. »Du hast mich eben so freundlich angesehen«, sagte ich. »Darf ich dir was ausgeben?«
»Dann aber was Richtiges«, sagte sie. »Whiskey.«
Sie hieß Nicole, stammte aus Apolda und war Apothekerin in Leipzig, und es kam rasch zum ersten Kuß. Auf den unmittelbar nach dem zweiten gemeinsamen Getränk ein noch innigerer folgte. So gefiel mir das Leben!
Hello, I love you
Let me jump in your game …
Offenkundig war Nicole ebenso liebeshungrig wie ich, und ich überlegte schon, ob es statthaft wäre, sie in das Quartier meiner Verleger mitzunehmen.
»Hier steckst du also!« rief Michael. »Wir haben dich überall gesucht!« Er stellte meine Reisetasche hinter meinem Barhocker ab und sagte, daß Gerd König und er jetzt eine Lesung experimenteller Lyrik besuchen wollten. »Gleich um die Ecke. Kommst du mit?«
»Nein. Ich bleibe lieber noch im Schwalbennest.«
»Na gut. Dann sehen wir uns hier so in ’ner Stunde wieder …«
Wen lockte experimentelle Lyrik, wenn es stattdessen Zungenküsse gab?
In das Taxi, das uns zu der Unterkunft in der Vorstadt bringen sollte, stieg Nicole dann tatsächlich mit ein, und ich schuf ihr einen Platz auf meiner kargen Lagerstatt, die aus einer in der Küche liegenden Matratze bestand. Als Zudecke diente uns ein rauhes volkseigenes Badehandtuch. Doch was brauchten wir mehr?
Das Frühstück war mager: Malzkaffee und getoastetes Weißbrot mit Goldina-Margarine und Zörbiger Pflaumenmus.
Nicole und ich wollten in Verbindung bleiben, und wir tauschten einen langen Kuß und unsere Adressen aus, bevor der zweite Messetag begann.
Im Tageslicht sahen die Bauten in der Leipziger Vorstadt noch schäbiger aus als in der Nacht. Viele waren bis zum zweiten Stock mit Müll gefüllt.
In den öden Fensterhöhlen
Wohnt das Grauen …
Und die Menschen! Quallig, knorpelig und teigig rollten sie von A nach B und stellten ihre vom jahrzehntelangen Schweinekopfsülzwurst- und Würzfleischverzehr entstellten Körper zur Schau. Figuren wie aus einer Freakshow.
»Sowas sehen wir hier alle Tage«, sagte Michael. »Reiß dich mal zusammen!«
Auf der Messe hatte auch der Semmel-Verlach einen Stand, der Mutterkonzern des Hamburger Satiremagazins Kowalski, für das Michael und ich schrieben. Wir nahmen dort die Cartoonbände unseres lieben Freundes Eugen Egner aus dem Regal und plazierten sie an einer besser sichtbaren Stelle.
Im Treppenhaus wären wir um ein Haar mit dem CDU-MdB Rainer Eppelmann kollidiert, und einmal kreuzten wir den Weg des TV-Journalisten Hanns Joachim Friedrichs, der genauso aussah wie im Fernsehen: Toll, was man auf einer Buchmesse alles erlebte.
Michael wollte zum Stand der Sozialistischen Verlagsauslieferung, kurz SOVA, die unter anderem Bücher der Verlage Nautilus, März und Stroemfeld/Roter Stern vertrieb. Sein Ziel war, die SOVA auch für den Verlag Weisser Stein zu gewinnen. Es war jedoch gerade niemand da, der ansprechbar gewesen wäre, aber eine der SOVA-Damen gab sich als Kowalski-Leserin zu erkennen und füllte uns mit Sekt ab.
Nebenan krachten Raketen los. Dort fand die Lesung eines Autors namens Harry Hass statt, der Feuerwerkskörper und Knallerbsen ins Publikum schmiß und einen Text über Touristen vortrug, die sich an der Ostsee den Hintern mit toten Krähen abwischten. Von anderswoher waren über Lautsprecher die sonoren Stimmen existentiell leidender Lyrikerinnen zu vernehmen, und Michael blies stumm die Backen auf.
Am Abend führten meine Verleger mich in das berühmte Lokal Auerbachs Keller aus, in dem Doktor Faust einst auf einem Faß über die Treppen geritten sein sollte.
Als Titel für mein Debütwerk schlug Michael mir »Der Sprung in der Schüssel der imperialistischen Bestie« vor, aber ich hätte etwas Milderes vorgezogen. Wenn ich auch noch nicht wußte, was.
Wir tranken wieder Köstritzer, und Gerd König rezitierte etwas von einem erzgebirgischen Heimatdichter: »Im Wald, da steht ein Ofenrohr. Stell dir mal die Hitze vor!«
Aus mir selbst unerklärlichen Gründen mußte ich darüber so ausdauernd lachen, daß mein Essen kalt wurde. Ich kriegte mich kaum wieder ein. Dieses im Wald stehende heiße Ofenrohr machte mich hilflos gegen den von innen kommenden Lachkoller.
Zuhause wartete ein Fax von Marcus mit einer für die Schnurrende Traglast gedachten Zeichnung auf mich, die den Titel »Die Okay-Bande« trug und zwei Räuber zeigte, die zwei Postkutschern zuriefen: »Alles klar, Männer? Seid ihr okay?«
Das war genau der Stoff, auf den ich aus war.
Zu seinem zweiwöchentlich tagenden Debattierzirkel, an dem ich meistens teilnahm, hatte Michael Rutschky nun auch Kathrin Passig eingeladen. Wir fuhren gemeinsam hin, und als wir vier Stunden später wieder draußen waren, sagte sie: »Hat mir gut gefallen, daß die alle so geschrien haben. Aber ich glaube, ich passe nicht in Herrn Rutschkys Sonntagsschule. Interessant fand ich nur die Information, daß es Leute gibt, die Fische akupunktieren.«
Der Müllmänner- und auch der Postbeamtenstreik waren endlich vorüber, und ich erhielt einen Brief von Eugen Egner aus Worpswede, wo er und seine Gefährtin Urlaub gemacht hatten. Es sei alles sehr schön gewesen, nur das Essen beim »Sudlerwirt« nicht:
Wie ein Balkon-Ersatzreifen lag mir der Haifischbraten im Magen.
Oje. Was mochte Eugen da verspeist haben?
Während ich an meinem Buch für die Edition Tiamat schrieb, sah ich mir auf Video Filme an – »Der Pate«, »Der Pate – Teil II« und »Der Pate – Teil III« –, und als die tödlich getroffene Mary Corleone gegen vier Uhr morgens auf den Stufen des Opernhauses von Palermo verblutete, brach zwischen Jochen und Philipp ein Streit aus, der sich auch in mein Zimmer verlagerte. Es schien um eine Frau zu gehen. Die beiden Kampfhähne brüllten sich an und gingen mit den Fäusten aufeinander los, aber schon am nächsten Vormittag hatten sie sich wieder lieb.
»Was war noh da gäschdern nachd los?« fragte Sigrun. »I hon dachd, ihr batschd eich gloi ’n Schädl oi!«
»Vergiß es«, sagte Jochen. »Kleine Meinungsverschiedenheit.«
Auf Geheiß des Tip-Redakteurs Volker Gunske besuchte ich die Pressevorführung einiger Folgen der Serie Drei Drachen vom Grill, einer albernen Parodie der Vorabendserie Drei Damen vom Grill. Da wurden einem so matte Scherze zugemutet wie der, daß jemand bei einem Familienkrach in ein offenes Messer lief und die Hinterbliebenen seine Leiche im Wald verscharrten, aber ich war nicht wählerisch, was meine filmkritischen Auftragsarbeiten anging, und ich durfte schreiben, was ich wollte.
Klaus Bittermann hatte inzwischen das Cover für mein Buch collagiert: einen Zylinder, aus dem Jürgen Fuchs, Wolf Biermann, Sascha Anderson, Stephan Krawczyk, Lutz Rathenow, Vera Lengsfeld und andere Vertreter der DDR-Opposition herausquollen.
»John Heartfield läßt grüßen«, sagte ich, was Klaus sehr amüsierte.
»Und wie weit bist du jetzt?«
»Auf Seite achtzig.«
»Na, einen guten Monat hast du ja noch Zeit …«
Meine Lieblingswitzzeichnung in dem Buch »Aus der Toilette kamen Wischgeräusche« von Tex Rubinowitz war die von dem Mann, der sich über ein oben rauchendes und unten tropfendes Rohr beklagte: »Typisch Rohr – oben rauchts raus, unten tropfts, und in der Mitte issis verstopft.«
Im Vorwort beschrieb Max Goldt das Zimmer, in dem Tex Rubinowitz wohnte:
In einer Ecke stehen drei Säcke mit den Aufschriften: Staub 86, Staub 87 und Staub 88. Staub 89 und 90 sind noch nicht eingetütet, die liegen noch rum …
Ha! Und wie wollte er diese beiden Jahrgänge trennen?
Um mich abzulenken, hätte ich die Stunde, in der meine Zahnärztin an meinem defekten Schneidezahn tischlerte, gern mit Erinnerungen an Nicole verbracht, doch es gelang mir nicht, die Praxis in Gedanken zu verlassen.
»Spülen Sie bitte mal aus …«
Es wurde aufs Schauerlichste der Bohrer geschwungen. Nur Erleuchtete hätten sich dabei in einer erotischen Träumerei verlieren können. Oder Perverse.
Für meine Beiträge in der Rubrik »Briefe an die Leser« waren zwei kleine Schecks von der Titanic eingetroffen, und aus dem Stadtmagazin Zitty sprang mir neues Rohmaterial für diese Rubrik entgegen, aus einem Interview, in dem der Verleger Axel Matthes sich in urgroßväterlicher Weise als Kulturkritiker äußerte:
Ein gutes Buch bringt mich zum Sprechen, die Massenmedien strangulieren unser Sprechen.
Literatur sei Sehnsucht, sagte er da. Und:
Ohne das Rauschgift Buch und andere Anachronismen wüßte ich freilich nicht, wie das Jetzt aushalten.
Ich zitierte einige der Sätze und schrieb:
Wie sollen wir das jetzt aushalten? Ach ja, wir strangulieren einfach Ihr Sprechen.
Schon passiert.
Bevor ich diesen neuen Brief an die Titanic faxte, rief ich in Frankfurt an, um nach dem nächsten Redaktionsschlußtermin zu fragen.
Am Apparat war der Redakteur Christian Schmidt. Das Juniheft sei bereits fertig, sagte er. Und daß er mich gern kennengelernt hätte, als er im Februar in Berlin gewesen sei. »Vielleicht können wir das irgendwann nachholen. Und Sie sollten einfach mehr für uns machen, finde ich …«
Unsere Spülmaschine schwächelte: Sie legte los, als wäre alles in bester Ordnung, aber nach jeweils zwei oder drei Minuten hielt sie inne und gab einen Heulton von sich wie eine sterbende Robbe.
»Und wer kümmert sich jetzt darum?« fragte Jochen.
»Du«, sagte Lizzy.
»Aha. Und was krieg ich dafür?«
»Bist du nicht jemand, der schon alles hat?«
»Ach, stimmt ja … hab ich ganz vergessen …«
In Wirklichkeit krebsten Jochen und Philipp mit ihrer kleinen Werbefirma natürlich am Rande des Existenzminimums herum.
Aus irgendeiner alten Zeitschrift hatte Kathrin den Kolumnentitel »Reserviert für Eva Ping« und die Überschrift »Dieter – der ›Kachel-Caruso‹« ausgeschnitten und fertigte dazu bei einer Redaktionssitzung in meinem Zimmer ein paar Zeilen für die Schnurrende Traglast an:
Ich und der Kachel-Caruso, wir werden sein wie drei. Achso, und dann noch der Fugen-Figaro! Dann werden wir nochmal neu durchzählen müssen. So stelle ich mir das vor.
Eure Eva Ping
P.S.: Bleibe am Ball!
Meinen Rat, ihr Studium abzubrechen und Schriftstellerin zu werden, schlug Kathrin jedoch in den Wind: »Ich hab dir schon mal gesagt, daß ich dafür nicht eitel genug bin …«
Seit sieben Uhr morgens operierten Bauarbeiter unten im Hof mit einer Kreissäge, und der seit halb acht auf die Spülmaschine einhämmernde Kundendienstmensch tat ein übriges, um mich aus dem Schlaf zu reißen. Die Sinfonie der Großstadt!
In meiner Zahnarztpraxis bekam ich einen Kostenvoranschlag für die weitere Behandlung. »Damit müssen Sie zu Ihrer Krankenkasse«, wurde mir gesagt, »und zwar am besten persönlich, denn sonst dauert die Bearbeitung Wochen …«
Klar. Ich hatte ja nichts anderes zu tun und konnte meine Tage gut damit verbringen, in Berlin herumzuflitzen und in Wartezimmern Däumchen zu drehen.
Kathrin brachte mir dann doch einen kurzen Text vorbei, von dem sie glaubte, daß er sich für Kowalski eigne:
Als ich in der U-Bahn Eugen Egners »Meisterwerke der grauen Periode« studierte, stieg Orla Froschfresser ein und setzte sich neben mich. In letzter Zeit scheine ich solche Kreaturen anzuziehen. Orla Froschfresser war mindestens einsneunzig groß und trug schwarzes Leder.
»Heda, schöne Frau!« krächzte er. »Mit dem Buch!« In der Tat waren einige schöne Frauen anwesend, aber keine hatte ein Buch, nur ich. Standhaft starrte ich hinein, das verdroß ihn. »Nur Bilder und Geschichten??« maulte er und schielte garstig in mein Buch, »nur Bilder und Geschichten, hä?« Was erwarten die Leute eigentlich von Büchern? Orla hatte offensichtlich noch nie eines gesehen. Wie? Man kann sie nicht ficken? Nicht austrinken? Ekel und Enttäuschung! Das kommt davon, wenn man auf die Kunst keinen anderen als jenen Schlüssel anwendet, mit dessen Hilfe man die Gegenstände des täglichen Umgangs als sinnvoll begreift. Ficken! Austrinken! Dumm sterben!
Ich faxte die Seite an die Redaktion, mit den besten Empfehlungen, und sagte Kathrin wahrheitsgemäß, daß sie sich jetzt ungefähr ein halbes Jahr lang auf das Honorar freuen könne.
Da ich mit Max zum Testen exotischer Biersorten verabredet war, mußte ich schleunigst welche auftreiben. Ich fand aber nicht viele. Continental Guinness, Eschweger Klosterbräu, Newcastle Brown Ale, Imperial Russian Stout …
Er selbst hatte sogar japanisches und mexikanisches Bier ausfindig gemacht. Zuerst gab es bei ihm jedoch eine Original-DDR-Champignon-Tütensuppe und dazu mit Holstener Liesel bestrichenes Finn-Crisp-Knäckebrot. Ob das als Grundlage genügte?
Es müsse natürlich nicht immer Hausmacherkost sein, sagte er. »Wir können auch mal burmesisch essen gehen. Oder uruguayanisch. Auch polnisch würde mich reizen. Mikronesisch oder nauruisch wäre zu gewählt.«
»Wie wär’s mit ghanaisch?«
»Geht nicht. Es gibt nur allgemein afrikanische Restaurants. Afrikaner scheinen alle das gleiche zu essen …«
Dann spielte er mir Stücke einer Band namens Sparks vor. Das sei »große, heilige Musik«, und ich solle mir gleich morgen bei WOM in der Augsburger Straße, Ecke Kudamm, für 39 Mark 90 »The Ultimate Sparks Collection« besorgen!
Aber was die Sparks da taten, mochte noch so brillant sein – das einzige, was ich von Musik verlangte, war, daß mir bei ihr das Herz aufging. Auch wenn Adorno das kulinarische Hören verboten hatte.
Als Max von mir vernahm, daß ich vorhätte, das Buch seines Freundes Tex Rubinowitz für den Tip zu besprechen, bat er mich, in der Rezension lauter Behauptungen aufzustellen, über die Tex sich wundern werde: »Schreib, daß er Ohrlochpistolen ablehnt! Und daß er Robert Gernhardt mal einen Lünebest-Joghurt zugeschickt hat. Und daß er nie, nie, nie seine von Tesafilmstreifen zusammengehaltene Brille putzt!«
Beim Verkosten des Biers gingen wir anfangs noch bürokratisch vor: Max notierte die Uhrzeit, und dann probierten wir zum Beispiel ein belgisches Dünndampfbier oder ein Schinkenbier und erteilten ihm eine Note, die Max ebenso festhielt wie alle ergänzenden Bemerkungen (»schmeckt nach Petroleum«, »marmeladig«, »katenrauchfleischartig salzig«, »ungustiös«). Mit der Zeit wurden die Urteile gröber und die Notizen fahriger, aber wir besaßen noch genug Geistesgegenwart, um uns für Sonnabend zu verabreden, und zwar zu Marlene Dietrichs Beerdigung auf dem Friedhof an der Stubenrauchstraße. Treffpunkt: das Restaurant in der Hertie-Filiale am Walther-Schreiber-Platz.
Am Freitag mußte ich leider schon um sieben Uhr aufstehen. Meine alte Liebe Andrea hatte sich angekündigt: Sie war wieder einmal auf der Durchreise nach Brandenburg zu der Kommune, die sich Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung nannte, abgekürzt ZEGG, und wollte vorher gern mit mir im Grunewald lustwandeln, was an sich ein guter Plan war, aber wenn man es nicht darauf anlegte, öffentliches Ärgernis zu erregen, konnte man im Grunewald zwar spazierengehen, aber nicht miteinander schlafen, und nach zwei Stunden mit Andrea schmerzten meine Schwellkörper.
Günther Willen, einer meiner treuesten Korrespondenten, schrieb mir aus Hamburg, daß ihm die deutsche Einheit »voll auf den Kanister« gehe:
Vom Stasi-Unfug ganz zu schweigen. Kann und will darüber nichts mehr aufnehmen. Heute war z.B. ein langweiliger Tag, das heißt, wir schrieben hier in Hamburg 25 Grad. Ich also nichts wie rein ins Haus, habe praktisch keinen Schritt vor die Tür gemacht. Genieße den Schatten, lese einen guten Krimi über einen nörgelnden Kältetechniker, mache mir ein schönes TV-Dinner (irgendwas mit Tomatenmark), schalte die Kiste ein – und hastdunichtgesehn irgendwas mit der deutschen Einheit. Ich natürlich gleich wieder ausgeblendet. Geht nicht.
Die Redewendung »Geht nicht« schien gerade im Kommen zu sein.
In Sigruns Zimmer hatte ein Redakteur des Hochschulmagazins IQ das Ende April von ihr geschossene Foto erblickt, das mich zeigte, wie ich mit Perücke und Kunstschnurrbart auf einer Sesselruine einen Penner mimte, und das wünschte er sich als Titelbild für die nächste Ausgabe.
»Wenn mein Name nicht genannt wird, hab ich nichts dagegen«, sagte ich. »Wie hoch ist denn die Auflage?«
»Dreißigtausend.«
Coverboy Martin Schlosser! Das mußte ich Eugen schreiben. Der würde staunen.
Auf dem Friedhof schlossen Max und ich uns im warmen Maisonnenschein einer langen Menschenschlange an, die aus gutbürgerlichem und normalem Volk und auch aus schrill aufgetakelten Transvestiten bestand und nur zögerlich vorrückte.
»Das sind keine Transvestiten, sondern Drag Queens«, sagte Max.
»Und was ist da der Unterschied?«
»Transvestiten haben das Bedürfnis, sich durch das Tragen von Frauenkleidung aufzugeilen, aber eher heimlich, im Kabüffchen. Drag Queens wollen strahlen und scheinen, leuchten und gesehen werden …«
Es vergingen zwei Stunden, bis wir vor Marlene Dietrichs offenem Ehrengrab standen und je eine Handvoll Sand hineinwerfen konnten.
Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund …
Max trug sich sogar in das aufgebahrte Kondolenzbuch ein.
»Könnd ihr des mol leisr schdella?« schrie Sigrun durch die Wohnung, als ich wiederkam. »Man verschdehd ja sai eigenes Word nemme!«
Was sie nervte, war die von Jochen und Philipp auf volle Lautstärke gestellte Radiokonferenzübertragung vom letzten Spieltag der Bundesliga. Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart befanden sich punktgleich an der Spitze, und nun lag Dortmund auswärts in Duisburg mit einem Tor vorn, während es zwischen Leverkusen und Stuttgart 1:1 stand und zwischen Rostock und Frankfurt gleichfalls 1:1. Wenn es dabei blieb, war Dortmund Meister, zum erstenmal seit 1963, aber dann schoß Guido Buchwald in der 86. Minute das 2:1 für den VfB, der das bessere Torverhältnis hatte als Dortmund. Kurz darauf ging Rostock mit 2:1 gegen Frankfurt in Führung, und weil auch den Dortmundern bis zum Schlußpfiff nichts mehr glückte, holte Stuttgart sich den Meistertitel.
»Sigrun!« schrie Jochen jetzt zurück. »Schduagard isch Meischdr! Hörsch mi?«
Er selbst war ein Anhänger des 1. FC Nürnberg, der auf dem siebenten Platz gelandet war. Sechs Plätze vor Gladbach.
Bei Getränke Hoffmann begegnete ich der Schneiderin Beate, die nicht Beate genannt werden mochte. Und von der ich einmal verführt worden war. Oder umgekehrt.
»Komm mich doch mal wieder besuchen«, sagte sie und gab mir einen kleinen Beckenkick. »Meine Nummer haste ja.«
She had that certain flash every time she smiled …
Das war die Welt, in der ich leben wollte. Babylon! Gomorrha! Sodom!
Jochen unterrichtete mich davon, daß der SV Meppen in der Aufstiegsrunde zur Bundesliga »verkackt« habe. Sonst hätte ich das gar nicht mitbekommen.
Schauderhaft war ein Buch mit Betrachtungen, Reden und Aphorismen von Franz Werfel, das Carola mir auf meinen Wunsch bestellt hatte:
Liebes- und beziehungstaub keucht ein Ich am anderen vorbei. Der Rest ist Elend und Verbrechen.
Und:
Die Sünde ist der geheimnisvolle Inbegriff der Verkehrtheit des verkehrten Lebens.
Und:
Tod ist gefrorene Zeit. Zeit ist geschmolzener Tod.
Solchen Stuß durfte man nur bis zur Obersekunda schreiben. Franz Werfel war kein Dichter gewesen, sondern ein von sich selbst ergriffener Zuckerbäcker.
Völlig unverständlich war mir auch, was andere Männer an dem Model Claudia Schiffer fanden. Im direkten Vergleich mit dieser maschinell erzeugten Schönheitskönigin besaß selbst die alte Frau Waas aus den Jim-Knopf-Romanen mehr Sex-Appeal.
Anruf eines Kowalski-Lesers aus Bayern: »Florian Eberle hier. Ich hatte Sie ja Ende April zum DFB-Pokalfinale Gladbach und Hannover am kommenden Sonnabend eingeladen. Erinnern Sie sich?«
»Natürlich.«
»Die Frage wäre jetzt die, ob ich dann vielleicht bei Ihnen übernachten kann.«
»Ja, das geht …«
»Von Freitag bis Sonntag?«
»Ja.«
»Und könnte ich eventuell auch ein paar Freunde mitbringen?«
»Wie viele denn?«
»Sieben.«
Sieben! Das war so unverschämt, daß ich es schon wieder rührend fand. »Gut, wenn Sie keine zu hohen Erwartungen hegen … und sich Schlafsäcke und Luftmatratzen mitbringen …«
Der Spiegel kolportierte eine Äußerung der Chansonette Evelyn Künneke:
Für alle, denen Marlenes Heimkehr wegen ihres tapferen Anti-Hitler-Kurses ein Greuel ist, sprach Evelyn Künneke die ungeflügelten Worte: »Es gefällt mir nicht, wenn jemand sein Vaterland verleugnet.«
Diese Giftspritze! Sie selbst hatte der Wehrmacht als singende Truppenbetreuerin gedient und fand das also auch ein halbes Jahrhundert später anständiger als Marlene Dietrichs Weigerung, für Joseph Goebbels auf den Strich zu gehen.
Als ich mit dem Kostenvoranschlag bei der weit entfernten Barmer Ersatzkasse erschien, hieß es: »Wir haben hier gerade einen Systemausfall.«
Der Fluch des EDV-Zeitalters!
»Haben Sie denn Ihr Bonusheft dabei?«
»Mein was?«
»Ihr Bonusheft. In dem Ihre Zahnarztbesuche verzeichnet sind.«
»Davon weiß ich nichts.«
»Bei wem sind Sie denn in Behandlung?«
»Bei Frau Brunner. Aber erst seit Ostern.«
»Und davor?«
»Bei Frau Schwickerath.«
»Und da ist Ihnen kein Bonusheft ausgestellt worden?«
»Nein.«
»Dann müssen Sie da nochmal vorstellig werden. Sonst können wir Ihnen nicht helfen.«
Auch das noch. Stöhnend gondelte ich wieder heim. Zwei Vormittagsstunden futsch, für nichts und wieder nichts.
»Wie ist noch gleich die Nummer der Telefonauskunft?« fragte ich Philipp.
»In Berlin kannste das vergessen«, sagte er. »Da verhungerste in der Warteschleife.«
Ich versuchte es trotzdem und ergatterte schon nach drei Minuten die Nummer meiner alten Zahnarztpraxis. Dort meldete sich eine Stimme vom Anrufbeantworter: Die Praxis sei montags erst ab elf Uhr dreißig besetzt.
Es war 11.27 Uhr. So wurde man vom Leben ausgebremst.
Oma hatte mir geschrieben:
Mein lieber, wenn auch uralter Martin!
Wo nun der Poststreik zu Ende ist, hoffe ich, daß mein inhaltsschwerer (70 DM) Brief für Deinen Geburtstag doch noch bei Dir ankommen wird! Nun haben wir auch im kühlen Friesland sommerliche Wärme, die ich sehr genieße. Ich habe es diese Woche überhaupt sehr gut, denn seit Montagabend ist Dagmar hier, was mein ganzes Leben und Befinden positiv beeinflußt, oh, Du weißt ja, wie sehr sie mich belebt! Es geht mir richtig gut! Gestern bekam ich eine Karte von Wiebke aus Spanien und einen Brief von Kim, die wochenlang geschäftlich in Gibraltar und Portugal weilte und sich dort eine Vergiftung zuzog. Da gibt es ja nicht so frische Fische wie auf dem Wochenmarkt in Jever. Wir essen heute Schollen, abends Granat und Sonntag Spargel mit Schinken. Gerne würde ich Dich auch mal wieder bewirten. Nun kommt Dagmar dran! Von mir noch liebe Grüße! Oma
Moin Martin, lieber Patensohn! Das Wetter ist seit heute (ätsch) hochsommerlich, und so fühle ich mich richtig toll (im Gegensatz zu Dir …!). Ich habe eingekauft en gros, habe den Friedhof »bestückt«, habe Oma einen neuen Wasserkocher verschafft, der sich automatisch abschaltet etc. Auch die neue Bank vor der Haustür wurde teetrinkenderweise eingeweiht. Um Pfingsten oder Ende Mai fährt Oma zu Luise. Auf bald – Dagmar
Jetzt war ich wieder halbwegs auf dem laufenden über die Aktivitäten der Sippenmitglieder.
»Normalerweise verschicken wir Bonushefte aber nicht mit der Post«, sagte eine Tante aus Frau Schwickeraths Praxis, aber durch gutes Zureden konnte ich eine Ausnahmeregelung erwirken.
Anschließend wetzte ich zur Sparkasse, zum Büchereck, zum Fotoladen, zu Edeka, zum Copy-Shop und zu Getränke Hoffmann, Pfandflaschen wegbringen und neues Bier holen. Und irgendwas essen mußte ich auch noch.
Der Kicker war wirklich stets für die verwegensten Wortspiele gut:
Ist Effe über den Berg?
Vom selben Geist zeugten einige Überschriften im Kicker-Sonderheft zur Europameisterschaft:
Sammer hat das Zeug zum Hammer
Binz bringt’s
Helmer beinhart – Bein arm dran
Sehr flüssig las sich auch der Gastkommentar des Weltmeisters Klaus Augenthaler:
Denn jede Abwehr sieht nur so gut aus, wie das Mittelfeld die Räume zumacht und vor allem die Außenbahnen abschirmt.
»Dir hängd a Zibfl Schbinad am Kinn«, sagte Sigrun, als sie am Eßtisch vorbeikam.
Leider ging die Schneiderin nie ans Telefon. Doch dafür nahte der Termin, an dem sich der bereits 1982 in Pardon ausgesprochene und auch von mir geteilte Wunsch des Dichters Horst Tomayer nach einem genscherfreien Tag erfüllte, denn der Außenminister Hans-Dietrich Genscher war nach achtzehn Amtsjahren zurückgetreten. Ein Leben ohne diesen segelohrigen Intriganten, der sich einst mit Hilfe des Springerkonzerns aus der sozialliberalen Koalition hinausgestohlen hatte, rückte damit für uns Fernsehzuschauer und Zeitungsleser in eine fast greifbare Nähe.
Beerbt worden war Genscher von dem Freidemokraten Klaus Kinkel, der schon als Präsident des Bundesnachrichtendienstes einschlägige Erfahrungen gesammelt hatte.
Im Debattierzirkel sollte Martin Heideggers Aufsatz »Die Frage nach der Technik« durchgenommen werden, und ich mühte mich redlich damit ab.
Das Unaufhaltsame des Bestellens und das Verhaltene des Rettenden ziehen aneinander vorbei wie im Gang der Gestirne die Bahn zweier Sterne. Allein, dieser ihr Vorbeigang ist das Verborgene ihrer Nähe …
Nein, hier philosophierte Heidegger nicht. Er schwallte.
Kathrin hatte Zeichnungen vom »Sexualverhalten bei Bärenmakaken der Kolonie an der Universität Stanford« entdeckt und schenkte mir Kopien davon für die Schnurrende Traglast.
»Die treiben’s ja ganz schön bunt.«
»Und rumschwulen tun sie auch noch«, sagte Kathrin.
Unterdessen hatte Eugen Egner einen Auftrag erhalten, der ihn überanstrengte:
Zum 250. Geburtstag von Herrn Lichtenberg will die Stadt Göttingen heuer eine große Ausstellung zelebrieren. Man hat mich zur Mitwirkung eingeladen, weil anhand meiner verschiedenenorts veröffentlichten Werke der Schluß gezogen wurde, ich könne evtl. eine günstige Einstellung zu dem Herrn haben. Und richtig: Der Mann, der vermutete, die Erde könne ein Weibchen sein, und seinen Hausschuhen Namen gegeben hat, liegt mir in der Tat am Herzen. Allzu gern lese ich immer wieder in seinen Aphorismen, wenn ich nicht gerade etwas anderes tue. Als »ausgewählter Tiefgräber« (lt. Informationstext) werde ich versuchen, mir zu dem Thema was einfallen zu lassen. Bis jetzt ist mir aber noch nichts eingefallen. – Immer noch nicht. – Jetzt auch noch nicht. – Nichts. – Noch immer nicht – wird mir noch etwas einfallen? – Wenn ja, wann? – Wehe …
Andere hätten einfach irgendwas hingekleistert, aber Eugen war skrupulös.
Obwohl ich es haßte, unzureichend bekleidet herumzulaufen, legte ich mir ein ärmelloses Oberhemd zu, ein sogenanntes Muscle-Shirt, denn anders ging es bei dieser Hitze nicht mehr. Und der Schweiß tropfte mir trotzdem von der Nase auf die Tastatur und auf die Seiten, die ich für den Verlag Weisser Stein ausdruckte.
Nachts um drei kam Sigrun schlafblind in mein Zimmer und fragte: »Isch des a Nadeldruggr?«
»Äh … ja.«
»Der isch ziemlich laud. Brauchsch no lang dafür?«
»Ich kann auch morgen weiter ausdrucken.«
»Des wär mordsmäßich nedd …«
Der Kollege Frank Schulz erinnerte mich per Postkarte an einen schon etwas älteren Autogrammwunsch:
Denkst Du dran, bei Gelegenheit mal nach Wencke Myrrhe, Mürre oder Myre/Myrre/Myrrre zu schauen?
Er wußte, daß ich von meinem Vetter Gustav eine große Autogrammsammlung geerbt hatte. Ich sah nach, und wahrhaftig, es war eine Autogrammkarte der Schlagersängerin Wencke Myhre dabei. Aber unsigniert!
Ich schickte Frank die Karte trotzdem und steckte als Zusatzprämie eine signierte Autogrammkarte der Schauspielerin Uschi Glas in den Umschlag.
Nachdem Michael Rudolf und ich uns telefonisch auf den Buchtitel »Moselfahrten der Seele« geeinigt hatten, brachte ich die ausgedruckten Seiten zur Post. Mit Expreßzuschlag und Aufpreis für ein Einschreiben kostete mich das Päckchen fast zwölf Mark. In meiner Zeit als Hilfsarbeiter hätte ich dafür rund achtzig Minuten lang Schneckenwellen und Schoko-Crossies verladen müssen, während der Drogenboß Pablo Escobar die gleiche Summe wahrscheinlich in jeder Picosekunde scheffelte.
Interessehalber fuhr ich zum Alexanderplatz und besuchte eine Wahlkundgebung der rechtsradikalen Republikaner, bei der ihr Bundesvorsitzender Franz Schönhuber sprach, der auf eine stolze Vergangenheit als SS-Unterscharführer zurückblicken konnte.
Vor der Tribüne hatten sich viele Männer mit ausrasiertem Stiernacken versammelt. Einer applaudierte so wütend, als ob er lieber jemanden verprügelt hätte, und wenn es nichts zum Applaudieren gab, reckte und streckte er sich wie ein Boxer vor der ersten Runde.
Ihm und seinen vielen mißgelaunten Kameraden gehörte gewiß nicht die Zukunft. Man sah ihnen das Scheißkerlhafte viel zu gut an.
Mein Buch für Klaus Bittermann war erst auf fünfzig Seiten angewachsen, und im September sollte es schon erscheinen. Ich mußte einen Zahn zulegen, aber nebenbei wollte ich mir ein paar Thriller ansehen, und so traf es sich, daß ich die Schneiderin wiedersah, denn sie arbeitete jetzt als Videothekarin.
»Aber gleich hab ich Feierabend«, sagte sie. »Wollen wir was trinken gehen? Bei mir?«
Ihren Sohn hatte sie gerade irgendwo anders geparkt, und wir hielten uns nicht lange mit dem Vorspiel auf.
Nachdem ich Walter Kempowski ein Kärtchen mit Genesungswünschen geschickt hatte, versuchte ich mich noch einmal an Heidegger:
Im Blick und als Blick tritt das Wesen in sein eigenes Leuchten. Durch das Element seines Leuchtens hindurch birgt der Blick sein Erblicktes in das Blicken zurück. Das Blicken aber wahrt im Leuchten zugleich das verborgene Dunkel seiner Herkunft als das Ungelichtete …
Selbst wenn das alles wahr gewesen wäre, hätte es mich nicht interessiert. Viel lieber nahm ich mir die neue Ausgabe der Briefe von Karl Valentin vor. Im November 1928 hatte er an eine »Hochwohlgeborene Firma« geschrieben, daß ihr »Fahnenalbum« ihm viel Freude mache. Nur das Einkleben der Bilder sei katastrophal schiefgegangen. Er habe einen »Mehlpapp mit Zusatz von oberbayrischem Brunnenwasser« angerührt …
Dieser Mehlpapp hatte jedoch nicht die richtige Klebkraft, denn schon nach kurzen 22 Minuten fielen die Bilder schon wieder aus dem Album heraus. Ich habe über dieses Vorkommnis tagelang geweint.
Danach seien die Bilder von einem Spengler in das Album hineingelötet worden, was zu einer Feuersbrunst geführt habe:
Der Spengler und der heisse Lötkolben wurden sofort wegen Brandstiftung verhaftet. Dies zur gefälligen Kenntnis.
Da kam Heidegger nicht mit.
Zwei der acht Pokalfinalgäste fragten mich nach einem Blick auf meine Bücher, ob ich die alle gelesen hätte, und dann richtete sich die ganze Schar in unserem vakanten WG-Zimmer ein, bevor sie sich in das Nachtleben stürzte. Florian Eberle hätte mich gern dabeigehabt, aber das ging nicht: Ich mußte nun wirklich ernsthaft an meinem Buch arbeiten.
Bei ihrer Rückkehr verhielten sich meine Besucher vorbildlich leise, doch am nächsten Tag äußerte Jochen eine Beschwerde: »Wenn du das nächste Mal so viele Leute einlädst, dann bring ihnen doch bitte vorher bei, wie man duscht. Die haben das halbe Badezimmer geflutet …«
»Und wo sind sie jetzt?«
»Irgendwo in der Stadt. Und ich soll dir von ihnen bestellen, daß sie dich um drei Uhr abholen wollen.«
Mit ein paar Fotos von der Feier meines dreißigsten Geburtstags hatte ich Eugen eine frohe Minute bereitet:
Zentralgeheizten U-Boot-Dank dafür und viel mehr! Abgesehen von Dir, sowohl mit Bart als auch mit Gesicht, hat uns Hiesigen ’s Kathreinerle am besten gefallen. Sie schreibt nicht nur beseligt-beseligende Karten, nein, sie bietet auch einen erfreulichen Anblick. Weitermachen, Frau Spaßig! Unbedingt! Schön, schön!
Diesen Absatz las ich Kathrin am Telefon vor.
»In deiner Antwort solltest du aber klarstellen, daß du kein Bartträger bist«, sagte sie. »Sonst werden die Germanisten dich in hundert Jahren mit Günter Grass verwechseln.«
Olympiastadion, Oberring in der Westkurve, Block 14 links, Reihe 1: Dort waren unsere Plätze. Links von mir saß Florian Eberle mit seinen Mannen und rechts ein Schreihals, der seine Begleiter pausenlos mit nichtsnutzigen Kommentaren versorgte (»Also, bis jetzt hat Hannover ja mehr Spielanteile, aber die Flügelwechsel müssen noch schneller gehen!«).
Meine Stimmung wurde auch nicht durch die Bratwürste, das Bier und den Pissoirgestank gehoben, und schon gar nicht dadurch, daß der Zweitligist Hannover 96 nach einhundertzwanzig zähen und torlosen Spielminuten im Elfmeterschießen über Gladbach triumphierte.
Florian Eberle sagte, daß es anders gelaufen wäre, wenn Günter Netzer sich in der Verlängerung selbst eingewechselt hätte. Von Spielern wie Criens und Pflipsen könne man keine Wunder erwarten.
Übel waren auch das langwierige Hinauswalzen aus dem Stadion und die Verkehrsmittelbenutzung in Gesellschaft besoffener Fans.
Mit meinen Gästen ging ich zwar noch ins Nova, aber ich blieb nicht lange, denn als sie hörten, daß ich etwas für Bob Dylan übrig hätte, bezeichneten sie mich als »Tunte«, und das stand ihnen nicht zu. Acht Mann hoch bei mir kampieren und mich dann mit einem Ausdruck belegen, der bei ihnen in Bayern als ehrenrührig galt? Ja, wo samma denn?
Zugute halten mußte ich ihnen jedoch, daß sie am Sonntag säuberlich hinter sich aufräumten und keinen Krümel zurückließen.
Bei der Kommunalwahl stimmte ich für KPD/RZ (Kreuzberger Patriotische Demokraten/Realistisches Zentrum). Diese Partei wollte die Hundesteuer um 700 % erhöhen und wegen der Häßlichkeit von Männerbeinen ein bei Außentemperaturen von mehr als 30 Grad Celsius gültiges Ausgehverbot für Herren erlassen.
Ein Anruf von Oma: Ob denn nun endlich der Geburtstagsbrief angekommen sei.
»Ja, gestern mittag«, log ich. »Vielen herzlichen Dank!«
Was hätte sie von der Wahrheit gehabt, daß ihr Brief von der Post versaubeutelt worden war?
Die sizilianische Mafia hatte einen Untersuchungsrichter mit einer Bombe umgebracht. Giovanni Falcone.
»Da kannst du Gift drauf nehmen, daß das mit dem Ministerpräsidenten Giulio Andreotti abgesprochen war«, sagte Philipp. »Der knödelt in Italien schon seit ’ner halben Ewigkeit ganz oben mit, und das schafft man nicht ohne den Segen der Mafia …«
Jochen, der ebenfalls vorm Fernseher saß, vertrat die Meinung, daß die Cosa Nostra anfänglich die richtigen Ziele verfolgt habe: »Das war mal ’ne antikolonialistische und später auch antifaschistische Organisation. Die kannste nicht pauschal verurteilen und sagen, hey, ihr handelt mit Drogen, also seid ihr Verbrecher! Verstehste? Da mußte auch mal die Hintergründe mitbedenken!«
Der geschichtliche Hintergrund sei ihm scheißegal, schrie Philipp. »Wenn ich sehe, wie die Mafia da die Leute umlegt, dann braucht mir keiner mehr mit der Antifaschismuskiste zu kommen! Da hört’s bei mir auf!«
In der neunten Folge seiner abonnierbaren Autobiographie erzählte der alte Verleger Jörg Schröder, wie er und seine damalige Frau Erika 1973 einmal Harry Rowohlt aus einer psychiatrischen Klinik in Rinteln abgeholt und mit ihm eine Striptease-Bar aufgesucht hätten:
Augenblicklich entwickelt sich enthemmte Geilheit, langsam und lüstern fallen Kittel, BH und Strapse, dann sieht man Brüste und Schamhaar, »schrumm, schrumm, schrumm«, Trommelwirbel.
Um elf habe Harry Rowohlt zurück in die Klinik gemußt:
Wir begleiteten ihn, und er stieg über die Mauer wie Fuchsberger in einem seiner frühen Würgerfilme.
Was für ein wunderschöner Satz. Auch wenn ich den Wahrheitsgehalt nicht beurteilen konnte.
Gegen den Protest von Lizzy, die fand, daß bei uns schon genug Müll herumrotte, bugsierte Torsten einen irgendwo geklauten Einkaufswagen in die Wohnung: So ein Gerät könne man immer brauchen …
Es fand auch gleich Verwendung bei einer kleinen Fotosatire, die ich mir für Kowalski ausgedacht hatte. Ich klebte Torsten ein Blatt Papier mit der Aufschrift »CIA« ans Hemd, setzte mir selbst eine Sonnenbrille auf, klebte mir wieder den künstlichen Schnurrbart an und ließ mich von Torsten im Einkaufswagen herumschieben. Das von Sigrun aufgenommene Foto konnte dann mit der Schlagzeile erscheinen:
Ringo Starr wurde von der CIA gekauft!
Für ein anderes Beweisfoto stellte ich mich mit zwei Makkaroni als Schlegeln zwischen Lizzy und Philipp:
Ringo Starr (Mitte) stand zwischen Yoko Ono und John Lennon!
Da Lizzy tatsächlich ein bißchen Ähnlichkeit mit Yoko Ono hatte, nahm Sigrun auch noch ein drittes Beweisfoto auf:
Als Ringo Starr das Gitarrespielen zu lernen versuchte und die Masern bekam, brachte ihm Yoko Ono Kaffee ans Bett!
»So verdienst du also dein Geld«, sagte Jochen, der kopfschüttelnd zusah. »Während unsereiner sich mit ehrlicher Arbeit abmüht …«
Die Masernflecken hatte ich mir mit einem Edding ins Gesicht getupft.
Von Dagmar hörte ich telefonisch Ungutes über die Lage in Meppen: »Deinem Bruder Volker hat dein Vater endgültig das Haus verboten. Das hat mir Therese berichtet. Er hat sie neulich wieder mal angerufen, und da hat er sich auch über dich und deine berufliche Traumtänzerei ausgelassen …«
Seit Papa verwitwet war, sprach er in unregelmäßigen Abständen Bannflüche aus. Mal über mich, mal über Volker, mal über seine Brüder und manchmal selbst über Renate. Nur über Wiebke meines Wissens nicht.
Ich durfte Papa aber noch besuchen kommen. Ende Mai diente ich ihm in Meppen drei Tage lang mit Einkaufsfahrten, Rasenmähen, Rindsrouladen, Kohlrabi und Salamibaguettes, und um mir auch mal eine Freude zu bereiten, schrieb ich einen langen Brief an meine flüchtige Freundin Nicole, die Gute, die mich hoffentlich noch nicht vergessen hatte.
Wieso war es zu dieser Jahreszeit schon so heiß? Ich schwitzte sogar im Liegen, fächelte mir mit einer Wurfsendung der Firma Mayrose Luft zu und soff jeden Tag vier Liter Cola.
In Jever tischte Oma mir eine Mammutportion Spargel auf und kassierte gleich danach drei schwere Schlappen im Malefizspiel, was ihr aber nichts ausmachte. »Hauptsache, du bist wieder mal hier, mien Jung!« sagte sie. »Wie geht’s denn deinem Vater?«
»Mittelhochprächtig.«
»Achtet er jetzt mal ’n bißchen auf seine Ernährung?«
Damit spielte sie auf Papas Zuckerkrankheit an, die ihn nicht groß bekümmerte. Er hatte nicht den Wunsch, noch möglichst lange zu leben.
Ich sagte Oma, daß Papa stark abgenommen habe, doch das war ihr auch wieder nicht recht: »Wenn einer nichts mehr auf den Rippen hat, dann ist das ganz sicher kein gutes Omen!«
An meinem alten Arbeitsplatz der Jahre 1989 bis 1991, der jeverschen Rumpeldiscothek Na Nu, drang der dicke Stammgast Wulf auf mich ein: »Haste inzwischen mal was über mich geschrieben? Das wollteste doch!«
Er trug kreischend bunte Shorts. Und er setzte noch einmal an: »Ey! Sachma! Wann schreibste endlich was über mich?«
»In meinen Lebenserinnerungen werde ich dich gebührend würdigen.«
I can feel it coming in the air tonight …
»Und wann kommen die raus?«
»2042.«
»In fuffzig Jahren! Leck mich fett! Da bin ich ja schon mit ’ner Altersmeise gesegnet …«
Er geriet dann wegen irgendeiner Frau in Streit mit einem Ochsen aus Addernhausen und wollte sich draußen mit ihm hauen. Ich ging als Schaulustiger hinter den beiden her, und als ich vor die Tür trat, rammte mir der Ochse seinen Schädel ins Genick, obwohl ich an diesem Revierkampf gar nicht beteiligt war.
Anyone with any sense had already left town …
Wie gut, daß ich meinen Wohnsitz von Friesland nach Berlin verlegt hatte!
Am Oldenburger Bahnhofskiosk kaufte ich mir auf der Rückreise die Frankfurter Rundschau, und ich hatte Glück: Es stand eine interessante Reportage darin, von Jutta Roitsch, die sich auf eine »Spurensuche in der ›kalten‹ Heimat Ostpreußen« begeben hatte und ernüchtert zurückgekehrt war:
Auch die Heimweh-Touristen, die jeden Abend im Beton-Hotel »Baltica« ihre Erfahrungen austauschen, machen sich da nichts vor. Hier leben will keiner, die Jüngeren reizt die billige Exotik. Für sie zählen auf dieser Reise die kleinen, anrührenden Gesten: Die Bäuerin, die ein Bund Zwiebelpflanzen mitgibt, »damit Sie im Winter Zwiebeln aus der Heimat haben«; der Apfelbaum-Zweig aus dem väterlichen Garten zum Aufpfropfen.
Diese Zeitungsseite wollte ich Papa schicken.
In Berlin war das Sonnengeschrei noch schlimmer als auf dem Lande. Man wurde gebraten, ohne sich in einen kühlen Kellerraum retten zu können. Das war der einzige Punkt, in dem ich eine andere Meinung vertrat als Leonard Cohen: In seine Hymne an die Sonne hätte ich nicht eingestimmt.
And the light came from her body …
Mir lief der Schweiß in Bächen aus den Achselhöhlen, und ich haßte das.
Frank Schulz regte brieflich einen kleinen Skandal auf der Frankfurter Buchmesse an:
Vielleicht könnte man ja ein bißchen als enfants terribles auftreten, oder tut man sowas nicht mehr? Ich überleg mir schon mal ein Konzept. Eventuell sollte es ganz gut kommen, entzündete man den Haffmans-Stand mit einem Fünfmarkschein, der anschließend einer dicken Brazil Feuer spendete, deren Raucher einen hysterischen Veitstanz um den jammernden Verleger aufführte.
Wie wär das?
Mit seinem Verleger Gerd Haffmans hatte Frank anscheinend ein Hühnchen zu rupfen, aber immerhin war er ein Haffmans-Autor und gehörte mithin zur Elite.
Auf Wunsch der Tip-Redakteurin Ulrike Kowalsky sah ich mir ein Video vom Premierenabend des neuen deutsch-französischen Fernsehsenders Arte an, der »eine neue Kommunikationskultur« herbeiführen wollte: Eine mondäne Postbotin schwang sich eine Wendeltreppe hinauf in den Festsaal; hinter Riffelglas krümmten sich Tanztheaterpantomimen und schlüpften durch Drehtüren; eine Kamera umkurvte einen Konzertflügel; Gerhard Polt, Peter Ustinov, Hanna Schygulla und der Krakelmaler Penck wurden ein- und wieder ausgeblendet, und dann trat Wolf Biermann ins Rampenlicht und sagte: »Ja, es ist schön, daß ich gelegentlich auch als Transportarbeiter arbeiten kann, als Transportarbeiter für Worte und Musik, und ich möchte Ihnen dieses Lied ›Il n’y a pas d’amour heureux‹ zeigen in deutscher Sprache. Das hat den Vorteil, die Franzosen kennen es sowieso, und die Deutschen freuen sich, wenn sie ein schönes Lied aus Frankreich hören. Dabei will ich Ihnen nicht verheimlichen, daß es mich ärgert, daß ausgerechnet Aragon dieses wunderbare Gedicht zustande gebracht hat.« Er griff sich an den Kopf. »Warum haben die Musen ihn bloß geküßt?« Jetzt rieb er sich sorgenvoll über die Stirn. »Er hatte doch so eine hündische« – er kniff die Augen zusammen – »Liebe zu Stalin … aber die Musik« – nun öffnete er die Augen wieder, die Hand sank, die Miene lichtete sich – »stammt von Brassens, der eine menschliche Liebe zu Katzen hatte, und alles zusammen ist eben ein schönes Lied.«
Dann turnten abermals Künstler über den Bildschirm, und Wim Wenders mopste sich über die Vorliebe der Russen für amerikanische Spielfilme. Ob das alles gutgehen konnte?
Lizzy nahm mich auf eine Journalistenparty mit. »Open End. Da kannst du Rotkäppchensekt aus Damenschuhen trinken …«
Man hätte dort aber verkleidet erscheinen sollen, und weil ich dem Dresscode nicht entsprach, rannte eine Art Schamane auf mich zu und kleckste mir grüne Farbe auf die Nase.
Auf der Tanzfläche wiegte sich eine schöne, nur in ein langes Herrenunterhemd gewandete Dame in den Hüften, die aber leider schon vergeben war, und zuhause brauchte ich eine halbe Stunde, um die Farbe wieder abzukriegen.
Für die Schnurrende Traglast lieferte Wiglaf mir eine »kritische Zeichnung«, auf der drei Container zu sehen waren: »Altglas«, »Altpapier« und »Alt-68er«.
Von Letzteren hätte ich niemals regiert werden wollen. In einer von Rudi Dutschke, Dieter Kunzelmann, Rainer Langhans und Horst Mahler gelenkten Räterepublik wäre spätestens nach drei Tagen alles Mus und Grus gewesen, und nach einer Woche hätten sich die Revolutionäre gegenseitig füsiliert.
Der nackte Schoß, den Sharon Stone in »Basic Instinct« beim Übereinanderschlagen ihrer Beine zeigte, war nur eine Zehntelsekunde lang zu erahnen, aber Jochen hatte angeblich nur auf ihr Gesicht geachtet: »Die hat mir dabei genau in die Augen gesehen! Die will’s jetzt echt wissen! Morgen flieg ich nach Los Angeles und mach sie lang, die Schlampe!«
Laut Spiegel herrschte auch im Auswärtigen Amt ein rauher Ton:
»Serbien muß in die Knie gezwungen werden«, forderte Bonns Außenminister Klaus Kinkel, den bisherigen EG-Steuermann Genscher im Jugoslawien-Konflikt an Härte beinahe noch übertreffend.
Sollten wir uns jetzt wieder ans Maulheldentum gewöhnen? Wie unter Wilhelm Zwo?
Sigrun und Lizzy blühten in der Junihitze auf, aber mich machte sie fertig. Ich japste nach Luft und mußte zwei- bis dreimal täglich duschen, um es mit mir selber aushalten zu können. Es war jedesmal eine Erleichterung, wenn die Scheißsonne endlich unterging.
Im zwölften Band von »Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur« (»Gegenwartsliteratur seit 1968«) behaupteten die Germanisten Keith Bullivant und Klaus Briegleb, daß sich in Walter Kempowskis Romanen »Aus großer Zeit« und »Schöne Aussicht« die »theoretische Möglichkeit einer kritischen Wirkung dieser versunkenen deutschbürgerlichen Romanwelt auf die Leser in einer fasziniert-wohlwollenden Großstimmungslage« verliere, in der – und nun wurde es vollends kryptisch – »eine neonationale Austreibung schonungsloser Erinnerung an das ›herrliche‹ Selbsterkennen des deutschen Bürgertums im Nazistaat, unüberprüfbar für Autor und Kritik, ›realistisch‹ lesend sich nun ab-spielen kann«.
Was wollten sie damit sagen, ohne es zu können? Wahrscheinlich nur, daß ihnen Kempowskis Romane irgendwie gegen den Strich gingen. Doch was sollte der quatschige Bindestrich in dem Wort »ab-spielen« bedeuten? Und was hatte es mit dem Begriff »neonational« auf sich? Das ganze Satzgebilde stand auf tönernen Füßen. In der Großstimmungslage sollte sich lesend eine unüberprüfbare Austreibung der Erinnerung an das Selbsterkennen des Bürgertums abgespielt haben? Wie bitte? Und diesen Humbug hatten Experten zu Papier gebracht, die sich hauptberuflich mit Literatur beschäftigten und den Studenten etwas über Sprachkunstwerke beibringen sollten!
Bonusheftmäßig hatte ich in der Zwischenzeit alles in Ordnung gebracht, aber meine Zähne bereiteten Frau Dr. Brunner noch immer Kopfzerbrechen. In den zwei Stunden, die ich bei ihr in Behandlung war, verpaßte sie mir vier Spritzen in den Gaumen, und danach schmeckte mein Oberkiefer nach Müll, und in meinen Ohren hallten die Bohrgeräusche nach.
Dutzende von Rezensenten hätten mein Buch bestellt, sagte Klaus Bittermann, als er mir in seinem Büro die Herbstvorschau der Edition Tiamat reichte.
Neue politische Bücher von Eike Geisel, Wolfgang Pohrt und Robert Kurz, zwei französische Kriminalromane und mein eigenes Buch. Das noch längst nicht fertig war …
Als Fan von Borussia Dortmund litt Klaus darunter, daß es mit der Meisterschaft nicht geklappt hatte.
»Du kommst doch aus Oberfranken. Wie bist du denn da an Dortmund gelangt?« fragte ich ihn.
»Aus reiner Opposition gegen meinen Vater. Der war für den Glupp.«
Glupp? Ach so, er meinte den Club, also den 1. FC Nürnberg.
Max und Marcus »muldierten« bei mir, das hieß, sie arrangierten an einem Tisch in meiner Wohngemeinschaft Zeichnungen, Texte und Zeitungsschnipsel für die Kowalski-Rubrik »Die Mulde«.
Nicht ohne Stolz zeigte ich eine Postkarte von Fritz Weigle alias F.W. Bernstein vor, die ich gerade erhalten hatte.
»Und die hast du gelocht?« fragte Max entsetzt. »Um sie abheften zu können? Man locht doch keine Karten von Fritz Weigle!«
Er selbst hatte einen ganzen Schwung Katzenpostkarten dabei und beschloß, die auch alle zu lochen. Für die »Mulde«. »Bring mir mal deinen Locher her!«
Während Max die ersten gelochten Katzenpostkarten betrachtete – »Süß! Aber jetzt süß mit Löchern!« –, zeichnete Marcus einen Mann, der ein Mädchen auf dem Bürgersteig liegen sah und sagte: »Wie süß!« Auf dem nächsten Bild hatte es eine Heroinspritze im Arm stecken, und der Mann rief ergänzend aus: »Mit Löchern!«
Weil es Max mißfiel, daß alle naselang jemand aus meiner WG ankam und glotzte, brachen wir die Session ab und gingen in einem Grill an der Urbanstraße Beck’s und Raki trinken. Und Marcus zeichnete immer weiter. Türkische Fliegen, Keilereien unter Engeln, beschriftete Löcher …
Für Marcus war Zeichnen wie Atmen. Er konnte gar nicht anders.
Beim »Umweltgipfel« in Rio strömten nach Zeitungsberichten mehr als 35000 Diplomaten, Ökologen und Journalisten zusammen.
»Fragt sich nur, ob die da nicht mehr Dreck verbreiten als verhindern«, sagte Jochen. »Sicher ist bloß, daß die brasilianischen Prostituierten bis Mitte Juni Überstunden schieben müssen …«
Meine Post entdeckte ich am Freitagmittag teils im Hof und teils im vermüllten Aufgang des Vorderhauses, aufgerissen und über die Treppenstufen verstreut: Welche Vandalen waren da am Werk gewesen?
Wir brauchten einen größeren Briefkasten, aus dem die Post nicht jeden Tag oben herausragte.
Von Berlin nach Greiz: Der IC nach Leipzig hatte eine Stunde Verspätung, der Anschlußzug war weg, und auf den nächsten mußte ich zwei Stunden warten.
Aus einer knallheißen Telefonzelle gab ich Michael Rudolf meine neue Ankunftszeit durch. Der Hörer glühte wie eine Herdplatte.
Zu meiner Unterhaltung hatte ich Bernd Eilerts Prosaband »Windige Passagen« dabei, und ich fand es gut, wie ruppig darin mit dem Heiratsschwindler Franz Kafka abgerechnet wurde. Dieses ewige Herumgeeier mit Felice Bauer!
Die erste Ver- und Entlobung machte ich noch mit, aber nach der zweiten hatte ich die Nase voll: Der Mann war zweifellos ein Terrorist, wenn auch ein sanfter – die Frau war offenbar eine ziemlich taube Nuß, sonst hätte sie ja wenigstens das rechtzeitig merken können.
In Gera, wo ich noch einmal umsteigen mußte, stand auf einem Schild, daß dies »Deutschlands 1. Nichtraucherbahnhof« sei. Haha! Wer kam denn auf so ’ne Idee?
Dann schlängelte sich der Bummelzug durch das liebliche Tal der Weißen Elster, und die Wälder schwollen auf und ab: Die Zone konnte auch sehr anziehend aussehen.
Wenn nur die Dörfer und die Städte nicht gewesen wären! Spröde, grau, verhärmt, verhutzelt und von allen guten Geistern verlassen präsentierte sich auch Greiz, als Michael mich vom Bahnhof abholte und wir zu seiner Wohnstätte am Gartenweg gingen, einer Straße, die halb einem Waldpfad und halb einer Panzertrasse glich.
Ganz am Ende des Gartenwegs wohnte Michael in einem porösen Altbau im Hochparterre, gemeinsam mit seiner freundlichen Frau Ina, einer Zahnärztin, die gerade alles von Kempowski las, wie ich sogleich erfuhr.
In Michaels Arbeitszimmer wartete ein Bücherturm auf mich – ostzonale Lyrik und politische Predigten wie »Dona nobis pacem. Fürbitten und Friedensgebete Herbst ’89 in Leipzig«, »Unser Glaube mischt sich ein«, »Bis alle Mauern fallen«, »Schmerzgrenze«, »Stasi intim« …
Am schlimmsten seien die Elaborate des Greizer Heimatdichters Günter Ullmann, sagte Michael. »Der hat sich alle Zähne ziehen lassen, weil er dachte, daß die Knechte von der Stasi ihm da Wanzen reinmontiert hätten.«
»Nein.«
»Doch! Die Stasi hat ihm wirklich übel mitgespielt, aber er leidet auch unter hausgemachtem Verfolgungswahn …«
In einem Lokal mit dem stark übertriebenen Namen Café Lebensart verputzten Michael und ich Speisen und Wernesgrüner Bier für 39 Mark, und zu späterer Stunde spielte er mir bei sich daheim noch einige Schallplatten vor: »Spitzenprodukte der DDR-Liedermacherszene«, wie er sagte. »Die darfst du in deinem Buch nicht vernachlässigen. Vor allem nicht die Stern-Combo Meißen und ihren Song über einen altersschwachen Müllkippenwärter …«
An diesem Musikstück war alles unfaßbar schlecht: die Melodie, die Instrumentierung, der dünne Gesang und nicht zuletzt der Text.
Und so lebt der Alte mit seinem Hunde,
Daß er uns erhalte wertvolle Funde.
Und so lebt der Alte mit uns im Bunde.
Ach, und manches kalte Herz wärmt die Kunde …
»Psychedelische Musik für Arme«, sagte Michael.
»Und an sowas habt ihr euch als Jugendliche hochgezogen?«
»Ich doch nicht! Für mich gab’s nur Jimi Hendrix! Aber da war natürlich schwerer ranzukommen als an diese einheimische Innerlichkeitsscheiße …«
Am Sonnabendvormittag gingen wir spazieren. Die meisten Häuser schienen einmal bessere Zeiten gesehen zu haben, an den Berghängen schimmerte Mischwald, und hoch über Greiz thronte ein schläfriges Schloß.
Die Menschen sahen anders aus als im Westen. Klobiger und bleicher. Sie bewegten sich auch irgendwie täppischer. Wie Meerschweinchen, die sich auf freier Wildbahn unwohl fühlten und schnell wieder in ihr Häuschen huschen wollten.
Oder kam mir das nur so vor?
»Nein, das siehst du schon ganz richtig«, sagte Michael und führte mich zu einem mitten in der Stadt aufgestellten Schaukasten der Bürgerrechtsbewegung Neues Forum, in dem er von einem gewissen Rudolf Kuhl, einem nicht gänzlich rechtschreibsicheren Mitbegründer jenes Forums, wegen eines polemischen Titanic-Beitrags über Greiz scharf angegangen wurde. Den Text, der dort aushing, las ich mit wachsendem Erstaunen:
Ich halte den Verfasser, der offenbar am Weißen Stein nach dem Stein der Weisen sucht, nicht für eine avantgardistische Oase in der Greizer Kulturwüste, sondern, um es in seinem Stil zu sagen, für einen unter Erfolgsdruck leidenten, arroganten, kleinen Schreiberling, der stumpfsinnig vor sich hindösend, Tag für Tag hochwertige Nahrungsmittel in sich stopft, um sie auf analem Wege später als stinkende, braune Masse auszuscheiden. Versagt ihm sein Anus diese Art der Entleerung, kommt es zu geistigen Absonderungen, die in der Qualität dieser bereits erwähnten Masse nicht nachstehen.
Also, Herr Rudolf, Schließmuskel entspannen und drücken, aber vorher frei machen, sonst geht’s in die Hose! Bestellen Sie ein T-Shirt bei »Kowalski« mit der Aufschrift »Aus dem Weg! Hier kommt ein Arschloch.« Tragen Sie es täglich, Sie haben es verdient!
»Das hängt da bereits seit zwei Monaten«, sagte Michael.
An seiner Stelle hätte ich schnellstmöglich den Wohnort gewechselt.