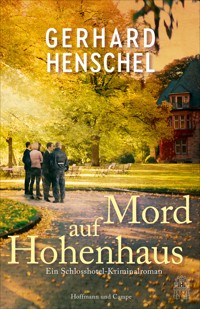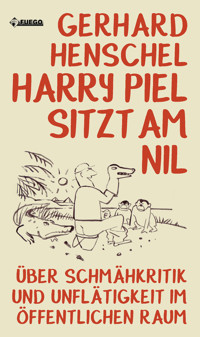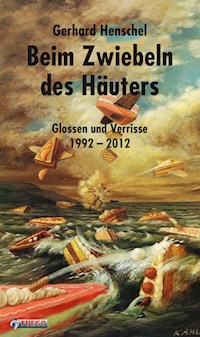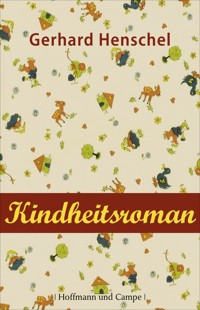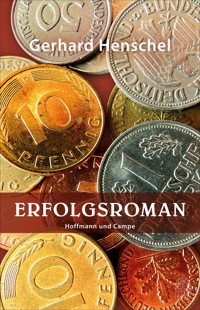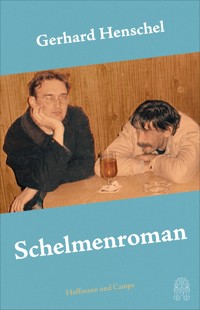
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Martin Schlosser
- Sprache: Deutsch
Kurz vor der WM 1994 kettet Martin Schlosser sich im Rahmen einer Titanic-Mahnwache vor der Frankfurter DFB-Zentrale an, um die Nominierung des Fußballstars Bernd Schuster zu erzwingen, was jedoch misslingt. Aber Martin Schlosser bleibt dem Leben gegenüber aufgeschlossen. Er unternimmt Lese- und Lustreisen, experimentiert mit Drogen, schreibt mit dem Kollegen Günther Willen auf Spiekeroog ein Buch über das dritte Tor von Wembley, übersteht einen katastrophalen Umzug von Frankfurt nach Göttingen, löst gemeinsam mit Wiglaf Droste ohne allzu böse Absicht einen Literaturskandal. Und zugleich sind es die Jahre, in denen Martin Schlosser sich auf den Abschied von seiner geliebten "Oma Jever" einstellen muss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 816
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Gerhard Henschel
Schelmenroman
In Frankfurt erwarteten mich postalische Geburtstagsgrüße von Kerstin, Andrea, Oma und den Blums, und meine gute alte Patentante Dagmar riet mir telefonisch, meine Jugend zu genießen: »Wenn du erstmal fünfzig bist und ’n dicken Bierbauch hast, wirst du an meine Worte zurückdenken!«
32 war ich jetzt. Ein ausbaufähiges Alter. Und ich war privilegiert: 5,6 Milliarden Menschen lebten mittlerweile auf der Erde, aber nur einem winzigen Bruchteil davon ging es so gut wie mir. Ich hatte eine halbe Stelle in der Titanic-Redaktion, ein Zimmer in einer Zweier-WG mit Heribert Lenz im Frankfurter Nordend und einen munter wachsenden Freundeskreis, und soweit ich wußte, war ich kerngesund. Die Zukunft konnte kommen.
Von dem rechtsgestrickten Medienmogul Silvio Berlusconi, der in Italien mit der Regierungsbildung beauftragt worden war, hielt Heribert nicht viel. »Der sieht doch wie der letzte Ölprinz aus«, sagte er, als die Tagesschau lief. »Den könntest du mir auf ’n Bauch binden, und ich würde trotzdem keine Kinder mit dem machen!«
In der Redaktion schwärmte der gelernte Maoist Christian Schmidt von dem hochverschuldet untergetauchten Frankfurter Baulöwen Jürgen Schneider, der offene Handwerkerrechnungen in Höhe von fünfzig Millionen Mark zurückgelassen hatte: »Der fügt dem Kapitalismus im Alleingang mehr Schaden zu, als es die Jusos im gesamten letzten Vierteljahrhundert geschafft haben! Ich wette, daß er jetzt mit den Anführern der Naxaliten irgendwo im indischen Dschungel zusammensitzt und die nächsten Schritte auf dem Weg zur Weltrevolution erörtert. Sieg im Volkskrieg – betrügerischer Bankrott im eigenen Land!«
Wer denn bitteschön die Naxaliten seien, fragte Heribert, und Christian tat ihm Bescheid: »Das sind marxistisch-leninistische Untergrundkämpfer, die das gleiche Ziel verfolgen wie Jürgen Schneider – den Klassenfeind zu vernichten!«
»Vielleicht hockt er aber auch in ’nem Hinterzimmer der Taverne Wachelstubb in Bockenheim und versäuft die Milliarden, die er sich bei den Banken ergaunert hat«, warf Achim Greser ein.
Der Chefredakteur Hans Zippert behauptete jedoch, Schneider habe ihm soeben glaubwürdig versichert, daß an der ganzen Sache nichts dran sei. »In Wirklichkeit verlegt er nämlich Kinderbücher. Die guten Schneider-Bücher! Kennt ihr doch. ›Die Jungens von Burg Schreckenstein‹, ›Lustige Streiche mit Hanni und Nanni‹ und so weiter.«
»Kinder lieben Schneider-Bücher!« schrie Thomas Gsella dazwischen, und dann widmeten sich alle wieder ihrem jeweiligen Murks.
Seiner neuen Kolumne hatte Max Goldt ein Foto des bodenlos scheußlichen Bahnhofs von Emden beigefügt und dazugeschrieben:
Der Bahnhof von Emden braucht sich hinter den Bahnhöfen von Stuttgart und Leipzig nicht zu verstecken. Nett wäre es, wenn er es trotzdem täte.
Das bereitete mir viel Freude.
Auf dem Cover der neuen Ausgabe war Johannes Rau, der Bundespräsidentschaftskandidat der SPD, als Schnabeltier zu sehen.
Muß das wirklich sein?
EIN PRÄSIDENT,
DER EIER LEGT!
Sehr schön fand ich auch immer die gezeichneten Witze von Kamagurka. Diesmal war einer dabei, in dem ein Trottel in einem Museum seine rechte Hand betastete und sagte: »Meine Hand im Museum, wer hätte das gedacht!« Und ein grimmiger Wärter rief: »Nicht anfassen, bitte!«
Der Layouter Tom Hintner suchte am Feierabend mal wieder verzweifelt nach seinen Autoschlüsseln, und Christian entbot uns den üblichen Abschiedsgruß: »Adjöh, Jenossen! Ick fahr heeme, und da wer’ ick mir ärrßma janz jepfleecht een’ vonna Palme wedeln! Mit deutscha Jründlichkeit!«
Süße Frühlingsdüfte umkirrten mich, als ich am Sonnabend in der baden-württembergischen Ortschaft Geislingen an der Steige vom Bahnhof zum sogenannten Maikäferhäusle spazierte, um dort zu lesen: Gerüche, die unverkennbar dem Zweck dienten, uns Erdenbürger einander näherzubringen, damit wir nicht ausstarben.
Zu meiner Lesung kamen aber nur sieben Zahlende, und auch der Rest des Abends nahm einen durchwachsenen Verlauf. Die freundliche Veranstalterin chauffierte mich ins gut dreißig Kilometer entfernte Neu-Ulm, wo ein Hotelzimmer auf mich wartete, doch wir suchten erst noch eine Discothek auf, in der eine Western-Party stieg. Danach paßte mein Hotelzimmertürschlüssel dummerweise nur noch so schlecht ins Schloß, daß ich mir beim Aufschließen den rechten Zeigefinger aufriß. Weil die Deckenlampen streikten, mußte ich die blutende Wunde im Dunkeln verarzten, mit Toilettenpapier, und es legte sich mir aufs Gemüt, daß meine Geliebte Kerstin, deren Mann nichts von mir wissen durfte, jetzt nach Japan flog, wo sie bis zum Ende des Sommers von einem Stipendium zu leben plante.
Was nutzten einem die schönsten Frühlingsgefühle, wenn es keine Zielperson gab, auf die man sie richten konnte?
Als ich wieder in Frankfurt einlief, war Heribert mißgelaunt, weil die Eintracht nur einen Punkt aus ihrem Heimspiel gegen den HSV geholt hatte, und aus Portsmouth berichtete meine alte Freundin Kathrin Passig mir brieflich, daß es auch dort nicht zum besten stehe:
Kaum hat es zehn Grad über Null, stapfen die Engländer alle in kurzen Hosen in der Öffentlichkeit herum, was recht ekelhaft aussieht. Der männliche Engländer wird aber schon in der Grundschule dadurch verdorben, daß er das ganze Jahr lang, auch im kalten Winter, kurze Hosen und Kniestrümpfe tragen muß. Bei den englischen Mädels erfreuen sich im Moment dämliche Zöpfchen einer gottlosen Beliebtheit, damit sehen sie aus wie acht Jahre alt, aber das ist wohl Sinn der Sache. Das gibt es allerdings erst seit wenigen Wochen, daß sie alle diese zwei Pinsel tragen, und wer das nicht hat, der hat aufgeschneckelte Björk-Beulen am Kopf. Es sieht spuckhäßlich aus, weil die Engländerinnen ja gerade nicht wie niedliche kleine Isländerinnen aussehen, sondern wie schreckliche, großmöpsige Scharteken.
Aber bald setzt man mich ja wieder auf freien Fuß, und ich darf zurück ins gelobte Land, wo es Kabelfernsehen, zumindest bei anderen Menschen, und Kartoffelchips und Turnschuhe gibt.
Sie fragte dann, ob ich etwas mitgebracht haben wolle:
Langsam wird es Zeit, eventuelle Wünsche anzumelden, aber es gibt ja in England eigentlich eh nur Sachen, wo man ganz froh ist, daß man sie anderswo nicht kaufen kann. Und das einzige, was hier besser ist, nämlich die Kino-Eintrittspreise, kann man nicht mitnehmen.
Brauchte ich irgendwas aus England?
Ein Autogramm von Bobby Moore wäre hübsch gewesen, dem Fußballspieler, der die englische Nationalmannschaft 1966 im WM-Finale als Kapitän angeführt hatte, aber damit hätte ich Kathrin überfordert, und außerdem war er bereits verstorben.
Hilmar Kopper, der Chef der Deutschen Bank, sah die fünfzig Millionen Mark, um die Jürgen Schneider seine Handwerker betrogen hatte, als »Peanuts« an, und dafür bekam er gehörig Gegenwind.
Bei der Montagskonferenz in der Titanic-Redaktion tat Robert Gernhardt allerdings kund, daß Kopper nicht ganz verkehrt sein könne, denn er habe sich im FAZ-Magazin als Gernhardt-Fan zu erkennen gegeben. »In seinem Hause würden fast täglich meine Gedichte zitiert, hat er gesagt …«
»Und was hast du ihm dafür gezahlt?« fragte Hans Zippert.
Er gebe ja gern zu, daß er schon viele Kritiker bestochen habe, erwiderte Gernhardt, aber Kopper gehöre nicht dazu. In dessen Fall scheine das aufrichtige Ehrfurcht zu sein.
»Leute«, rief Christian, »so kommen wir doch nicht weiter!« Wir sollten ihm lieber mal erklären, was der Kritiker Wolfram Schütte mit seiner Bemerkung in der Frankfurter Rundschau gemeint habe, daß Pier Paolo Pasolinis »nietzscheanisches Lachen« einem heute »im Halse steckenbleiben« könne. »Weiß einer von euch, was Schütte uns damit sagen will?«
»Durchaus«, sagte Peter Knorr. »Bei mir ist das aber eher so ’ne Art schopenhauerisches Lachen …«
»Also, wenn mir mal was im Halse steckenbleibt, dann nur ein homerisches Gelächter«, verkündete Gernhardt. »Darunter mach ich’s nicht!«
»Und wie sieht das aus, wenn Wolfram Schütte Pasolinis nietzscheanisches Lachen im Halse steckenbleibt?« fragte Christian.
»Wie wenn der Mops mit der Wurst über ’n Spucknapf springt«, mutmaßte Heribert, während Chlodwig Poth, der fast nie irgendwas sagte, mißmutig in dem Lifestyle-Magazin Max blätterte und Achim eine Skizze entwarf: Friedrich Nietzsche mit Monstertitten.
Ob es so ähnlich wohl auch in der Münchner Redaktion der humoristischen Wochenschrift Fliegende Blätter zugegangen war, als Wilhelm Busch zu deren Mitarbeitern gehört hatte?
Bei den ersten freien Wahlen in Südafrika hatte Nelson Mandelas Partei ANC die absolute Mehrheit gewonnen, und zugleich fanden in Ruanda Massaker statt, auch an Waisenkindern und Rotkreuzhelfern. In der Tagesschau sah man eine Wasserleiche, die auf einem Grenzfluß zwischen Ruanda und Tansania vorübertrieb – eine von täglich ungefähr siebenhundert, wie es hieß.
Am Mittwochabend wurde die Zahl der Todesopfer des ruandischen Stammeskriegs bereits auf mehr als zweihunderttausend geschätzt.
»Da fällt einem nix mehr ein«, sagte Heribert.
In die »Liste ekliger Wörter«, die Wiglaf Droste und ich einmal monatlich zusammenstellten – er als freier Mitarbeiter und ich als Redakteur –, nahmen wir unter anderem die Begriffe »MultiCash Plus-Programm«, »Slim-O-Matic«, »Rockbüro Leipzig«, »Aachener Pflümli«, »Bendzko Immobilien« und »McDonald’s Power-Wahl-Frühstück« auf. Der Born, aus dem solche Wörter sprudelten, schien niemals zu versiegen.
»Und was sagt ihr zum Tarifstreit in der Textilindustrie, ihr Schöngeister, die ihr euch nur für euer eigenes Fortkommen interessiert, während wir deutschen Weber darben wie zu Gerhart Hauptmanns Zeiten?« wurden Thomas, Heribert und ich von Achim gefragt, als wir abends, wie so oft, in der Gastwirtschaft Horizont an der Friedberger Landstraße beisammensaßen. »Ihr habt’s ja vielleicht schon gehört – der Versuch, im Tarifbezirk Westfalen-Osnabrück einen Pilotabschluß zu erreichen, ist fehlgeschlagen!«
Er habe in den Nachrichten gehört, daß da auf regionaler Ebene weiterverhandelt werden solle, sagte Thomas.
»Ach, komm!« rief Achim. »Das ist doch die typische Hinhaltetaktik der kapitalistischen Blutsauger! Die wollen dadurch Proletarier wie mich ermüden, weil sie genau wissen, daß wir wöchentlich hundert Stunden am Webstuhl hocken, um die Feinripphemden für die Herren da oben zu produzieren, und daß uns deshalb der lange Atem fehlt, den wir brauchen, um die Unternehmerseite mit einer tarifbezirksübergreifenden Strategie auszuhebeln und den überfälligen Generalstreik einzuläuten, so wie damals, als wir nach dem Kieler Matrosenaufstand kurz davor gewesen sind, in Deutschland eine Räterepublik einzuführen, die alten Zöpfe abzuschneiden und die Aristokraten an die Laterne zu hängen!«
Da Achim sehr laut geworden war, blickten zwei Leute vom Nachbartisch herüber. Sie schienen sich zu fragen, ob bei uns gleich auch die Fäuste sprächen, und Achim gab dieser Befürchtung weitere Nahrung, indem er schrie: »Mann der Arbeit, aufgewacht! Und erkenne deine Macht! Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will!«
Das scheppernde Lachen, das er diesem Aufruf folgen ließ, besänftigte die Tischnachbarn ein wenig, und nachdem uns eine neue Runde Bier serviert worden war, erkundigte Heribert sich bei Achim, ob er als Weber auch Negligés herstelle, und falls ja, ob es möglich sei, eines davon mit Rabatt im Werksverkauf zu erwerben.
»Trägst du denn gern Negligés?« fragte Thomas.
»Ich persönlich nicht«, behauptete Heribert, »aber meine Stiefgroßmutter väterlicherseits hat sich von mir zu ihrem diesjährigen Namenstag eins gewünscht …«
Nun wollten wir natürlich alle wissen, wie sie hieß, doch Heribert ließ sich sehr lange bitte, bis er mit dem Vornamen »Crescentia« herausrückte.
Das treffe sich sehr gut, sagte Achim, denn der Vatikan habe gerade eine Sonderanfertigung von Negligés zum Gedenken an die heilige Crescentia von Kaufbeuren in Auftrag gegeben. »Die ersten fünfzig Exemplare werden als Sammlerstücke vom Papst signiert. Wenn du willst, beschaff ich dir eins davon. Zum Freundschaftspreis!«
»Du, meine Oma würde sich echt totfreuen«, sagte Heribert beglückt, und darauf stießen wir an.
Am Freitag pinnte die unerschütterliche Redaktionssekretärin Birgit Staniewski neue Zeitungsberichte an die Korktafel: lauter gutgemeinte, aber durch und durch greuliche Lesungskritiken aus Provinzblättern. Hans Zippert und Christian Schmidt waren also »zwei exzellente, die Nordhalbkugel bewohnende Sprachgebrauchler«, Wiglaf Droste eine »Ärgerfeder« (»Am Ende hat das Publikum brüllend über den genialen Einfallspinsel gelacht und steht doch vor dem rauchenden Trümmerhaufen seiner Leib-, Herz- und Hirnwerte«) und Max Goldt ein »Pionier der frei assoziierenden, treff- und blicksicheren Querfeldein-Verarsche«. Ja, mehr noch:
Goldt ist eine gelehrige Spürnase in der »Neuen Frankfurter Schule«, jener juxigen Ironie-Bolzen um Gernhardt und Traxler, die seinerzeit in »Pardon« den Aufgespießten nur selten denselben gewährten.
Man kriegte Pickel davon, doch Christian nahm es mit Humor: »Wir sind hier eben die juxigen Ironie-Bolzen, mein lieber Schlosser, und je eher du das begreifst, desto besser für dich!«
Ein Ding der Unmöglichkeit war es, irgendwo auf der Frankfurter Zeil einen warmen Imbiß zu erstehen, bei dem es sich nicht um eine überteuerte Kalorienbombe handelte.
Infolgedessen nahm ich zu. Weil es in meiner WG keine Personenwaage gab, wußte ich zwar nicht, wieviel ich wog, aber ich sah, daß die Wasseroberfläche sich nur noch zögerlich über meiner Bauchdecke schloß, wenn ich in der Badewanne lag.
Aber sollte ich etwa regelmäßig Sport treiben?
Beim Frühstück las ich die Frankfurter Rundschau. Eurotunnel eingeweiht, Großbrand im Reaktorblock eines Schnellen Brüters im Ural, weiter Kämpfe in Ruanda, Bürgerkrieg in ganz Jemen …
Oh, und auf der Literaturseite stellte die Kritikerin Anne Hamilton fest, mein Buch »Das Blöken der Lämmer« über linken Kitsch biete »bei aller Schärfe zu wenig Gärsubstanz«.
Tja. Ich wußte doch, daß ich irgendwas vergessen hatte – die Gärsubstanz! Dafür war es jetzt aber zu spät.
Der Kulturredakteur Jörg Lau vertrat in der taz hingegen die Ansicht, ich hätte mich mit meinem Buch »um die Förderung des Stoffwechsels verdient gemacht«. So gingen die Meinungen auseinander …
In der taz stand auch ein Interview mit dem konkret-Herausgeber Hermann L. Gremliza. Darin erklärte er, daß er Helmut Kohl den Wahlsieg wünsche:
Weil’s schlimmer wird, wenn’s die anderen machen. Die müssen nämlich immer wieder beweisen, daß sie keine vaterlandslosen Gesellen sind. Die hauen erst richtig drauf. Und sie fühlen sich als Gutmenschen historisch legitimiert, überall die Menschenrechte zu regeln. Die Koalition, die zuerst deutsche Bomben werfen würde, wäre eine rot-grüne.
Fast ein halbes Jahr war es noch hin bis zur nächsten Bundestagswahl. Die SPD setzte ihre Hoffnungen noch immer in den Kanzlerkandidaten Rudolf Scharping, der das geballte Charisma einer Büroklammer besaß. Vor diesem Männchen brauchte Kohl sich nicht zu ängstigen.
Mit einem Punkt Vorsprung vor Kaiserslautern wurde Bayern München am letzten Bundesligaspieltag Deutscher Meister, während Eintracht Frankfurt sich mit dem fünften Tabellenplatz abfinden mußte.
Heribert schäumte vor Wut. Er gebrauchte Kraftausdrücke, für die er als kleiner Junge aller Wahrscheinlichkeit nach körperlich gezüchtigt worden wäre, und er beklagte den mangelhaften Siegeswillen der Eintracht: »Wir waren in dieser Saison so nah dran, Martin! So nah! Fünf Punkte haben die Scheißbayern zeitweise hinter uns gelegen! Wir sind Weltklasse gewesen! Und dann haben wir in der Rückrunde alles vergeigt! Wie soll man denn da noch an Gott glauben?«
So waren wir Söhne der Erde: zu lieben gemacht und zu leiden.
Nach dem Einzug hatte ich meine Bücher in kunterbuntem Durcheinander eingeräumt. Jetzt nahm ich sie alle wieder heraus, sortierte sie und stellte sie zurück in die Regale. Dabei führte das Alphabet zu kuriosen Nachbarschaften: Theodor W. Adorno, Woody Allen, Eric Ambler und Günter Amendt rückten wieder ebenso eng zusammen wie Fjodor M. Dostojewski, Wiglaf Droste und Albrecht Dürer, und auf Walter Kempowski folgten Stephen King, Heinar Kipphardt und Heinrich von Kleist. Ob die wohl alle auch an einem Kaffeehaustisch so friedlich koexistiert hätten wie in meiner Bibliothek?
Was sich in der Welt so tat: In Bosnien-Herzegowina blockierten bosnische Serben internationale Hilfskonvois, in Südafrika wurde Nelson Mandela zum Präsidenten gewählt, in Italien paktierte der neue Ministerpräsident Silvio Berlusconi mit Neofaschisten, in Algerien muckte die »Islamische Heilsfront« auf, und Eckhard Henscheid lud mich brieflich zu einem sommerlichen Umtrunk ein:
Ich mach mich hin und herpendelnd etwas ins Ausland, hab aber mit Achim Greser wieder für Juni/Juli unsere legendäre Tankstellen-Bierabendreihe ins Auge gefaßt. Willst mit?
Achim klärte mich auf: Es drehe sich bei diesen losen Zusammenkünften um ein mehr oder weniger rituelles »Elendbiertrinken«, wie Eckhard es einmal genannt habe, und es müsse sich nicht zwingend notwendig auf das Areal einer Tankstelle beschränken. Hervorragend geeignet seien auch die bewährten Wasserhäuschen in den Stadtteilen Dornbusch, Ginnheim und Eckenheim. »Auf größer konzipierten Streifzügen kann man ohne weiteres auch Trinkhallen in Preungesheim oder Eschersheim ansteuern. Die Hauptsache ist die, daß man sein Flaschenbier unabhängig von der Wetterlage draußen und im Stehen trinkt!«
Dazu war ich selbstverständlich bereit.
Rechtzeitig vor der WM erschien im Verlag Weisser Stein »Supersache!«, das kleine Fußball-Lexikon, das der Kowalski-Veteran Günther Willen und ich geschrieben hatten. Neben Einträgen zu den Stichworten »Spielerbus«, »Euphoriebremse«, »Beckenringschiefstand«, »Heilfleisch«, »Geläuf, tiefes« und »Bug, Schuß vor den« enthielt es auch einen zum Thema »Lendenfilet«:
Für Reinhard Saftig geht nichts über ein zartes Lendenfilet mit frischem Gemüse, selbst zubereitet, versteht sich. Süße Leidenschaft des Türken-Trainers: Pflaumenkuchen. Die Mannschaft steht voll dahinter.
Unmittelbar darauf folgte der Eintrag »Lenz, Heribert«:
Hat im Gefängnis ein komplettes Tipp-Kick-Spiel aus Brotkrumen geknetet – 22 Spieler, 6 Reservisten, 3köpfiges Schiedsrichtergespann, 1 Ball, 2 Tore, 4 Eckfahnen, 6 Flutlichtmasten, 27000 Zuschauer. Doch Sekunden vor dem Anpfiff (Rinde gegen Schimmel): Zellenrazzia, Spiel beschlagnahmt. Lenz dumpf: »Ich kann es nun nicht mehr.« Schreiben Sie an Ihren Bundestagsabgeordneten.
Als Torwart hatten wir Heribert auch in eine »Zeichner-Elf« aufgenommen, in der Eugen Egner und F.W. Bernstein in der Abwehr spielten, Bernd Pfarr und F.K. Waechter im Mittelfeld und Achim Greser und Leonardo da Vinci im Sturm. Nebst anderen Koryphäen.
Nachdem ich Gott und die Welt mit dem Büchlein bedacht hatte, belohnte ich mich im Virgin-Megastore an der Zeil mit einer CD-Box: »King Arthur« von Henry Purcell. In dieser Barockoper wurden alte Wahrheiten besungen:
Love has a Thousand Ways to please
But more to rob us of our Ease …
Die Abwesenheit aller Freundinnen war allerdings auch keine Lösung. Auf ewig binden wollte ich mich zwar nicht so bald wieder, aber neuen Liebschaften stand ich aufgeschlossen gegenüber.
»Hier, Schlosser!« rief Christian und schmiß die Wochenzeitung Freitag auf den Tisch in meinem Redaktionsbüro. »Da wirste wieder anjefeindet!«
»Und von wem?«
»Von dem verdienten Linken Thomas Rothschild, der vor zwei Jahren mit dem österreichischen Staatspreis für Literaturkritik geadelt worden ist!«
»Und was schreibt er?«
»Lies es selbst. Er verreißt da das ›Wörterbuch des Gutmenschen‹ …«
In diesem Wörterbuch hatten der Verleger Klaus Bittermann und ich als Herausgeber Polemiken gegen die schwammige Sprache vieler Linker versammelt. »Wut und Trauer«, »Streitkultur«, »Betroffenheit«, »die Mauer in den Köpfen einreißen«, »verkrustete Strukturen aufbrechen«, »Ich sag mal«, »Ich denk mal« – um solche und ähnliche Sprechblasen ging es darin, aber Rothschild warf uns vor, daß wir zum Klassenfeind übergelaufen seien: Dieses Buch, schrieb er, sei eine konjunkturbewußte Huldigung »der Macht des Bestehenden und der bestehenden Macht«, und es demonstriere »ein unbedingtes Einverständnis mit dem kapitalistischen Status quo«.
Es war also ein Kniefall vor dem Kapitalismus, wenn man die Linken dazu aufrief, weniger Kappes zu reden …
»Geh doch mal rüber zur Deutschen Bank und frag den Hilmar Kopper, ob er dir für dein Einverständnis mit dem kapitalistischen Status quo ’ne Dividende ausschüttet«, sagte Heribert, als er seine Pinsel ausspülte. »Für den sind das doch bloß Peanuts, und für mich hätte das den Vorteil, daß ich deine Miete verzehnfachen könnte!«
Rothschild stellte noch eine andere kühne These auf:
Ein heikler Punkt: unter jenen, die sich (nicht nur in diesem Band) über die Rhetorik der Gutmenschen in bezug auf die deutsche Vergangenheit und die Ausrottung der Juden ereifern, sind einige, von denen man weiß, daß ihre Eltern während des Nationalsozialismus mehr als nur Mitläufer gewesen waren. Sie geben, ungebeten, ständig vor, die Opfer des Nationalsozialismus vor den Gutmenschen schützen zu müssen. Könnte es sein, daß sie sich ertappt fühlen?
Wen mochte er meinen? Von welchen Beiträgern wußte »man« das?
Ich rief Klaus Bittermann an, aber auch der war ratlos. »Rothschild nennt ja keine Namen«, sagte er. »Diese Verleumdung hat er sich aus den Fingern gesogen.«
Volle zwei Stunden hatte eine halbe Hundertschaft angesoffener Neonazis am Vatertag in der Magdeburger Innenstadt Jagd auf Ausländer gemacht, bis es der Polizei endlich gelungen war, erfolgreich dazwischenzugehen.
Schwere Körperverletzungen und Landfriedensbruch: So etwas konnte in den besten Familien mal vorkommen. Aber ob es wohl auch zwei Stunden gedauert hätte, bis die sachsen-anhaltinischen Polizeikräfte mit fünfzig vor dem Wohnsitz des christdemokratischen Ministerpräsidenten Christoph Bergner randalierenden Linksradikalen fertig geworden wären?
Die Niederlage, die Rot-Weiß Essen im DFB-Pokalfinale erlitten hatte, ließ den alten Essener Thomas Gsella angeblich kalt. Er interessiere sich inzwischen »mehr so für Eishockey und Dressurreiten«, tat er kund und wechselte das Thema: »Heribert, kannst du nicht mal irgendwas für den Friedensprozeß zwischen Syrien und Israel tun?«
»Du, da bin ich Tag und Nacht mit beschäftigt«, sagte Heribert, »aber morgen muß ich erstmal in der Moslem-Enklave Bihać in Bosnien nach dem Rechten sehen, und danach steht in Brüssel das Treffen der Außenminister in meinem Terminkalender. Und anschließend flieg ich als Unterhändler nach Damaskus runter …«
»Triffst du da auch den Drusenführer Kamal Dschumblat?« fragte Achim.
Der sei doch schon lange tot, rief Christian, und es entspann sich eine längere Debatte über die Frage, wer denn seither die Drusen führe und ob sie nicht ein Recht darauf hätten, auch mal führerlos durchs Leben zu gehen.
Auf meinem treuen Rennrad kurvte ich nach Eschersheim, vom Uferweg an der Nidda weiter zu den Streuobstwiesen am Berger Hang hinauf und über Seckbach und Bornheim wieder zurück in die Vogelsbergstraße, wo ich das Fazit zog, daß Frankfurt aus der Ferne besser aussah als aus der Nähe.
Heribert saß tuschend am Küchentisch, und der Fernseher lief, als ich mir nach dem Duschen ein Bier aus dem Kühlschrank holte. »Die FDP will sich nun doch nicht als die Partei der Besserverdienenden bezeichnen«, sagte der Tagesschau-Sprecher Werner Veigel da gerade. »Das Präsidium beschloß heute nach öffentlicher und auch parteiinterner Kritik, eine entsprechende Formulierung in dem Entwurf für das Wahlprogramm zu ändern. Vorgeschlagen wird nunmehr ein Satz, in dem es unter anderem heißt: ›Wir ergreifen Partei für die, die es nicht verdient haben, mit dem Klassenkampfbegriff ‚Besserverdienende‘ belegt zu werden.‹«
Fabelhaft: Die Partei der Besserverdienenden verteidigte die Besserverdienenden gegen den Vorwurf, Besserverdienende zu sein!
Er finde das richtig, sagte Heribert. Die Besserverdienenden würden schon so viel verdienen, daß sie jetzt nicht auch noch den Klassenkampfbegriff »Besserverdienende« verdienen sollten: »Irgendwann muß mal Schluß sein mit dieser ewigen Gier!«
Gemeldet wurde auch, daß die Eintracht künftig von Jupp Heynckes trainiert werden sollte, aber das ging mich nichts an. Mit diesem Luschenverein war ich fertig.
Bei Saturn in der Bergerstraße kaufte ich einen Fernseher von Blaupunkt für 1199 Mark, den ich auf meinem Schreibtisch unterm Hochbett plazieren wollte, und dazu Kopfhörer von Sennheiser für 139 Mark. Beim Bezahlen bat ich den Kassierer, mir ein Taxi zu rufen, und ich war in Sorge: Würde die Glotze in ihrer monumentalen Verpackung da überhaupt hineinpassen?
Der Kofferraum war dann tatsächlich zu klein, doch durch den Rahmen der Beifahrertür ließ der Karton sich mit einiger Mühe ins Auto quetschen.
Mit der Inbetriebnahme war es schwieriger. Ich müsse mir einen Kabelanschluß in mein Zimmer legen lassen, sagte Heribert.
Über solche Nebensächlichkeiten hatte ich noch gar nicht nachgedacht.
Christian schritt paffend durch die Redaktionsräume und sprach mit ungekünstelter Begeisterung davon, daß der Schuldenberg des Pleitiers Jürgen Schneider bei einem Gläubigertreffen inzwischen auf viereinhalb Milliarden Mark beziffert worden sei. »Stellt euch das mal vor, ihr Mikroben! Viereinhalb Milliarden – das sind viertausendfünfhundert Millionen! Während jeder einzelne von euch Versagern sein Konto doch bestimmt nur um maximal zweitausend Oschis überziehen darf! Wenn überhaupt!«
»Wir Kleinsparer sind aber auch nicht ohne«, wandte Thomas Gsella ein. »Erst dank uns ist der Kapitalismus ja so weit gekommen, daß er sich revolutionär überwinden läßt …«
Woraufhin Achim mit der Faust auf den Tisch schlug und ausrief: »Genau! Das gleiche hat der Genosse Wladimir Iljitsch Uljanow Lenin in seiner viel zu selten gelesenen Streitschrift ›Materialismus und Empiriokritizismus‹ ausgeführt, ihr Schweine! Darin ist er seitenweise auf die historischen Verdienste der russischen Kleinsparer eingegangen!«
»Hat er denen nicht sogar verbilligte Wechselobligationen versprochen?« fragte Heribert.
Der sonst recht stille Tom Hintner schaute von einem Negativ auf, das er mit einer Lupe untersucht hatte, und stellte Heribert die Gegenfrage, ob er überhaupt wisse, was das sei, eine Wechselobligation.
»Na, das lieb ich ja!« kofferte Heribert zurück und warf seinen Zeichenstift hin. »So wird man hier diskriminiert, bloß weil man keinen Abschluß von der Harvard Business School hat! Ich sag dir, du, ich hab schon mit Wechselobligationen hantiert, als du noch am Schnuller gelutscht hast!«
In der Türkei wurden kurdische Dörfer niedergebrannt und ausradiert, und die türkische Ministerpräsidentin Tansu Çiller hatte sogar von der »Endlösung der Kurdenfrage« gesprochen, doch der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber erkannte darin keinen Grund zur Besorgnis. »Wir haben keinen Anlaß, daran zu zweifeln, daß man nach Istanbul oder in diese Gebiete ohne weiteres abschieben kann, daß es hier keine entsprechenden Gefahren gibt«, sagte er kühlen Herzens in der Tagesschau.
Auch der christdemokratische Bundesinnenminister Manfred Kanther hatte sich gegen einen vorläufigen »Abschiebestopp« für kurdische Asylbewerber ausgesprochen und gesagt, eine derartige Maßnahme komme einer Aufforderung zur illegalen Einwanderung gleich.
Mir wurde jedesmal schlecht, wenn dieser gescheitelte Widerling auf der Mattscheibe erschien. Er gab sich den Anschein, seine amtlichen Pflichten leidenschaftslos zu exekutieren, aber ich glaubte, daß es ihm insgeheim Freude machte, Kurden in Folterknäste abschieben zu lassen. Es war auch kein Zufall, daß mir immer das Wort »Reichssicherheitshauptamt« in den Sinn kam, wenn ich Kanther erblickte.
Am Sonnabend vor Pfingsten machten Heribert und ich einen Großeinkauf. Das wollten wir nun jeden Sonnabend tun, denn es war schon zu oft vorgekommen, daß wir entweder gar nichts oder alles mögliche doppelt eingekauft hatten.
Als wir fast alles beisammenhatten, gingen wir noch in ein Fischgeschäft, aber das verließen wir wieder, um nicht mit ansehen zu müssen, wie der blutbespritzte Fischhändler für eine vor uns anstehende Kundin mehrere Karpfen mit einem Hammer totschlug. Oder waren es Barsche?
Er werde jetzt »mal ’ne Weile vegetarisch leben«, sagte Heribert.
Eine halbe Million Menschenleben sollte der Bürgerkrieg in Ruanda bereits gekostet haben. Der Spiegel berichtete, daß Manfred Kanther es trotzdem nicht für nötig hielt, ein paar mehr ruandische Flüchtlinge als sonst ins Land zu lassen:
Das Innenministerium will nur »in Fällen singulärer Sonderschicksale« helfen. Aufnahme in Deutschland komme nicht in Frage, so ein interner Vermerk in kaltem Juristen-Deutsch, solange »der Einzelne nicht mehr und nicht weniger erleidet als andere ruandische Flüchtlinge auch«.
Im Klartext: Bei Völkermord und Massenverfolgung sollen alle dran glauben.
Und wohin wäre ein um all sein Hab und Gut beraubter Kanther vor einem Bürgerkrieg in Deutschland geflohen? In die Schweiz? Oder nach Liechtenstein? Im Geiste sah ich den verhärmten Bundesinnenminister vor einem Schlagbaum auf die Knie sinken, und ich hörte ihn die Zöllner anflehen: »Bitte lassen Sie mich rein! Ich besitze zwar leider keine Barmittel, und ich weiß, daß außer mir auch viele meiner Mitbürger auf der Flucht sind, aber mich hat ein singuläres Sonderschicksal ereilt! Das kann ich beweisen! Ich bin der erste abendländische Asylbewerber, der andere Asylbewerber abgeschoben hat!«
Was machte man an den Pfingsttagen, wenn man mit niemandem verabredet war?
Ich las mich in den Briefen aus Mamas und Papas Nachlaß fest. Im November 1965 hatte Papa auf einer seiner ersten großen Dienstreisen die Beschaffenheit seines Hotelzimmers in Minneapolis geschildert:
Ein Zimmer in der Größe eines Fußballfeldes, in Bad und Schlafraum Spiegel von ca. 3 m2, Zeitschalteruhr für Infrarotsonne im Bad, versiegelter Lokusdeckel, Telefon, 20 cm dicke Telefonbücher, natürlich Television gleich vereint mit Radio und einem hoteleigenen festen Unterhaltungsmusikprogramm usw. usw. Manches ist wirklich schon so, wie es sich der Europäer für 2000 denkt.
Dieser lustige Brief hatte Mama in Koblenz-Lützel erreicht. Acht Jahre später hatten wir auf der anderen Rheinseite gewohnt, in Vallendar, Ortsteil Mallendarer Berg, und Papa war nach Meppen versetzt worden. Erst jetzt ging mir auf, wie einsam Mama sich damals gefühlt haben mußte. Im Dezember 1973 hatte sie Papa einen todtraurigen Brief geschrieben. Es ging darin um einen von ihr nach Meppen geschickten Schlips, über den Papa sich telefonisch beschwert zu haben schien, und daran schlossen sich bittere Überlegungen an:
Ich hatte gehofft, Du würdest ein bißchen das Gefühl haben, daß ich mir um Dein Wohlergehen Gedanken mache, und in diesem Sinne vielleicht auch die paar Nikolaus-Kleinigkeiten verstehen. Es muß wohl so sein, daß wir beide einfach zu verschieden konstruiert sind. Du kannst offensichtlich lange Zeit ohne meine Fürsorge auskommen, aber ich kann mit so wenig Kontakt und so viel Kritik eben nicht so leicht fertig werden.
Herrje. Und es hatte weit und breit niemanden gegeben, mit dem Mama über diese Misere hätte sprechen können …
Mag sein, weil es mir in letzter Zeit schlechter geht, oder es mag auch daran liegen, daß die Kinder da ahnungslos und oft wenig rücksichtsvoll sind oder daß mir die ewige Trennung in der Adventszeit besonders zu schaffen macht, jedenfalls würde ich mich freuen, wenn Du mir mal einen Abend schreiben könntest, einfach so, und weil einem am Telefon ja doch die richtigen Worte fehlen. Das würde mir ein wenig Auftrieb geben, bis Du endlich kommen kannst. Alle hier scheinen zu glauben, es mache mir nichts aus, allein zu sein, und das zeigt doch bloß, daß sie mich alle nicht richtig kennen.
Einen Gegenbrief von Papa fand ich nicht.
In Mamas Lebensplanung war allzu früh der Wurm drin gewesen. Abitur und Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin, schön und gut, aber dann: vier ungewollte Kinder, eine verkorkste Ehe, ein freudloses Hausfrauendasein fern von der Heimat und am Ende Lymphdrüsenkrebs, jahrelanges Siechtum und Tod.
An irgendeiner Stelle mußten da die Weichen falsch gestellt worden sein. Aber wo? Und von wem?
Der neugewählte Bundespräsident Roman Herzog war alles anderes als ein Hänfling, aber neben dem Fleischgebirge Helmut Kohl wirkte er zwergenhaft.
»Der neue Präsident«, hieß es in der Tagesschau, »rief die Deutschen dazu auf, tolerant, weltoffen und vor allem unverkrampft zu sein.«
»Sind wir doch schon lang!« schrie Heribert den Küchenfernseher an. »Wir sind hier so unverkrampft, wie’s ihr euch da in Berlin ned amoi vorstellen könnt, ihr Kachelbrunzer!«
Dann hielt ich »Die gnadenlose Jagd« in der Hand, mein neuestes Buch – geschrieben in meiner Grundschulzeit, gut zwei Jahrzehnte später gründlich überarbeitet, mit bezaubernden Zeichnungen von F.W. Bernstein illustriert und jetzt erschienen im Greizer Kleinverlag Weisser Stein. Ein Kriminalroman, auf den die Menschheit nicht gewartet hatte, doch was wußte die schon?
Die schöne Fotografin Nele Jaskula, die ich aus Berlin kannte, kündigte mir für Fronleichnam ihren Besuch an. Sie hatte einen argwöhnischen festen Freund und hoffte, ihm Anfang Juni einmal unter Vorspiegelung falscher Tatsachen mit ihrem Pkw entwischen zu können.
Einen roten Teppich wollte ich für Nele ausrollen und die Hochbettleiterstufen bohnern.
Immer wieder stand ich staunend vor der Korktafel mit den Presseberichten. Eine Lesung von Max Goldt hatte einen Reporter der Kieler Nachrichten zu der Bemerkung angeregt:
Syntaktisch verschieden bis verwickelt badet er in Formulierungen und hebt Nebensächliches genußvoll auf den Olymp des Bedeutsamen.
Gab es in den Lokalzeitungsredaktionen keine Rotstifte mehr? Und keine Redakteure, die den Volontären ihren Plunder um die Ohren hauten?
Mit einem Leihwagen verfrachtete ich eine neue Matratze und eine neue Daunendecke von Ikea in die Vogelsbergstraße. Mein von Büchern überquellender Kaninchenbau näherte sich damit dem höchstmöglichen Grad an Behaglichkeit. Eine Frau hätte in dieser Bude vermutlich noch irgendwelche Zimmerpflanzen geparkt, um die Wohnlichkeit zu steigern, aber erstens war ich keine Frau, und zweitens wollte ich das Fenster aufreißen können, ohne vorher einen halben botanischen Garten abräumen zu müssen.
»Willste dir nicht so ’ne indirekt beleuchtete Wassersprudelsäule in dein Zimmer stellen?« fragte Heribert. »Diese Dinger sind jetzt richtig in …«
Da trieb er mit Entsetzen Scherz.
Den Warnstreiks, mit denen die Postgewerkschaft drohte, sah ich mit Sorge entgegen. Mein Briefverkehr sollte bitte nicht von Tarifkonflikten lahmgelegt werden!
Es gab da allerlei Mißhelligkeiten im Gefolge der Postprivatisierungspläne der schwarz-gelben Bundesregierung. Die waren wahrlich des Teufels. Wie kam der Staat dazu, die Erledigung einer seiner vornehmsten Aufgaben an profitgierige Privatunternehmer zu delegieren?
Meiner Ansicht nach hatte die Post, so wie auch die Bahn, allein dem Gemeinwohl zu dienen, und Gewinne und Verluste hätten dabei überhaupt keine Rolle spielen dürfen.
Erich Honecker war im chilenischen Exil an Krebs gestorben. Im Fernsehen sah man daher alte Aufnahmen aus der kriecherischen DDR-Volkskammer und Aufmärsche zum Jubeln abkommandierter Jungpioniere sowie die Bruderküsse, die Honecker und der sowjetische Staatschef Leonid Breschnjew sich abgequält hatten. Alles daran war verlogen und faul. Auch Honecker selbst mußte gewußt haben, daß ihn niemals jemand freiwillig umjubelt und geküßt hätte.
Tom Hintner hatte die Idee, sein Baby in eine DDR-Fahne zu wickeln und ihm eine Hornbrille aufzusetzen, während es im Schlaf ein Fäustchen ballte. In ein Foto davon montierte er dann noch ein grünes Cordhütchen, und fertig war das nächste Titelbild:
Ach, du lieber Gott:
Honecker wiedergeboren!
In einem Testspiel mußte Deutschland sich den Iren mit 0:2 geschlagen geben. »Und der schlechteste Mann auf ’m Platz war Stefan Effenberg«, sagte Heribert. »Ich weiß überhaupt nicht, was der im deutschen WM-Kader zu suchen hat. Der Vogts hätte mal lieber Bernd Schuster nominieren sollen! Das ist der beste deutsche Mittelfeldspieler seit Netzer und Overath. Aber dafür ist der Vogts natürlich zu feige gewesen, weil er weiß, daß der Schuster keiner von denen ist, die vor der DFB-Führung kuschen …«
Diesen Skandal brauchte man ja nicht auf sich beruhen zu lassen. Wie wäre es, dachte ich, mit einer Titanic-Mahnwache? Um Effenbergs Hinauswurf und Schusters Nachnominierung durch den Bundestrainer Berti Vogts zu erzwingen? Ich war dazu bereit, mich für diesen guten Zweck vor der Frankfurter DFB-Zentrale anzuketten.
Den Kollegen gefiel dieser Plan. Dann müßten alle Redaktionen alarmiert werden, sagte Christian. »Mach mal ’ne schöne runde Pressemitteilung fertig. Die jag ich dann per Fax in alle vier Winde, wenn’s soweit ist. Und was brauchen wir sonst noch?«
»Kerzen«, sagte Thomas. »Keine Mahnwache ohne Kerzen!«
Hans Zippert meinte, daß wir besser Grablichte nehmen sollten. Die würden nicht so schnell ausgehen, und sie entsprächen sehr gut den Erfolgsaussichten, die wir uns versprechen dürften.
Bei einer Ortsbegehung vor der DFB-Zentrale an der Otto-Fleck-Schneise 6 hielt ich Ausschau nach einem Objekt, an das ich mich ketten konnte, und entschied mich für ein kleines Metallgestell mit dem DFB-Logo.
Dann kaufte ich in einer Eisenwarenhandlung eine Kette und ein Vorhängeschloß, verfaßte in der Redaktion eine Presseerklärung und stellte eine Adressenliste für Christians Fax-Orgie zusammen: Reuter, AP, dpa, ddp, Kicker, Frankfurter Rundschau, Süddeutsche, taz, FAZ, Bild, Welt, Radio FFH, Frankfurter Neue Presse, Spiegel, Focus, ARD, ZDF, RTL plus und was nicht alles.
Thomas baute währenddessen Plakataufsteller mit der Botschaft:
So nicht,
Herr Vogts!
Auch Flugblätter mußten her und Unterschriftenlisten, in die Passanten sich eintragen konnten.
Am 31. Mai 1994 um elf Uhr vormittags begann unsere Mahnwache. Sie bestand aus Thomas Gsella, Jürgen Roth, Oliver Nagel und mir. Thomas kettete mich an, ich schmückte meinen Sitzplatz mit einem Halbkreis aus brennenden Grabkerzen, Jürgen und Oliver bauten die Aufsteller auf, und das Warten begann.
Zur Verpflegung hatten wir belegte Brote und eine Kiste Bitburger Pils mitgenommen, aber ich durfte natürlich nichts trinken. Wenn man sich schon anketten ließ, um einer Forderung Nachdruck zu verleihen, dann durfte man sich nicht zwischendurch mal eben abketten lassen, um auszutreten.
In der DFB-Zentrale regte sich nichts. Oder hatte sich da eine Gardine bewegt?
Es kam auch fast niemand des Wegs. Wenn nebenan im Waldstadion kein Spiel stattfand, verirrten sich nur wenige Menschen in diese abgelegene Ecke Frankfurts.
Thomas, Jürgen und Oliver standen mit ihren Flugblättern herum wie die Zeugen Jehovas, und ich saß im Schneidersitz da und fragte mich, ob es nicht klüger gewesen wäre, die Mahnwache auf der Zeil abzuhalten.
Jürgen machte sich an einen Jogger ran, um ihm zu erklären, was wir hier taten, und der unterzeichnete sofort unseren Appell an Berti Vogts.
»Jetzt ist der Knoten geplatzt«, sagte Thomas. »Das ist so wie damals, als Mahatma Gandhi Unterschriften für Indiens Unabhängigkeit gesammelt hat! Da hat zuerst auch nur so’n einzelner Jogger unterschrieben, und dessen Beispiel sind dann plötzlich Millionen Inder gefolgt …«
Nach einer Viertelstunde fuhren die ersten Journalisten vor und bildeten vor dem Kerzenhalbkreis einen Pulk, der rasch wuchs. Ihre Fragen und meine Antworten waren immer die gleichen.
»Was haben Sie gegen Stefan Effenberg?«
»Effenberg ist ein unreifer Zweitligaspieler mit einem unglücklichen Hang zur dicken Lippe, und er hat sich durch seine Formschwankungen und sein Maulheldentum disqualifiziert.«
»Warum soll er durch Bernd Schuster ersetzt werden?«
»Weil Schuster der beste deutsche Mittelfeldregisseur ist.«
»Wie lange soll Ihre Aktion dauern?«
»Bis der DFB einlenkt.«
»Was passiert, wenn Berti Vogts sich weigert?«
»Das können wir uns nicht vorstellen.«
»Und wenn doch?«
»Dann wird Deutschland wahrscheinlich bereits in der Vorrunde ausscheiden.«
Einige der Reporter drangen in die DFB-Zentrale ein, aber aus den dort anwesenden Bonzen konnten sie keine Stellungnahme herausleiern.
Auf dem Weg vom Parkplatz zum Eingang blieb eine DFB-Angestellte vor mir stehen und sagte, daß sie mir einen Teller Suppe bringen werde, wenn ich hier heute abend noch säße. Und sie riet uns, nach Barsinghausen fahren, denn dort und nicht hier in Frankfurt würden sich Berti Vogts und der DFB-Präsident Egidius Braun gegenwärtig aufhalten.
Der Journalistenhaufen mit den vielen Kameras und Mikrofonen übte eine magnetische Kraft auf den einen oder anderen Spaziergänger aus. Die Unterschriftenliste wurde länger, aber der DFB hielt still.
Es ging auf zwölf Uhr zu. Da sich nichts Neues tat, packten die Journalisten ihr Equipment wieder ein und hielten erst inne, als auf einmal doch noch ein DFB-Funktionär aus der Zentrale herauslief und uns anblaffte: »Was geht hier vor?«
Dicklich war er, und er bebte vor Zorn.
Dies sei eine Demonstration der Titanic zugunsten der Nominierung Bernd Schusters für den deutschen WM-Kader, sagte Thomas.
In scharfem Ton fragte der Mann: »Was ist Titanic?«
An der Antwort – »Ein Satiremagazin« – schien er jedoch gar kein Interesse zu haben. »Wenn Sie sich nicht sofort entfernen, müssen wir die Polizei rufen!« rief er. »Es hat Beschwerden gegeben, weil unsere Mitarbeiter sich von Ihnen belästigt gefühlt haben. Der Anblick eines angeketteten Menschen ist ekelerregend und eine Zumutung für unsere Angestellten! Und im übrigen ist das hier ein Privatgrundstück!«
»Sie müssen aber berücksichtigen, daß es nicht nur das Eigentumsrecht gibt, sondern auch das Recht auf zivilen Ungehorsam«, sagte Oliver, und Jürgen legte nach: »Wir protestieren hier ja keineswegs krachmeierisch. Wenn Sie sich den angeketteten Mann ansehen, dann müssen Sie doch zugeben, daß er eine geradezu buddhistische Ruhe ausstrahlt! Außerdem treten wir für etwas ein, dessen Berechtigung kein Sachverständiger abstreiten kann …«
Darauf gab der Dicke keine Antwort. Er machte kehrt und dampfte schmollend wieder ab.
Die Hoffnung auf einen Polizeieinsatz veranlaßte die meisten Journalisten dazu, ihr Handwerkszeug wieder auszupacken.
Das konnte ja heiter werden. Würde die Polizei meine Kette aufschweißen? Und uns alle verhaften?
Nein, nichts dergleichen. Es war eine leere Drohung gewesen. Der DFB wagte es leider nicht, uns vor den Augen der Pressemeute abführen zu lassen.
Als ich so gegen halb drei mal strullen mußte, teilte ich den letzten bei uns verharrenden Journalisten mit, daß Berti Vogts unsere Forderungen akzeptiert habe.
»Und woher wissen Sie das?«
Das sei so eine Intuition, behauptete ich und lobte die Kollegen Gsella, Roth und Nagel »für die Supermoral«, die sie bewiesen hätten.
Vergnüglich war’s dann vor dem Redaktionsfernseher. RTL Hessen Live berichtete in wünschenswerter Ausführlichkeit von der Mahnwache, und SAT.1 hatte sogar Bernd Schuster höchstpersönlich irgendwo in Madrid aufgetrieben und gefragt, was er davon halte, daß jemand sich ihm und seiner Nominierung für den deutschen WM-Kader zuliebe angekettet habe. Da lachte Schuster, und er sagte: »Der Mann hat scheinbar Ahnung vom Fußball!«
Er meinte natürlich »anscheinend« und nicht »scheinbar«, aber das sah ich ihm nach.
Meine Patentante Dagmar reagierte anders, nachdem ich ihr telefonisch von unserem Vorgehen berichtet hatte. »Ihr habt doch ’n Vogel«, sagte sie. »Glaubt ihr im Ernst, daß ihr damit irgendwas bewirken könnt?«
Wie sich anderntags zeigte, hatten wir immerhin für ein paar kleingedruckte Schlagzeilen gesorgt, unter anderem in Bild (»Protest mit Ketten«) und im Tagesspiegel (»In Ketten für den ›blonden Engel‹«), und auch andere Zeitungen schärften das Problembewußtsein. Die Süddeutsche sah infolge unserer Protestaktion eine »Gefahr für Effenberg« heraufziehen, und die FAZ solidarisierte sich mit uns:
Von der Angst getrieben, das deutsche Schiff unter Admiral Vogts werde bei der WM in den Vereinigten Staaten untergehen, hat sich »Titanic«-Redakteur Martin Schlosser geopfert, eine Mahnwache zum Wohle des deutschen Fußballs abzuhalten.
Nur der Kölner Express hatte was zu meckern:
Es sei erlaubt, Schusters treuester Fan (»Es ist die Liebe zu seiner Spielweise«) träumt abwegig, ein wenig spinnert.
War es denn nicht viel spinnerter, auf die Großschnauze Effenberg zu setzen und den besten aktiven deutschen Fußballspieler bei der WM außen vor zu lassen?
Auf unserem Heimweg vom Horizont stellte ich in tiefer Nacht auf Heriberts Wunsch pantomimisch das zweite Gesetz der Thermodynamik dar und wäre dabei fast überfahren worden, weil ich für die Vorführung auch die Straße genutzt hatte.
»Netter Versuch«, sagte Heribert. »Aber so kommst du mir nicht davon! Ich warte nämlich noch auf deine Miete für Juni!«
Am Donnerstag faxte Günther Willen mir eine Meldung der Hamburger Morgenpost in die Redaktion:
Berti sauer auf »Titanic«
Nanu?
Der Bundestrainer und seine Spieler kennen keinen Spaß, sind reichlich verstimmt. Grund: Die Medien hatten berichtet, wie sich ein Redakteur des Satire-Magazins »Titanic« vorm DFB-Haus in Frankfurt angekettet hat. Seine Forderung: Vogts sollte Effenberg rausschmeißen, dafür Schuster nachnominieren.
Natürlich verstand Vogts keinen Spaß, aber vielleicht verstand er ja, daß wir es ernst gemeint hatten. Es war einfach strunzdumm gewesen, anstelle des Genies Schuster den Kotzbrocken Effenberg ins Team zu holen.
Meine Besucherin Nele eröffnete mir, daß mein Name Sabine sei: »So hab ich’s meinem Freund erklärt. Ich bin hier bei meiner alten Freundin Sabine zu Gast, die in ’ner WG wohnt. Kannst du damit leben?«
»Hab ich ’ne Wahl?«
»Nein, hast du nicht. Und wenn mein Freund hier anruft, dürft ihr euch nicht verplappern. Ich hab ihm eure Nummer gegeben. Also, wie heißt du?«
»Sabine.«
»Kannst du mich bitte mit ›Memsahib‹ ansprechen?«
»Sehr wohl, Memsahib. Ich heiße Sabine, Memsahib.«
»Danke, Sabine. Und was gibt’s zu essen?«
Da ich Nele mit meinen Kochkünsten nicht verdrießlich stimmen wollte, hatte ich mir von Heribert einen Italiener empfehlen lassen, und bei dem bestellten wir gebackene Seezungenfilets mit Zitronenbutter, Brokkoliröschen, Kirschtomaten und Kartoffeln sowie insgesamt drei Halbliterkrüge Soave, denn Nele war trinkfest.
Eine sympathische Eigenschaft! Bei Frauen traf man sie nicht so oft an wie bei Männern, und wenn es dann doch einmal vorkam, war es um so erfreulicher.
In Berlin sei sie nun schon seit Monaten auf der Suche nach ’ner neuen Wohnung, sagte Nele. »Aber seit dem Mauerfall … Na, das weißt du ja selbst. Auf bessere Zeiten, Sabine. Saluti!«
Es war eine Liaison dangereuse, auf die ich mich hier einließ. Wenn ich das nicht bereits gewußt hätte, wäre es mir am nächsten Morgen klargeworden, als Neles Freund anrief und ihr mitteilte, daß er beschlossen habe, ihr hinterherzureisen.
»Wie? Und wo ist er jetzt?«
»Im Frankfurter Hauptbahnhof«, sagte Nele, während sie hastig ihre Sachen zusammenkramte. »Und ich soll ihn da abholen.«
»Ach du Schreck.«
»Das kannst du laut sagen. Hast du meine Schuhe irgendwo gesehen?«
Ich sah unter den Bücherregalen und unter meinem Schreibtisch nach und verfluchte im stillen wieder einmal den ideologischen Anspruch auf das Privateigentum an Menschen. Woher nahm dieser Mann das Recht, Nele und mich in unserer Zweisamkeit aufzustören?
»Er glaubt ja, daß ich hier nur ’ne Freundin besuche«, sagte Nele.
»Und was willst du ihm erzählen, wenn ihr euch gleich trefft?«
»Weiß ich noch nicht. Daß wir uns zerstritten haben oder so …«
»Kann ich helfen?« fragte Heribert, als er aus seinem Zimmer kam und uns auf allen vieren nach den Schuhen suchen sah.
Sie fanden sich im Badezimmer wieder an. Dann ging es hoppla-hopp: Ich bekam ein Küßchen, und gleich darauf klabasterte Nele mit ihrer Reisetasche die Treppe hinunter und verschwand aus meinem Leben.
Die taz wollte während der WM jeden Tag einen Eintrag aus Günther Willens und meinem Fußball-Lexikon nachdrucken, und nun fragte auch die Sportredaktion der FAZ an, ob sie das dürfe. »Ab Freitag nächster Woche, Herr Schlosser. Wären Sie damit einverstanden?«
»Von mir aus können sie das tun«, sagte Günther, nachdem ich ihn telefonisch informiert hatte. »Da lacht das runde Leder!«
Silvio Berlusconi hatte dem US-Präsidenten Bill Clinton versichert, daß in Italien keine Gefahr einer Rückkehr zum Faschismus bestehe.
Wie schön! Und wie bedenklich, andererseits, daß so etwas gesagt werden mußte. »Meine neofaschistischen Koalitionspartner und ich wollen übrigens nicht zum Faschismus zurückkehren, Mister President. Falls Sie das beruhigt …«
Im Traditionslokal Hexenkessel rekapitulierten Achim, Heribert und ich die bisherigen deutschen WM-Finalsiege und den Endstand der Spiele: 1954 in Bern 3:2, 1974 in München 2:1 und 1990 in Rom 1:0. Wie sollte es da weitergehen?
»Mit null zu minus eins!« rief Achim, und Heribert stellte eine »physikalische Nettospielzeitkrümmung« zur Diskussion.
Verfressen und versoffen hatten wir nach drei Stunden rund neunzig Mark, die sich erstaunlicherweise von der Steuer absetzen ließen.
In einem Werbespot der Naturgesetz-Partei, die zur Europawahl antrat, äußerte sich ein silberfischig beschlipster Mops namens Reinhard Borowitz zu der Frage, wie er und die Seinen ein »konfliktfreies Europa« zu erkämpfen gedächten: »Wir schaffen eine Gruppe von siebentausend Experten in Maharishis Transzendentaler Meditation und dem Yogischen Fliegen. Dadurch wird nachweislich Geordnetheit, Positivität und Harmonie in Europa erzeugt …«
Man sah dazu jemanden auf einem Trampolin herumhopsen.
Von diesem Quatsch konnte Reinhard Borowitz offenkundig gut leben, denn er hatte ordentlich was auf den Rippen. Bewies das nicht, daß er recht hatte? Er säte nicht, er erntete nicht, und der himmlische Vater ernährte ihn doch.
Nach dem DFB wollte ich den ADAC provozieren. Ein schickes Auto kaufen, damit nach München fahren und es vor dem Hauptquartier des ADAC mit Baseballschlägern und Vorschlaghämmern in tausend Stücke hauen: Das hätte mir gefallen, aber Hans Zippert sagte, daß der Etat das nicht hergebe.
Doch das Thema lag in der Luft.
Zu den weiblichen Wandelsternen, die sich manchmal zu den Gelagen im Horizont einfanden, gehörte eine robuste Bühnenbildnerin, die Silke hieß, und einmal fügte es sich so, daß ich sie heimbegleitete. Es war nicht sehr weit, doch wir kamen nur langsam voran, weil sie die Angewohnheit hatte, alle paar Meter stehenzubleiben und jedes auf dem Bürgersteig parkende Auto mit einem Karatehieb von seinem rechten Außenspiegel zu trennen. Darin schien sie geübt zu sein. Sie mußte jedenfalls bei keinem Auto öfter als einmal zuschlagen.
»Hat dich dabei schon mal die Polizei erwischt?« fragte ich sie.
»Wieso? Hast du Angst?«
Und kracks – schon flog der nächste Außenspiegel zu Boden.
Silkes Wohnung sah dann aber gar nicht wie die einer skrupellosen Gewalttäterin aus. Es hingen selbstgeknüpfte Teppiche an den Wänden, im Wohnzimmerregal standen großformatige Kunstbildbände, im Schlafzimmer wuchs ein Drachenbaum, und ich erhielt aus einer Glaskaraffe Kognak eingeschenkt.
Oh, the world is sweet, the world is wide
And she’s there where the light and the darkness divide …
Liebeleien ohne nachfolgende Beziehungsgespräche: Gipfelte darin nicht der gesamte Schöpfungsprozeß?
Ob ich nicht mal mitkommen wolle zum Kicken im Ostpark, fragte Thomas Gsella mich. »Könnte dir nicht schaden!«
Ich sagte zu und erwarb eine Turnhose sowie ein Paar Fußballschuhe der Marke Adidas.
Wir waren zu fünft: Thomas Gsella, Jürgen Roth, zwei weitere Herren und ich. Nachdem wir vier Torpfosten aus zusammengeknüllten Jacken gebildet hatten, teilten wir uns auf – drei Raucher gegen zwei Nichtraucher –, und obwohl sich meine sechzehn Jahre Trainingsrückstand bemerkbar machten, lagen wir Raucher zuletzt mit 30:29 Toren vorn.
Die sportliche Aktivität hatte einen rabiaten Muskelkater zur Folge, der mir äußerst hinderlich war. Einmal mußte ich Hans Zippert sogar darum bitten, mich vom Bürostuhl hochzuziehen, weil ich es nicht schaffte, mich aus eigener Kraft aufzurichten, und bei meinen Gehversuchen kam ich mir wie Frankensteins Monster vor.
»Weißt du, an wen du mich erinnerst?« fragte Birgit Staniewski, als ich an ihrem Tisch vorüberstakste. »An Frankensteins Monster!«
»Sag bloß …«
»Doch, ungelogen!«
Er könne das bestätigen, sagte Tom Hintner. »Du bewegst dich so graziös wie Boris Karloff, Martin. Aber mit dir hat Doktor Frankenstein sich mehr Mühe gegeben. Man sieht praktisch keine Nähte!«
Meine Favoriten in der neuen Liste ekliger Wörter waren »Hama DigiCall 701«, »Meditationseinleitungshorn«, »DDR-Identität«, »Flüsterbrummi«, »Entsorga ’94«, »Ergo-Fit-Fußbett« und »angesagter Knitter-Look«. Was hätten die braven Wörtersammler Jacob und Wilhelm Grimm wohl von diesen Preziosen gehalten?
Günther Willen rief an, um mir zu stecken, daß es bei unserer Lesung im Bremer Schlachthof am Mittwoch nächster Woche erbarmungslos rundgehen werde: »Torwandschießen, vollbesetzte Fankurve, VIP-Lounge mit integriertem Abendessen für einhundert Mark pro Nase und in der Halbzeit ’ne Live-Schaltung in unsere Kabine.« Und es kämen auch Fernsehreporter der Regionalsendereihe Buten un binnen. »Hab ich gerade alles von den Veranstaltern erfahren. Die wollen’s da krachen lassen wie beim Europacupfinale im Giuseppe-Meazza-Stadion …«
Ich erzählte Peter Knorr davon, und er sagte, daß man es als Buchautor früher leichter gehabt habe. »Da ist das Buch erschienen und fertig, aus. Aber ihr armen Schweine müßt heute tingeln gehen!«
Glücklicherweise ging ich ja nicht ungern tingeln.
Im Nachtjournal von RTL zeigte der Chefreporter Ulrich Klose sein ganzes Können, als er die Mutter eines dreijährigen Jungen interviewte, der ermordet worden war: »Was werden Sie tun, wenn der Täter gefaßt ist? Sagt Ihnen der Name Bachmeier etwas? Marianne Bachmeier, die sich für den Tod ihres Kindes gerächt und den Mörder erschossen hat? Könnten Sie sich vorstellen, so etwas auch zu tun?«
Die gepeinigte Mutter sagte schließlich, daß sie dazu bereit sei.
Klose faßte nach: »Bereit, Leute zu töten, die Ihr Kind getötet haben?«
»Auf jeden Fall«, sagte die Mutter, und der Leichenschänder Klose konnte sich freuen.
»Und wer schlägt dem jetzt die Zähne aus?« fragte Heribert.
Die Postgewerkschaft organisierte »flächendeckende Warnstreiks«, bei denen es allerdings bloß um höhere Sozialleistungen für die Postangestellten ging und nicht um den Kampf gegen die Privatisierung des Postbetriebs, von der ich mir nichts Gutes versprach. Und wie auf Bestellung gähnte mich mein leerer Briefkasten an.
Und wieder ein Anruf von Günther Willen: Ob ich schon gelesen hätte, was in der FAZ über unser Fußball-Lexikon stehe? »Hör zu: ›Das bisher reizvollste WM-Buch‹, schreiben sie da. Und die besten Einträge hätten den Biß von Henscheid und die Tiefe Netzers …«
Sehr nett, aber auch etwas übertrieben, gelinde gesagt.
Am Sonntag werde der französische Artist Philippe Petit auf einem dreihundert Meter langen Hochseil ungesichert von der Paulskirche zum Kaiserdom laufen, hatte Achim immer wieder gesagt, und das dürfe sich niemand entgehen lassen, doch am Samstagabend versumpfte ich im Club Voltaire, und wer wollte schon verkatert und unausgeschlafen um das Leben eines Hochseiltänzers zittern?
In einem Spiegel-Interview gab Donald Ducks Vater Carl Barks sich als Fan des Malers Norman Rockwell zu erkennen:
Ich habe sein Amerika geliebt. Es waren die besten Jahre, und ich durfte sie erleben.
Wenn dessen Bilder Carl Barks gefallen, müßten sie auch dir gefallen, sagte ich mir. Doch wie sollte ich da rankommen?
Das sogenannte Nachrichtenmagazin Focus erschien mit immer seichteren Titelgeschichten: »Risiko Büro-Flirt«, »Schöne Zähne – Das neue Statussymbol«, »Reisen ohne krank zu werden«, »Forschungsobjekt Liebe« …
Nicht einmal aufblättern mochte ich dieses primitive Presseorgan.
»Du gehörst eben nicht zur Info-Elite«, sagte Christian, und da hatte er recht.
Um endlich ungestört Atombomben bauen zu können, war Nordkorea aus der Internationalen Atomenergie-Organisation ausgetreten. Ein Zwergstaat auf Abwegen. Als ob dieses Land nun gerade Atomwaffen nötiger gebraucht hätte als Wasser und Brot! Wenn ich das nordkoreanische Volk gewesen wäre, hätte ich mich aufgebäumt und den Diktator Kim Jong-il entthront und zertreten, anstatt bei Militärparaden Transparente mit dessen Kotzfresse durch die Straßen von Pjöngjang zu tragen. Hätte es da nicht wenigstens mal eine Palastrevolte geben können? Nach einer 47jährigen Terrorherrschaft der pharaonischen Kim-Dynastie?
Am Vorabend unserer Lesung im Schlachthof fuhr ich Günther Willen in Oldenburg besuchen, und er nahm mich zu der Geburtstagsfeier eines Freundes mit, bei der Milch und Honig flossen. Am höchsten ging es in der Küche her. Eine indianisch aussehende Dame namens Maren, die dort eine Flasche Wodka verwaltete, wollte von mir alles über die Mahnwache vor der DFB-Zentrale wissen. Darüber gab ich gern Auskunft, und als die Flasche leer war, sagte Maren, daß sie daheim noch Nachschub habe und gewillt sei, ihn mit mir zu teilen. »Du kannst auch bei mir schlafen. Ich muß leider elend früh aufstehen, aber das kann dir ja wurscht sein. Wo haste ’n dein Gepäck?«
»Das steht in Günthers Wohnung.«
»Egal! Dann holste das da morgen irgendwann ab …«
Wir sollten uns am Mittwochnachmittag zusammentelefonieren, sagte ich zu Günther, der stutzte, und dann saß ich Glückspilz Hand in Hand mit Maren hinten in einem Taxi und sah die altvertrauten Straßenzüge an mir vorüberziehen. Theaterwall, Schloßwall, Paradewall … Drei Jahre lang hatte ich in Oldenburg gewohnt, vor langer Zeit, aber hatte ich mich in jenen Jahren jemals so beschwingt gefühlt?
Maren hielt Wort: In ihrer Wohnung pumpte sie uns mit noch mehr Wodka voll, und ich zerfloß in ihren Armen.
So sollte es ja auch sein, das süße Leben. Wozu war man denn sonst überhaupt auf die Welt gekommen?
»Aufstehen, Schlosser! Günther hat schon dreimal angerufen!« rief Maren und rüttelte mich aus dem Schlaf. »In einer Stunde geht euer Zug!«
Es war mir unklar, wo ich mich befand, aber als es mir aufging, sprang ich auf und eilte zur Dusche.
»Willst du Kaffee?« schrie Maren.
»Ja!« schrie ich zurück.
»Schwarz?« schrie sie.
»Nein, mit Milch!« schrie ich und starrte die fremde Armaturenleiste an. Mit der altbekannten Aufteilung in einen Warmwasser- und einen Kaltwasserhahn wäre ich spielend zurechtgekommen, und ich hatte auch schon Übung mit Mischhebeln, aber die Knäufe, Stöpsel und Zylinder in dieser Duschkabine gaben mir Rätsel auf.
»Mit Zucker?« schrie Maren.
»Nein, ohne!«
Ein kalter Wasserschauer überfiel mich, als ich an einem der Knäufe drehte, und als ich ihn in die Gegenrichtung drehte, wurde ich verbrüht wie ein Suppenhuhn.
In den Zug nach Bremen konnte ich in letzter Sekunde noch hineinspringen, und es freute mich sehr, daß ich darin Günther antraf und er mir meine Reisetasche aushändigte.
Zum erstenmal in meinem Leben wechselte ich dann in einem WC der Deutschen Bahn meine Unterwäsche. Es war ein Kunststück, den Kontakt mit den verkeimten Oberflächen dabei auf das hygienisch gebotene Minimum zu reduzieren. Und natürlich war der Seifenpulverspender leer.
Der Schlachthof hatte sich schon gut gefüllt, als wir dort eintrafen. Es dröhnten Gastrompeten, und mit Grausen sah ich auf der Bühne die Torwand stehen, vor der Günther und ich uns beweisen sollten.
Um zum Garderobenraum zu gelangen, mußten wir uns an einer jungen Frau vorbeischlängeln, die ein Stück Kunstrasen auf dem Bühnenboden auslegte. »Für euch machen wir doch alles!« rief sie uns zu und lachte.
Backstage suchten uns Reporter von Radio Bremen und vom Weser-Kurier auf und wollten wissen, was wir mit unserem Lexikon bezweckten, welche Erfolge wir uns für die deutsche Elf erhofften und welche Endspielpaarung uns die liebste wäre.
Unser Buch sei »ein Lexikon für die ganze Familie«, sagte Günther. Für die deutsche Mannschaft sehe er jedoch schwarz: »Wir machen Franz Beckenbauer dafür verantwortlich, daß der deutsche Fußball auf Defensive umgeschwenkt ist. Beckenbauer ist der Totengräber des offensiven Fußballs. Und was das Finale angeht, hoffen wir auf die Partie Kolumbien gegen Schweiz!«
Bei der Antwort auf die Frage nach unserer eigenen fußballerischen Laufbahn konnte Günther damit punkten, daß er einmal in die Niedersachsenauswahl berufen worden sei. Ich hingegen mußte eingestehen, daß ich es nur zu einem Stammplatz als eisenharter Verteidiger in der C- und in der B-Jugend des SV Meppen gebracht hatte. »Inzwischen hab ich mich aber freigespielt …«
Es war ein schöner Nervenkitzel, vor den vielen gastrompetenden Werder-Fans zu lesen. Im großen und ganzen verhielten sie sich wohlwollend, doch wenn die Stimmung in diesem kochenden Saal aus irgendeinem Grund gekippt wäre, hätten Günther und ich alt ausgesehen.
Sehr freundlich nahmen sie die Dias von der Mahnwache vor der DFB-Zentrale auf, und die Spannung stieg noch einmal, als wir nach der Lesung vor der Torwand antraten. Drei unten, drei oben …
Günter Netzer und Rudi Völler waren die ersten gewesen, die beim Torwandschießen im Aktuellen Sportstudio des ZDF fünfmal eingelocht hatten. Und wir?
In die Anfeuerungsrufe mischten sich von Mal zu Mal schrillere Pfeiftöne, als wir wieder und wieder danebenhauten. Kein einziger Treffer wollte uns gelingen, und nach dem letzten versemmelten Schuß schlichen wir wie geprügelte Hunde in die Kabine.
»Na, ich danke«, sagte Günther. »Jetzt weiß ich, wie Uli Stielike sich vor zwölf Jahren nach seinem verschossenen Elfer im WM-Halbfinalspiel gegen Frankreich gefühlt hat. Und das hab ich eigentlich nie so genau wissen wollen!«
Zum Glück kriegten wir Zuspruch von den Veranstaltern und von anderen Sportsfreunden, die uns zugehört hatten. Ich kam auch mit der Kunstrasenverlegerin ins Gespräch.
I could feel the heat and the pulse of her …
Sie hieß Beate, und es ergab sich so, daß ich ihr in ihre Wohnung folgte, wo sie als alleinerziehende Mutter erst einmal den Babysitter auszahlen und ihren vierjährigen Sohn in den Schlaf wiegen mußte, bevor wir uns einander zuwenden konnten.
In Beates Wohnung hielt sich auch eine Katzenfamilie auf. Ich hörte sie nachts miauen, und frühmorgens hörte ich, wie Beates Sohn mit einem Hammer einen Nagel in den Rahmen der offenstehenden Schlafzimmertür schlug, um uns zu wecken.
Weil ihn das Ergebnis nicht zufriedenstellte, zog mir der Sohnemann mit einem Schlüsselbund eins über die Rübe.
»Fabian, laß das«, sagte Beate im Halbschlaf, aber der Junge war nicht zu bremsen. Er schlug abermals zu, und da ging ich doch lieber mal duschen.
Es zeigte sich, daß einer von Beates Katern meinen linken Jackenärmel begattet hatte. Während sie und ihr Sohn frühstückten, wusch ich das Ejakulat ab, so gut es ging.
It was short, but it was so sweet
Nevertheless, maybe we’ll meet
Some other place, some other day, some other time …
Im Zug traf ich wieder mit Günther zusammen. Am Abend sollten wir in der Oldenburger Kulturetage aus unserem Lexikon lesen.
»Und zwar ohne Gastrompeten«, sagte er. »Wenn ich bei Lesungen irgendwas nie und nimmer vermissen werde, dann Gastrompeten. Oder geht’s dir da anders?«
Die Lesung in der Kulturetage verlief erwartungsgemäß friedlich.
Auch Maren war da. Diesmal könne sie mich leider nicht beherbergen, teilte sie mir mit. »Ein andermal gern wieder, obwohl du gestern nachmittag was total Unverschämtes zu mir gesagt hast …«
»Wieso? Was denn?«
»Weißt du das nicht mehr?« Sie lachte auf. »In der Zeit, in der du bei mir deinen Wodkarausch ausgeschlafen hast, hab ich acht Stunden lang geackert, und als ich wiedergekommen bin, hast du zu mir gesagt: ›Mach weiter!‹ Ist das etwa nicht unverschämt?«
Ich konnte mich zwar nicht daran erinnern, aber ich rechnete es Maren hoch an, daß sie mir verzieh.
Wegen des Poststreiks lagen laut Tagesschau vierzig Millionen Briefe auf Halde, aber in Frankfurt fand ich ein von meinem Rechtsanwalt weitergeleitetes Schreiben des Kieler Amtsgerichts vor, das festgestellt hatte, daß in der Zwangsvollstreckungssache zur Erlangung meiner offenen Honorarforderungen in Höhe von zwölftausend Mark von der Semmel-Zeitschriften-Verlags GmbH der Erlaß eines Haftbefehls abgelehnt werde, »weil bereits die Sequestration gegen den Schuldner nach § 106 KO im Verfahren angeordnet worden ist«.
Sequestration? In meinem Fremdwörterlexikon stand die Übersetzung »Zwangsverwaltung«. Aha. Und weil diese ominöse Zwangsverwaltung bereits angeordnet worden war, konnte mein Anwalt keinen Haftbefehl gegen den Mann erwirken, der mir zwölftausend Mark schuldete. Interessant!
Eine Umfrage der Zeitschrift Gala unter den deutschen Spielerfrauen habe ergeben, daß Lothar Matthäus »der erotischste Kicker« sei. Dies erfuhren wir von Christian im Horizont während der Übertragung des langweiligen WM-Eröffnungsspiels zwischen Deutschland und Bolivien.
Wenn er noch ein einziges Mal das Wort »Spielerfrau« höre, könne er für nichts garantieren, sagte Achim. »Ich bin ein Feminist der ersten Stunde und hab schon zu einer Zeit, als sich das noch kein anderer deutscher Mann getraut hat, sowohl mit Clara Zetkin als auch mit den britischen Blaustrümpfen fraternisiert. Aber diese Spielerfrauen sollen gefälligst die Klappe halten! Die gehören zurück an den Herd!«
In der zweiten Halbzeit tappten die Bolivianer in ihre eigene Abseitsfalle, und Jürgen Klinsmann schoß das Siegtor.
Eröffnet werden sollte am Tag darauf auch die König Fußball gewidmete Ausstellung »Satanische Fersen« im Kasseler Kulturhaus Dock 4, die Achim Frenz und Andreas Sandmann organisiert hatten. Drei Stunden vorher wurde auf dem A-Platz der Kasseler Sportanlage Waldauer Wiesen aus diesem Anlaß ein Fußballspiel zwischen einem Old-Star-Team des Amateurvereins Dynamo Windrad und einer sogenannten Prominenten-Elf angepfiffen, für die nicht nur Joschka Fischer und die ehemaligen Bundesligaspieler Holger Brück und Thomas Rohrbach nominiert worden waren, sondern auch Bernd Müllender von der taz, der Kabarettist Bernd Gieseking und der Titanic-Autor Albert Hefele und außerdem Achim Greser, Heribert Lenz, Thomas Gsella und ich sowie eine Frau namens Doreen Meier, die einst in der Damenfußballnationalmannschaft der DDR gespielt hatte, und noch einige andere Gestalten, die ich nicht kannte.
Bei der Ausgabe der Trikots hatte Achim sich in der Herrenumkleide erfreut über den strengen Schweißgeruch unserer männlichen Mitspieler geäußert: »Aaah – daß ich das noch einmal schnuppern darf! Dieses kernige Aroma!«
Ich positionierte mich im linken Mittelfeld hinter dem Linksaußen Rohrbach. Fischer trat als Mittelstürmer an. Er trug die 9, Doreen Meier die 10 und ich die 8.
Die ersten Angriffswellen liefen gut, doch sie brachten nichts ein. Doreen Meier tanzte die gegnerischen Abwehrreihen aus, und als der Ball sich zu mir verirrte, legte ich Rohrbach an der Strafraumgrenze einen Paß vor, den er aber nicht verwandeln konnte.