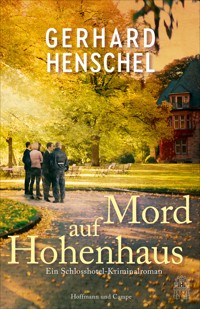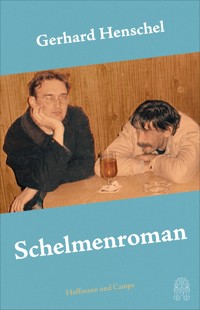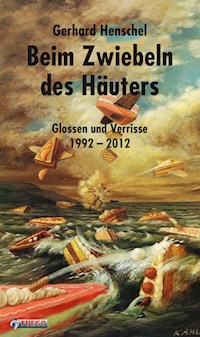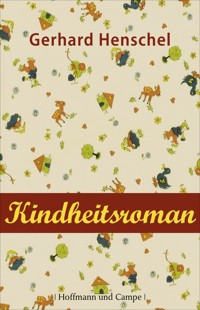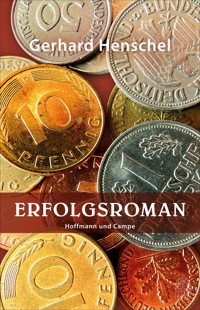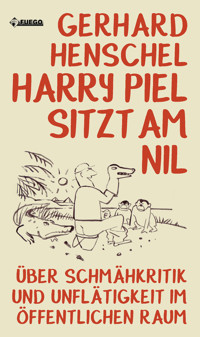
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fuego
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Ein Deutschrapper brüstet sich damit, dass er auf Bettler pisse und "mehr Teenies weggeknallt" habe als Anders Breivik, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bescheinigt ein Komiker dem türkischen Präsidenten, dass er Ziegen ficke und dass sein "Gelöt" nach Döner stinke, auf RTL wirft der Juror eines Talentwettbewerbs regelmäßig mit Fäkalausdrücken um sich, und unter freiem Himmel kommen einem Menschen in T-Shirts entgegen, auf denen Sachen stehen wie "Stöcke aus dem Arsch - Wir machen Lagerfeuer", "Dicke Männer ficken besser" oder "Wer bläst, wird auch geleckt!" Wo hört er auf, der Spaß? Was darf die Satire? Was sollte sie lieber lassen? Wo verlaufen inzwischen die Grenzen des schlechten Geschmacks? Weshalb ist Robert Gernhardts Kragenbär, der sich munter einen nach dem andern runterholt, im Gegensatz zum Latrinenhumor der Comedians nicht obszön, sondern schön? Gerhard Henschel geht in seinem Buch auf alte und neue Skandale ein, auf quotensteigernde Zoten, ordinäre Gemeinheiten und wahrhaft große Werke der schweinischen Kunst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Gerhard Henschel
Harry Piel sitzt am Nil
Über Schmähkritik und Unflätigkeit im öffentlichen Raum
FUEGO
- Über dieses Buch -
Ein Deutschrapper brüstet sich damit, dass er auf Bettler pisse und »mehr Teenies weggeknallt« habe als Anders Breivik, auf RTL wirft der Juror eines Talentwettbewerbs regelmäSSig mit FäkalausdrÜcken um sich, und unter freiem Himmel kommen einem Menschen in T-Shirts entgegen, auf denen Sachen stehen wie »Dicke Männer ficken besser« oder »Wer bläst, wird auch geleckt!«
Wo hört er auf, der Spaß? Was darf die Satire? Was sollte sie lieber lassen? Wo verlaufen inzwischen die Grenzen des schlechten Geschmacks? Weshalb ist Robert Gernhardts Kragenbär, der sich munter einen nach dem andern runterholt, im Gegensatz zum Latrinenhumor der Comedians nicht obszön, sondern schön?
Gerhard Henschel geht in seinem Buch auf alte und neue Skandale ein, auf quotensteigernde Zoten, ordinäre Gemeinheiten und wahrhaft große Werke der schweinischen Kunst.
Seiner Polemik gegen den türkischen Präsidenten Recep Erdoğan schickte der Komiker Jan Böhmermann in seiner ZDF-Sendung Neo Magazin Royale eine distanzierende Bemerkung voraus: »Was jetzt kommt, das darf man nicht machen.« Und dann unterstellte er ihm in gereimter Form, daß er übel rieche, Mädchen schlage, geschlechtlich mit Ziegen verkehre, Kinderpornos schaue, eine »dumme Sau« mit »Schrumpelklöten« sei und zudem »schwul, pervers, verlaust und zoophil«, und daß er an Gangbangpartys teilnehme, »bis der Schwanz beim Pinkeln brennt«. Böhmermanns Annahme, er sei durch die vorangestellte Distanzierungsformel vor straf- und zivilrechtlichen Konsequenzen seiner beleidigenden Worte geschützt, zeugt von einer fast kindlichen Naivität. Wenn es so einfach wäre, könnte sich in ähnlich gelagerten Fällen jedermann auf diese Weise einen rechtsfreien Raum verschaffen.
Dem türkischen Präsidenten, der bereits auf milden Spott mimosenhaft empfindlich zu reagieren pflegt, hat Böhmermann leichtfertigerweise einen Trumpf in die Hand gespielt. Satirikern bietet Erdoğan viele Angriffsflächen, doch es gab keinen Grund für einen Schlag unter die Gürtellinie. Das ZDF hat den Beitrag schamhaft aus der Mediathek entfernt, und während nun die Köpfe der involvierten Juristen und Politiker rauchen, mehren sich die Solidaritätsadressen aus Böhmermanns Kollegenkreisen. Oliver Welke von der heute-show erkennt in dem Gedicht ein Experiment der Selbsterfahrung (»Ich kann mir vorstellen, daß Böhmermann seine Grenzen ausloten wollte. Das ist legitim«), der Komiker Dieter Hallervorden singt, daß Erdoğan ein Terrorist sei, »der auf freien Geist nur scheißt«, der Kabarettist Wolfgang Krebs teilt mit, er stehe »voll auf der Seite Böhmermanns« (»Lachen über Satire ist Katharsis, ein reinigender Prozess«), und auch Mathias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende des Springerkonzerns, hat in einem offenen Brief erklärt, daß er die Schmähkritik für »gelungen« halte (»Ein Kunstwerk. Wie jede große Satire«). Er habe »laut gelacht«.
Ob er das auch getan hätte, wenn er selbst das Ziel des Angriffs gewesen wäre? »Sein Gelöt stinkt schlimm nach Döner, / selbst ein Schweinefurz riecht schöner« – es ist ein weitgefasster Kunstbegriff, mit dem Döpfner hier operiert, wenn er solchen Versen den Rang einer großen Satire zuspricht. Die Tendenz und das Bauprinzip gehen auf Reimgebilde zurück, die der Kindermund schon vor Jahrzehnten geprägt hat: »Harry Piel sitzt am Nil, / wäscht sein’ Stiel mit Persil.« Der Schauspieler Harry Piel mußte allerdings nicht damit rechnen, in einer öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt in dieser Form angegangen zu werden.
In den sechziger Jahren waren Kraftausdrücke im Fernsehen noch tabu, und nicht nur hierzulande: In seiner Autobiographie »Wo war ich noch mal?« hat der große britische Komiker John Cleese geschildert, wie in der BBC bei der Produktion der Folgen von Monty Python’s Flying Circus um jedes »damn« und »bloody« und »bastard« gerungen wurde. Ihm selbst hätten die Streichungen jedoch nichts ausgemacht, schreibt er, denn er habe Kraftausdrücke im allgemeinen nicht gemocht: »Flüche auf der Bühne sind Schummelei, weil es einfach eine saufaule Methode ist, Lacher aus einem Text rauszuholen, der nicht komisch genug für einen Lacher ist. Doch allmählich gingen mit den allgemeinen Normen auch die meinen den Bach runter. Den besten Rat, den ich je in diesem Zusammenhang bekam, erteilte mir Richard Attenborough Anfang der Siebzigerjahre: ›Verwende Anstößiges sparsam.‹ Also gestattete ich mir hie und da mal ein fucking, vielleicht vier in einer Zweistundenshow. Doch im tiefsten Inneren war ich nach wie vor überzeugt, dass wirklich gute Comedy nicht auf künstliche Stimulanzien bauen muss.«
Im bundesrepublikanischen Fernsehen hielten derbere Töne Einzug, als 1973 Wolfgang Menges vom WDR produzierte Serie »Ein Herz und eine Seele« auf Sendung ging, mit der Kunstfigur Alfred Tetzlaff in der Hauptrolle, einem unentwegt schimpfenden Kleinbürger, der seine Frau als »dusselige Kuh« und »blöde Gans« abkanzelte, gelegentlich auch »Scheiße« und »Arschloch« sagte und immer wieder mit seinem ungeliebten Schwiegersohn aneinandergeriet: »Aber das kann ich dir sagen, du langhaarige bolschewistische Hyäne, bevor ich abkratze und dir auch nur einen Furz hinterlasse, schmeiß ich ’ne Bombe und jag die ganze Bude in die Luft!« So etwas hatte es noch nicht gegeben. Die Serie erfreute sich großer Beliebtheit, doch es gab auch Bedenken gegen diese Mischung aus realistischer Vulgarität und spaßhafter Überzeichnung eines nie zuvor in seiner komischen und grotesken Schäbigkeit gezeigten Milieus. Der Kritiker Walter Jens urteilte 1974 in der Zeit, daß es sich um eine »Popo- und Busen- und Pinkelklamotte« handele, über die er nicht lachen könne.
Er machte es sich damit sehr leicht. Ihm genügte der nicht näher definierte Begriff »Pinkelklamotte«, um eine Serie abzutun, die für Millionen Fernsehzuschauer einen Lichtblick bildete, nachdem man sie viele Jahre lang mit zahnlosen Lustspielen, seichten Quizsendungen und Sissi-Filmen abgespeist hatte. Es war höchste Zeit für eine wahrheitsgetreuere Abbildung der Wirklichkeit. Dem damals noch immer ermittelnden Fernsehkommissar Herbert Keller wäre niemals das Wort »Scheiße« über die Lippen gekommen; das besorgte erst sein Erbe Horst Schimanski, ab 1981, und dann brachen alle Dämme, als die Privatsender die Fernsehlandschaft umpflügten und sämtliche bis dahin bekannten Grenzen des guten Geschmacks überrannten.
Nun schwappten zum Telefonsex animierende Brüste auf den Bildschirm, die Mitglieder einer Band namens Die Doofen hielten sich Klobürsten vor den Mund und sangen »Nimm mich jetzt, auch wenn ich stinke«, und es begann der Aufstieg der Comedians, die sich von Jahr zu Jahr kühner gebärdeten und die Punchlines, die man vornehmlich von der Toilettenwand gekannt hatte, ungefiltert in die Öffentlichkeit trugen.
2001 verhöhnte Stefan Raab in seiner Sendung TV total auf ProSieben ein sechzehnjähriges Mädchen, das sich bei einer Schönheitskonkurrenz beworben hatte: »Ja, die Lisa Loch, meine Damen und Herren! Man muß doch heute nicht Lisa Loch heißen! So was kann man doch heute notariell ändern lassen, zum Beispiel Lotti Loch, oder vielleicht war Lisa Loch ihr Künstlername, und die heißt nämlich Petra Pussy.« In seiner Sendung führte er dann das Wahlplakat einer fiktiven »Lisa-Loch-Partei« vor, auf dem ein kopulierendes Paar zu sehen war. Für diese Schandtat mußten Raab und ProSieben 70.000 € Schmerzensgeld zahlen, aber unendlich viele Aussprüche ähnlicher Art sind fröhlich belacht worden, im Ozean der Gemeinheit versunken und ungesühnt geblieben. In seiner Late-Night-Show zeigte der Entertainer Harald Schmidt dem Publikum einmal eine Aufnahme der erfrorenen Füße eines Bergsteigers und knüpfte daran den launigen Kommentar, daß dieses Bild Paul McCartney sexuell erregen müsse. Wobei der Witz darin bestand, daß McCartney mit einer beinamputierten Frau verheiratet war.
Auf diesem Niveau bewegt sich seit 2002 auch die von RTL ausgestrahlte Sendung Deutschland sucht den Superstar, die ihre Popularität großenteils der Schadenfreude des Publikums an der Beschimpfung untalentierter Kandidaten verdankt. »Ein Kritiker läßt vor einer Million Menschen drucken, was er nicht einem einzigen anständigen Menschen ins Gesicht sagen dürfte« – diese dem Dirigenten Hans von Bülow im späten 19. Jahrhundert zugeschriebenen Worte sind überholt, seit der Schlagersänger Dieter Bohlen sich als DSDS-Juror betätigt. Koprolalie ist geradezu sein Markenzeichen. »Du kneifst die Augen zusammen wie ich beim Kacken«, sagt er seinen Opfern ins Gesicht. Oder auch: »Klopups-Imitator – da hast du genau die richtige Stimme für. Weißt du, wenn du auf dem Klo sitzt und neben dir sitzt ein anderer, und du singst und der furzt, dann denkt ihr beide, ihr singt im Duett.«
Im Duett singt Bohlen seinerseits mit der Bild-Zeitung: Den Fernsehstar und das Massenblatt verbindet eine für beide Seiten einträgliche Beziehung, und zwar durchaus auf Augenhöhe, was das Vokabular betrifft. In einem Werbeclip, der die Wahrheitsliebe der Redaktion illustrieren sollte, ist eine Frau zu sehen gewesen, die zunächst einen Mann im Schlafzimmer umgarnt und sich dann mit dem Satz verabschiedet: »Ich geh nur kurz kacken.« Gang und gäbe sind auch die als »Po-Blitzer« und »Busen-Blitzer« verbreiteten Schnappschüsse prominenter Frauen, denen die Kleidung verrutscht ist, und wenn irgendjemandem, und sei es am anderen Ende des Erdballs, das Mißgeschick widerfährt, sich in einer Fernsehsendung übergeben zu müssen, findet sich das Beweisbild unweigerlich in der Bild-Zeitung wieder – »die Rotzbüberei ist ein publizistisches Amt geworden«, hatte Karl Kraus bereits 1925 festgestellt, ohne ahnen zu können, daß in unseren Tagen selbst Erbrochenes als Nachrichtenware gehandelt wird.
2009 warb der Rapper Sido für Bild mit den bundesweit plakatierten Worten: »Danke für die Titt’n.« Es ist fraglich, wie Eltern ihren Kindern noch Manieren beibringen sollen, wenn der öffentliche Raum ein Tummelplatz von Rüpeln ist, denen ihr Maulheldentum Ruhm und Reichtum beschert. Auch im Rap wird uneigentlich gesprochen, was aber nichts daran ändert, daß es sich um die Sprache krimineller Dreckflegel handelt. Der Rapper Fler tut in seinen Darbietungen gern kund, worauf und auf wen er pisse und scheiße und was er unter einem gelungenen Abend verstehe (»Ich spritz deine Bitch voll«), und der Rapper Kollegah kokettiert mit Vergewaltigungsdrohungen (»Ich ficke deine Hurenmutter quer durch ihr Wohnzimmer«), während der Rapper Julien Sewering sein eher pragmatisches Verhältnis zum anderen Geschlecht betont (»Frauen sind wie Toiletten, sie werden benutzt, wenn ich muß / Zieh’ den Schlüpfer zur Seite und fick, Tanga-Technik / Ich hab’ mehr Teenies weggeknallt als Anders Breivik / Piss’ auf die Penner, dann box’ ich die Weiber«), so daß der Rapper Farid Bang im Konkurrenzkampf seine liebe Not damit hat, sich als den noch rüderen Malefizbuben zu präsentieren. Beholfen hat er sich mit der Selbstbezeichnung »Fotzenschläger« und verbalen Muskelspielen, in denen er die Größe seines Gemächtes hervorhebt und Massaker ankündigt.
All das gehört zum kulturellen Hintergrundrauschen, vor dem jetzt die Debatte über Böhmermanns Schmähkritik geführt wird. »Kunst kann nicht in einem Klima stattfinden, in dem sich Künstlerinnen und Künstler Gedanken darüber machen müssen, ob ihr Schaffen zur Strafanzeige führt«, heißt es in einem »Solidaritätsaufruf« an die »Liebe Regierung«, den zahlreiche deutsche Kabarettisten und Publizisten unterzeichnet und in der Zeit veröffentlicht haben. Doch was wäre so schlimm daran, wenn Künstlerinnen und Künstler sich Gedanken darüber machten, ob ihr Schaffen zu einer Strafanzeige führen könnte? Sollte das nicht jeder tun, der etwas schafft?
Nachdem Julien Sewering den 1,3 Millionen Abonnenten seines YouTube-Blogs im Mai 2015 mitgeteilt hatte, daß die streikenden Lokführer »Mistviecher« seien, die man in Auschwitz vergasen solle, versuchte er sich vor Gericht damit herauszureden, er habe es »witzig gemeint«. Aus gutem Grund sind die Alben des einen oder anderen Rappers indiziert worden, und auch ein Satiriker muß sich an die geltenden Gesetze halten und so wie jeder andere Bürger damit leben, daß er angezeigt werden kann. Wer Grenzen ausloten will, der sollte nicht schockiert tun, wenn er sie entdeckt. Um die Entlassung in die reine Narrenfreiheit können nur Narren bitten.
Auf einen groben Klotz gehört selbstverständlich auch in Zukunft ein grober Keil, und auch die Fäkalsprache ist und bleibt literaturfähig. Wie man sie auf die höchste Kunstebene befördern kann, hat der Kabarettist Gerhard Polt in einem unsterblichen Rollenmonolog vorgeführt, in dem sich ein vermeintlich gesitteter Tennisfan immer stärker über das ungehobelte Gebaren einer Frau am Spielfeldrand erregt und sich allmählich in einen Raptus hineinsteigert, der in den unflätigsten Beschimpfungen gipfelt: »Sie dumme Gans! Ja? Mia san da doch ned im Wirtshaus! Sondern auf einem Tennisplatz! Du Amsel, du bleede! Du bleedes Kracherl, sog i, du Matz, du verreckte! Hoid dei Fotzn, sog i, du Schoaßwiesn! Gell? Du mistige, sog i, du Schoaßblodern! Gell? Du Brunzkachel, du ogsoachte! So wos wie du g’hert doch mit da Scheißbiaschtn nausg’haut!«
Es liegen Welten zwischen diesem Sprachkunstwerk und Jan Böhmermanns Zoten. Aber erkennt überhaupt noch jemand den Unterschied, nachdem wir dreißig Jahre lang mit Zoten zugetextet worden sind?
*
Als der voranstehende Text – leicht gekürzt – am 17. April 2016 in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erschienen war, erhielt ich freundlichen Zuspruch von so konträren Geistern wie dem Kabarettisten Matthias Deutschmann und dem einstigen FAZ-Herausgeber Johann Georg Reißmüller. Der ehemalige Titanic-Chefredakteur Leo Fischer erklärte mich hingegen für verrückt und wies mich darauf hin, daß der Bild-Herausgeber Kai Diekmann getwittert habe: »Ausgerechnet Fäkal-Experte Gerhard Henschel zeigt Zoten-König @janboehm den moralischen Zeigefinger« – eine Stellungnahme, die Diekmann mit drei gackernden Smileys garniert hatte.
Es bleibt nicht aus, daß man zum »Fäkal-Experten« wird, wenn man sich mit Diekmann auseinandersetzt, so wie ich es hin und wieder getan habe, doch es spielt keine Rolle, wie niedrig er von jemandem denkt, der sich mit ihm befaßt. Es ist nicht ehrenrührig, in Diekmanns Augen ein »Fäkal-Experte« zu sein. Übel wäre es nur, von ihm als »Zoten-König« gefeiert zu werden.
Es gab einmal einen ähnlichen Fall, und da war schon alles Nötige gesagt worden. 1994, als Kai Diekmanns Mann fürs Grobe, der Klatschkolumnist Franz Josef Wagner, noch die Illustrierte Bunte redigierte, warf er Harry Rowohlt »Geschmacklosigkeit« vor und bezeichnete ihn als einen Menschen »von gestern«. Dafür bedankte sich Rowohlt in einem Brief an Wagner:
Wenn einem ausgerechnet in der »Bunten« eine Geschmacklosigkeit nachgewiesen wird, dann ist das schmeichelhaft.
Wenn man von einem ausgebrannten, kurz vor der endgültigen Abhalfterung stehenden Flippi als Mensch »von gestern« bezeichnet wird, merkt man: Hier spricht der Fachmann.
Wenn man Sätze schreibt, bei deren Lektüre ein Halb-Analphabet ins Schleudern kommt, ist das zwar normal, man denkt sich aber doch: Vielleicht sollte er bei Schumann’s auch mal Bier trinken und nicht immer nur so harte Sachen.
*
In einem anderen Fachorgan für Anstandsfragen, Bild am Sonntag, nahm die evangelische Theologin Margot Käßmann zu der Affäre Stellung: Böhmermanns Gedicht sei keine »große Poesie«, aber »Personen, die im Licht der Öffentlichkeit stehen, müssen so etwas aushalten heutzutage«.
Warum? Weshalb sollte sich eine Person des öffentlichen Lebens nicht juristisch gegen die Unterstellung wehren dürfen, daß sie »Schrumpelklöten« habe, »verlaust« sei und Sodomie betreibe? Nur weil solche Töne im Überbietungswettbewerb der Comedians heutzutage üblich sind?
In der FAS vertrat der Jurist Volker Rieble die Gegenposition: »Sosehr man den türkischen Staatspräsidenten oder den Menschen Erdoğan kritisieren mag – vogelfrei ist er nicht.« Deshalb sei es unzulässig, Böhmermann eine künstlerische Immunität zuzubilligen:
Der Bürger B. mag sich für sein Handeln verantworten, in einem geordneten rechtsstaatlichen Verfahren. Ihm jede Verantwortung abzunehmen ächtet nicht bloß das Opfer; das negierte die Eigenverantwortung als erwachsener Mensch, das Ernstnehmen im Guten wie im Bösen. B. würde so behandelt wie ein strafunmündiges Kind, das brabbeln kann, was es mag, und keinen Staatsanwalt fürchten muss.
In der Not, in die er sich selbst gebracht hatte, wandte Böhmermann sich an den Kanzleramtsminister Peter Altmaier und ließ ihn wissen: »Ich möchte gerne in einem Land leben, in dem das Erkunden der Grenze der Satire erlaubt, gewünscht und Gegenstand einer zivilgesellschaftlichen Debatte sein kann.« Und er bat erstaunlich weinerlich um die »Berücksichtigung meines künstlerischen Ansatzes«. Doch der Kanzleramtsminister enthielt sich der Antwort auf die Frage, ob Böhmermann mit seinem künstlerischen Ansatz bei Schweinefürzen und Schrumpelklöten die Grenze der Satire nicht nur »erkundet«, sondern erreicht oder überschritten habe.
Dem Strafverlangen, das Erdoğan und die türkische Regierung gestellt hatten, gab die deutsche Bundesregierung statt und ermächtigte die Staatsanwaltschaft Mainz zur Strafverfolgung. Diese Entscheidung trug der Bundeskanzlerin Angela Merkel sogar den Spott US-amerikanischer Komiker ein: Wie könne sie es zulassen, daß Staatsanwälte wegen eines Gedichtes ermittelten? »Komisch nur«, schrieb Reinhard Müller am 22. April 2016 in der FAZ, »dass dieses Werk im amerikanischen Fernsehen nicht gezeigt wurde und wohl auch kaum verlesen werden dürfte in jenem Land, das so frei ist, dass jedes F-Wort im Fernsehen mit einem Piep übertönt wird.«
Am 4. Mai äußerte sich Böhmermann in einem Gespräch mit der Zeit zu den Vorgängen. »Mein Team und ich wollen den Humorstandort Deutschland nach vorne ficken«, teilte er dort mit. »Und wenn Sie noch einmal ausschließlich nach dem dekontextualisierten Gedicht fragen, poliere ich Ihnen die Fresse, Sie Kackwurst!« Er war es seit langem gewohnt, für solche Sprüche Applaus zu bekommen. Der Komikerin Carolin Kekebus hatte er in seiner Sendung einmal scheinbar aufgebracht hinterhergerufen: »Scheißfutt!« Und: »Fick dich doch selber, du dumme Futt, ey!« Schwer zu sagen, welche unbekannten Grenzen er mit diesem künstlerischen Ansatz fernerhin erkunden oder ausloten könnte. Ist er nicht bereits ganz unten angekommen?
*
Man sollte nicht dem Trugschluß erliegen, daß früher, als die Hände noch über der Bettdecke gefaltet wurden, alles besser gewesen wäre. Schlimme und zum Teil auch erheiternde Dinge fördert bereits ein kleiner, unsystematischer Streifzug durch die quecksilbrige Geschichte der Schmähkritik und der Unflätigkeit im öffentlichen Raum zutage.
Im Jahre 1049 wetterte der Benediktinermönch Petrus Damiani in seinem »Liber Gomorrhianus« gegen Priester, die eine Frau nahmen (er nannte sie »Schweine des Epikur«), gegen Priester, die ihr Amt niederlegten, um zu heiraten (»Mag daher ein Kleriker den ehrwürdigen Altären den Scheidebrief geben, um frei, wie ein Springhengst gierig sich in die Wollust zu stürzen – dem Fluche Gottes wird er nicht entrinnen«), und besonders gegen die Frauen von Priestern:
Ihr Schätzchen der Kleriker, ihr Lockspeise des Satans, ihr Auswurf des Paradieses, ihr Gift der Geister, Schwert der Seelen, Wolfsmilch für die Trinkenden, Gift für die Essenden, Quelle der Sünde, Anlaß des Verderbens, Euch rede ich an, ihr Lusthäuser des alten Feindes, ihr Wiedehopfe, Eulen, Nachtkäuze, Wölfinnen, Blutegel, die ohne Unterlaß nach mehreren gelüstet. Kommt also und höret mich, ihr Metzen, Buhlerinnen, Lustdirnen, ihr Mistpfützen fetter Schweine, ihr Ruhepolster unreiner Geister, ihr Nymphen, Sirenen, Hexen, Dianen und was es sonst für Scheusalsnamen geben mag, die man Euch beilegen möchte. Ihr seid Speise des Satans, zur Flamme des ewigen Todes bestimmt. An Euch weidet sich der Teufel, wie an ausgesuchten Mahlzeiten, und mästet sich an der Fülle Eurer Üppigkeit.
Das tat auch Petrus Damiani selbst, auf seine Weise, in Worten voller Leidenschaft, nur leider keiner reinen: Da er sich die Begegnung mit den »Lusthäusern« und »Mistpfützen« versagen mußte, genoß er wenigstens ihre wortreiche Verdammung. »Damiani muß ein komischer Kauz gewesen sein, und um seinen Reichthum an Schimpfwörtern würde ihn manches Königsberger Fischweib beneiden«, schrieb der kirchenfeindliche Schriftsteller Otto von Corvin 1845. Interessanterweise ist die Koprolalie, also die krankhafte Neigung zum Gebrauch obszöner Wörter, häufig geradezu das Kennzeichen derer, die durch andere den Anstand und das Schamgefühl verletzt sehen.
Unschuldiger, wenn auch nicht erbaulicher wirken die Grobheiten in mittelalterlichen Fastnachtsspielen. »Secht, ich pin gar nacket und zurissen / Und ganz in ars besaicht und beschissen« – Philologen haben Tausende solcher Verse zusammengetragen und überliefert. Wenn an ihnen einmal etwas Komisches gewesen sein sollte, hat es sich verflüchtigt. Sie atmen den gleichen Geist wie die moderne Pissoirpoesie, der sich nur selten zu höheren Leistungen aufschwingt.
*
In Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausens Roman »Der Abentheuerliche Simplicissmus Teutsch«, der 1668 erschien, spielen Darmwinde eine nicht unerhebliche Rolle. Dem einfältigen Helden Simplicius entfährt in kultivierter Gesellschaft versehentlich »ein solcher grausamer Leibs=Dunst / daß beydes ich und der Secretarius darüber erschracken; dieser meldet sich augenblicklich so wol in unsern Nasen / als in der gantzen Schreibstuben so kräfftig an / gleichsam als wenn man ihn zuvor nicht genug gehöret hätte: Troll dich du Sau / sagt der Secretarius zu mir / zu andern Säuen im Stall / mit denen du Rülp besser zustimmen / als mit ehrlichen Leuten conversiren kanst; er muste aber so wol als ich den Ort räumen / und dem greulichen Gestanck den Platz allein lassen«. Simplicius läßt sich dann weismachen, daß es ein Geheimrezept zur Unterdrückung von Fürzen gebe – »du darffst nur das linke Bein auffheben / wie ein Hund der an ein Eck bruntzt / darneben heimlich sagen: Je pete, Je pete, Je pete, und mithin so starck gedruckt / als du kanst / so spatzieren sie so stillschweigends dahin / als wann sie gestolen hätten.«
Wenig später soll er bei einem großen Essen aufwarten und sieht sich genötigt, den erlernten Kunstgriff anzuwenden:
Als aber der ungeheure Gespan / der zum Hindern hinauß wischete / wider mein Verhoffen so greulich thönete / wuste ich vor Schrecken nit mehr was ich thäte / mir wurde einsmals so bang / als wenn ich auff der Läiter am Galgen gestanden wäre / und mir der Hencker bereits den Strick hätte anlegen wollen / und in solcher gählingen Angst so verwirret / daß ich auch meinen eigenen Gliedern nicht mehr befehlen konte / massen mein Maul in diesem urplötzlichen Lermen auch rebellisch wurde / und dem Hindern nichts bevor geben / noch gestatten wolte / daß er allein das Wort haben / es aber / das zum reden und schreyen erschaffen / seine reden heimlich brumlen solte / derowegen liesse solches das jenige / so ich heimlich zu reden im Sinn hatte / dem Hindern zu Trutz überlaut hören / und zwar so schröcklich / als wann man mir die Kehl hätte abstechen wollen: Je greulicher der Unterwind knallete / je grausamer das Je pete oben herauß fuhr / gleichsam als ob meines Magens Ein- und Außgang einen Wettstreit miteinander gehalten hätten / welcher unter ihnen beyden die schröcklichste Stimm von sich zu donnern vermöchte.
Zur Strafe wird Simplicius verprügelt, und man bemüht sich, die üblen Folgen seines Ungeschicks zu minimieren – »da brachte man Rauch-täfelein und Kertzen / und die Gäst suchten ihre Bisemknöpff und Balsambüchslein / auch so gar ihren Schnupfftoback hervor / aber die beste arommata wolten schier nichts erklecken«.
Es kommt nicht oft vor, daß eine so leicht verderbliche Ware wie das Komische – und zumal das Derbkomische – sich über weit mehr als dreihundert Jahre hält, aber Grimmelshausen ist es gelungen, so etwas zu erschaffen. Vielleicht liegt es an der Einbettung des Derben in kunstvoll gedrechselte Satzperioden und auch daran, daß nicht überall der Latrinenhumor aufdringlich durchscheint, so wie in Jonathan Swifts Satire »The Benefit of Farting explained« von 1722, die sich bereits in der Autorenangabe »Don Fart-In-Hand-O Puff-En-Dorff« und der Widmung (»Dedicated to a Lady of Dis-stink-tion, with Notes by Nicholas Nincom-poop«) als wenig ansprechende Witzelei zu erkennen gibt.
*
Freunde, helft, mich zu befreien!
Galle, Gift und Kot zu speien
Ist mein Privilegium.
Possen, Schweinereien, Zoten,
Alles das wird mir geboten,
Saust mir um den Kopf herum.
Der junge Goethe, von dem diese Verse stammen, trug gern dick auf und beugte sich nur widerstrebend der Notwendigkeit, seine Werke zu entschärfen. »Mußt alle garst’gen Wörter lindern, / Aus Scheißkerl Schurken, aus Arsch mach Hintern«, klagte er 1774, ohne zu ahnen, daß auch diese Worte ihren Zensor finden sollten. In Heinrich Dörings Sammelband »Göthe in Frankfurt am Main« von 1839 lauten sie: »Mußt alle die garstigen Wörter lindern, / Aus Sch–kerl Schurk, aus A– mach Hintern«, und in einer Fußnote heißt es dort: »Diese Ausdrücke finden sich nur in der ersten Ausgabe des Götz von Berlichingen, Hamburg 1773; in den spätern Editionen sind sie weggelassen oder gemildert worden.« Wobei man sich natürlich fragt, was an den Ausdrucken »Sch–kerl« und »A–« milderungsbedürftig gewesen sein soll.
Im Eröffnungsmonolog der Kilian Brustfleck parodierte Goethe sich in seiner Farce »Hanswursts Hochzeit« 1775 selbst:
Hab ich endlich mit allem Fleiß
Manchem moralisch politischem Schweiß
Meinen Mündel Hanswurst erzogen
Und ihn ziemlich zurechtgebogen.
Zwar seine tölpisch schlüfliche Art
So wenig als seinen kohlschwarzen Bart
Seine Lust in den Weg zu scheißen
Hab nicht können aus der Wurzel reißen.
Was ich nun nicht all kunnt bemeistern
Das wüßt ich weise zu überkleistern
Hab ihn gelehrt nach Pflichtgrundsätzen
Ein paar Stunden hintereinander schwätzen
Indes er sich am Arsche reibt
Und Wurstel immer Wurstel bleibt.
Zu den Figuren, die er in dem Fragment gebliebenen Stück auftreten lassen wollte, gehören u. a. »Hans Arsch von Rippach«, »Reckärschgen«, »Schnuckfötzgen«, »Peter Sauschwanz«, »Hosenscheißer«, »Leckarsch«, »Spritzbüchse«, »Fotzenhut«, »Matzpumpes genannt Kuhfladen«, »Heularsch«, »Hans Schiß« und »Nonnenfürzgen«. »Es waren alle erdenklichen Schimpfnamen, mitunter von der derbsten lustigsten Sorte, so daß man nicht aus dem Lachen kam«, notierte Johann Peter Eckermann 1831, nachdem Goethe ihm dieses Jugendwerk vorgelesen hatte. Aber kann es wirklich so lustig gewesen sein, den alten Geheimrat Namen wie »Fotzenhut« und »Heularsch« aussprechen zu hören? Waren die Herren vielleicht etwas angenattert?
Arno Schmidt erkannte in »Hanswursts Hochzeit« nur »säuische Lappalien, nicht wert der Druckerschwärze«, und laut Eckermann hatte Goethe selbst irgendwann das Vergnügen an solchen Lustbarkeiten verloren: »Es war nicht zu denken, daß ich das Stück hätte fertig machen können, sagte Goethe, indem es einen Gipfel von Muthwillen voraussetzte, der mich wohl augenblicklich anwandelte, aber im Grunde nicht in dem Ernst meiner Natur lag, und auf dem ich mich also nicht halten konnte. Und dann sind in Deutschland unsere Kreise zu beschränkt, als daß man mit so etwas hätte hervortreten können.«
Heute kann man’s. Ob man es auch sollte, steht dahin.
*
Füllest wieder Busch und Tal
Still mit Nebelglanz,
Lösest endlich auch einmal
Meine Seele ganz;
Breitest über mein Gefild
Lindernd deinen Blick,
Wie des Freundes Auge, mild
Über mein Geschick.
Diese Eingangsstrophen aus Goethes Gedicht »An den Mond« in der Fassung von 1789 würden uns heute als »Inbegriff eines natürlichen, geruhsamen Sprachblaufes« erscheinen, schrieb der Kunsthistoriker Franz Roh 1948 in seinem Buch »Der verkannte Künstler« und zitierte dann einen Verriß, den der Kritiker Martin Spann 1831 veröffentlicht hatte: »Herr von Goethe apostrophiert allererst den Mond und zwar in der Pöbelsprache, indem er nach Art ungebildeter Menschen in den drei ersten Strophen die Zeitwörter ohne ihre persönlichen Fürwörter, d. h. ohne ausdrückliche Subjektbesetzung setzet.« Und daß der Mond »seinen Blick lindernd verbreitet, läßt mutmaßen, daß die Gegend an einer schmerzhaften Krankheit leidet«.