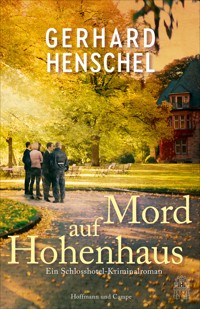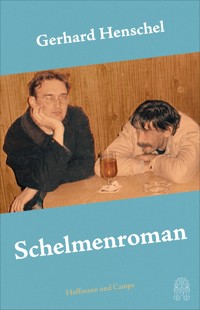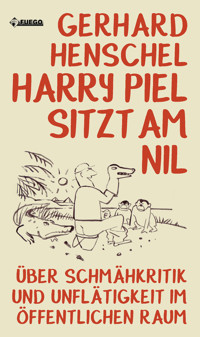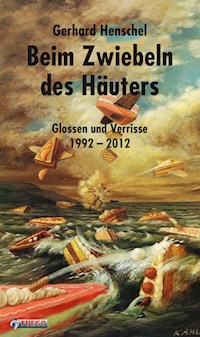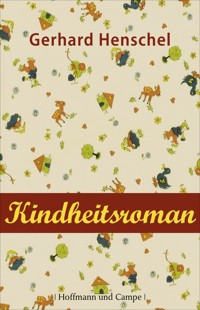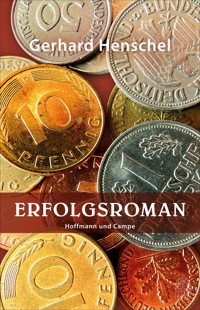14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Martin Schlosser
- Sprache: Deutsch
Der sechste Band der Martin-Schlosser-Chronik Mitte der achtziger Jahre hat der Germanistikstudent Martin Schlosser noch keinen fest umrissenen Lebensplan. Wenn er nicht gerade über Tschernobyl, den Historikerstreit oder die Barschel-Affäre nachdenkt, setzt er sich mit seiner anspruchsvollen Freundin Andrea auseinander und übt sich in der Kunst des Lebens. Zwischen Brotjobs bei Tetra Pak, Uniroyal und Edeka und Philosophieren über Stubenfliegen, türkische Folklore und Monogamie wird ihm eines Tages schlagartig klar, was er will.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 762
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Gerhard Henschel
Künstlerroman
Hoffmann und Campe
Künstlerroman
Himmelfahrt? War das nicht der sogenannte Vatertag? An dem zugedröhnte Männer jeden Alters Bollerwagen voller Bierkisten hinter sich herzogen, Spazierstöcke mit Fahrradklingel schwangen, öffentlich rülpsten und sich schlimmer aufführten als die Neandertaler?
Auf der Schönholzer Heide, da gab’s’ne Keilerei …
Unter anderen Umständen wäre ich zum Strandbad Wannsee gefahren. Dazu hätte es allerdings auch einer besseren Wetterlage bedurft. Alles flau und grau, nein danke, da blieb ich lieber zuhause. Einen Liebesbrief schreiben, Tee trinken und Dylan hören.
Why wait any longer for the world to begin
You can have your cake and eat it too …
Andrea in Aachen und ich in Berlin: Viereinhalb Monate ging das schon so, doch es war auf die Dauer kein Zustand. In Berlin hätte Andrea ihr Sozialpädagogikstudium nicht fortsetzen können; ich aber konnte mich als Germanist durchaus zum Wintersemester ’85/86 in Köln einschreiben und nach Aachen ziehen, so wie Andrea es mir vorgeschlagen hatte. Auch wenn Mama und Papa nicht davon begeistert wären, daß ich vorhatte, jeden Tag zu meinen Vorlesungen zu trampen. Doch die Germanistische Fakultät in Aachen taugte nun mal nichts, und ich wollte endlich in derselben Stadt wie Andrea wohnen.
In Aachen, schrieb ich ihr, könnte ich eventuell einen Taxischein machen (leichter als in Berlin, wo man sich fünfzigtausend Straßennamen merken mußte), so daß ich eine sichere Nebenerwerbsquelle hätte, und überhaupt, es werde alles himmlisch, wenn ich erstmal ein Zimmer gefunden hätte …
Was ich ihr nicht schrieb, war, daß ich hoffte, sie in Aachen von ihrer Neigung zu anderen Männern kurieren zu können. Wir hatten uns zwar darauf geeinigt, eine offene Beziehung zu führen, ohne Exklusivitätsversprechungen, aber ich wäre trotzdem gern der einzige Mann in Andreas Leben gewesen.
Es dräute eine Umzugskostenlawine, und ich brauchte auch noch Geld für unsere Pfingstferien in Paris, der Stadt der Liebenden, wo Andrea uns bereits ein Doppelzimmer gebucht hatte, in einem Null-Sterne-Hotel natürlich, ohne Frühstück, aber von irgendwas mußten wir ja leben, und als Gentilhomme wollte man seiner Geliebten schließlich auch mal einen Café au lait spendieren. Nach allem, was ich aus der Schule und dem Fernsehen wußte, war Paris ein teures Pflaster.
Bei den »Heinzelmännchen«, der studentischen Jobvermittlungslotterie, ergatterte ich die Startnummer 11. Das wäre an und für sich eine gute Zahl gewesen, doch ich schien den falschen Tag erwischt zu haben. Nach langem Zögern entschied ich mich für eine Tagesschicht in einer Getränkedosenfabrik in Lichterfelde. Anzutreten am kommenden Dienstag um vierzehn Uhr. Zwölf Mark die Stunde. Besser als nix.
Was ich noch nicht aufgegeben hatte, war meine Karriere als Filmemacher. Wozu besaß ich eine Super-8-Kamera, wenn ich keine Experimentalfilme damit drehte? Sonnenaufgang in Berlin im Zeitraffer: Als zusätzliches Equipment brauchte ich dafür nur ein Stativ und ein Gerät für die Einzelbildschaltung.
Dann holte ich meine Jacke aus der Reinigung ab und mußte sechs Mark neunzig löhnen. Am Kragen prangte ein gelber Zettel:
Um dieses Kleidungsstück haben
wir uns besonders bemüht.
Dennoch sind die verbliebenen
Flecken
nicht besser zu entfernen,
ohne Stoff und Farben anzugreifen.
Die Flecken stammten von einem Abstecher in die Kanalisation der Stadt Göttingen, den ich mit meinem alten Freund Hermann unternommen hatte. Nicht ganz nüchtern, um der Wahrheit die Ehre zu geben.
Was hatte man alles erlebt!
Um etwas für meine Allgemeinbildung zu tun, sah ich mir im Schloß Charlottenburg eine Ausstellung an: Gemälde, Zeichnungen und Stiche von Jean-Antoine Watteau. Die aufgeblasenen Harlekine und Musikanten und die fetten Engelchen fand ich abscheulich, aber die Himmelsfarben gefielen mir, und ich legte mir den vierzig Mark teuren Katalog zu.
An Bob Dylans vierstündigem Spielfilm »Renaldo und Clara«, der in einem Schöneberger Programmkino lief, waren die Konzertausschnitte das beste. Die Handlung bestand irgendwie darin, daß Dylan als Renaldo zwischen zwei Frauen stand, auf einem Pferd herumritt und das Grab von Arthur Rimbaud besuchte.
Für die ganz Doofen waren die Songs deutsch untertitelt. Und wie! »Leave at your own chosen speed«, sang Dylan, und als Übersetzung wurde eingeblendet:
Geh so schnell du kannst.
Darüber kam auch bei anderen Zuschauern Unmut auf.
Nach zwei Stunden gab es eine Pause, in der viele sich verdrückten, aber ich hielt bis zum Abspann um halb vier Uhr morgens durch. Das war ich Dylan schuldig, nach allem, was er für mich gesungen hatte.
Als ich Stativ und Kamera auf der Friedenauer Brücke aufbaute, konnte ich nur mutmaßen, wo die Sonne aufgehen würde, und nachdem ich eine Stunde lang alle zehn Sekunden ein Einzelbild belichtet hatte, zeigte sich, daß die Sonne ein Stück zu weit rechts in Erscheinung trat.
Scheiße.
Wenn ich richtig gerechnet hatte, ergaben 360 auf eine Stunde verteilte Einzelbildaufnahmen nur fünfzehn Sekunden Film. Bei meinem nächsten Versuch mußte ich die Frequenz erhöhen. Für einen fünfzehn Sekunden langen Experimentalfilm kriegte man keinen Goldenen Löwen.
In der Germanistenbibliothek war Arno Schmidts Spätwerk vollständig vorhanden. Ich blätterte in »Zette’s Traum«, diesem Monstrum von einem Roman, in dem es hauptsächlich darum zu gehen schien, daß ein bibliomanischer Privatgelehrter sich vor einer sechzehnjährigen Nymphe mit seinen Lesefrüchten brüstete. Und das auf 1334 großformatigen Seiten und in einer Geheimsprache, an der sich selbst die größten Koryphäen die Zähne ausbissen. Das hatte was Inhumanes.
Von der Bescheinigung, die besagte, daß ich das Grundstudium im Nebenfach Soziologie mit dem Gesamturteil »bestanden« abgeschlossen hatte, schickte ich Mama und Papa eine Kopie. Daran konnten sie sich aufrichten, wenn ich sie mit meinem Umzugsplan bekanntmachte.
In der Rheinstraße gingen gewaltige Bauarbeiten los, gleich vor meiner Haustür, und sie sollten, wie auf einem Schild stand, insgesamt drei Jahre andauern. Bis 1988. Zack mi seu! Noch ein Grund mehr, nach Aachen umzuziehen.
Ich stellte es mir lustig vor, ein Buch mit kurzen Geschichten zu schreiben und sie mit den immergleichen Bildern zu illustrieren. Nur jedesmal in einer anderen Reihenfolge.
Bei fünf Bildern gab es, wie ich nach langer Rechnerei herausfand, genau 120 Möglichkeiten.
Und welche Bilder würden sich da eignen?
Völlig belanglose aus einer Fernsehzeitschrift.
Ich zog los und kaufte mir die Hörzu, und schon hatte ich meine fünf Illus: eine Mutter im Zwiegespräch mit ihrem offenbar an den Hausaufgaben sitzenden Sohn; ein sich küssendes Liebespaar; eine alte Dame und ein alter Herr, die einander mit Weingläsern zuprosten; eine bezopfte Frau in einem Kahn auf einem Weiher; ein Mann, der einer Frau einen Blumenstrauß überreicht.
Bevor ich mit dem Schreiben anfing, mußte ich allerdings noch auf angemessene Inspirationen warten.
Ferngespräche waren irre teuer, auch abends, doch ich wollte Andreas Stimme hören. Nur rief ich leider im falschen Moment an: Ihr gehe es »gerade irgendwie nicht so gut«, sagte Andrea.
Deine Frau, das unbekannte Wesen.
Am Dienstag stand ich um zwei Uhr morgens auf. Zwei Schnitten Schwarzbrot und ein Ei. Dann fuhr ich mit drei verschiedenen Nachtbuslinien nach Rudow und erklomm einen Hügel, wo ich das Stativ aufbaute und durch den Sucher der Kamera im Osten die Stelle anpeilte, von der man annehmen durfte, daß dort die Sonne aufging. Offiziell sollte sie das um 4.26 Uhr tun.
Von 4.05 Uhr bis 5.10 Uhr betätigte ich alle zwei Sekunden die Einzelbildschaltung und ließ mich weder von keifenden Singvögeln noch von einem hinter mir raschelnden Igel aus dem Takt bringen. Dummerweise ging die Sonne aber wieder zu weit rechts auf.
Bei den Heinzelmännchen kriegte ich die aussichtslose Nummer 39 und konnte wieder abziehen und mich aufs Ohr hauen, von acht bis zwölf. Anschließend zur Sparkasse, zweihundert Mark in Francs abheben, und weiter nach Lichterfelde zu der Getränkedosenfirma mit dem bekloppten Namen PLM Ball: Dosendeckelstapel vom Fließband heben und in lange Plastikschläuche stecken, bei mörderischem Lärm, ratta-tatt, ratta-tatt, ratta-tatt, von zwei bis halb elf, mit einer halben Stunde Essenspause. Wenn ich das täglich hätte machen müssen, wäre ich wahrscheinlich zum Maschinenstürmer geworden.
Karl Marx hatte recht:
Während die Maschinenarbeit das Nervensystem aufs äußerste angreift, unterdrückt sie das vielseitige Spiel der Muskeln und konfisziert alle freie körperliche und geistige Tätigkeit. Selbst die Erleichterung der Arbeit wird zum Mittel der Tortur, indem die Maschine nicht den Arbeiter von der Arbeit befreit, sondern seine Arbeit vom Inhalt.
Das Tollste war noch, daß ich wiederkommen mußte, um mein Geld abzuholen, denn das Lohnbüro hatte geschlossen.
Und noch einmal als Nachtgespenst nach Rudow. Ich nahm ein Einzelbild pro Sekunde auf, neunzig Minuten lang, 5400 Stück, bis mir der Daumen wehtat, und diesmal hatte ich die Sonne genau im Visier, in ihrem eigenen Rampenlicht, ein riesiger Ballon, dunkelrot und glühend, so daß alles bestens gewesen wäre, wenn ich zwischendurch nicht mit dem Knie an das Stativ gestoßen hätte.
Martin Schlosser – Filmographie: 1) Sonnenaufgang in Rudow / Sunrise in Rudow / Lever du Soleil à Rudow. Bundesrepublik Deutschland 1985, 2 ½ Minuten. Regie: Martin Schlosser; Kamera: Martin Schlosser; Musik: Jean Sibelius. Vgl. Peter Bogdanovich: The Cinema of Martin Schlosser, New York 1999; Hans C. Blumenberg: An Index to the Creative Work of Martin Schlosser, London 2007.
Zu zweit wäre sie fideler gewesen, die Filmerei. Man hätte sich mal abwechseln können und rauchen oder pinkeln. Als Altmeister hätte ich auch einen meiner Lakaien losschicken können: »Hier ist Ihr Ticket nach Granada. Bringen Sie mir zehn Sonnenaufgänge aus der Sierra Nevada mit. Aber stoßen Sie bitte nicht wieder mit dem Knie ans Stativ!«
Zurückfahren mußte ich schwarz, weil ich nicht mehr genug Kleingeld hatte und zu geizig gewesen war, mir eine Monatskarte zu holen. 24 U-Bahn-Stationen. Und bei jedem Halt zittern. Ein Opfer für die Filmkunst.
Am mittleren Nachmittag wurde ich bei PLM Ball vorstellig, aber das Lohnbüro hatte zu. Obwohl es laut Aushang bis 16.30 Uhr geöffnet sein sollte.
»Kommense morgen wieder«, sagte eine Trulla, die sich selbst für unzuständig erklärte.
Und dafür war ich anderthalb Stunden mit dem Bus unterwegs! Die hatten doch den Arsch offen, die Leute da.
Um halb sieben in der Frühe wurden die Bauarbeiten auch auf dem Innenhof eröffnet: Preßlufthämmern, Meißeln, Schreien, Rasseln, Donnern, Knallen, Bohren und ähnliche Lautmalereien aus dem Höllenschlund der Bauarbeiterklasse.
Unterschriften für eine Protestresolution an den Regierenden Bürgermeister sammeln und eine ganzseitige Anzeige im Tagesspiegel aufgeben:
HERRDIEPGEN!
Wir, die Bewohner der Rheinstr. 21, fordern hiermit die bedingungslose Kapitulation der in unserem Innenhof eingesetzten Bauarbeiterstreitmacht. Sollten Sie – als oberster Dienstherr der dort werkelnden Radaubrüder – unserer Forderung nicht augenblicklich nachkommen, sehen wir uns dazu gezwungen, das Schöneberger Rathaus in Schutt und Asche zu legen. Sie haben die Wahl.
Hochachtungsvoll:
Und dann 132 Namen.
Als ich nach Aachen aufbrach, hatte es bereits den ganzen Morgen über in Strömen gegossen. In der Rheinstraße schwamm der Schlamm aus den aufgerissenen Wegen, alles troff, und die Wolkendecke sah so aus, als ob sie noch ein paar Milliarden Hektoliter Regenwasser mehr in petto hätte.
Doch es gab kein Zurück, wenn die Liebe rief. Wobei ich zum Glück nicht wußte, daß mir eine sechzehn Stunden lange Tramptour bevorstand, mit ausgedehnten Latenzperioden auf den Raststätten Waldkater, Lehrte, Bad Eilsen, Herford, Rhynern, Lichtendorf, Remscheid und Frechen, denn es fehlte an Fahrern, die sich einen patschnassen Vagabunden ins Auto laden wollten.
»Ich dachte schon, du kämst überhaupt nicht mehr«, sagte Andrea, als sie mich nachts um halb zwei in die Wohnung ließ. »Wir müssen leise sein, Ariane und Monika schlafen schon …«
Ich fühlte mich wie durch den Wolf gedreht von der Reise, und mich stieß Andreas militanter Kurzhaarschnitt ab. Wo sie doch so schöne Locken gehabt hatte!
Hinter ihr lag ein Treffen mit ihrem Vater, das »ganz schön seelenstressig« gewesen sei, wie sie mir anvertraute, als wir im Bett lagen. Ihr Vater war irgendwann abgehauen und hatte ihre Mutter mit drei kleinen Kindern sitzengelassen, doch er trieb sich noch immer in der Gegend herum und ging undurchsichtigen Geschäften nach. Andrea hatte mir mal ein Foto von ihm gezeigt. Da wirkte er wie der Prototyp des rheinischen Hallodris, der von Herzen gern feiert und schunkelt und zu leben versteht und vielleicht auch mal krumme Sachen macht, ohne sich deswegen schuldig zu fühlen.
Ich hätte Andrea lieber für mich allein gehabt, ohne ihren familiären Hintergrund und das ganze damit zusammenhängende Psychogewölle.
Nur wir zwei.
Ich hätte auch auf ihre Mitbewohnerinnen verzichten können. Die waren mir zu brav. Als wären sie der Rama-Reklame entsprungen. Rosig, kerngesund ernährt und irgendwie asexuell, was es Andrea und mir nicht leichter machte, in ihrem Zimmer die Sau rauszulassen.
Der Nachtzug nach Paris war proppenvoll. Wir hatten keine Plätze reserviert, aber wir fanden ein Abteil, in das wir uns reinquetschen konnten. Die Fahrkarten wollten wir nachlösen.
Eine Reise nach Paris im Wonnemonat: Enge, Pestluft, Schienengeratter, steifer Hals, Geschnarche, Fußschweiß, Fürze, Mücken, warmes Bier und scheppernde Durchsagen in drei gleichermaßen unverständlichen Sprachen.
Und die ganze Zeit über ließ sich kein Schaffner blicken. Aachen – Paris, wie viele Kilometer waren das? 450? 470? Mein neuer Streckenrekord als Schwarzfahrer.
In unser Zimmer konnten wir noch nicht rein, aber wir durften im Hotel unser Gepäck abstellen.
Springtime in Paris! Wer hatte hier nicht alles gelebt und geliebt? Und gemalt, gesungen, komponiert, philosophiert, gedichtet, gefilmt und geschauspielert? Baudelaire, Rimbaud, Picasso, Dalí, Sartre, Gabin, Montand, Truffaut, Vian, Brassens, Bécaud, Piccoli …
»Die deutschen Truppen trugen Grau, und du trugst Blau«, hatte Humphrey Bogart zu Ingrid Bergman gesagt.
Wir gingen frühstücken, in einem Straßencafé, wo uns ein Spatzenschwarm belagerte. Die Viecher kannten keine Scheu. Ein besonders kühner Spatz setzte sich auf Andreas Zeigefinger und pickte Krümel aus ihrem Croissant.
Metropolenspatzen.
Um elf war unser Zimmer endlich frei. Ein schiefer Kleiderschrank, ein Klo, ein Waschbecken und ein breites Doppelbett, das in allen Fugen knirschte und ächzte, als wir es erprobten, doch es hielt den enormen Belastungen stand.
Die Frage war, was man in Paris eigentlich machen sollte, wenn man niemanden kannte und so bitterarm war wie wir.
In Museen gehen, natürlich. Aber zuerst zum Eiffelturm.
Auf einer der Zwischenetagen stand ein Fotoautomat. Darin ließen wir uns beim Grimassenschneiden ablichten. Das fertige Bild hatte die Aufschrift:
SOUVENIRDELATOUREIFFEL
»Das zeigen wir dann unsern Enkelkindern«, sagte Andrea.
»Dazu müßten wir erstmal Kinder haben.«
»Irgendwann will ich das ja auch.«
»Und wozu?«
»Wozu wohl! Ich will Kinder haben, um Kinder zu haben!«
Weibliche Logik.
Meinen Einwand, daß Kinder Krach und Dreck machten und jede Liebesbeziehung ruinierten, weil es dann bloß noch um Dinge wie Arschabwischen, Naseputzen, Hausarbeit und Geldranschaffen gehe, wies Andrea brüsk zurück, aber argumentativ hatte sie mir nichts entgegenzusetzen.
Die Seine, der Triumphbogen, die Avenue des Champs-Élysées – alles ganz nett anzusehen. Nur, was hatte man davon?
Wenn wir tiefer in die Tasche hätten greifen können, ja dann! Ente à ’Orange, Champagner, Moulin Rouge, Damastkissen …
Wir kauften Käse, Äpfel, zwei Baguettes und eine Flasche Rotwein ein und zogen uns zum Nachtmahl ins Hotelzimmer zurück.
An dem Korken mußte ich extrem lange mit meinem Wohnungsschlüssel herumschnitzen, weil wir keinen Korkenzieher hatten und ich auch vom Portier keinen bekommen konnte, und weil es keine Gläser gab, mußten wir aus der Flasche trinken.
Korkenzieher: tire-bouchon.
Als Aschenbecher diente mir das Waschbecken neben dem Bett.
Et maintenant?
»Voulez vous coucher avec moi?«
»Je ne sais pas«, sagte Andrea und gähnte. »Je suis fatigué …«
Aber als sie sich räkelte und streckte, wurde sie anderen Sinnes, wenn auch unter der Bedingung, daß ich keine größeren Aktivitäten von ihr verlangte, was ich als Chevalier selbstredend unterließ.
Lieber als in den Louvre wollte Andrea ins Centre Pompidou, einen Museumsneubau von dickstens aufgetragener Modernität, der einen anschrie: Ich bin ein super-hyper-ultrateures Stück Renommierarchitektur aus dem späten 20. Jahrhundert – sieht man das nicht?
Für die ausgestellten Kunstwerke konnte ich mich auch nicht erwärmen. Außerdem mißfiel es mir, daß dieses Bauwerk nach einem Präsidenten benannt war, der die Todesstrafe gebilligt hatte. Ich konnte mich noch an die Schlagzeile im Stern erinnern:
Pompidou gab kein Pardon
Weshalb nicht Centre Baudelaire?
Draußen gab es einen Volksauflauf um eine Gruppe trommelnder Afrikaner. Andrea war davon kaum wieder wegzukriegen.
Ich fotografierte sie vor einer Bäckerei, in deren Schaufenster eine schwarze Katze auf den Broten lag. Das hätte es in Deutschland nicht gegeben.
Andrea tippte an die Scheibe, und die Katze stellte ihren Schwanz auf.
Mit zwei weiteren Baguettes und einer weiteren Flasche Rotwein fuhren wir zum Friedhof Père Lachaise, auf dem viele berühmte Leute begraben lagen, u.a. Balzac, Chopin, Molière, Max Ophüls und Simone Signoret.
In einem der bemoosten Mausoleen picknickten wir.
Le temps d’apprendre à vivre il est déjà trop tard …
Ich hätte mir gern noch das Grab von Jim Morrison angesehen, aber als wir weiterzogen, wurden wir von der motorisierten Friedhofspolizei verwarnt: »You can’t drink wine here!«
Wieso nicht? An einem Ort, wo lauter Säufer ihre letzte Ruhestätte gefunden hatten?
Das war also Paris. Merci beaucoup. Wenn ich wiederkommen sollte, dann nur auf Einladung des französischen Kulturministers.
Obwohl ich immer noch meine Finanzen sanieren mußte, mit einem Job in Berlin, trampte ich nach der Frankreichreise erst einmal nach Göttingen zu Hermann.
Bei einem Waldspaziergang verstießen wir gegen das Betäubungsmittelgesetz und tauschten uns über die jüngsten Entwicklungen aus. An der prekären Situation, daß zwei Frauen Hermann für sich allein haben wollten – Marita und Mareike –, hatte sich nichts geändert, und was seine sonstige Freizeitgestaltung anging, war er von dem Vorhaben abgerückt, sich der Drachenfliegerei zu widmen. Stattdessen wollte er sich nun dem Windsurfen zuwenden.
Das fand ich degoutant. Ich sagte, daß auch ich mir jetzt eine Sportdisziplin ausgesucht hätte.
»Und welche?«
»Jo-Jo.«
»Jo-Jo?«
»Jawohl. Jo-Jo! Das liegt total im Trend. Windsurfen ist schon längst wieder out …«
Was er mir jedoch nicht abnahm.
Zu meinem Verdruß wollte er auch nichts von meinem Vorschlag wissen, bei seinem nächsten Besuch in Berlin gemeinsam mit mir drei Stunden lang die Morgendämmerung zu filmen, mit sekündlicher Einzelbildschaltung, bei der wir uns ganz lässig hätten ablösen können. Drei Stunden lang jede Sekunde ein Bild, sagte er, das wären 60 × 60 × 3, also 3600 × 3, und das mache alles in allem 10800 Aufnahmen. »Wenn du glaubst, daß ich dafür meinen gewohnten Schönheitsschlaf abkürze, muß ich dich enttäuschen!«
»Hättest du das auch zu Luis Buñuel gesagt?«
»Erstens«, erwiderte Hermann, »bist du nicht Luis Buñuel, und zweitens hätte Buñuel mir nichts Geringeres als eine Hauptrolle angetragen! Wenn du wirklich was vom Film verstündest, würdest du mich nicht zum Kamera-Assistenten degradieren, sondern mich als Leinwandstar verpflichten und mir eine Millionengage anbieten …«
In Berlin fuhr ich wieder zu PLM Ball, und das Lohnbüro hatte wieder geschlossen. Diese Ganovenbande! Und ich hätte nicht einmal beweisen können, daß ich schon zweimal versucht hatte, meine kümmerlichen 96 Märker einzufordern. Der reinste Manchesterkapitalismus.
Beim Endspiel um den Europapokal der Landesmeister hatten alkoholisierte Hooligans im Brüsseler Heysel-Stadion randaliert und eine Massenpanik verursacht: 39 Tote, Hunderte von Verletzten.
Als FIFA-Präsident hätte ich für einen kleinen Wissenstest plädiert, den jeder Stadionbesucher bestehen müßte. Nur drei Fragen: Unter welchem anderen Namen kennt man den Spieler Edson Arantes do Nascimento? Wie viele Ecken hat ein Fußballfeld? Wie hieß der Kapitän der ungarischen Vizeweltmeistermannschaft von 1954?
Wer nicht mindestens zwei der drei Fragen richtig beantworten könnte, müßte draußenbleiben. Den durchs Raster gefallenen Hooligans hätte man dann ja einen Betonbunker zuweisen können, in dem sie sich ausagieren dürften.
Als ich abermals bei PLM Ball aufkreuzte, schloß eine Tante gerade das Lohnbüro zu. Am Arm hatte sie einen Henkelkorb voller Leckereien. Eine Hartwurst ragte heraus, und ich sah auch eine Ananas und mehrere Schokoladentafeln.
»Entschuldigen Sie«, sagte ich, »ich möchte zum Lohnbüro …«
»Das geht jetzt nicht. Das hat erst morgen wieder auf.«
»Aber hier steht doch, daß es bis halb fünf geöffnet hat!«
»Ja, normalerweise, aber heute nicht, und ich hab jetzt echt keine Zeit mehr.«
»Ich bin aber schon zum vierten Mal hier, um mein Geld abzuholen, und nie ist jemand da!«
Die Tante gab ein ungnädiges Murren von sich, doch sie stellte ihren Korb ab, schloß das Büro wieder auf, zahlte mir nach längerem Aktengeblätter meinen Lohn aus und entließ mich mit der Bemerkung: »Da haben Sie aber Glück gehabt, daß ich so kulant bin!«
Wäre ich gläubisch gewesen, hätte ich diese Firma in meine Gebete eingeschlossen: Lieber Gott, bitte mach, daß PLM Ball in Konkurs geht und daß der Geschäftsführer wegen betrügerischen Bankrotts für zehn Jahre ins Kittchen wandert …
Das Prächtigste in der Juni-Nummer der Titanic war eine Bildergeschichte von F. K. Waechter. Mann und Frau an einem Kneipentisch. Der Mann entblößt seine Brust. Darauf steht geschrieben:
Ich heiße Ernst. Kommen Sie mit mir nachhaus?
Die Frau öffnet ihre Bluse. Über den Brüsten steht:
Nö.
Der Mann wendet sich zum Gehen, nimmt seinen Hut vom Haken und läßt die Hose ein Stück runter. Auf dem Hintern steht:
Schade.
In Aachen überfiel Andrea mich mit der Idee, daß wir ein Bioenergetikseminar besuchen sollten. »Nächstes Wochenende. Von Sonnabendvormittag bis Sonntagnachmittag. Hier in der Stadt. Wie wär’s ?«
»Und was passiert da?«
»So genau weiß ich das auch nicht. Da wird irgendwie auf der Körperebene gearbeitet. So in der Gruppe halt.«
»In welcher Gruppe?«
»Na, in der Gruppe aus den Leuten, die da mitmachen!«
»Wie viele sind das denn?«
»So zehn oder fünfzehn. Oder kann sein auch zwanzig. Das weiß man vorher nicht.«
Auf der Körperebene arbeiten? Was hieß das? Nackt herumtollen? Mit fremden Leuten?
Klarkommen mußte ich auch mit Andreas Eröffnung, daß Tarik, ihr türkischer Folkloretanzlehrer, »gewisse Gefühle« in ihr auslöse.
Die alte Kaiserstadt – ein Sündenbabel.
Als ich aufstand, suchte ich zuerst nach meiner Brille und dann nach meiner Waschtasche.
Andrea saß auf dem Balkon und sonnte sich. Oben ohne. Bei einer Tasse Brennesseltee.
Als ich auf den Balkon hinaustrat, zwinkerte Andrea mir zu und sagte: »Na?«
Neben ihr saß Monika im Bikini mit übereinandergeschlagenen Beinen auf einem Hocker und las den Klenkes, das Aachener Stadtmagazin, und es wäre dieser jungfräulich wirkenden Mitbewohnerin gegenüber unhöflich gewesen, wenn ich mich auf Andreas Schoß gesetzt und ihr einen Zungenkuß gegeben hätte. Obwohl es mich danach verlangte.
Im Klenkes gab ich eine Kleinanzeige auf:
Gibt’s das: 1 großes billiges helles Zimmer in einer WG ab August oder später? Notfalls nehm ich (Student, 23) auch ein kleines teures finsteres.
Dazu Andreas Telefonnummer. Täterätusch!
Auf der Rückreise kehrte ich wieder bei Hermann ein und hörte mir sein Lamento über die Eifersüchteleien zwischen Mareike und Marita an. Marita ahne, daß zwischen ihm und Mareike nicht immer alles platonisch verlaufe, und Mareike habe es satt, die zweite Geige zu spielen. Und da wir gerade bei den Frauen seien: Seine Ex-Freundin Astrid, die Medizin studierte, sei im Physikum zum zweiten Mal durchgefallen.
Es gebe aber auch gute Nachrichten: Im Sommer könnten wir zu einer Reise aufbrechen. Er schlage Marrakesch vor.
»Und was machen wir da?«
»Die Lage peilen, auf den Spuren der berühmten Haschischesser wandeln, Land und Leute kennenlernen und mit Drogen experimentieren.«
Kein schlechter Plan. Noch etwas unausgefeilt, wie mir schien, aber prinzipiell tragfähig.
Vom Asternweg, wo Hermann wohnte, hatte man’s nicht weit zu einem Park mit einem See mit Bänken drumherum, die sich hervorragend für kleine Zechgelage eigneten. Wenn man einen Umweg in Kauf nahm, konnte man sich vorher an der Tanke mit einem Sixpack ausrüsten.
Als die Flaschen alle waren, spazierten wir durch eine nahegelegene Kleingartenkolonie, und da es schon dunkel war, probierten wir eine der Türklinken aus.
Nicht zu, die Tür. Und keiner da.
Ich machte mein Feuerzeug an.
Alles hübsch eingerichtet: Eßtisch, Bänke, Schränke, Kühlschrank und sogar ein Sofa.
Hermann öffnete den Kühlschrank, und so kam eines zum anderen – wir nahmen uns jeder ein Bier und stießen an, aber weil wir keine gewöhnlichen Einbrecher waren, legten wir fünf Mark auf den Tisch.
Der Typ, dem diese Laube gehöre, mache einen guten Schnitt, sagte Hermann und streckte sich auf dem Sofa aus. »Der wird uns noch dankbar sein …«
Dann hörten wir Schritte näherkommen und die Stimmen zweier Männer, und schon ging die Tür auf.
Ich war sofort auf den Beinen und schlängelte mich zwischen den beiden Männern zur Tür hinaus. Bevor sie begriffen, wie ihnen geschah, hatte ich einen Vorsprung von zehn oder zwanzig Metern. Wann war ich zuletzt so gerannt? 1978 in der B-Jugend des SV Meppen?
Irgendwo am Ufer der Leine verschnaufte ich hinter einem Baum und dachte an den armen Hermann, der eine viel ungünstigere Startposition gehabt hatte. Hoffentlich war auch er den Kleingärtnern entkommen!
Nach rund zehn Minuten hörte ich ihn durchs Unterholz krautern und nach mir rufen.
Er habe sich den Überrumpelungseffekt zunutze machen können, sagte er. Die Männer hätten noch darüber debattiert, ob sie mir hinterherlaufen sollten, als er sie beiseitegeschubst habe. »Und dann bin ich abgesaust wie Speedy Gonzales …«
Um als VWLer irgendwann in der freien Wirtschaft unterzukommen, brauchte Hermann ein blütenweißes polizeiliches Führungszeugnis. Über eine Vorstrafe wegen Einbruchdiebstahls hätten wohl nur die wenigsten Personalchefs generös hinweggesehen.
Wie ich in Berlin mit Schrecken feststellte, hatten Mama und Papa vergessen, mir das Geld für Juni zu überweisen. In meiner Not trug ich den Watteau-Katalog zu einem Antiquar, der mir aber nur schlappe zehn Mark dafür gab.
Vorher blühte mir aber noch das Bioenergetikwochenende in Aachen.
Als ich am Freitagabend in Aachen anlangte, schleifte Andrea mich in eine Kneipe, wo sich ihr Folkloretanzkurs traf. So lernte auch ich mal den Tanzlehrer Tarik kennen, den sie so verführerisch fand, obwohl er – zumindest in meinen Augen – nicht viel hermachte: ein lurchartiges Männlein mit Nickelbrille und Mäusezähnen.
»Hello, Martin«, sagte er und schüttelte mir überschwenglich die Hand. »How are you? Andrea has told me a lot of things about you! Sit down!«
Beim Bier flötete er mir ins Ohr, daß ich »such a sweet girlfriend« hätte, und Andrea lachte, denn sie hatte jedes Wort gehört.
Eine raffinierte Tour! Man erzähle jemandem, wie beneidenswert er sei, weil er eine so süße Freundin habe, und wenn man das laut genug tut, kann man sie indirekt angraben und sich gleichzeitig bei ihrem Freund einschmeicheln.
Bei mir verfing das aber nicht.
Den Sommer hatte Andrea bereits verplant: Da mußte sie als Aushilfe im Büro eines Pfadfindervereins sowie in irgendeinem Jugendheim ein mehrwöchiges Praktikum absolvieren.
Ich könne ihr dann ja mal ’ne Karte schreiben aus Marrakesch, sagte sie, nachdem ich ihr von Hermanns und meinen Reiseplänen berichtet hatte.
Zu dem Bioenergetikseminar sollte man in »bequemer Kleidung« kommen und am besten auch »kuschelige Decken, Tücher u.ä.« mitbringen.
Ich hätte gerne einen Rückzieher gemacht, aber dann wäre Andrea ohne mich hingegangen, statt das Wochenende mit mir zu verbringen, und das wäre noch bescheuerter gewesen – ich allein in ihrem Zimmer in der Beverstraße und Andrea schutzlos in den Fängen der Bioenergetikmafia …
In dem Raum, wo das Ganze steigen sollte, gab es nichts als einen Stapel Sitzkissen. Drei Teilnehmer waren schon eingetrudelt: ein bärtiger Mittvierziger vom Typus Erdkundelehrer, der eine blaue Adidas-Hose anhatte, und zwei Mamsellen mit Doppelkinn und Pluderröcken.
Die etwa dreißig Jahre alte Frau, die das Seminar leitete, trug eine Art Indianertracht und stellte sich mit den Worten vor, daß sie »die Rosie« sei, wobei sie dermaßen breit lächelte, daß es mir schwerfiel, meinen Fluchtreflex niederzukämpfen.
Wir setzten uns hin und harrten der Dinge, die da kommen mochten.
Als sich der Raum gefüllt hatte und man im Kreis saß, lud Rosie alle Teilnehmer dazu ein, sich kurz vorzustellen: Name, Beruf und Absicht.
Absicht?
»Die Absicht, mit der ihr hierhergekommen seid.«
Ein pickeliger Mann machte den Anfang: »Ich bin der Wulf und arbeite als Erzieher, und meine Absicht ist, hier mehr über mich herauszufinden.«
Dann sprach eine rundliche Frau: »Ich bin die Antje, und ich bereite mich gerade auf ’ne Umschulung zur Ernährungsberaterin vor, weil, aus meinem alten Beruf als Kosmetikerin, da will ich raus, das hat sich festgelaufen, auch wenn das echt mal ’n Traumberuf gewesen war für mich … und hier, also, die Absicht, mit der ich gekommen bin, da würde ich sagen, daß ich grundsätzlich ziemlich offen bin, aber daß ich auch meine Grenzen ausloten will …«
Gulp.
Andrea sagte, daß sie Andrea heiße und Sozialpädagogik studiere und schon viel Gutes über Bioenergetik gehört habe. »Ja, und nun will ich mal kucken, was … na ja, was hier so abgeht!«
Dabei mußte sie lachen, und sie steckte alle damit an.
Meinen eigenen Beitrag hatte ich inzwischen gut durchdacht: »Mein Name ist Martin, ich studiere Germanistik, und meine Absicht ist, hier heil wieder rauszukommen.«
»Hier sind noch alle heil wieder rausgekommen«, sagte Rosie.
Es ging dann damit los, daß man sich recken und strecken sollte.
»Ruhig auch mit Stimme«, sagte Rosie. »Ohne Worte – einfach die Geräusche rauslassen, die euer Körper machen will …«
An dem allgemeinen Gekeuche, das daraufhin einsetzte, wollte ich mich nicht beteiligen. Auf Kommando keuchen? Das war unter meinem Niveau.
»So, und jetzt zieht euch mal selbst an den Haaren – nicht so doll, daß es schmerzt, aber doch kräftig, und wer mag, der kann dabei ein bißchen lauter werden und schreien! Zeigt mal, was ihr drauf habt!«
Die anderen schrien wie die Irren und schienen sogar noch Vergnügen daran zu finden, und Rosie feuerte die Gruppe an: »Lauter! Ich will euch hören! Laßt euer inneres Kind raus!«
Ich wäre mir kindisch vorgekommen, wenn ich mitgemacht hätte, aber es wurmte mich, daß ich es nicht einmal spielerisch konnte. War ich denn so verklemmt?
Bei der nächsten Übung sollte man auf allen Vieren im Raum herumkrabbeln und sich durch Fauchen, Knurren und Brüllen Respekt verschaffen. Keine große Sache, aber Martin Schlosser tat sich damit schwerer als der Rest der Gruppe.
Warum?
Abends kehrten wir in eine Kneipe ein, und Rosie antwortete auf alle Fragen nach den theoretischen Grundlagen der Bioenergetik. Daß sie von dem amerikanischen Psychotherapeuten Alexander Lowen entwickelt worden sei und im Gegensatz zur Psychoanalyse bei den körperlichen Symptomen seelischer Störungen ansetze, also beispielsweise bei chronischen Muskelverspannungen oder Atemwegserkrankungen. Die Arbeit an den Symptomen habe positive Rückwirkungen auf die psychischen Ursachen. »Das ist jedenfalls nicht so verkopft wie die klassische Analyse à la Sigmund Freud, wo man redet und redet und nach fünf Jahren feststellt, daß man immer noch stottert und lispelt und hinkt.«
Ihr habe dieser Tag »schon was gebracht«, sagte Andrea, als wir zu Bett gingen. »Und dir?«
»Joah … schon auch … aber ich könnte das jetzt nicht genau definieren …«
»Du meinst mehr so ’n Bauchgefühl?«
Diese Vokabel gehörte eigentlich nicht zu meinem aktiven Wortschatz, aber: Ja, es war mehr so ein Bauchgefühl.
Wenn man als Mann beim Sex unten lag, hatte man nicht viel Bewegungsspielraum. Man war weitgehend darauf angewiesen, daß die Frau sich rührte, aber man hatte die Hände frei, und wenn die Bauchmuskulatur mitspielte und die Frau sich tief genug herabbeugte, ließen die Brüste sich auch mit den Lippen erreichen. Doch sobald im Zuge der Körperachsenverschiebungen eine Schieflage entstand, flutschte unten womöglich das Yang aus dem Yin, und man mußte manuell nachbessern, um die Dinge wieder in Fluß zu bringen.
Lernen konnte man das nur autodidaktisch, weil es den Kultusministern wichtiger erschien, daß man sich in der Schule mit dem Wormser Edikt und gemischtquadratischen Gleichungen beschäftigte. Oder mit Glukosemolekülen.
Auf den Bauch kam am Sonntagvormittag auch Rosie zu sprechen: Wir sollten uns nicht wundern, wenn es bei uns im Bauchraum öfter und lauter gluckere als gewöhnlich. Das sei eine Folge der bioenergetischen Arbeit. »Wenn sich im Bauch was löst, dann gluckert’s halt. Nicht daß ihr denkt, daß das was Schlechtes zu bedeuten hätte!«
Aufrecht stehen, die Füße parallel mit fünfzehn Zentimetern Abstand und die Knie leicht gebeugt, damit die Energie fließen könne, und die Hände flach auf den Bauch legen. Wenn man strammstehe, mit durchgedrückten Knien, so wie beim Militär, sei der Energiefluß blockiert. Man könne das auch in der Schlange im Supermarkt üben. Federnd stehen und nicht starr und das Becken beim Einatmen nach hinten kippen und beim Ausatmen nach vorn. Die Atmung sei das A und das O.
Ich sah Andrea neben mir und kriegte schon wieder Lust.
»Versucht mal ins Becken zu atmen«, sagte Rosie.
Ins Becken atmen? Anatomisch unmöglich.
»Und dann stellt euch vor, daß ihr bei jedem Atemzug Energie in euch aufnehmt, die ihr beim Ausatmen wieder abgebt … Energie aus dem Kosmos … und daß ihr ein Teil davon seid … mit jeder Körperzelle …«
Rechts neben mir brach eine Frau zusammen. Gabriele. Heulend.
Rosie war zur Stelle und dirigierte uns um, bis wir einen Kreis bildeten, und nach einigem Hin und Her wurde Gabriele auf eine Decke gebettet, die wir auf Rosies Geheiß anhoben und behutsam schaukelten.
Gabriele rollten die Tränen übers Gesicht.
So ging es eine ganze Weile. Ich fragte mich schon, wie lange ich es noch schaffte, diese Frau zu wiegen.
Als sie sich gefangen hatte, sagte Rosie zu ihr: »Du kannst jetzt deinen Satz sagen.«
Da weinte sie wieder, doch sie brachte einen klaren Satz heraus: »Ich will nicht mehr für alles verantwortlich sein.«
Das schien sie zu erschüttern, und ich stellte mich innerlich auf eine Verlängerung der Wiegezeit ein, obwohl es mich viel Kraft kostete, die Decke festzuhalten und zugleich Mitgefühl zu haben und in mir das Bedürfnis nach einer Zigarette zu ersticken.
»Jedes Gefühl hat seine Berechtigung«, sagte Rosie zu Gabriele. »Versuch mal, dein Gefühl zu verstärken …«
In der Abschlußrunde erzählte Gabriele, daß sie schon von kleinauf als Babysitter für ihre jüngeren Schwestern in Dienst genommen worden sei, fast jeden Abend, und heute stecke sie als alleinerziehende Mutter in der gleichen Misere und habe zwei kleine Kinder zu versorgen. Diese Verantwortung hänge ihr wie ein Mühlstein am Hals. Die könne ihr auch keiner abnehmen. »Aber allein das mal sagen zu dürfen, das hat was Befreiendes!«
Jetzt war ich angefixt. Ich wollte alles über Bioenergetik wissen und sofort das nächste Seminar besuchen, doch ich hatte mich ja darauf festgelegt, bei Tetra Pak zu arbeiten.
Die Spätschicht fing um zwei Uhr an und endete um zehn. Als Hilfskraft wurde man einem Maschinenführer zugeteilt, der darüber wachte, ob die Getränkepackungsrollen, die in seinem Arbeitsbereich maschinell zerschnitten wurden, Druckfehler enthielten. Irgendwo von hinten wurde eine elefantöse Rolle herbeigeschafft. Die mußten wir in die Maschine einspannen wie eine überdimensionierte Klosettrolle. Beim Abwickeln wurde dieser Jumbo in einzelne Bahnen zerteilt, die dann über ein Transportband ratterten und mit einem Etikett versehen werden mußten.
Der Maschinenführer erspähte selbst die kleinsten Fehler. Dann stoppte er die auf vollen Touren laufende Maschine und spulte die Rolle zurück, bis er die fehlerhafte Partie gefunden hatte: Das Braun auf dem Rücken einer grasenden Kuh und das Grün einer Wiese standen nicht innerhalb der vorgesehenen Umrisse, sondern leicht nach links oder nach rechts versetzt. Oder nach oben oder nach unten. Die verdruckten Meter waren an der Seite zu markieren. Solche Rollen wurden dann weiter hinten in der Halle vom Band gekrant und wieder abgewickelt und gekürzt.
Bei reibungslosem Betrieb hatte ich wenig zu tun. Meine Arbeitsleistung erschöpfte sich im Etikettenaufpappen und Knöpfedrücken. Menschlich kam man sich nicht näher, weil der Maschinenführer mehrere Meter von mir entfernt operierte, und beim Einspannen der neuen Rollen wechselten wir nur sachdienliche Worte.
»Paßt?«
»Paßt!«
»Okay!«
Dem Maschinenführer, der mit einem zottigen Schnurrbart herumlief und sich Paule nannte, wäre ich menschlich allerdings auch andernorts nicht nähergekommen.
Einmal stündlich durfte man zur Raucherkabine. Ich war immer froh, wenn kein anderer drinsaß, weil ich mir dann kein Gebabbel über Autos oder betriebsinterne Statusrangeleien anhören mußte und weil man ab drei Personen in der kleinen Kabine kaum noch unverrauchte Luft bekam.
Die entwickelten Super-8-Filme bewahrte ich in einem Pappkarton auf. Schön blöd, daß ich keinen Projektor hatte!
Wegen der langen An- und Abfahrtszeiten mußte ich schon mittags aus dem Haus und kam erst um Mitternacht wieder an. Einmal ließ ich mich, anstatt auf den Bus zu warten, von Paule zur U-Bahn mitnehmen, aber der fuhr wie ein Geistesgestörter: hupend, fluchend, hektisch rauf- und runterschaltend und von der Zwangsvorstellung besessen, daß jede rote Ampel ein gegen ihn persönlich gerichteter Affront sei. Paule Bleifuß, der Brüllaffe mit Fahrerlaubnis.
Da ich sonst nichts erlebte, schrieb ich Andrea von meinen Erfahrungen als Hilfsarbeiter in der Großindustrie. Bei Tetra Pak ging es menschenfreundlicher zu als in den hochkapitalistischen Tuchfabriken. Für die Arbeiter gab es sogar eine Sauna und ein Solarium, die gratis benutzt werden konnten. Ich schwitzte aber auch so schon genug, und auf eine Sonnenbank hätte ich mich freiwillig niemals gelegt. Braunwerden um des Braunwerdens willen?
Ich sicherte mir den schmalen, fünfzig Mark teuren Gedichtband »Eiswasser an der Guadelupe Str.« aus dem Nachlaß von Rolf Dieter Brinkmann. Limitierte Auflage. Mein Exemplar trug die Nummer 1130.
Was mir an den Gedichten gefiel, hätte ich nicht erklären können.
Hier kommt der blaue Bus. Er schleppt eine Staubfahne
hinter sich her. Im Innern summt die Hitze ein Lied,
das der Stoffwechsel heißt. Die Pflanzen summen
ihre Geschichte im Körper vom Tod der Geschichte,
die hinter den Weidezäunen beginnt. Sie beginnt in
Form silbrig geschälter Gerippe unter der Sonne,
die dröhnt. Es ist Zeit für die Pflanzen. Es ist
Zeit für den Kühlschrank, hier, wo die Geschichte
vorbei ist.
Geschrieben hatte Brinkmann die Gedichte 1974 in Texas, ein Jahr vor seinem Unfalltod in London.
Ich kaufte mir auch Dylans Live-Album von 1976 als Kassette. »Hard Rain«. His Bobness in Hochform. Angriffslustig. Voller Elan.
From the crossroads of my doorstep,
My eyes begin to fade,
As I turn my head back to the room
Where my love and I have laid …
Das hätte auch Brinkmann gefallen. Doch da war er schon tot gewesen.
Das Schwerste an der Arbeit war ihre Monotonie. Rolle einspannen, rumstehen, Etiketten aufpappen, Knöpfchen drücken und der Maschine zukucken, die alles andere erledigte.
Da war es eine angenehme Abwechslung, als eine nicht vollkommen waagerecht eingespannte Rolle plötzlich zu qualmen begann. Die Hülse hatte sich irgendwie heißgelaufen. Eine schwarzgraue Rauchwolke stieg zur Fabrikhallendecke auf, und es roch brenzlig …
Paule hielt die Maschine an, doch es dauerte noch eine Weile, bis sie zum Stillstand kam.
Der Zwischenfall hatte den Schichtleiter auf den Plan gerufen. Bestimmt wären auch die anderen Arbeiter gern angewetzt gekommen, wenn sie von ihren eigenen Maschinen weggekonnt hätten.
»Feurio!« rief einer rüber.
Wir brauchten lange, bis wir die angekokelte Rolle ausgespannt hatten.
Der arme Paule. Für den war das natürlich ’ne schwere Blamage.
Freiheit, Anmut und Schönheit seien die natürlichen Merkmale jedes lebenden Organismus, schrieb Alexander Lowen.
Freiheit ist Hingabe an den Fluß der Gefühle, Anmut ist der Ausdruck dieses Flusses in Bewegungen, und Schönheit ist die Äußerung der inneren Harmonie, die ein solcher Fluß erzeugt.
Wenn das auch für Bandwürmer und Kellerasseln gelten sollte, mußte deren Schönheit in den Augen von Betrachtern liegen, die ein radikal anderes Schönheitsempfinden hatten als ich.
Die Bioenergetik will den Menschen helfen, sich dem Leben und der Liebe zu öffnen. Das ist keine leichte Aufgabe. Das Herz wird von einer knöchernen Bastion, dem Brustkorb, geschützt, und wer sich ihm nähert, muß starke psychologische und physische Sperren überwinden.
Wer mit einem verschlossenen Herzen lebe, könne ebensogut im Laderaum eines Schiffes auf Kreuzfahrt gehen.
Er ahnt und begreift nichts von der Bedeutung, dem Abenteuer, der Erregung und Herrlichkeit des Lebens.
Und wo war ich? Im Laderaum oder an Deck?
Ein mitgehörtes Raucherkabinengespräch:
»Wat hat der Paule mit Moses jemein?«
»Weeß ick nich. Schieß los.«
»Der Paule muß jetz ooch durchs Rote Meer.«
»Wieso ’n dit?«
»Weil seine Alte ihre Tage hat.«
»Vasteh ick nich. Ach so! Weil seine Alte ihre Tage hat!«
»Da mussa ehmd durchs Rote Meer.«
»Na, der is jut! He, Charly! Charly, komma rüber! Haste schon jehört? Wat der Paule mit Jesus jemein hat?«
»Nich mit Jesus. Mit Moses!«
»Jesus, Moses, is doch jehupft wie jesprungn …«
Am Freitag fuhr ich nach Schichtende direkt nach Dreilinden, um nach Meppen zu trampen, und zog einen Joker in Form einer Ente aus Osnabrück, in der ich hinten dösen konnte, während der Fahrer mit seiner Beifahrerin darüber stritt, ob angebrannter Toast krebserregend sei oder nicht. Die Beifahrerin vertrat die Meinung, daß eine angebrannte Toastscheibe selbst dann noch »karzinogen« sei, wenn man das Schwarze abgeraspelt habe. Genauso gesundheitsschädlich sei es, irgendwas aus einer Pfanne mit aufgeplatzter Teflonbeschichtung zu essen. Da könne man sich besser gleich einen Strick nehmen; das erspare einem jahrelange Leiden.
In Osnabrück setzte mich das Pärchen am Bahnhof ab. Um vier Uhr morgens! Der nächste Zug in Richtung Emsland ging erst nach sechs Uhr, und alle Bahnhofsbuden hatten zu.
Was tun? Außer sich die Reklame mit den rosaroten Elefanten anzukucken?
Ich hockte mich auf eine Treppe in der Bahnhofshalle und las Lowen.
Schlaf und Sex sind, wie wir sahen, eng miteinander verbunden; das äußert sich nicht zuletzt darin, daß man nach einem befriedigenden Geschlechtsverkehr am besten schlafen kann. Entsprechend ist Sex, wie jedermann weiß, das beste Mittel gegen Angst …
Am Fuß der Treppe rotteten sich fünf oder sechs uniformierte Soldaten zusammen. Besoffene Engländer, die säuisch grölten und sich gegenseitig anrempelten. Als wären sie die einzigen Menschen auf Erden. Das altbewährte Rezept für Krawalle: Man nehme junge Männer, kaserniere sie, drille sie, schurigele sie, behandle sie wie ein Stück Dreck, bringe ihnen das Schießen bei und gebe ihnen dann Wochenendausgang.
Vielleicht hatte ich einmal zu oft hingekuckt, ohne meine Verachtung zu kaschieren. Jedenfalls kam einer der Suffköppe die Treppe hochgetorkelt, streckte mir die Hand entgegen und kläffte: »Friends?«
Stinken tat er auch noch.
Shakehands? Mit diesem Kretin?
Ich drehte mich weg, schon um seine Bierfahne nicht mehr riechen zu müssen.
Das machte ihn wild. Er holte ein Messer raus, ein Schnappmesser, und ließ die Klinge hervorschnellen. ZING!
Die hielt er mir an die Kehle.
Wir haben uns hier versammelt, um Abschied von Martin Schlosser zu nehmen, der viel zu jung gestorben ist, als Opfer einer sinnlosen Gewalttat …
Es war mir klar, daß ich diesen Affen in seiner Würde gekränkt hatte, und zwar aus gutem Grund, aber mein Leben war mir lieber als mein Stolz. Nur wußte ich trotzdem nicht, was ich tun sollte, als der Messermann herumschrie, mit den Augen rollte und mir die Klinge an die Gurgel hielt. Ich hätte ihn ja gern zur Räson gebracht, aber wie?
Einer seiner Kumpane griff sich meine Reisetasche, warf sie über das Geländer und sagte: »Get it back.«
Bevor ich dieser Aufforderung nachkommen konnte, verpaßte Jack the Knife mir einen Kinnhaken.
Ich sah Sterne, doch ich kam auf die Beine. Tasche holen, dachte ich. Tasche holen und ab.
Sie ließen mich ziehen, die Hooligans, mit meiner Tasche und meinem Leben. Ich eierte nach draußen und sah mich nach einer Telefonzelle um, weil ich die Bahnhofspolizei verständigen wollte. Draußen gab es aber keine Zelle. Also wieder rein in den Bahnhof?
Damit wartete ich noch ein paar Minuten. Ich setzte die Tasche ab, ging in die Hocke und versuchte mir eine Zigarette zu drehen, was nicht einfach war, denn ich hatte in beiden Händen den Tatterich.
Dieser Drecksack mit seinem Schnappmesser.
Und willst du nicht mein Bruder sein,
so schlag ich dir den Schädel ein.
Daß der andere Typ meine Tasche über das Geländer geworfen hatte, war meine Rettung gewesen. So hatte er mich aus der Gefahrenzone bugsiert, ohne sich offen mit mir zu verbünden. Eine als Akt der Aggression getarnte Hilfeleistung.
Was nichts daran änderte, daß ich Mackie Messer lieber der Polizei ausliefern wollte, als mich nachher eventuell von ihm in einem Zugabteil erstechen zu lassen.
In der Bahnhofshalle war von den Engländern nichts mehr zu sehen. Ich ging zu einem Münzfernsprecher und meldete mich unter 110 bei der Polizei.
»Und wo halten sich die Personen, von denen Sie bedroht worden sind, jetzt auf?«
»Das weiß ich nicht.«
»Wir schicken jemanden zu Ihnen. Geben Sie sich den Beamten dann bitte sofort zu erkennen.«
Es verstrichen volle zehn Minuten, bis ich zwei Polizisten erblickte, die durch die Halle patrouillierten. Ein kleiner Dicker und ein großer Dünner. Wie Pat und Patachon.
Ich ging zu ihnen hin und redete mir alles von der Seele.
»Ja, da können wir jetzt natürlich auch nichts mehr machen«, sagte der Dicke. »Wollen Sie Anzeige gegen Unbekannt erstatten?«
Davon erhoffte ich mir nichts. Selbst wenn es der Polizei gelungen wäre, den Täter anhand einer Phantomzeichnung aufzutreiben, hätte ich keine Zeugen für meine Beschuldigung gehabt. Es hätte Aussage gegen Aussage gestanden, und Mackie Messer wäre von seinen Waffenkameraden gedeckt worden. Am Ende hätten die mir noch ’ne Klage an den Hals gehängt: Martin Schlosser, der Rowdy, der brave Soldaten anpöbelt …
Da ihre Dienste nicht länger benötigt wurden, räumten Pat und Patachon das Feld. Soviel zum Thema Bullenrepublik Deutschland.
Meinen Personenschutz mußte ich wieder selbst übernehmen. Ich postierte mich in einer Nische, wachsam wie ein Luchs.
Doch meine Freunde, die Engländer, blieben verschollen, und als ich mit dem Zug die gastliche Stadt Osnabrück verließ, war mein Appetit auf Erlebnisse fürs erste gestillt.
While riding on a train goin’ west,
I fell asleep for to take my rest …
In Meppen traf ich nur Papa und Wiebke an. Mama hatte sich in Köln wieder ärztlich behandeln lassen müssen, damit ihr Lymphdrüsenkrebs nicht weiterwucherte, und dann war sie nach Bonn zu den Blums gefahren. Am Abend wollte sie wiederkommen und Oma Schlosser aus Bielefeld mitbringen.
Wenn Mama für ihre Autofahrten Kilometergeld gekriegt hätte, wäre sie eine reiche Frau gewesen.
Papa bosselte an einem Gewächshaus für Tomaten und anderes Gemüse. Dafür mußten Bretter zugesägt werden, die so lang waren, daß das nur im Elternschlafzimmer bei offener Balkontür ging. Ich hatte mich schon gefragt, weshalb Papas neue Riesenkreissäge mitten im Elternschlafzimmer stand. Wobei das Wort Elternschlafzimmer gar nicht mehr paßte, weil Mama das Ehebett halbiert und ihre Hälfte in das Nähzimmer verfrachtet hatte.
Beim Abendbrot flammte ein Streit zwischen Papa und Wiebke auf. Wenn ich es richtig verstanden hatte, spielte sie mit dem Gedanken, sich in einem Kaufhaus ausbilden zu lassen, als »Substitut«, wie die Berufsbezeichnung lautete.
»Substitut!« rief Papa aus. »Als Abiturientin brauchst du keine Socken zu verkaufen! Da kannst du viel höher hinaus, auch wenn du nicht studieren willst! Man muß ja nicht um jeden Preis was Besseres werden als die eigenen Eltern, aber man darf auf der sozialen Leiter nicht nach unten steigen! Mein Vater hat sich aus einfachsten Verhältnissen nach oben gearbeitet, und wenn wir hier ein Dach über dem Kopf haben und nicht darben müssen, dann ist auch das nicht aus dem Nichts gekommen, sondern das Ergebnis harter Arbeit! Und das gilt genauso für Mamas Familie! Noch vor drei, vier Generationen sind das durchweg arme Leute gewesen – Tagelöhner und Matrosen und Heuerkötter, die von der Hand in den Mund gelebt haben! Mamas Vater hat’s dann immerhin zum Mädchenschullehrer gebracht. Trotz Weltkrieg und Inflation! Und die anderen Geschwister mußten dafür zurückstehen! Aber die ganzen Entbehrungen, die deine Vorfahren sich auferlegt haben, sind rückblickend betrachtet für die Katz, wenn sich die Nachfahren in irgendwelchen Kaufhäusern als kleine Gehilfen verdingen! Als Substitut! Dann können wir uns auch gleich wieder auf die Bäume setzen!«
Also sprach Zarathustra bzw. der Regierungsbaudirektor Richard Schlosser. Zwischenfragen wurden nicht gestattet.
Oma Schlosser hatte Mühe, die paar Stufen vor der Haustür zu erklimmen, und wir stellten ihr einen Stuhl ins Wohnzimmer, weil sie aus dem Sofa gar nicht wieder hochgekommen wäre.
How terribly strange to be seventy …
Oma war schon 85. Noch stranger.
Und was gab es Neues?
Vor der Reise nach Köln hatte Mama Oma Jever beim Umzug von der Mühlenstraße in den Philosophenweg geholfen. »Da hat sie jetzt ’ne aparte kleine Terrasse mit einem Stück Rasen davor, und sie braucht sich nicht mehr mit dem großen Garten abzuplagen …«
Am Wochenende davor hätten sie in Hildesheim-Itzum Tante Luises Fünfzigsten gefeiert, was sehr schön gewesen sei. So oft komme man ja nun auch nicht zusammen.
»Apropos Umzug«, sagte ich, »da hätte ich noch was mitzuteilen. Ich hab mich ja mit einer Studentin aus Aachen angefreundet, und ich will deshalb dorthin umziehen und mich in Köln immatrikulieren …«
Nach einer Schreckverarbeitungssekunde bombardierten mich Mama und Papa mit Fragen: »Und wie willst du jeden Tag zu deiner Uni kommen?« – »Hat diese Frau dir den Kopf verdreht?« – »Was studiert die denn?« – »Hast du dir das auch gut überlegt?« – »Wo hast du die denn überhaupt kennengelernt?« – »Und wieso ziehst du nicht nach Köln?« – »Hast du in Aachen etwa schon ’ne Bleibe?« – »Bist du dir im Klaren über die Umzugskosten?« – »Was steht denn in deinem Mietvertrag über die Kündigungsfrist?« – »Hättest du uns nicht vorher mal fragen können? Statt uns vor vollendete Tatsachen zu stellen?«
Fehlte nur noch, daß auch Oma Schlosser ihren Senf dazugegeben hätte, doch sie hielt sich vornehm zurück, und ich war ihr dankbar dafür.
Der Regierungssprecher Peter Boenisch war der Steuerhinterziehung überführt worden und zurückgetreten. Da ging es um eine Million Mark, die er mit schmierlappigem Auto-PR-Lobbyismus verdient hatte. Es sprach bereits Bände, daß er als ehemaliger Bild-Chefredakteur, also als altgedienter Sex-and-Crime-Experte, überhaupt mit einem öffentlichen Amt betraut worden war.
Am Frühstückstisch goß Oma sich einen schaurigen »Brottrunk« ein, der zu ihrer Reiseausstattung gehörte. »Den besorgt mir Gertrud immer aus dem Reformhaus. Die Zeiten, in denen ich meine Einkäufe noch selbst erledigen konnte, sind leider vorbei …«
Wiebke schabte mit dem Messer das Schwarze von ihrem angebrannten Toast, und als ich sie vor der möglichen Krebsgefahr warnte, schaltete Papa sich ein: Was denn das nur wieder für ein Tinnef sei? Und aus welcher Quelle ich die Weisheit hätte, daß Toastbrot Krebs verursache?
»Nicht jedes Toastbrot. Nur angebranntes.«
»Und wer behauptet das?«
»Mediziner.«
»So? Du glaubst aber auch jeden Mist.«
Und wenn er stimmte, dieser Mist? Was wußte Papa denn über Lebensmittelchemie und Karzinogene? War nicht sein eigener Vater an Krebs gestorben? Und Opa Jever? Und woher hatte Mama ihren Krebs?
Aber mich beleidigen! Als wäre ich ein Dummerchen, das alles nachbetet, was es irgendwo aufgeschnappt hat!
Ich nahm den alten Diercke-Atlas an mich, denn den brauchte Wiebke jetzt ja wohl nicht mehr. Dann trampte ich mit meinen Siebensachen über Haselünne, Löningen und Cloppenburg nach Oldenburg zu Heike, meiner verflossenen Liebe, und ihrem Malerfreund Matthias. Weil am Montag der Nationalfeiertag war, mußte ich erst am Dienstag wieder in die Fabrik.
Das letzte Stück nahm mich ein Fahrer mit, der permanent »meines Erachtens nach« sagte. »Meines Erachtens nach hat sich der Westen bei den Abrüstungsverhandlungen in eine Sackgasse manövriert.« Oder: »Meines Erachtens nach ist die galoppierende Staatsverschuldung der sicherste Weg in den Untergang.« Oder: »Wenn du zum hinteren Ende der Lindenstraße willst, dann solltest du meines Erachtens nach am Pferdemarkt aussteigen. Von da aus sind’s meines Erachtens nach höchstens noch fünf Minuten zu Fuß.«
Meines Erachtens nach wären mir die Ohren abgefallen, wenn er mich bis vor die Haustür gefahren hätte.
Heike und Matthias tischten Sardinen, Reis und geriebene Möhren auf. Und Bier.
»Zum Pudelwohlsein!« rief Matthias.
Das Anstoßen mit Flaschen fand Heike zu unfein. Sie trank ihr Bier aus einem Weinpokal, weil gerade kein anderes sauberes Glas mehr vorrätig war.
Dank meiner Liaison mit Andrea hatte ich dann endlich einmal etwas Gefälligeres zu referieren als die üblichen Liebeskummergeschichten.
»Seit wann seid ihr nochmal zusammen?« fragte Heike.
»Seit Silvester.«
»Also ’n halbes Jahr. In unserer heutigen Zeit ist das ja schon fast ’ne Ewigkeit! Findest du nicht auch, Matthias? Mein Schnäuzelchen?«
»Was?«
»Daß unser Zeitalter schnellebig ist?«
»Aber ja, Gutemine …«
Das war offenbar ein einstudierter Dialog.
Nach dem Essen wollte ich Andrea anrufen, und Heike sagte: »Grüß die man von mir! Und sag ihr, daß sie dir nichts durchgehen lassen soll!«
Mein Bericht über das Rencontre mit dem Messerstecher machte auf Andrea keinen großen Eindruck. Als hätte sie Wichtigeres im Kopf. Irgendwas mit Ergün? Ihrem türkischen Ex-Freund?
Sie sei im Moment nicht so gesprächig, sagte Andrea. Und sie müsse auch gleich weg. Aber sie habe mir einen Brief geschrieben. »Da steht alles drin.«
»Was alles?«
»Wirst du dann ja sehen. Ich ruf dich morgen an.«
Mir war der ganze Abend verdorben.
Vier Biere später nahm ich zwei von Matthias’ Horst-Janssen-Büchern ins Gästebett mit: »Angeber X« und »Norwegisches Skizzenbuch«.
Volvi rollt durch den ersten Verkehr und ich bin glücklich darüber, jenen Teil der glücklichen Jugend hinter mir zu haben, wo ich mit Freund Drenkhahn und einer Flasche Wermuth zu 1,90 Mark in solchen Hallen wie diesem Busbahnhof herumstand und mich glücklich schätzte, nicht ins Büro zu müssen, wie die Gesichter, die uns passierten, anguckten und nicht sahen: bös geratene Portraits von einem bösartigen Meister gepinselt – sein Name: »ungeliebte Arbeit«.
Mir bekannt, diese Gesichter. Die gab es auch in der U-Bahn zuhauf.
In dem anderen Buch züchtigte Janssen die Zelebritäten des Kunstmarkts.
Die 2 lächerlichsten Armseligkeiten heute sind zugleich die berühmtesten Erscheinungen im Gehege Bildende Kunst: Warhol + Beuys …
Um die möglichen Konsequenzen solcher Kampfansagen schien sich Janssen nicht zu scheren.
Auf der Fahrt nach Berlin konnte ich an nichts anderes denken als an Andreas Brief, in dem »alles drinstehen« sollte, aber der war noch nicht angekommen, und sie rief mich auch nicht an, obwohl sie es versprochen hatte.
Monday, Monday …
Am Dienstagvormittag kiebitzte ich aus dem Küchenfenster. Wann würde der Postbote kommen? Hoffentlich noch vor meinem Aufbruch zur Spätschicht!
Um zwanzig vor zwölf lief ich zum fünften Mal zu den Briefkästen runter.
Und da war er, der Brief von Andrea.
Ich riß mich zusammen, trug ihn hoch und schlitzte den Umschlag erst in der Wohnung auf.
Lieber Martin!
Wollte sie mich einlullen? Sie schrieb zwei Seiten lang von ihrer Sehnsucht nach mir und ließ dann die Katze aus dem Sack:
Gestern hab ich mit Ergün geschlafen.
Das traf mich wie ein Blitz.
Ist jetzt mal wieder doof, daß ich Dir das nicht direkt erzählen kann, weil ich gern möglichst genau erklären möchte, wie das für mich war, und ich weiß nicht, ob ich das schriftlich alles so ausdrücken kann. Die Angst vor neuen Mißverständnissen und Spannungen hat mich zuerst auch zögern lassen, ob ich einfach meiner Lust nachgeben soll, und schließlich hab ich doch das »Luder« entscheiden lassen.
Ich mußte mich setzen.
Ergün und ich waren spazierengegangen und danach in einer Pinte. Ich hatte schon die ganze Zeit Lustgefühle gehabt. Was ich toll fand, war, daß ich mich ziemlich unverkrampft und natürlich gefühlt hab. Ich kam mir auch Monika gegenüber nicht komisch vor, die sich wahrscheinlich ihre Gedanken machte, als sie mitkriegte, daß Ergün hier übernachtet. Auch als ich mit ihm im Bett lag, hab ich mich ganz frei und natürlich gefühlt.
War irgendwie ulkig, Ergüns Körper zu spüren.
Ulkig!
Es war wie eine schöne zarte warme Dusche. Wenn ich mit Dir schlafe, geht das viel tiefer und ist hitziger. Ich liebe Dich und nicht Ergün. Und ich freue mich auch schon tierisch auf uns. Meine Güte, freu ich mich!
Für mich hat sich durch meine »Eskapade« Dir gegenüber nichts verändert. Ich liebe Dich immer mehr. Ich würde so gern wissen, was Du jetzt fühlst, wo Du das liest. Du merkst vielleicht, daß ich ein klein wenig Schiß habe.
Und dann war ich ja noch auf einem Rhetorik-Seminar. Das war echt super.
Na, das freute mich aber!
Es war wirklich heiß, sich auf Video zu sehen. Ich war immer unheimlich gespannt, wie ich wirke, und ich habe beim Anschauen gemerkt, daß ich ziemlich lebhaft reden kann, wenn ich meinen Standpunkt sicher vertrete. Ich hab zur Zeit das Gefühl, daß ich mich ganz schön weiterentwickele und daß Du mir unheimlich dabei hilfst …
Gleich will ich mir noch das Gelände ansehen, wo morgen die Ferienspiele beginnen, etwas Wilhelm Reich lesen, Türkisch lernen, Gudrun anrufen und dann mal kucken, was mir noch so einfällt.
Vielleicht Ergün besuchen? Und wie kam sie auf Wilhelm Reich?
Tausend Küsse, liebster Märchenprinz!
Unterschrift:
Dein Andrealuder
Erst der Knockout und dann eine Liebeserklärung.
Ergün! Dieser –
Stop. Wir hatten eine Vereinbarung, Andrea und ich, und –
Trotzdem. Dieser Schweinskerl! Robbte sich an Andrea heran, hinter meinem Rücken … schleimte sich bei ihr ein und …
Zu feige, dieser Typ, um den Kriegsdienst in der Türkei zu verweigern, aber mutig genug, um sich in meiner Abwesenheit an meine Freundin ranzumachen …
Andrea konnte ich nicht böse sein. Aber Ergün! Was dachte der sich? Dachte der sich überhaupt was? Oder wilderte der einfach blindlings in der mitteleuropäischen Frauenwelt, weil er bei den prüden türkischen Jungfrauen nicht landen konnte oder durfte?
Wie sollte ich den Achtstundentag überleben? Nach dieser Hiobspost?
Rolle einspannen, rumstehen, Etiketten aufpappen, Knöpfchen drücken und der Maschine zukucken …
Rolle einspannen, rumstehen, Etiketten aufpappen, Knöpfchen drücken und der Maschine zukucken …
Ich sah immerzu Andrea vor mir, wie sie sich für Ergün auszog.
Zum Kotzen.
The grunt of unity when he came in …
Was fand sie bloß an diesem Lumpenhund?
Rolle einspannen, rumstehen, Etiketten aufpappen, Knöpfchen drücken und der Maschine zukucken …
Meine verfluchte Bequemlichkeit. Ich hatte es mir viel zu gemütlich gemacht mit Andrea. War allein auf sie fixiert gewesen und keiner anderen Frau mehr nachgestiegen, obwohl ich dazu befugt gewesen wäre, gemäß unserer Abmachung, und nun wurde ich von den Ereignissen überrollt. Weshalb hatte ich mir nicht selbst eine Geliebte gesucht?
Weil ich dafür zu faul gewesen war. Ich hatte ja Andrea.
Und Andrea hatte außer mir jetzt auch noch Ergün. Und auf der Ersatzbank lauerten bestimmt noch andere Kandidaten auf ihr Einsatzzeichen.
Mitternacht. Andrea anrufen?
Zehnmal ließ ich es klingeln, bevor ich wieder auflegte.
Schlief sie? Oder –
Ich wollte reden. Ich rief Heike an, und die nahm sofort ab und hörte sich die ganze verworrene Story geduldig an.
Als ich damit durch war, sagte ich im Scherz: »Ach ja … in meiner schwersten Stunde …«
»So schlecht geht’s dir ja anscheinend gar nicht«, bekam ich zur Antwort.
Das verstimmte mich. Wenn ich in meiner Lage schon den heroischen Willen zur Selbstironie aufbrachte, dann wollte ich dafür gelobt werden! Aber da hatte ich Heikes Einfühlungsvermögen wohl überschätzt.
Um halb eins versuchte ich’s noch einmal bei Andrea. Und ich erreichte sie!
Mit einem längeren Telefongespräch wollte ich sie aber nicht in Verlegenheit bringen. Nein – ich wollte ihr nur einen Song von Dylan vorspielen, der ihr alles sagen sollte, wofür ich keine besseren Worte gefunden hätte, und ich hielt den Hörer dicht vor die eine der beiden Boxen.
Love is so simple, to quote a phrase,
You’ve known it all the time, I’m learnin’ it these days.
Oh, I know I can find you, oh, oh,
In somebody’s room.
It’s a price I have to pay.
You’re a big girl all the way …
Sieben Minuten dauerte der Song in dieser Live-Version. Ich hätte gern Andreas Gesicht gesehen dabei. Hörte sie überhaupt zu? Und konnte sie genug Englisch?
Sie freue sich auf unser für Ende Juni in Aachen geplantes Wiedersehen, sagte sie schließlich, und ich versicherte ihr, daß ich an sie dächte.
»Öfter, als mir lieb ist«, hätte ich hinzufügen können, doch das ließ ich klugerweise bleiben.
Stattdessen schrieb ich ihr, daß ich vorhätte, auch Ergün zu schreiben, weil ich eine Antwort auf die Frage haben wollte, warum er von Andrea, als er mit ihr zusammengewesen war, absolute Treue verlangt habe, während er jetzt den Casanova spiele.
Meine Schneidezähne hatten braune Furchen. Aus den Gelben Seiten suchte ich mir eine Zahnarztpraxis raus und machte einen Termin ab: 4.7.85, 11.30 Uhr.
Umziehen mußte man sich bei Tetra Pak in einer Art Container hinter dem Fabrikgebäude. Einheitliche Arbeitskleidung.
Neben dem Container türmte sich der Abfall aus fehlbedruckten Verpackungsmaterialmetern zu Bergen. Ökologisch gesehen der nackte Wahnsinn, Tag für Tag derartige Unmengen von Pappe wegzuwerfen. Wenn es in einer Industriegesellschaft schlechterdings nicht mehr möglich war, daß die Verbraucher mit der Milchkanne zum Bauern gingen, dann hätten sie doch ein Auge zudrücken können, wenn auf der Milchpackung aus dem Supermarkt ein Stückchen Wiese oder eine Kuh mal nicht so ganz die korrekte Farbe hatte!
Von der Realität wichen die Bildmotive sowieso kraß ab. Auf einer Open-Air-Weide geruhsam Halme zermalmende Kühe vor einer Kulisse aus Sonnenblumen, Fachwerkhäusern, Windmühlen und grünen Hügelketten am Waldessaum?
Post von Hermann:
Ein anstrengendes Wochenende hab ich hinter mich gebracht, das kann ich Dir aber flüstern, jawoll. Meine vernagelten Beziehungskistenprobleme will ich hier gar nicht darzulegen versuchen. Du weißt, ich fühle mich wie in einem Schraubstock mit zwei Hebeln (next turn more about it).
Aufregung bereiteten mir meine Eltern. Die haben mich nämlich besucht, und Du kannst Dir ausmalen, daß das Nerven gekostet hat – mindestens so viele, wie wenn Julius Nyerere die BRD besucht. Es war dann aber doch ganz nett, meinen Eltern die große weite Welt zu zeigen oder pars pro toto eben Göttingen.
Für Hermanns bodenständige, in Rütenbrock bei Haren im Emsland verwurzelte Eltern, die einer altehrwürdigen Dynastie von Handwerkern und Kleinbauern entstammten, kam ein Ausflug nach Göttingen einer Weltreise gleich. Ja, ich konnte mir ausmalen, wie schwer es Hermann gefallen war, vor diesem Familienstaatsbesuch jeden Schritt zu erwägen: Was soll es zu essen geben? Wie stellt man seinen Eltern die WG-Mitbewohner vor? Dürfen die beim Essen dabeisein oder muß man Angst davor haben, daß sie allzu lose Reden führen? Was soll man den Eltern von der Stadt zeigen? Genügt ein Gang über den Wall? Muß man sich für die von außen und von innen vollgeschmierte Uni schämen? Und für die Rauhbeinigkeit der Studenten?