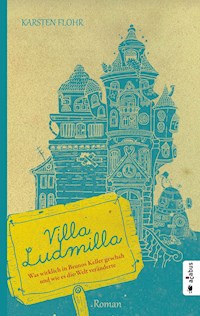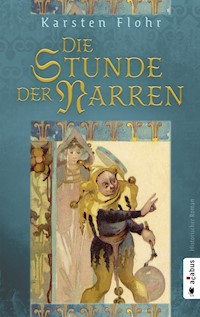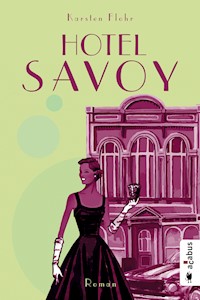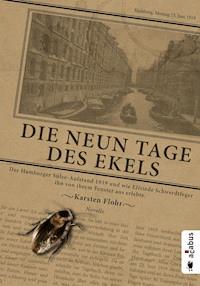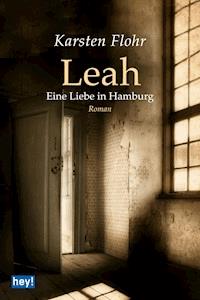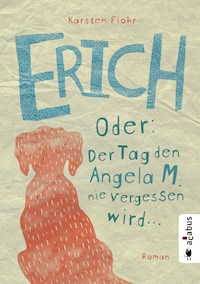
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acabus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Leben nimmt seinen gewohnten Gang, so scheint es: Rüdiger, der Supermarkt-Azubi, fürchtet, dass die Chefin seinen Wurst-Klau bemerkt haben könnte; Postbote Ahmed fiebert dem Treffen mit seiner geheimnisvollen Lieblings-Kundin entgegen; Taxifahrerin Bella hat mal wieder 'ne Stinkwut auf alle Männer dieser Welt; Herr Klose versucht weiterhin, den Tauben im Park Essmanieren beizubringen; Polizeiobermeister Mizerski hilft der alten Frau Kleinschmidt, ihre Konservendosen zu öffnen und erfährt dabei viel Wissenswertes über die Welt des Subatomaren; Bob Dylan kommt in die Stadt und bricht sich kurz vor seinem Konzert beim Fußballspielen ein Bein – das wird die große Stunde von Harry, dem Straßenmusiker! Doch der Schein des Alltäglichen trügt: Sie alle – und noch einige mehr, die uns in diesem Buch einen Tag lang an ihrem Leben teilhaben lassen – verfolgen nebenher in den Medien die Berichte über die mysteriöse Entführung von Erich, dem Hund der Bundeskanzlerin. Und als eine Zeitung glaubt, damit den großen Scoop landen zu können, läuft alles vollends aus dem Ruder. Ein Roman wie ein Film: Die "Kamera" begleitet einen Tag lang zwölf unterschiedliche Personen in ihrem täglichen Leben – und der Leser erfährt wie nebenbei, welch Ungeheuerlichkeit sich am Rande abspielt ... Manche Bücher kann man nicht aus der Hand legen, weil sie so spannend sind; andere, weil sie so herzerwärmend sind; wieder andere, weil sie so urkomisch sind: "Erich" gehört zu den Letzteren. Die Situationskomik, die liebenswerte Skurrilität der Menschen macht diesen scheinbar normalen Tag zu einem ganz besonderen, nämlich zu dem "Tag, den Angela M. nie vergessen wird" …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karsten Flohr
ERICH
Oder:Der Tag, den Angela M.nie vergessen wird
Roman
Flohr, Karsten: Erich. Oder: Der Tag, den Angela M. nie vergessen wird, Hamburg, acabus Verlag 2017
Originalausgabe
ePub-eBook: ISBN 978-3-86282-484-7
PDF-eBook: ISBN 978-3-86282-483-0
Print-Ausgabe: ISBN 978-3-86282-482-3
Lektorat: ds, acabus Verlag
Umschlaggestaltung & Illustration: Annelie Lamers
Bibliografische Information der
Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese
Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der acabus Verlag ist ein Imprint der Diplomica Verlag GmbH, Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.
© acabus Verlag, Hamburg 2017
Alle Rechte vorbehalten.
www.acabus-verlag.de
eBook-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmundwww.readbox.net
Für Erik und Karla (für später mal …)
Inhalt
1. Kapitel
„Rüdiger, bist du da drin?“
2. Kapitel
„Wir müssen jetzt mal die Hose wechseln.“
3. Kapitel
„Ich weiß alles über Sie.“
4. Kapitel
„Du bist meine Nachspeise.“
5. Kapitel
„Hast du Angst vor gelben Punkten ?“
6. Kapitel
„Ja, dann sag’ ich auch nichtsl“
7. Kapitel
„Du führst etwas im Schildel“
8. Kapitel
„Nun muss ich allmählich mal los.“
9. Kapitel
„Sie brauchen nicht so zu schreien.“
10. Kapitel
„Das wird man doch noch mal sagen dürfen.“
11. Kapitel
„Das machen wir jetzt jeden Tag.“
12. Kapitel
„Geht das nicht in eure Birnen!?“
13. Kapitel
„Pack die Klampfe aus!“
14. Kapitel
„Ist noch ein Likörchen da?“
Epilog
1. Kapitel
„Rüdiger, bist du da drin?“
Es muss schon eine Art Wunder geschehen, wenn er aus dieser Sache mit heiler Haut herauskommen will. Heute geht es für ihn um die Wurst, das weiß Rüdiger. Ja, um die Wurst. Seit vier Monaten arbeitet er als Auszubildender im Spar-Markt, und er hat seine Sache bisher gut gemacht. Das hat ihm die Filialleiterin mehr als einmal gesagt. „Gut, Rüdiger, das machst du prima“, hat sie gesagt. Gerade gestern erst wieder. Trotzdem: Er hat so ein Gefühl, als wisse sie von der Sache mit der Wurst. Und das ist schlecht. Denn stehlen ist natürlich das Letzte, was ein Angestellter bei Spar sich zuschulden kommen lassen darf, zumal ein Auszubildender.
Letzte Woche hat er mit eigenen Augen gesehen, wie eine altgediente Kassiererin gefeuert wurde. Was genau sie gemacht hatte, war nicht klar, aber irgendwas Schlimmes. „Das geht gar nicht!“, hatte die Filialleiterin empört gesagt, „Sie packen jetzt Ihre Sachen und gehen. Sie hören dann von der Personalabteilung.“
Ein furchtbarer Satz.
Rüdiger war in der Schule nicht der Hellste gewesen. Die meisten seiner Mitschüler machen eine Lehre bei der Sparkasse, eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann, einer hat sich bei der Polizei beworben und ist genommen worden. Rüdiger hat nach vielen Absagen den Job bei Spar bekommen: In der Gemüseabteilung ausfegen (wieso liegen dauernd Kohlblätter auf dem Boden?), aufwischen, wenn mal wieder eine Tüte aus dem Milchregal fällt (wer stapelt die so kippelig?), bei schlechtem Wetter den Eingangsbereich trocken halten (warum sind dort so rutschige Fliesen?). Erst letzten Monat ist dort eine junge Frau samt Kleinkind zu Boden gegangen. Zum Glück war Rüdiger an dem Tag nicht zuständig für den Eingangsbereich. Er hatte gerade im Hof Kartons zerrissen und zum Altpapier getan; die Filialleiterin findet, dass er das besonders gut kann.
Mit seinen 16 Jahren weiß er noch nicht viel vom Berufsleben, aber dass er bei seinem miserablen Zeugnis überhaupt einen Ausbildungsplatz bekommen hat, ist schon eine gute Sache, das weiß er zu schätzen. Ja, das weiß er wirklich, und gefeuert werden – das will er nicht.
Aber die Versuchung ist auch nicht zu unterschätzen. Schon seit seiner Kindheit ist er versessen auf Cervelatwurst mit Gesicht. Ein Tag war ein schlechter Tag, wenn seine Mutter keine im Kühlschrank hatte und ihm auf das Abendbrot legte. Aber meistens hatte sie welche. Rüdiger wartete dann immer, bis sie kurz raus ging, nahm dann die Wurstscheibe vom Brot, rollte sie wie eine Zigarre zusammen und stopfte sie sich in den Mund. Dann flitzte er zum Kühlschrank, nahm eine neue Scheibe heraus und legte sie aufs Brot, und wenn die Mutter in die Küche zurückkam und sah, wie er säuberlich mit dem Messer die Scheibe in kleine Quadrate schnitt und dann aß, lobte sie ihn für seinen Ordnungssinn.
Das war natürlich pädagogisch wertvoll, denn Ordnung halten ist das, was Rüdiger am wenigsten beherrscht. In dem Zimmer, das er für sich allein hat, seit seine große Schwester aus dem Haus ist – sie lernt Krankenschwester in einer anderen Stadt – herrscht gelinde gesagt Chaos, weniger gelinde gesagt: ein Spiegelbild der Wirrnis, die in seinem Kopf regiert. Doch seine Mutter hat auf der Familienseite der Fernsehzeitschrift gelesen, dass es keinen Zweck hat, ständig zu ermahnen und zu berufen, sondern dass es darauf ankommt, die wenigen Anlässe, die das Kind bietet, um gelobt zu werden, beim Schopf zu ergreifen und es ausgiebig zu loben. Das haben Wissenschaftler herausgefunden, also bitte!
Bei Spar liegt die Cervelatwurst in der Wursttheke ganz vorn hinter der Glasscheibe, damit die Kinder, die mit ihren Müttern oder Vätern davor stehen, sie genau vor der Nase haben und darum betteln, etwas davon zu bekommen. Die Verkäuferinnen sind von der Filialleiterin dazu angehalten, den Kindern eine Scheibe – genau so zusammengerollt, wie Rüdiger es liebt – über den Tresen zu reichen. Natürlich nicht, ohne die Eltern vorher zu fragen, ob das recht ist. Doch das ist es eigentlich immer, und die glücklichen Augen der Kinder veranlassen die Erwachsenen dann, hundert Gramm davon zu kaufen. Manchmal auch ein Viertel Pfund.
Rüdiger war schon nach wenigen Tagen seiner Ausbildung dazu übergegangen, den Wurstmädels, wie die Chefin sie nennt – obwohl zwei der drei Verkäuferinnen deutlich älter sind als sie selbst –, kurz vor Geschäftsschluss freiwillig beim Aufräumen zu helfen: Das heißt, den nicht verkauften Aufschnitt in Folie packen und ins Kühlfach legen. Er ist sich nicht ganz klar darüber, ob sie absichtlich weggucken, wenn er sich von der Cervelatwurst bedient, oder ob sie es wirklich nicht sehen. Auf jeden Fall stopft er sich den Mund voll, und wenn genug vorhanden ist, auch noch ein paar Scheiben in die Hosentaschen, die er dann auf dem Nachhauseweg isst. Das sind Glücksmomente pur.
Aber heute ist es anders: Die Cervelatwurst ist schon weg, als Rüdiger erscheint, um seine Hilfe anzubieten. Er betrachtet enttäuscht die Wurstauslage und hat das Gefühl, dabei beobachtet zu werden. Mit besonderem Eifer macht er sich daran, das Roastbeef einzusammeln, die ungarische Salami sowie die Hackbällchen, von denen sich Helga, die älteste der drei Damen von der Wursttheke, im Laufe des Tages immer mal wieder ungeniert eines in die Backen schiebt. Dieser Beobachtung ist es überhaupt erst zu verdanken, dass Rüdiger den Mut aufbrachte, mit der Cervelatwurst ebenso zu verfahren.
Nun ist die Wurst nicht mehr da. Und die Filialleiterin steht wenige Meter entfernt und beobachtet ihn; er sieht das aus den Augenwinkeln und ist sich sicher, dass sie seine Reaktion genau registriert. Er muss also total cool sein. Sich nichts anmerken lassen, absolut gar nichts.
Als die Theke leergeräumt ist, sieht er verstohlen in ihre Richtung. Sie steht nicht mehr da.
Ihr Name ist Frau Weihrauch und sie mag Rüdiger, das spürt er ganz klar. Aber genau deshalb fürchtet er sie. So ist es schon in der Schule gewesen: Lehrer, die ihn, den im Kopf etwas langsamen Rüdiger, mochten, schüchterten ihn ein. Mehr als diejenigen, die ihn hin und wieder zusammenstauchten, wenn er aus dem Fenster sah und nichts verstand von dem, was sie erzählten, weil er nämlich mit seinen Gedanken ganz woanders war. Wenn sie ihn anraunzten, setzte er sich aufrecht und machte ein konzentriertes Gesicht, wusste aber trotzdem nicht auf ihre Fragen zu antworten. Aber die, die ihn mochten, die wollte er keinesfalls enttäuschen. Und deshalb hatte er immer besondere Angst vor diesen Stunden. Herr Schmude zum Beispiel, der Erdkundelehrer, der ihn immer so aufmunternd ansah und ihn, wenn er sich mal meldete, sofort drannahm – was war es für ein furchtbares Gefühl, wenn er dann die falsche Antwort gab! Und noch furchtbarer, wenn Herr Schmude so tat, als wäre die Antwort gar nicht vollkommen falsch und mit ein paar korrigierenden Worten eine richtige Antwort daraus machte und Rüdiger lobte. Dann schämte er sich.
Frau Weihrauch also: Wenn sie seine Wurst-Exzesse bemerkt haben sollte – noch ist es ja nicht klar, sondern nur ein Verdacht – aber wenn: Was würde sie tun?
Ihm wird schwarz vor Augen, als er im Angestelltenaufenthaltsraum für Herren seinen Spind öffnet und seine Privatkleidung herausnimmt, um sich für den Nachhauseweg umzuziehen. Er zieht sich gerade das Spar-Sweatshirt über den Kopf, was er hasst, weil der enge Halsausschnitt seine David-Beckham-Frisur zerstört, da klopft es. Und dann hört er sie sagen: „Rüdiger, hast du mal einen Moment für mich?“
Er muss sich hinsetzen, weil seine Beine vor Schreck einknicken. Das war schon von Klein auf eines seiner Probleme: diese extreme Schreckhaftigkeit! Seine Eltern hatten sich wenige Tage nach seiner Geburt getrennt, seine große Schwester peinigte ihn später öfter damit, dass sie ihm sagte, der Vater sei nur deshalb gegangen, weil er eigentlich wollte, dass Rüdiger den Namen Georg erhalten sollte, dem Fußballer Schwarzenbeck zu Ehren, den zwar keiner mehr kennt, der aber eine Lottoannahmestelle hatte und ohne den Franz Beckenbauer, so meinte der Vater, ein Niemand geblieben wäre. Das hatte die Mutter rundheraus abgelehnt, behauptete die Schwester, und nun erlitt Rüdiger jedes Mal einen Zitteranfall, wenn jemand den Namen Georg aussprach. Das war sehr schlimm, denn allein in seiner Klasse gab es vier davon, und immer, wenn einer von ihnen aufgerufen wurde, bekam Rüdiger einen Schluckauf und seine Knie zitterten.
Ein anderes Problem ist seine Fixation, wie die Mutter es nennt: Der Umstand, dass er seinen Blick oftmals nicht von einem Gegenstand losreißen kann, wenn er ihn erst einmal ins Visier genommen hat. Festgeklebt, hat Rüdiger als kleines Kind dazu gesagt, seine Augen seien festgeklebt. Er sieht zum Beispiel die Butter an, die auf dem Frühstückstisch steht, und kann den Blick nicht mehr davon lösen. Er sieht den betreffenden Gegenstand in solchen Momenten so überdeutlich, so glasklar und empfindet ihn als so überwältigend, dass er ihn für die ganze Welt hält. Im Grunde ist es ein schönes Gefühl, und er leidet darunter, wenn die Mutter ihn auffordert, etwas anderes anzusehen. Problematischer war es dann in der Schule, wenn er aus dem Fenster sah und einen Vogel im Baum auf der anderen Straßenseite entdeckte und seinen Blick nicht mehr von ihm abwenden konnte.
Der Trick, der dann am besten half, war, Rüdiger zu erschrecken. Seine Mutter tat das ungern, denn zu sehen, wie ihr Sohn zusammenfuhr und kreidebleich wurde, war schmerzlich für sie. Sie suchte dann meistens einen Weg, ihm den Schrecken schmackhaft zu machen, zum Beispiel, indem sie ein Stück Cervelatwurst vor sein Gesicht hielt und „Wurst!“ rief. Vermutlich ist so seine Cervelatwurst-Obzession entstanden, aber das nahm sie billigend in Kauf.
Und nun will Frau Weihrauch ihn sprechen. Vermutlich wegen der Wurst. Sie hat es also gesehen, sie weiß von seinen Diebstählen! Er blickt sich im Raum nach einem Fluchtweg um, das Fenster zum Beispiel. Aber das ist von außen vergittert, um Einbrecher fernzuhalten. Das ist natürlich vernünftig, aber in diesem Augenblick eine Katastrophe. Denn Rüdiger hat nur einen Wunsch: fliehen. Es gibt jedoch nur die Tür, und davor steht Frau Weihrauch.
„Rüdiger, bist du da drin?“
Zugegeben, sie ist dick und hat einen Watschelgang. Aber das stört Rüdiger nicht. Er sieht an ihr eigentlich nur die leicht wässrigen blauen Augen, mit denen sie ihn so freundlich anzusehen pflegt und von denen er seinen Blick nicht lassen kann, wenn sie zu ihm heruntersieht. Und das muss sie, denn Rüdiger ist klein und schmächtig, und sie ist groß und raumfüllend. Ihre Augen sind anders als die Butterdose auf dem Frühstückstisch. Frau Weihrauchs Augen scheinen ihn aufzusaugen, er hat das Gefühl, in sie hineinzufliegen. Ganz ohne Angst ist dieses Gefühl, denn diese Augen verheißen eine schöne Welt, eine gütige Welt, eine friedliche Welt. Ja, so sind Frau Weihrauchs Augen.
„Ja“, antwortet er; es ist mehr ein Hauchen, aber sie hört es trotzdem durch die geschlossene, feuerfeste Eisentür.
„Das ist gut, ich wollte dich um etwas bitten, falls du noch ein wenig Zeit hast.“
Also nicht die Wurst? Worum geht es, um was will sie ihn bitten?
„Ich komme.“
Ihre blauen Augen sehen ihn an, als er vorsichtig öffnet. „Deine Frisur!“, ruft sie, „du siehst ja noch viel besser aus als David Beckham.“
„Echt?“
„Sonst würd’ ich es nicht sagen. Einfach klasse.“ Sie deutet nach hinten zu den Kassen, die gerade geschlossen werden. Eine Kundin steht dort noch und redet mit Frau Biel, der Kassiererin, die den ganzen Tag lang so seltsam spitze Lippen macht, als würde sie genussvoll einen winzig kleinen Bonbonrest auflutschen, was sie aber nach Rüdigers Ansicht nicht tut, denn er hat sie noch nie ein Bonbon in den Mund stecken sehen.
„Die alte Frau Kranich“, sagt die Filialleiterin, „du kennst sie ja. Hat wieder den ganzen Einkaufswagen voll mit Vorlagen für ihren Mann, und nun weiß sie nicht, wie sie die alle nach Hause kriegen soll. Hilfst du ihr? Du hast ihr ja schon mal die Sachen getragen, wenn ich mich nicht irre.“
„Hab ich.“
„Hast du Zeit? Ihr Mann braucht die Vorlagen, sagt sie. Sie gibt dir sicherlich Trinkgeld. Sie wohnt nur zwei Straßen weiter, das geht schnell.“
„Mach ich.“
So ganz schnell geht es dann doch nicht, denn Frau Kranich ist hoch in den Achtzigern und geht sehr langsam, echt langsam, findet Rüdiger. Aber das ist okay, Hauptsache, die andere Sache ist aus der Welt. Wenn sie es denn ist.
„Mein Urenkel hat auch so eine Frisur wie du“, sagt Frau Kranich, als sie vor der Ampel stehen und sie ein wenig zu Atem kommt. Beim Gehen kann sie nicht sprechen. „So richtig schön verwuschelt. Wie macht ihr das?“
„Den Pullover übern Kopf ziehen.“
„Nein!“, sagt sie, ehrlich erstaunt. „So einfach?“
„Ja.“
„Na, bei meinem Mann hilft das auch nicht mehr. Aus seinen drei Haaren kann man keine Frisur mehr machen.“ Und dann erzählt sie Rüdiger, dass es ohnehin mühsam ist, ihn an- und auszuziehen. Er ist jetzt 95 und hat immer noch die Gewohnheit, sich morgens gut anzuziehen, wie damals, als er noch ins Büro ging. Nur dass er sich nicht mehr selber anziehen kann. „Die Krawatte habe ich ihm ausgeredet, er trägt jetzt Rolli. Wir können uns nie einigen, ob zuerst der Kopf oder erst die Arme. Du weißt schon, was ich meine. Wie machst du das?“
Die Ampel zeigt jetzt Grün.
„Erst Kopf“, sagt Rüdiger.
„Find ich auch. Aber – na egal. Viel wichtiger ist, dass wir jetzt wieder genügend Vorlagen im Haus haben. Manchmal muss ich sie ihm stündlich wechseln.“
Sie beginnt wieder zu schnaufen, während sie gebeugt mit ihren Trippelschritten neben Rüdiger geht. „Lass uns im Gleichschritt gehen, dann komme ich nicht so leicht ins Stolpern“, keucht sie. Das machen sie, und Rüdiger guckt sich um, ob jemand ihn dabei beobachtet. Er hat das Gefühl, eine ziemlich alberne Figur abzugeben, wie er da so trippelt, aber es scheint niemanden zu interessieren.
Zum Glück wohnt Frau Kranich im Erdgeschoss, gleich links hinter dem Eingang. Zum Glück für sie, denn die Treppen nach oben würde sie nicht schaffen, denkt Rüdiger, und sie tut ihm leid. Sie schließt schwer atmend die Tür auf, und er trägt die Pakete in die Küche, wobei er an der Stube vorbeikommt, wo Herr Kranich vor einem Computer sitzt. Ein altes Modell mit ausladendem Gehäuse, das den ganzen Tisch in Anspruch nimmt. Er starrt gebannt hinein. „Trude?“, ruft er, „das musst du dir ansehen! Hier, Spiegel-online: Sie haben den Hund von der Kanzlerin geklaut. Mit wem redest du da?“
„Der Junge vom Spar-Markt. Er hat mir tragen geholfen. Und er ist ganz meiner Meinung.“
„Welche Meinung?“
„Erst den Kopf!“, sagt sie, während sie in der Küche stehend ihr Portemonnaie hervorkramt und Rüdiger zwei Euro gibt. „Zuerst den Kopf in den Pullover und dann erst die Arme! Stimmt doch, oder?“
„Genau“, sagt Rüdiger. Und: „Danke, Frau Kranich. Wenn Sie mal wieder was zu tragen haben …“
„Nun komm schon!“, hört er Herrn Kranich rufen, als er die Wohnung verlässt. „Guck dir das mal an hier. Der Hund ist weg.“
Seine Mutter ist schon da, als Rüdiger nach Hause kommt. Das ist unüblich. Ihr Tagesdienst in der Funktaxizentrale geht normalerweise bis 19 Uhr. Und sie sieht ihn so seltsam an. Oh nein!, denkt er, hat Frau Weihrauch sie wegen der Wurst informiert?
Es geht dann tatsächlich um die Wurst, aber ganz anders. „Ich hab was für dich!“, sagt die Mutter so freudig, als habe ihr selbst jemand etwas mitgebracht. Rüdiger bekommt ein schlechtes Gewissen: Er sollte ihr mal was mitbringen, schießt es ihm durch den Kopf, sie bekommt so selten etwas geschenkt. Sie geht an den Kühlschrank und nimmt einen Teller heraus, den sie mit ausladender Geste auf den Tisch stellt. Darauf liegt ein großer Haufen Cervelatwurst mit Gesicht. „Ich war vorhin bei euch im Laden, als du gerade die Kartons in den Papiercontainer gebracht hast. Hast mich nicht gesehen. Und da hab ich die für dich gekauft – der gesamte Rest! 755 Gramm. Kannst sie ruhig zusammenrollen.“
2. Kapitel
„Wir müssen jetzt mal die Hose wechseln.“
„Ja“, ruft Trude Kranich, „ich komme gleich! Das wird schon nicht weglaufen.“
„Nein, nicht weggelaufen. Man hat ihn geklaut! Ge-stoh-len …“
„Was soll ich holen?“
Sie wartet die Antwort nicht ab, sondern geht seufzend in die Knie, um die Vorlagen unten im Küchenschrank zu verstauen. Natürlich ist das unpraktisch, das ist ihr klar, viel besser lägen die Dinger im Schlafzimmerschrank, dann hätte sie einen kürzeren Weg, wenn sie nachts hoch muss, um Hubertus trocken zu legen. Aber er bekommt jedes Mal einen Wutanfall, wenn er an den Kleiderschrank geht, um seine Krawatten zu inspizieren und dabei sein Blick auf die Pakete fällt.
Deshalb ist sie dazu übergegangen, sie in der Küche zu verwahren. Hier kommt er nie hin, denn die Tür ist für seinen Rollator zu schmal. Sicher, mit etwas Geschick und Wendigkeit könnte man ihn hindurch manövrieren, aber darüber verfügt Hubertus nicht mehr. Eigentlich widersinnig, findet Trude, die Küchentür sollte die breiteste in der Wohnung sein! Man würde dann mit dem Essentablett frontal hindurchgehen können, anstatt sich seitlich hindurchzuzwängen. Neubau halt, denkt sie, so ist das heute. Wir hätten in der Altbauwohnung bleiben sollen mit den schön breiten Türen. Aber dort wohnen jetzt die Enkelkinder mit ihren Kindern, sie können den Platz gut gebrauchen.
Wutanfall ist genau genommen nicht das richtige Wort. Hubertus Kranich hat eigentlich noch nie im Leben einen Wutanfall gehabt. Es ist etwas anderes bei ihm, eine Art Starre, bei der er die Fäuste ballt, den Kopf in den Nacken legt und kleine, hohe Töne ausstößt. Das kann bis zu einer Minute dauern. Anschließend ist er vollkommen erschöpft und der Schweiß steht ihm auf der Stirn. Manchmal lässt er dabei den Rollator los, was dazu führt, dass er das Gleichgewicht verliert und auch schon mal zu Boden fällt.
Abgesehen von diesen „Momenten“, wie Trude Kranich es nennt – Hubertus hat heute wieder einen Moment gehabt, sagt sie, wenn sie jemandem davon erzählt, zum Beispiel abends am Telefon, wenn sie mit ihrer Tochter spricht –, ist er ein durch und durch friedlicher Mann. Deshalb hat sie ihn überhaupt geheiratet, damals gleich nach dem Krieg. Die jungen Männer aus der Nachbarschaft gebärdeten sich laut, großspurig und betont sorglos, wenn sie Heimaturlaub von der Front hatten, so als würden sie für die Wochenschau gefilmt und wollten zeigen, welch ganze Kerle der Krieg aus ihnen gemacht hatte. Anders Hubertus: Er hielt sich still abseits, war höflich und zuvorkommend, sagte Bitte und Danke und rührte keinen Alkohol an.
Dass er der Richtige für sie sein könnte, dämmerte Trude, als sie eines Tages im Luftschutzkeller beobachtete, wie er für mehrere verstörte Kleinkinder aus seiner Pelerine ein Zelt machte, um sie vor dem herabrieselnden Mörtel zu schützen. Trude kommen jedes Mal die Tränen, wenn sie sich daran erinnert, auch heute noch.
Das Zeltbauen wuchs sich dann später zu einer Leidenschaft aus, wenn Hubertus zum Beispiel bei strömendem Regen mit seinen eigenen Kindern im Garten unter der Zeltplane saß und sie zusammen Regen-Lieder sangen, die er selbst erfunden hatte. Es gab Zeiten, in denen die Kinder hofften, am Wochenende würde es regnen, nur damit er wieder mit ihnen das Zelt aufbaute und sang. In Trudes Erinnerung regnete es oft damals.
Auch in den Aufbaujahren war Hubertus anders als die anderen. Während die meisten Männer ihre Energien, die sie zuvor in die Errichtung eines Weltreiches investiert hatten, nun in das Wirtschaftswunder umleiteten und sich dafür mit Autos, Fernsehern und Rasenmähern belohten, erwachte sein Interesse für die Kriegsgräberfürsorge. Gemeinsame Reisen nach Frankreich, Spanien und Nordafrika, aber auch in die deutsche Provinz, wo es französische, spanische und afrikanische Gräber zu pflegen gab, gefielen Trude. Und während sie ehrenamtliche Helferin wurde, die Basare und Spendenaktionen organisierte, stieg er hauptamtlich ein. Nach wenigen Jahren wurde er Vorsitzender des Kriegsgräber-Verbandes.
Und dann kam als nächster, folgerichtiger Schritt die Entwicklungspolitik. Auch hier bekleidete Hubertus in kürzester Zeit wichtige Ämter; Konferenzen überall in der Welt, zu denen er Trude oft mitnahm, wurden Routine. Einmal wurde ihm sogar die Präsidentschaft des Roten Kreuzes angeboten, was er ablehnte. Dort seien zu viele Altnazis untergeschlüpft, fand er.
Sein Name wurde bekannt, Hubertus Kranich war häufig in der Zeitung zu sehen, er avancierte zum neuen guten Gesicht der Deutschen, war überall auf der Welt willkommen und nahm nie auch nur ein einziges Bestechungsgeschenk an. Nur einmal – eine Reise nach Ruanda, an der Trude wegen der ersten Schwangerschaft nicht teilnehmen konnte – brachte er etwas für sie mit: Ein Elefantenhaararmband, das er am Flughafen Köln-Bonn gekauft hatte.
Als Beate, das erste Kind, zur Welt kam, weilte Hubertus in Dänemark bei einer Konferenz über die Bürgerrechte der Grönländer. Er telegrafierte seine sofortige Heimkehr, Trude telegrafierte zurück: Bleib, sie schläft sowieso ständig. Er kam aber trotzdem.
Die rechte Tür des Küchenschrankes geht nicht zu, also nimmt Trude eines der Pakete wieder heraus, richtet sich mühsam auf und geht mit den Vorlagen in der Hand in die Stube. Hubertus spielt inzwischen Tetris. „Also – wer ist geklaut worden?“
„Geklaut? Ich glaube, der Postbote klaut. Mein Päckchen müsste doch schon längst angekommen sein.“
„Was hast du denn schon wieder bestellt?“
„Na ja, heute Morgen, ich weiß nicht mehr. Es war so günstig bei Amazon. Klebeband, glaube ich. Ja, Klebeband!“
„Klebeband.“
„Ja, zum kleben. Ich bin jetzt im siebenten Level!“
„Das ist gut!“
„Jetzt wird’s aber wirklich schwer.“ Seine Finger sausen über die Tasten, und dann ist Schluss – er ist nicht schnell genug gewesen. Er ballt die Fäuste und legt den Kopf in den Nacken. Und dann nässt er ein.
„Nicht ärgern“, sagt Trude, „fang einfach noch mal von vorn an, nachher. Dann schaffst du auch bald das achte Level.“
Sie wartet, bis sein „Moment“ vorüber ist, dann dreht sie seinen Stuhl zur Seite und zieht ihm die Hausschuhe aus. „Wir müssen jetzt mal die Hose wechseln“, sagt sie und stellt das Paket mit den Vorlagen neben sich auf den Boden. Hubertus schließt die Augen und lässt es geschehen.
„Wenn du das Klebeband heute bestellt hast, dann kann es noch nicht da sein, Hubertus. So schnell sind die nun auch nicht. Was willst du denn kleben?“
„Sag nicht Hubertus.“
„Warum nicht?“
„Das sagst du nur zu mir, wenn du böse bist.“
„Ich bin nicht böse. Warum sollte ich böse sein?“
„Das kann man nie wissen.“
Da ist natürlich was dran. Zum ersten Mal hat Trude zu diesem Mittel gegriffen, als sie gemeinsam bei einem Empfang beim Schah von Persien waren – übrigens eine Reise, die Hubertus Kranichs Karriereverlauf einen leichten Knick zugefügt hatte. Aber nur einen leichten, denn kurz danach avancierte er vom Referent im Ministerium für Entwicklungshilfe zum Staatssekretär, nachdem es ihm gelungen war, den Potentaten einer gerade in die Unabhängigkeit entlassenen afrikanischen Republik davon abzubringen, 100 Schulkinder mit der Machete zerstückeln zu lassen, um damit der Welt seine Unabhängigkeit zu beweisen. Hubertus, der wegen eines Brunnenbauprojektes in diesem mit Bodenschätzen reich gesegneten Land weilte, deretwegen die CIA und der französische Militärgeheimdienst rivalisierende Einheimische mit Waffen versorgten und aufeinander hetzten, hatte ihm in einem Vier-Augen-Gespräch klar gemacht, dass vermutlich mehr als jedes zweite der hundert Schulkinder sein eigen Fleisch und Blut war. Der Potentat hielt sich daraufhin an Hühnern schadlos, was der Bevölkerung in den höher gelegenen Regionen des Landes eine Hungersnot bescherte. Aber darüber stand nichts in der Zeitung, und Hubertus wurde in der Presse als Kindesretter gefeiert.
Noch zwei Wochen zuvor war seine Persien-Reise als äußerst fragwürdig angeprangert worden, weil der Mann auf dem Pfauenthron sich offen als Anhänger Hitlers zu erkennen gegeben hatte. Ja, so ist sie, die Presse, hatte Hubertus gesagt.
Für Trude jedoch war etwas anderes vollkommen inakzeptabel, nämlich dass Hubertus während der zweiminütigen Audienz beim Schah die Stirn besessen hatte zu sagen: „Das mit Soraya muss aber noch mal auf die Agenda.“
„Hubertus!“, hatte sie gezischt, ihren Mann am Ellenbogen gepackt und außer Hörweite des Herrscherpaares verbracht, das mittlerweile schon zwölf anderen Besuchern die Hände geschüttelt hatte. Trotzdem befürchtete Trude, dass Farah Diba gehört haben könnte, was Hubertus da gesagt hatte, und erst als das Flugzeug auf der Rückreise nach Bonn abgehoben hatte, legte sich ihre Angst vor einer Last-Minute-Verhaftung. Sie stellte die Rücklehne zurück und entspannte sich. „Du bist mir einer, Kranich“, sagte sie, „sowas kann man da doch nicht sagen!“ Und er atmete tief aus vor Erleichterung darüber, dass sie ihn wieder mit seinem gewohnten Namen ansprach.
„Und was ist mit diesem Hund?“, fragt sie nun. „Wer hat den gestohlen?“
„Der Hund der Kanzlerin – du weißt schon, diese Frau da, wie heißt sie noch? Egal: Kaum waren sie im Kanzleramt eingetroffen heute Morgen, sie und der Hund, da war er weg. Es gab eine riesige Suchaktion.“
„Aber das muss doch nicht heißen, dass er gestohlen wurde. Vielleicht hat er sich verlaufen. Oder er ist in einen Reißwolf gefallen, davon haben die viele im Kanzleramt.“
„Aber dann wäre keine Lösegeldforderung eingegangen …“
Trude erwidert nichts, räumt im Stillen ein, dass das eine gewisse Logik hat, und zieht ihrem Mann die Trainingshose hoch. „So!“, sagt sie, mit kurzem „o“: „So!“
„Was?“
„Alles wieder trocken.“
„Wenn ich doch nur die Klebebänder schon hätte“, greint Hubertus.
„Die kommen morgen. Unser netter Postbote, der macht das“, beruhigt Trude ihn und schlägt sein Bett auf. Es ist ein Krankenhausbett, angenehm hoch. Um aufzustehen, braucht man nur von der Bettkante zu gleiten und schon steht man senkrecht. Und mit Herausfall-Schutz: Ein umlaufendes, abnehmbares Gitter verhindert das Herausfallen des Schlafenden. Es steht im Wohnzimmer mit Blick zum Balkon. „Und jetzt ist Schlafenszeit. Noch eine Runde Tetris, dann wird das Licht ausgemacht.“
„Eine Million wollen die.“
„Wer?“
„Die Entführer.“
„Das muss ja ein toller Hund sein“, sagt Trude und verlässt das Zimmer, nicht ohne ihm eine Kusshand zuzuwerfen.
„Morgen kommt das Klebeband“, murmelt er müde und nimmt Tetris in Betrieb.