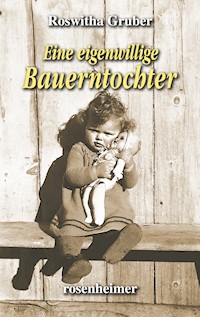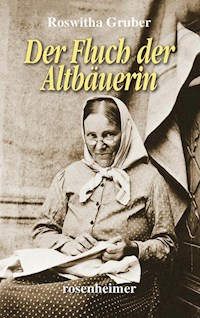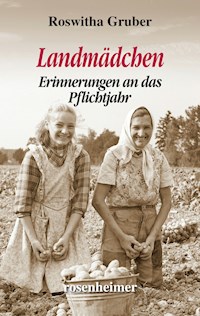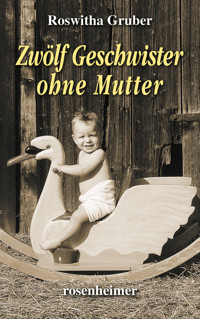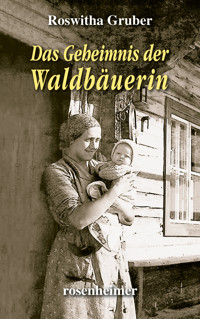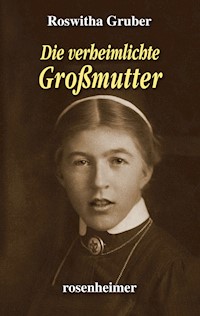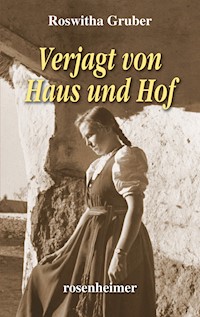16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Marianne Feldmoser hat als "Sprengelhebamme" in den österreichischen Bergen über 3000 Kindern geholfen, das Licht der Welt zu erblicken. Auf einsamen und schwer erreichbaren Berghütten oder in versprengten Siedlungen stand sie den Frauen bei der Geburt zur Seite. Dabei hat sie Aufregendes, aber auch Schmerzliches erlebt. Sei es die glückliche Geburt eines Stammhalters oder eine in Not geratene siebenfache Mutter - das bewegende Schicksal der Menschen, die sich Marianne anvertraut haben, geht jedem nahe. Die Bestsellerautorin Roswitha Gruber widmet sich der Schilderung starker Frauen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten. Für jeden ihrer Romane recherchiert sie ausführlich und nähert sich in langen, intensiven Gesprächen dem Schicksal ihrer Protagonistinnen an. Roswitha Gruber lebt und arbeitet in Reit im Winkl.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
LESEPROBE zuVollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2012
© 2014 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheimwww.rosenheimer.com
Lektorat: Ulrike Nikel, Herrsching am Ammersee
Titelfoto: Superbild / KEY
Satz: Bernhard Edlmann Verlagsdienstleistungen, Raubling
eISBN 978-3-475-54328-9 (epub)
Worum geht es im Buch?
Roswitha GruberErlebnisse einer Berghebamme
Marianne Feldmoser hat als »Sprengelhebamme« in den österreichischen Bergen über 3000 Kindern geholfen, das Licht der Welt zu erblicken. Auf einsamen und schwer erreichbaren Berghütten oder in versprengten Siedlungen stand sie den Frauen bei der Geburt zur Seite. Dabei hat sie Aufregendes, aber auch Schmerzliches erlebt.
Sei es die glückliche Geburt eines Stammhalters oder eine in Not geratene siebenfache Mutter – das bewegende Schicksal der Menschen, die sich Marianne anvertraut haben, geht jedem nahe.
Die Bestsellerautorin Roswitha Gruber widmet sich der Schilderung starker Frauen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten. Für jeden ihrer Romane recherchiert sie ausführlich und nähert sich in langen, intensiven Gesprächen dem Schicksal ihrer Protagonistinnen an. Roswitha Gruber lebt und arbeitet in Reit im Winkl.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Die freudige Nachricht
Die Sache mit dem Plumpsklo
Problemfall Frühgeburt
Eine himmlische Fügung
Fiakerkinder
Fannys denkwürdige Entbindungen
Zwillinge hoch zwei
Ein Festmahl für die Hebamme
Eine erstaunliche Erstgebärende
Nachtwanderungen
Ein fleißiger Mann
Glück gehabt
Ein rätselhafter Unfall
Das ungewollte Kind
Die Kusinen
Der Misttrak
Angst
Ein Sonnenschein
Das Räuscherl
Die schwangere Hebamme
Das Kind von der Brücke
Ein Traum in Rosa
Das »Münchner Kindl«
Die Aussteiger
Friede auf Erden
Vorwort
Hebammen waren und sind äußerst wichtige Personen. Seit Jahrhunderten stehen sie Müttern in ihrer schweren Stunde bei, verfügen seit jeher über umfangreiches Wissen, weshalb sie früher auch weise Frauen genannt wurden. Sie helfen dem Kind, heil und unversehrt ans Licht der Welt zu kommen. Sie halten es als Erste in den Händen, entlocken ihm oftmals den lebensnotwendigen, befreienden Schrei, bevor sie es der Mutter in den Arm legen.
Mit der Zeit hat sich jedoch das Berufsbild erheblich gewandelt.
War man vor hundertfünfzig Jahren noch stolz darauf, dass endlich jedes Dorf seine eigene qualifizierte Hebamme besaß, so setzte bereits knapp ein Jahrhundert später eine gegenläufige Entwicklung ein. Geburten fanden mehr und mehr in Kliniken und Geburtshäusern statt – nicht nur in den Städten, sondern auch in ländlichen Regionen.
So kommt es, dass der Beruf der Berghebamme inzwischen ausgestorben ist. Ich jedoch hatte das große Glück, der Marianne Feldmoser zu begegnen, die viele Jahre in den österreichischen Bergen gewirkt und in ihrem Sprengel über dreitausend Kindern ans Licht der Welt verholfen hat. Sie erzählte mir von ihrer Tätigkeit immer wieder mit so viel Begeisterung und Herzenswärme, dass ich beschloss, ihre Geschichte und ihre Geschichten auch anderen zugänglich zu machen. Sie haben bereits zahllose begeisterte Leser gefunden.
Jetzt habe ich die Nanni, wie sie allgemein liebevoll genannt wird, erneut besucht und sie gebeten, mir weitere Begebenheiten aus ihrem langen Berufsleben zu erzählen: anrührende und nachdenkliche, heitere und traurige, aber auch originelle und skurrile. Geschichten eben, die das Leben geschrieben hat, die vom Schicksal der Menschen erzählen, mit denen und für die die Nanni gelebt hat, die sie brauchten und die sich ihr anvertrauten.
Wir hören von der Freude über die glückliche Geburt eines Stammhalters ebenso wie von der verzweifelten Lage einer ledigen Mutter. Wir hören über dramatische Geburten und über die abenteuerlichen Wege der Hebamme bei Wind und Wetter, bei Schnee und Eis. Immer wieder geht es um Freud und Leid, um Glück und Unglück.
Und es wird uns ein intensiver Einblick vermittelt in die Lebenswelt abgelegener Bergregionen, wo die Uhren anders gingen und viel Wert gelegt wurde auf Traditionen und Gebräuche, die von Urväter Zeiten überliefert waren. Eine Hebamme wie die Marianne Feldmoser, die bei der Geburtshilfe »neumodischen Kram« einführen wollte und musste, hatte da nicht immer einen leichten Stand, vor allem nicht auf den einsamen Berghöfen, auf denen moderne medizinische Erkenntnisse ebenso wie technischer Fortschritt nur ganz langsam akzeptiert wurden. Wie die Nanni diesen Spagat schaffte, ist bewundernswert – und amüsant zu lesen.
Nun aber soll sie endlich selbst zu Wort kommen, und ich wünsche allen, die dieses Buch in die Hand nehmen, beim Lesen ebenso viel Freude, wie ich sie bei meinen Gesprächen mit der alten Hebamme und bei der Niederschrift ihrer Geschichten hatte.
Roswitha Gruber
Die freudige Nachricht
Ich war, was man heute eine Spätberufene nennen würde, denn ich machte meine Hebammenausbildung erst, als ich bereits verheiratet und Mutter zweier Kinder war. Vorher schien dieser Lebenstraum in unerreichbarer Ferne zu liegen. Mädchen erlernten damals keinen Beruf, schon gar nicht die Töchter von Bergbauern. Sie arbeiteten im elterlichen Haushalt, halfen in der Landwirtschaft oder verdingten sich als Mägde, bis sie einen braven Mann fanden.
Aber das Schicksal war mir gewogen, und es wies mir einen Weg, wie sich mein sehnlichster Wunsch doch noch erfüllen konnte. Und so trat ich eines Tages, erwartungsvoll und bang zugleich, meine erste Stelle an.
Der Sprengel, in den es mich auf eigenen Wunsch verschlagen hatte, lag mitten in den Salzburger Alpen, in einem engen Nord-Süd-Tal. Drei Dörfer waren es, die ich versorgen sollte, zwischen neun- und elfhundert Metern hoch gelegen und zu beiden Seiten von steil aufragenden Zweitausendern flankiert. Ich war in diesen Bergen aufgewachsen, in einem Nachbartal, und ich hatte nie etwas anderes gewollt, als hier in diesen abgeschiedenen ländlichen Gebieten als Hebamme zu arbeiten, mich um Menschen zu kümmern, deren Leben und Probleme mir vertraut waren, weil ich dazugehörte.
Natürlich hatte ich gut gemeinte Warnungen erhalten, wie viel anstrengender die Tätigkeit einer Berghebamme sei als die der Kolleginnen in den Krankenhäusern, doch ich ließ mich nie beirren. Zum Glück. Natürlich kostete es, besonders im Winter, bisweilen Überwindung, wenn ich des Nachts weite und beschwerliche Wege zurücklegen musste, bis ich bei werdenden Müttern auf entlegenen Höfen ankam. Zur Entbindung wurde ich zwar meist von den Bauern mit irgendeinem Gefährt abgeholt, doch an den anschließenden zehn Tagen der Wochenpflege musste ich schauen, wie ich zu den Einödhöfen kam – zu Fuß natürlich, egal ob es regnete, stürmte oder schneite oder ob die Sonne unbarmherzig auf mich niederbrannte.
Doch die langen Wege stellten nicht nur für mich eine gewisse Mühsal dar, sondern konnten bei Komplikationen zum ernsthaften Problem werden. Dann musste der Bauer erneut ins Dorf, um den Sprengelarzt zu rufen, denn Telefone gab es auf den meisten Höfen lange Zeit keine. Wie oft habe ich gebetet, der gute alte Doktor möge bitte rechtzeitig kommen. Noch schwieriger war es, wenn eine Einlieferung ins Krankenhaus nötig wurde und alle ungeduldig auf den Rettungswagen warteten, und oftmals wurde es ein Wettrennen mit der Zeit. Auch etwas anderes gab mir sehr bald zu denken: Die hygienischen Verhältnisse in den Bauernhäusern ließen sehr zu wünschen übrig, und kaum besser sah es in den Arbeitersiedlungen aus, die mittlerweile in den lang gestreckten Dörfern entstanden waren. Da musste ich von dem Standard, der mir auf der Hebammenschule als unerlässlich eingeimpft worden war, gewaltige Abstriche machen.
Immerhin brachten mich diese Unzulänglichkeiten auf eine glänzende Idee: Ich beschloss, in unserem nicht voll belegten Altersheim ein Entbindungszimmer einschließlich Wochenstation einzurichten. Wenn die Frauen diese Möglichkeit anfangs auch nur zögernd annahmen, so sprachen sich die Vorteile doch bald herum. Und jede, die einmal dort entbunden hatte, kam beim nächsten Mal wieder. Diese meist abgearbeiteten Mütter genossen es regelrecht, sich zehn Tage mal rund um die Uhr versorgen und verwöhnen zu lassen. Einen solchen Luxus hätten sie zu Hause niemals gehabt. Da sprangen die bereits vorhandenen Kinder herum, da waren der Ehemann oder sonstige Familienangehörige, die Auskünfte, Entscheidungen oder gar irgendwelche Hilfeleistungen forderten. Ich habe schon Wöchnerinnen einen Tag nach der Entbindung bei der Stallarbeit angetroffen.
Eine der ersten Frauen, die zur Entbindung ins Altersheim kam, war die Hochmoser Frieda. Sie stammte zwar von einem Bauernhof, lebte aber mit ihrem Mann Albert, einem Postangestellten, in einer bescheidenen Dienstwohnung unweit des Bahnhofs. Es war ein ziemlich kalter Tag Ende Februar, und es schneite still vor sich hin, als ich vom Altersheim den Anruf bekam, die Frieda habe sich eingefunden, wolle bei mir entbinden und es sei bald so weit. Ich hatte die junge Frau vorher noch nie richtig zu Gesicht bekommen – auch das war damals üblich so.
Bei meiner Ankunft erzählte sie mir, dass dies ihr erstes Kind sei und wie sehr sie und ihr Mann sich freuten. Die Entscheidung, wo sie entbinden wolle, habe sie sich nicht leicht gemacht. Immer wieder habe sie das Für und das Wider gegeneinander abgewogen. Daheim sei daheim, habe sie sich gesagt. Da kenne sie sich aus. Da sei ihr alles vertraut. Aber andererseits: Wer würde sie und das Neugeborene in den Tagen des Wochenbetts pflegen? Sollte sie ihre Mutter kommen lassen? Oder ihre Schwester? Aber sowohl die eine als auch die andere würde nur ihre Nase überall reinstecken. Das wolle sie dann doch nicht. Also habe sie sich für meine kleine Wochenstation im Altersheim entschieden. Nur dass ihr Mann nicht dabei sein könne, das fände sie jammerschade. Der bekäme jetzt von der ganzen Entbindung nichts mit. Wo er sich doch so auf das Kind freue und es gar nicht erwarten könne.
Eine Wehe unterbrach ihren Redefluss. Dann ging es weiter: Andererseits habe sie sich gedacht, dass zu Hause nicht nur alles recht beengt, sondern auch primitiv sei. Sicher, es gebe schon fließendes Wasser, aber kein warmes. Das brauche man doch dringend bei einer Entbindung! Und die ganze Wäsche, die bei einer Entbindung anfalle! Ganz zu schweigen von der vielen Kindswasch anschließend! Das müsste ja alles auf dem Küchenherd gekocht werden. Dann sei sie auch noch zu waschen und zu schwenken. Und wo sollte man das alles trocknen, jetzt im Winter? Nein, das habe sie sich und den anderen nicht zumuten wollen. Da sei es doch gescheiter, sich im Altersheim bequem ins Bett zu legen. Das alles und noch mehr erzählte die Frieda, während wir darauf warteten, dass sich der Muttermund weit genug öffnete, damit das sehnlich erwartete Kind endlich ans Licht der Welt kam.
»Es ist mir ganz gleich, was es wird«, versicherte sie mir. »Hauptsache gesund.«
Nach einer Weile fügte sie hinzu: »Schön wär’s allerdings schon, wenn als Erstes ein Bub käm. Den wünscht sich der Albert so sehr, damit er mit ihm all das unternehmen kann, was er in seiner Jugend hat entbehren müssen. Mit einem Buben würd der Albert überglücklich sein.«
»Na, dann wollen wir mal schauen, was sich machen lässt«, plapperte ich optimistisch vor mich hin, als ob ich da irgendeinen Einfluss hätte. »Wichtig ist jetzt, dass du immer tief durchatmest, damit dein Kind genug Sauerstoff bekommt. Es hat die richtige Lage und gesunde Herztöne, und es liegt jetzt viel an dir, damit das auch so bleibt.«
Sie atmete brav, und der Minutenzeiger wanderte träge von Strichlein zu Strichlein.
»Ist auch alles normal?«, fragte die Frieda zwischendurch beunruhigt, weil sich nichts tat. »Es dauert schon arg lang.«
»Beim ersten Kind ist das halt so. Das ist ganz normal, und es besteht kein Grund zur Beunruhigung. Schau, der Muttermund, der bislang fest verschlossen war, muss sich jetzt immerhin so weit öffnen, damit das Kopferl durchkann.«
Endlich, endlich kam das Kind! Gesund und aus Leibeskräften schreiend. Und es war sogar der erhoffte Stammhalter! Selten habe ich eine glücklichere Mutter gesehen als die Frieda. Sie drückte den winzigen nackten Körper an sich, streichelte den Kleinen zärtlich, küsste seine Stirn und die runden Wangen, ja sogar den rosigen Po. Sie wusste gar nicht, auf welche Weise sie ihrem Glücksgefühl noch Ausdruck verleihen sollte. Auf einmal aber wurde sie ernst: »Ach, der Albert! Jetzt hat er diesen wundervollen Moment verpasst. Was wird der für eine Freud haben, wenn er erfährt, dass es ein Bub ist!«
»Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich hab schon manch einen Vater erlebt, der vor lauter Freud einen Luftsprung gemacht hat.«
»Den macht der Albert auch, darauf kannst dich verlassen.«
»Na, das wirst ja sehen, wenn er dich morgen besucht. Nur schad, dass ich wahrscheinlich nicht dabei sein kann.«
»Wo denkst hin! So lang will ich den Albert nicht ohne Nachricht lassen. Die Neuigkeit muss er heut noch erfahren.«
»Und wie stellst dir das vor? Telefon habt ihr ja keines, und Brieftauben hab ich keine bei mir.«
Sie lachte über meinen Scherz, um dann gleich in vollem Ernst fortzufahren: »Ich tät dich halt schön bitten, dass du auf dem Heimweg bei ihm vorbeischaust.«
»Das wär aber ein schöner Umweg, den ich da machen müsst. Und das bei Nacht und am Bahnhof vorbei, wo es mir eh nicht ganz geheuer ist.«
»Ach geh, Nanni, so furchtsam brauchst nicht sein. Wer sollt dir da schon was tun? Den kleinen Umweg kannst für mich wirklich machen.«
Kleiner Umweg! Die Frieda hatte Nerven. In der Nacht, wenn man zu Fuß ist und über fünfzehn Zentimeter Neuschnee liegen und man eine schwere Tasche zu tragen hat, sind gute zwei Kilometer mehr eine ganz schöne Zumutung. Deshalb wagte ich einen weiteren Einwand: »Was glaubst eigentlich, wann ich überhaupt hier wegkomm?«
»Von mir aus kannst gleich losmarschieren«, schlug sie vor.
»Du bist gut. Wir müssen noch die Nachgeburt abwarten. Mit ein bisschen Glück ist die in einer halben Stund da. Es kann auch länger dauern. Und anschließend muss ich drei Stunden bei dir Wache halten.«
»Das brauchst nicht«, wollte sie mir großmütig freigeben. »Ich komm ganz gut allein zurecht. Für dich gibt’s ja eh nichts mehr zu tun.«
»Da irrst aber gewaltig. Ich muss das Kind versorgen, ich muss die Eintragungen in mein Tagebuch machen, und ich muss aufräumen, damit alles für die nächste Entbindung fertig ist.«
»Dafür brauchst doch keine dreieinhalb Stunden.«
»Das nicht, aber es ist Vorschrift, dass ich so lang bei dir bleib, wegen der Gefahr einer möglichen Nachblutung.«
Einen Moment war sie still. Sie rechnete offenbar nach, wie spät es dann sein würde. »Mitternacht wär grad eine halbe Stund vorbei, und bis du zu unserm Haus kämst, wär es vielleicht ein Uhr.«
»Eben. Und dein Mann liegt im tiefsten Schlummer.«
»Das glaubst wohl selbst nicht. Meinst, der bringt heut ein Auge zu? Dazu ist er viel zu aufgeregt, einerseits aus Sorge um mich, andererseits vor Ungeduld, weil er wissen will, was es geworden ist.«
»Es reicht doch wirklich, wenn ich morgen Früh bei ihm vorbeischau. Auf dem Weg zu dir, vor der Wochenpflege.«
»Ach nein, bitt schön, Nanni, tu mir den Gefallen. Solang der Albert nicht weiß, was los ist, findet der keinen Schlaf.«
Schließlich ließ ich mich von ihr breitschlagen, damit sie endlich Ruhe gab. Außerdem, was wogen die Strapazen einer übermüdeten Hebamme schon gegen die Freude, die ein junger Vater empfinden würde bei der Nachricht, dass er einen Sohn bekommen hatte?
Es war halb eins, als ich losmarschieren konnte. Ich stellte meinen Kragen hoch und wickelte meinen Schal enger um den Hals, denn es pfiff ein eisiger Wind. Meinen ganzen Mut zusammennehmend, marschierte ich Richtung Bahnhofsviertel, und es war gegen ein Uhr, als ich an besagtem Haus anklopfte.
Drinnen rührte sich nichts, auch Licht schien keines zu brennen, denn durch die geschlossenen Läden fiel nicht der geringste Schimmer. Ob ich mich einfach davonschleichen sollte? Aber nein, dann hätte ich den ganzen Umweg ja umsonst gemacht. Außerdem würde die Frieda glauben, dass ich mein Versprechen nicht gehalten habe. Also pochte ich nochmals an die Tür, diesmal energischer, doch wieder vergeblich. Nachdem ich eine Ewigkeit gewartet hatte, nahm ich einen großen Stein, um meinem Klopfen noch mehr Nachdruck zu verleihen. Endlich flammte im ersten Stock ein Licht auf, wie ich durch die Ritzen der Läden erkennen konnte. Dann hörte ich, wie das Fenster aufgemacht und der Laden zurückgestoßen wurde. Im Lichtschein erkannte ich die Silhouette eines zerzausten Kopfes. »Kruzitürken!«, fluchte eine Stimme von oben herab. »Was soll der Radau mitten in der Nacht?«
»Bist du der Hochmoser Albert?«, vergewisserte ich mich, bevor ich meine Botschaft überbrachte.
»Ja, was willst denn von mir?«
»Ich bin die Feldmoser Nanni, die Hebamme. Von deiner Frau soll ich dir einen schönen Gruß ausrichten und dir die Neuigkeit überbringen, dass du einen Buben bekommen hast.«
»Das hätt auch noch Zeit bis morgen gehabt«, raunzte er mich an. »Deshalb musst mich nicht aus dem tiefsten Schlaf reißen.« Schon klappten Laden und Fenster wieder zu, und ich stand da wie ein begossener Pudel.
Bei der Morgenvisite fragte die Frieda ungeduldig: »Und: Hat der Albert einen Luftsprung gemacht?«
»Davon hab ich nichts gemerkt. Aber geflucht hat er wie ein Postkutscher.«
»Das kann nicht sein«, antwortete die junge Mutter spontan. »Du warst bestimmt am falschen Haus.«
»Das würd ich auch denken, wenn ich nicht die nächtliche Gestalt extra nach ihrem Namen gefragt hätt.«
Den lieben langen Tag ließ sich kein freudestrahlender, glücklicher Vater blicken, wie ich am Abend erfuhr, als ich noch einmal nach der Wöchnerin schaute. Mit vorwurfsvollem Blick empfing mich die Frieda. »Gewiss warst in der Nacht gar nicht an unserem Haus«, sagte sie mit belegter Stimme. »Die Geschichte hast dir bloß ausgedacht.« Dann kullerten Tränen der Enttäuschung über ihre Wangen.
Tröstend legte ich meinen Arm um ihre Schultern. »Das glaubst doch selbst nicht, was du da sagst. Wahrscheinlich ist der Albert aus irgendeinem Grund verhindert und kommt morgen erst.« Meine eigenen Worte konnte ich allerdings selbst nicht glauben. Ich hegte eher den Verdacht, dass der Gute zu der Sorte Männer gehörte, die das freudige Ereignis lieber mit Saufbrüdern in der Kneipe feierten als am Bett der Frau.
Am nächsten Morgen erschien er endlich, mit einem Mordsrausch. Er sei verärgert gewesen über die nächtliche Störung und hätte sich aus Wut einen angetrunken, versuchte er sich herauszureden. Ich aber schwor mir, nie wieder mitten in der Nacht eine »freudige Nachricht« zu überbringen.
Die Sache mit dem Plumpsklo
Als mein Mann und ich ein paar Jahre nach Kriegsende heirateten, fingen wir mit nichts an. Was er als Angestellter bei der Bahn verdiente, reichte gerade mal für eine bescheidene Mietwohnung aus, eine sehr bescheidene genau genommen. Ich besserte die Haushaltskasse auf, indem ich einen Nutzgarten anlegte und dort alles zog, was sich in der Küche verwerten ließ. Zeitweilig arbeitete ich auch in einem Sägewerk, sodass ich ein wenig Geld zurücklegen konnte – übrigens die Voraussetzung für meine spätere Hebammenausbildung.
Bis ich die Schule in Salzburg beendet hatte, blieben wir in der winzigen Wohnung, zumal meine Kinder in den Zeiten meiner Abwesenheit ohnehin von meiner Mutter betreut wurden. Dann aber war es für uns ein enormer Fortschritt, als wir ein kleines Holzhaus mieten konnten, das unserer Familie mehr Platz bot. Allerdings verfügten wir jetzt über noch weniger Komfort als früher, denn es gab weder fließendes Wasser noch eine Toilette im Haus. Wir fühlten uns aber reichlich entschädigt dadurch, dass wir auf niemanden mehr Rücksicht nehmen mussten. Es gab keinen Vermieter, der dies und jenes verbot und keine Mitbewohner, die sich über Lärm im Treppenhaus beschwerten. Das Beste jedoch war das Grundstück, durch das ein Wildbach floss. Ich konnte Leinen spannen und meine Wäsche im Wind flattern lassen, anstatt sie nur in der Küche zu trocknen. Ja, und die Kinder! Für sie war es ein Paradies – es gab genug Platz zum Toben und Spielen, und ich war erleichtert, dass sie sich dadurch von der gefährlichen Straße fernhielten.
Und was den mangelnden Komfort betraf, da arrangierten wir uns. Aus dem Wildbach schöpften wir Nutzwasser, so viel wir brauchten, und das Trinkwasser – man glaubt gar nicht, mit wie wenig man tatsächlich auskommen kann – holten wir uns vom Dorfbrunnen, der kaum zehn Minuten entfernt war. Als stilles Örtchen gab es hinter dem Haus, in respektvoller Entfernung natürlich, ein Plumpsklo. Es bestand aus einer tiefen Grube, in der ein leeres Teerfass versenkt war, mit einem kastenähnlichen Gebilde darüber, in das man ein großes Sitzloch gesägt hatte. Geschützt wurde das Ganze durch das obligatorische Holzhäuschen mit einem Herzerl in der Tür. Zugegeben, im Winter war es nicht sehr angenehm, dort zu thronen, wenn der Wind durch sämtliche Öffnungen und Ritzen pfiff und den Schnee hereinwehte. Aber man gewöhnte sich daran und schränkte die Dauer der Sitzungen so weit wie möglich ein.
Unser einziges wirkliches Problem mit dieser urwüchsigen sanitären Anlage war ihr geringes Fassungsvermögen, denn bereits nach einigen Monaten war die Tonne randvoll. Was tun? Es gab keine Firma, die den Inhalt abholte, und außerdem hätten wir für einen solchen Luxus kein Geld gehabt. Für die Leerung der Grube war man also ganz auf sich gestellt. Dazu benutzte man ein Schöpfgerät, das bei uns Götscht hieß – es war ein hölzerner Topf mit einer langen Stange daran, eine Art überdimensionaler Schöpfkelle, mit der sich die braune Masse gut aus der Tiefe holen ließ. Aber wohin mit dem Zeug? Das war das eigentliche Problem. Weil ich bei der Lösung solch »anrüchiger« Fragen nicht auf die Hilfe meines Mannes hoffen konnte, musste ich mir selbst etwas überlegen. Mir fiel jedoch nichts Besseres ein als der Wildbach. Die Idee war eigentlich gar nicht so schlecht, denn das reißende Gewässer würde alle Fäkalien rasch abtransportieren und sämtliche Spuren wegwaschen.
Doch die Sache hatte einen Haken: Diese Art der Entsorgung war nämlich offiziell verboten. Verständlicherweise, würde ich heute sagen, aber damals sah ich das wohl anders.
Jedenfalls konnte ich mein schmutziges Werk nur im Schutz der Nacht vollbringen. Es war einer jener Sommertage, in denen es spät dunkel und früh hell wird, als unsere Tonne zum ersten Mal voll war. Ich beschloss, vorsichtshalber bis nach Mitternacht zu warten, wenn keine Passanten mehr unterwegs und in der Nachbarschaft alle Lichter erloschen waren.
Fleißig schöpfte ich Kelle um Kelle aus der Tiefe und kippte sie in den Bach. Die Tonne war etwa zur Hälfte geleert, da drang vom Haus her ein Geräusch an meine Ohren – jemand schien an eine der Fensterscheiben zu klopfen. Vor Schreck hätte ich beinahe meinen gefüllten Götscht fallen lassen und erstarrte zur Salzsäule. Nur mein Gehirn arbeitete fieberhaft: War das etwa ein Gendarm? Hatte mir den ein wachsamer Nachbar auf den Hals gehetzt? Was sollte ich tun? Geräuschlos legte ich mein Schöpfgerät ins Gras, schlich mich bis ans Haus heran und spähte vorsichtig um die Ecke.
Erleichtert atmete ich auf. Meine inzwischen an die Dunkelheit gewöhnten Augen identifizierten zweifelsfrei eine Frau aus der Nachbarschaft. Sie war ganz bestimmt nicht gekommen, um meinen nächtlichen Frevel zur Anzeige zu bringen. Die Schneider Hedwig war hochschwanger und brauchte offensichtlich meine Hilfe. Trotz der zwielichtigen Situation, in der ich mich befand, konstatierte ich voller Mitleid, dass sie offensichtlich zu den Frauen gehörte, die selbst die Hebamme holen mussten, weil der Ehemann dazu nicht in der Lage war. Aus welchem Grund auch immer. Trotzdem wagte ich nicht, mich bemerkbar zu machen – zu peinlich war mir mein verbotenes Tun. Also verhielt ich mich mucksmäuschenstill in der Hoffnung, die Hedwig würde heimgehen und später wiederkommen. In der Zwischenzeit konnte ich ins Haus schlüpfen, mich waschen und ordentlich ankleiden.
Irrtum! Die Hedwig dachte gar nicht daran, umzukehren. Stattdessen schrie sie mit zunehmender Lautstärke: »Nanni! Nanni! Bittschön, meld dich! Ich hab so starke Wehen!«
Die schreit mir ja die ganze Nachbarschaft zusammen, dachte ich. Was blieb mir also anderes übrig, als aus meinem Versteck hervorzukommen. Inzwischen hatte ich genug Zeit gehabt, mir eine einigermaßen glaubhafte Ausrede zurechtzulegen: »Tut mir leid, Hedwig. Ich saß grad auf dem Häusl und konnte die Hosen nicht gleich hochziehen.«
Den Unsinn hätte ich mir glatt ersparen können. Meine Hochschwangere hörte überhaupt nicht hin. Der war es völlig egal, was ich eben getan hatte. »Gott sei Dank, dass da bist!«, rief sie erleichtert aus.
»Wie oft kommen die Wehen?«, wurde ich nun ganz sachlich. »Alle vier oder fünf Minuten«, war die Antwort. Ich atmete auf. Das reichte gerade noch. »Geh bitte nach Haus und leg dich ins Bett. In ein paar Minuten bin ich bei dir. Ich muss nur noch meine Tasche holen und was Gescheites anziehen.«
Dass ich mir in einem Bottich neben dem Haus erst einmal gründlich Hände und Arme waschen musste, brauchte sie ja nicht zu sehen. Ich kam einigermaßen rechtzeitig bei ihr an, und es blieb eben noch Zeit für eine notdürftige hygienische Vorbereitung, die meine Dorffrauen übrigens zunächst als unnötigen neumodischen Kram abtaten. Die Geburt verlief recht rasch und ohne Komplikationen. In den frühen Morgenstunden ließ ein hübsches kleines Mädchen seine Stimme zum ersten Mal ertönen – nach zwei Buben eine große Freude für die Mutti. Wie die Mutter bekam es den Namen Hedwig, wurde später jedoch Hedi gerufen, damit es keine Verwechslungen gab. Nachdem ich anschließend meine drei Stunden am Bett der Wöchnerin abgesessen hatte, war es bereits helllichter Tag, als ich endlich völlig übernächtigt wieder unser Grundstück betrat. Dort erwartete mich eine neue Aufregung, sodass ich noch lange nicht zu meinem wohlverdienten Schlaf kam.
Meinem Mann, der an diesem Sonntag keinen Wochenenddienst hatte, war nichts anderes übrig geblieben, als am Morgen in die Rolle des Babysitters zu schlüpfen, sobald die Kinder sich lautstark bemerkbar machten. Anfangs lief alles gut: Zuerst zog er den Großen an, den Rupert, der fünfeinhalb war, dann unsere vierjährige Tochter Franziska und bereitete anschließend ein Frühstück für alle vor. Allerdings schien er sich anschließend so sehr in seine Zeitung vertieft zu haben, dass er nicht mitbekam, was seine lieben Kleinen so trieben. Erst als sein Sohn ihn am Ärmel zupfte und aufgeregt rief: »Du Papa, die Franzi schreit«, kam Leben in ihn. Er sprang auf und rannte hinters Haus. Was war geschehen? Unser Töchterchen hatte auf eigene Faust das stille Örtchen aufgesucht, es mit größter Anstrengung sogar geschafft, ihren kleinen Po auf die Sitzfläche hochzuwuchten, doch dann passierte das Malheur. Franzis Allerwertester war zu zierlich für das Loch über der Grube, und so flutschte das ganze Kind hindurch und fiel in die stinkende Brühe.
Es hatte Glück im Unglück, weil es auf den Füßen landete und die Tonne dank meiner nächtlichen Aktion halb geleert war. Nach dem ersten Schreck begann die Kleine wie am Spieß zu schreien und alarmierte damit ihren Bruder. Als mein Mann an der Unglücksstätte erschien, steckte sie bis zu den Achselhöhlen in Fäkalien. Irgendwie schaffte er es, seine Tochter zu packen und durch die Öffnung herauszuziehen.
Nach der geglückten Rettung war es seine erste Handlung, das Kind völlig auszukleiden und es im Bach von Kopf bis Fuß zu waschen. Für die Kleine der nächste Schock, denn das Wasser war eisig. In diesem Moment kam ich nach Hause und hörte meine Tochter erbärmlich schreien. Als ich den Bach erreichte, fand ich sie in ein Frotteetuch gehüllt vor. Ich drückte mein armes, wimmerndes Kind an mich und brachte es ins warme Bett, während mein Mann mir berichtete, was vorgefallen war.
Anschließend nahm ich mich der verdreckten Kleidung an. Immer und immer wieder warf ich sie in den Bach, rieb sie mit Seife ein, rubbelte und scheuerte sie, aber der Gestank wollte einfach nicht weichen. Entmutigt hängte ich die Sachen schließlich, stinkend wie sie waren, auf die Leine und legte mich selbst für einige Stunden aufs Ohr, bis ich von kleinen Trippelschritten vor meinem Bett geweckt wurde. Ich zog meine Tochter zu mir unter die Decke und ließ mir von ihr noch einmal beschreiben, wie sich das Missgeschick ereignet hatte. Erst danach wurde mir so richtig bewusst, in welcher Gefahr sie geschwebt hatte und dass die Geschichte sehr wohl hätte böse enden können. Ich sandte einen stillen Dank zu ihrem Schutzengel. Doch allein auf die himmlischen Mächte mochte ich mich für die Zukunft nicht verlassen. Also knöpfte ich mir meine Kinder vor und redete ihnen ernstlich ins Gewissen, nie, nie wieder allein aufs Plumpsklo zu gehen. Sie nickten nachdrücklich und versprachen es mir hoch und heilig.
Der einzige »Totalschaden«, der uns entstanden war, betraf Franzis Kleidung. Selbst nachdem sie im Sommerwind getrocknet waren, stanken die Sachen weiterhin gottserbärmlich. Und obwohl wir jede Ausgabe angesichts unserer nicht gerade rosigen finanziellen Lage dreimal überlegen mussten, schob ich das stinkende Zeug kurzerhand in den Küchenherd.
Problemfall Frühgeburt
Jede Hebamme hat die Pflicht, sobald Unregelmäßigkeiten auftreten, einen Arzt hinzuzuziehen oder die Schwangere in ein Krankenhaus zu schicken. Das ist beispielsweise auch der Fall bei einer drohenden Frühgeburt. Für die Klinikeinweisung sprechen zwei Gründe: Erstens hat das Frühgeborene dort wegen der besseren medizinischen Versorgungsmöglichkeiten eine wesentlich größere Überlebenschance, zweitens ist auch die Mutter in besserer Obhut, falls etwas aus dem Ruder läuft. Eine Frühgeburt bedeutet nämlich immer einen erheblichen unnatürlichen Eingriff in den Organismus, der im schlimmsten Fall sogar Lebensgefahr bedeuten kann. Also versuchte ich nach Möglichkeit, falls Zeit blieb, die oft widerstrebenden Bäuerinnen ins nächste Krankenhaus bringen zu lassen.
Bei sehr unreifen Frühgeburten allerdings konnte man damals selbst dort nichts mehr tun. Eine gewisse Chance bestand erst ab Beginn des siebten Lunarmonats, wie man in der Geburtshilfe zählt. Der Begriff kommt vom lateinischen Wort »luna« (Mond), und ein Monat umfasst in dieser Rechnung exakt vier Wochen. Die reguläre Schwangerschaft mit zweihundertachtzig Tagen dauert also genau zehn Lunarmonate, während es nach dem normalen Kalender nur neun Monate sind.
Ein Kind, das unter einem Kilo wog, hatte bis in die Fünfzigerjahre des vorigen Jahrhunderts, als ich mit meiner Hebammentätigkeit begann, keine Chance durchzukommen. Es gab zwar schon Brutkästen, aber die waren längst nicht so ausgeklügelt, und so mussten wir bei vielen Frühchen einfach der Natur ihren Lauf lassen. Derart winzige Kinder am Leben zu erhalten, wie es die hoch technisierte moderne Medizin vermag, diese Möglichkeit lag noch in weiter Ferne. Heute haben sie, egal wie klein, eine reelle Überlebenschance, werden an Kabel und Schläuche angeschlossen, beatmet und künstlich ernährt, stets von Monitoren überwacht, bis sie in etwa ein normales Geburtsgewicht erreichen.
Als Hebamme musste man sich damals irgendwie behelfen. Wenn eine werdende Mutter mir sagen konnte, um wie viel zu früh ihr Kind kommen würde, was durchaus nicht immer der Fall war, oder wenn das Abtasten des Bauches mir zuverlässige Hinweise gab, habe ich gleich die Rettung bestellt oder den Arzt verständigt, falls es für einen Transport ins Krankenhaus bereits zu spät schien. Letzteres war bei den Salvenmosers der Fall.
Es war an einem heißen Sommertag, kein Wölkchen trübte den Himmel, als ich mich bergauf zu ihrem einsam gelegenen Hof kämpfte. Der Bauer hatte mich von einem öffentlichen Fernsprecher aus verständigt – ich selbst besaß mittlerweile Telefon –, dass seine Frau in den Wehen liege. Dann war er mit seinem Moped gleich wieder umgekehrt, statt bei der Telefonzelle auf mich zu warten, um zumindest meine schwere Tasche mit nach oben zu nehmen.
Ich kannte die Salvenmoserin bereits von ihrem vierten Kind her. Das musste vor anderthalb Jahren gewesen sein, und ich erinnerte mich, dass es eine schnelle und leichte Geburt gewesen war. Bei meinem Eintritt in die Schlafkammer atmete sie schwer, was auf eine Wehe hindeutete. Als ich mir jedoch ihren Leib anschaute, wusste ich auf Anhieb, dass es für eine reguläre Entbindung noch zu früh war. Auf meine Frage nach ihrer letzten Regelblutung konnte sie mir zum Glück präzise Auskunft geben – demnach war sie in der vierundzwanzigsten Woche, also noch viel zu früh für eine günstige Prognose. Vielleicht ließ sich die Geburt ja noch stoppen, hoffte ich insgeheim, doch dann entdeckte ich eine Blutung – allem Anschein nach war der Fötus nicht mehr zu halten.
Jetzt musste schleunigst der Sprengelarzt her, denn für einen Transport ins Spital war es bereits zu spät. Dem Bauern, der während der Untersuchung händeringend in der Kammer auf und ab gegangen war, blieb es nicht erspart, abermals mit seinem Moped ins Dorf zu tuckern, um unseren alten Doktor zu benachrichtigen, der dem Sebastian mit seinem Auto ein Stück bergauf folgen würde. Den Rest des Weges, da wo er für Autos unpassierbar war, musste er auf dem Sozius zurücklegen.
Er kam gerade rechtzeitig, um die Ausstoßphase mitzuerleben. Man mag es nicht glauben: Obwohl der Körper eines unreifen Babys so winzig ist, bereitet die Geburt der Mutter ebenso große Schmerzen wie die eines voll ausgetragenen Kindes, denn hinsichtlich der Heftigkeit der Presswehen gibt es keinen Unterschied. Der Arzt und ich erkannten auf den ersten Blick, dass dieses Menschlein nicht lebensfähig war. Während meiner Ausbildung hatte man uns auch geschult, in welchen Fällen man eine Nottaufe vornehmen sollte und wie man sie durchführte. Natürlich musste man zuvor um Erlaubnis fragen, doch auf dem Land erübrigte sich das eigentlich, denn weder die Mutter noch der Vater würden etwas dagegen haben. Im Gegenteil: Die Menschen hier legten größten Wert darauf, dass ihrem Kind durch die Taufe wenigstens die Aussicht auf ein ewiges Leben erhalten blieb, wenn ihm schon kein irdisches vergönnt war. Wie tief verwurzelt die Frömmigkeit im Leben der Dörfler war, zeigte sich allein daran, dass in jedem Schlafzimmer neben der Tür ein Weihwasserbrunnen oder Weihwasserkessel, wie man anderswo sagt, hing.
Während sich der Arzt weiter um die Mutter bemühte, nahm ich das Gefäß von der Wand und goss in Kreuzesform Wasser über die winzige Stirn des verlöschenden Lebens. Dabei sprach ich die Worte: »Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.« Wenige Minuten später hauchte der kleine Körper sein Leben aus. Der winzige Leichnam, der deutlich unter tausend Gramm wog, wurde in ein Tuch gehüllt und beiseitegelegt. Jetzt ging es in erster Linie um Leben und Gesundheit der Mutter. Auch das war in unserer bäuerlichen Gegend von großer Wichtigkeit, denn was würde man machen ohne die Hausfrau, die Bäuerin? Keine Magd war imstande, ihre unermüdliche Arbeitskraft und ihren Fleiß zu ersetzen, und ein Bauer war verloren ohne sie. Jeder kannte zudem das traurige Los von Kindern, deren Mutter im Kindbett gestorben war. Falls es überhaupt noch Großeltern gab, fühlten diese sich oft der Aufgabe nicht gewachsen. Im günstigsten Fall fand der Bauer vielleicht bald eine neue Frau, oftmals innerhalb der Verwandtschaft, aber zumeist war keine interessiert an einem Witwer mit einem Haufen unmündiger Kinder und einem Einödhof, auf dem man sich von der Früh bis in die Nacht schinden musste. Dann wurden die Kinder auseinandergerissen, unter den Verwandten verteilt oder, sofern sie über zehn Jahre alt waren, als Arbeitskräfte zu Bauern gegeben, wo sie sich ihr Brot selbst verdienen mussten.
Den Kindern der Salvenmoserin sollte das nicht passieren, doch bei der Annegret wollte sich die Blutung einfach nicht stillen lassen. Selbst eine entsprechende Spritze richtete wenig aus. Da zudem die Plazenta keine Anstalten machte, sich zu lösen, entschloss sich der Sprengelarzt zu einer Curettage.
Dieser Eingriff, im Volksmund unter der Bezeichnung Ausschabung bekannt, wird mit einem löffelartigen Gegenstand, der Curette, ausgeführt und muss, weil das sehr schmerzhaft ist, unter Narkose gemacht werden. Im Krankenhaus, wo es einen Anästhesisten oder zumindest eine Narkoseschwester gibt, kein Problem, aber was sollten wir tun in einem Bauernhaus, über tausend Meter hoch am Ende der Welt gelegen und mit keinem normalen Fahrzeug zu erreichen? Da musste die Hebamme als Narkoseschwester herhalten. Der Arzt drückte mir eine Metallmaske in die Hand, dazu ein Mulltuch und ein Fläschchen Äther. Die Maske stülpte ich der Bäuerin über die Nase, den Lappen legte ich darüber und ließ darauf Tropfen um Tropfen aus dem Fläschchen fallen, während die Salvenmoserin auf Geheiß des Arztes laut zählen musste, damit sie tiefer einatmete und das Narkotikum schneller wirkte. Außerdem erkannte man auf diese Weise sofort, wenn sie eingeschlafen war, und vermied eine Überdosierung. So einfach ging das damals, keine Kontrolle des Blutdrucks, kein Überwachen der Atmung oder der Herzfrequenz.
Trotzdem ging alles gut. Bald nach dem Eingriff wachte die Annegret auf und fand sich schnell wieder in der Wirklichkeit zurecht. »Was ist mit dem Kind?«, wollte sie wissen, ganz sachlich, ganz ohne Emotionen. Eigentlich hatte ich erwartet, dass sie in Tränen und Jammern ausbrechen würde, und schob die fehlenden Emotionen auf die Nachwirkungen der Narkose. Bald merkte ich jedoch, dass auch der Ehemann und seine Eltern die Tatsache, dass die Jungbäuerin eine Totgeburt erlitten hatte, völlig nüchtern betrachteten. Auch bei ihnen gab es kein Klagen, keine große Trauer. Man sah es nicht als Tragödie an, sondern nahm es einfach als gegeben hin. Wenn dieses Kind nicht leben durfte, dann vielleicht das nächste. Das war eben Schicksal, in das musste man sich fügen.
Diese Haltung sollte ich in Zukunft in meinem Sprengel immer wieder erleben. Vermutlich lag es daran, dass der Tod eines Kindes irgendwie als normal galt: Kinder starben bei der Geburt, an allerlei Krankheiten, und man war daran gewöhnt, dass längst nicht alle heranwuchsen. Diese Einstellung änderte sich erst, als durch den medizinischen Fortschritt ein grundlegender Wandel stattfand. Bis dahin aber trug man es mit Gelassenheit und Ergebung – wie die alte Salvenmoserin, die zu mir sagte: »Die Annegret hat bereits einige Kinder, und so Gott will, wird sie weitere kriegen.«
Obwohl kein Säugling zu versorgen war, erschien ich in den nächsten Tagen zur Wochenpflege, denn die Mutter hatte immerhin einen chirurgischen Eingriff hinter sich. Auch tat es ihr sichtlich gut, über das Geschehene reden zu können. Wenngleich sie nach wie vor nicht über den Verlust des kleinen Jungen klagte, so lag ihr die Frage seiner Beisetzung doch sehr am Herzen. Fehlgeburten und nicht lebensfähige Frühgeburten wurden in der Regel vom Kindsvater in eine selbst gezimmerte Kiste gelegt und auf dem Friedhof in einer Ecke der Familiengrabstätte beigesetzt. Die Salvenmosers aber wünschten eine richtige Beerdigung, und deshalb hatte der Sebastian seinen Sohn, der in der Nottaufe nach Annegrets Vater den Namen Jakob erhalten hatte, beim Pfarrer an- und gleichzeitig abgemeldet. Und so bekam der Kleine, der nicht hatte leben dürfen, im Beisein seines Vaters und seiner Großeltern ein würdiges kirchliches Begräbnis auf dem Dorffriedhof, wo er bei den Kindergräbern seine letzte Ruhe fand.
Eine himmlische Fügung
Nottaufen gehörten früher leider zum Alltag einer Hebamme – eben weil seinerzeit viele Kinder nicht lebensfähig zur Welt kamen. Darum waren wir auch auf der Salzburger Lehranstalt speziell für den Umgang mit diesen traurigen Fällen geschult worden, wozu auch die Kenntnis des Taufritus gehörte. Allerdings erlebte ich damals bereits, dass es in der Stadt eine ganze Menge Leute gab, die eine Nottaufe nicht für wichtig hielten oder diese sogar rundheraus ablehnten. Natürlich waren wir gehalten, die Wünsche der Eltern zu berücksichtigen, doch einmal ist es mir im Trubel der Ereignisse passiert, dass ich die Erlaubnis einzuholen vergaß. Was zunächst zu einem mittleren Drama auszuufern drohte, erwies sich am Ende als Wink des Schicksals oder, um in der religiösen Sprache zu bleiben, als Fügung Gottes.
Gegen Ende meiner Ausbildung sollte ich mit meiner Lehrhebamme in der Frauenklinik eine Entbindung durchführen, bei der ein Frühchen erwartet wurde. Es ging hektisch zu an diesem Tag, zumal unsere Schwangere, eine anspruchsvolle Fabrikantengattin, die mit den Geburtsschmerzen schlecht zurechtkam, uns mit ihren gellenden Schreien die anderen Gebärenden verrückt machte, bis ihr der diensthabende Arzt eine Evipanspritze gab. Wenig später war das Kind da, ein armseliges Mädchen von fünfundvierzig Zentimetern Länge und knapp zwei Kilo Gewicht. Es wollte und wollte nicht schreien, so sehr wir uns auch um es bemühten. Erst einige energische Klapse auf das winzige Hinterteil brachten es dazu, sein Stimmchen ertönen zu lassen. Danach übergab die Lehrhebamme mir das Neugeborene zur weiteren Versorgung, während sie selbst und der Arzt sich um die Mutter kümmerten.
Ich hatte die Anweisung erhalten, das winzige Mädchen, nachdem ich es gebadet hatte, in das Frühgeborenenzimmer zu bringen, damit es dort in den Brutkasten gelegt wurde. Weil es nicht nur sehr unreif aussah, sondern auch äußerst zerbrechlich wirkte, wuchs in mir plötzlich die Besorgnis, das kleine Mädchen könnte womöglich schon seine erste Nacht nicht überleben. Um mir als guter Katholikin später keine Vorwürfe machen zu müssen, beschloss ich, dem Kind die Nottaufe zu spenden. Dass ich keine Erlaubnis der Eltern hatte – die Mutter war noch nicht ansprechbar, der Vater nicht zu erreichen –, schien mir das geringste Problem zu sein. Ich irrte gewaltig, wie ich bald feststellen sollte.
Zunächst war ich jedoch fest davon überzeugt, völlig richtig zu handeln. Ich goss Weihwasser über das Köpfchen und sprach die vorgeschriebenen Taufworte. Nicht nur das – ich vermerkte die Nottaufe auch im stationsinternen Tagebuch, in dem alle wichtigen Vorkommisse festgehalten wurden. Außerdem machte ich anschließend meiner Lehrhebamme Mitteilung, sodass alle Bescheid wussten.
Unser Frühchen überlebte nicht nur seine erste Nacht, sondern eine nach der anderen, nahm zusehends zu an Reife, Gewicht und Länge, und nach einigen Wochen konnten die Eltern ein gesundes Kind bei uns abholen. Sie waren überglücklich, bis sie bei der Entlassung von der Nottaufe erfuhren. Vor allem der Vater fiel aus allen Wolken. Das bedeute doch nicht, versuchte die Säuglingsschwester zu beschwichtigen, dass keine offizielle, feierliche Taufe mehr stattfinden könne. Sie verkannte das Problem gründlich, wie sie bald merkte.
»Was fällt euch ein? Ich lehne Taufen ab!«, herrschte der Mann die Schwester an. »Wer hat das veranlasst?«
»Ich weiß es nicht«, antwortete diese wahrheitsgemäß. »Aber das lässt sich herausfinden.«
Bald stand ich als Täter vor dem erbosten Vater, der aus der Kirche ausgetreten war und sich als Freigeist betrachtete. Die Taufe seiner Tochter lief seinem ganzen Weltbild zuwider.
»Was fällt Ihnen ein?«, herrschte er mich an. »Ihr eigenmächtiges Handeln wird Sie teuer zu stehen kommen.«
O Gott! Wollte er mich etwa anzeigen? Mit bemüht ruhigen Worten versuchte ich ihm meine Gründe und meine Sichtweise zu erklären, aber nichts vermochte seinen Ärger zu besänftigen.
»Ich hab es doch nicht bös gemeint«, verteidigte ich mich jetzt. »Ich hatte bloß Angst, dass sie die Nacht nicht überlebt.«
»Sie hat aber überlebt, wie Sie sehen.«
»Ja, zum Glück! Darüber sollten Sie über die Maßen froh sein und dem Herrgott danken.«
Mit dieser Empfehlung kam ich allerdings schlecht bei ihm an, denn jetzt ging das Gezeter erst recht los. »Für mich existiert Gott nicht. Also muss ich ihm auch nicht danken. Außerdem, was maßen Sie sich an? Sie als einfache Schülerin wollen mir vorschreiben, was ich zu tun habe? Ich will Ihnen mal sagen, was Sie zu tun gehabt hätten: Ihre Aufgabe wäre es gewesen, sich den Erhebungsbogen anzuschauen. Dann hätten Sie nämlich festgestellt, dass wir keiner Konfession angehören und eine Nottaufe demzufolge völlig unangebracht war.«
Es ging noch eine Weile hin und her, ohne dass der aufgebrachte Vater meine Erklärungen und Entschuldigungen akzeptieren wollte. Schließlich ließ er mich einfach stehen. Seine Frau hatte während der ganzen Szene nur schweigend dabeigestanden, den Säugling auf ihrem Arm fest an sich gedrückt.
Einige Tage später wurde ich zu unserem Primarius zitiert. Er ließ sich von mir den Fall schildern und ermahnte mich, solche Eigenmächtigkeit künftig zu unterlassen, was ich mit schuldbewusst gesenktem Kopf versprach. Danach erzählte er mir schmunzelnd, dass es ihm gelungen sei, den aufgebrachten Vater zu beschwichtigen, und ich somit keine Konsequenzen befürchten müsse. Der Chefarzt hatte dem Mann klarmachen können, dass die Nottaufe seiner Tochter, wenn er es denn so wolle, ohne jede Verpflichtung bleibe. Da sie bislang in keinem Kirchenregister eingetragen wurde, sei das Kind offiziell kein Mitglied der Kirche, und genau das war ja der springende Punkt. Es liege allein an den Eltern, ob die Taufe bindend werde oder nicht. Der Primarius riet dem Kirchengegner, sie doch einfach zu ignorieren und die Tochter religionslos aufwachsen zu lassen. Was er dann wohl auch tat, wie ich viel später erfahren sollte, denn die Geschichte war an diesem Punkt noch nicht zu Ende. Allerdings hörte ich erst wieder von dieser Familie, als ich sie eigentlich längst vergessen hatte, höchstens einmal bei einer zu spendenden Nottaufe dachte ich kurz an die verzwickte Situation von damals.
Zwanzig Jahre später führte mich ein sonderbarer Zufall genau mit jenem Frühchen zusammen, das ich aus Sorge um sein Seelenheil seinerzeit ohne Einwilligung der Eltern getauft hatte. Ich war eingeladen, beim Eintritt einer Nichte in ein Kloster anwesend zu sein. Es handelte sich um die Tochter meines Bruders, die ich schon über die Taufe gehalten hatte und die nach mir Marianne hieß. Mit zwanzig war dieses Patenkind auf die Idee gekommen, der Welt Lebewohl zu sagen und in einen Orden einzutreten, was sowohl von ihren Eltern als auch von den Großeltern freudig begrüßt wurde. Man war auf dem Land noch lange stolz darauf, wenn eines der Kinder einen geistlichen Beruf oder ein Leben in klösterlicher Abgeschiedenheit wählte. Nach einer einjährigen Vorbereitungszeit sollte nun die feierliche Einkleidung mit Ablegen der zeitlichen Gelübde erfolgen, und dazu waren nicht nur die Eltern, Geschwister und Großeltern eingeladen, sondern auch Onkel und Tanten, besonders natürlich die Paten.
Wie stolz war ich, meine kleine Nichte vor den Altarstufen in der Reihe mit vier anderen Postulantinnen zu sehen. Die erste wurde mit ihrem vollen Namen aufgerufen und trat vor den greisen Priester hin. Dieser legte ihr die Hände aufs Haupt, sprach sie mit ihrem Vornamen an und ließ sie das Gelübde sprechen. Anschließend sagte er in etwa, dass sie mit diesem Gelübde auch den alten Menschen ablege und nun als Braut Christi einen neuen Namen erhalte. Als dann meine Nichte an die Reihe kam, allem Weltlichen abschwor und ihr Ordensname genannt wurde, konnte ich nicht mehr an mich halten. Vor Rührung zerdrückte ich einige Tränen und hätte beinahe nicht auf die nächste Novizin geachtet. Doch plötzlich ging mir ein Licht auf. Dieser für unsere Gegend gänzlich ungebräuchliche Name! Wer hieß hier schon Tamara? Und auch ihr Familienname war etwas ungewöhnlich, sodass ich ihn mir bis heute gemerkt hatte. Ein Bild aus längst vergangenen Tagen tauchte vor meinem inneren Auge auf. Ein kleines Mädchen im Arm seiner Mutter, daneben ein aufgebrachter Vater, das Lehrkrankenhaus in Salzburg und ich als Hebammenschülerin. Vom Rest der Einkleidungszeremonie bekam ich nicht mehr viel mit, ungeduldig fieberte ich dem Ende der religiösen Handlung entgegen. Danach sollte nämlich ein gemeinsames Mahl für die Novizinnen und ihre Angehörigen stattfinden. Vielleicht ergab sich ja eine Gelegenheit, mit jener jungen Schwester, die den Ordensnamen Gertrudis erhalten hatte, ins Gespräch zu kommen.
Tatsächlich gelang es mir, einen Platz neben ihr zu ergattern. Während fast alle anderen Novizinnen von ihren Eltern eingerahmt am Tisch saßen, hatte Gertrudis nur eine weibliche Begleitperson neben sich, in der ich bei genauerer Betrachtung die Fabrikantengattin wiederzuerkennen glaubte. Der Stuhl zur Linken der jungen Schwester war frei geblieben. Während des einfachen Mahls, das weitgehend schweigend eingenommen wurde, wagte ich es nicht, meine Tischnachbarin anzusprechen. Beim Pudding dann, als sich ein allgemeines fröhliches Geschnatter erhob, kam sie mir zuvor und fragte mich freundlich: »Zu welcher Novizin gehören denn Sie?«
»Zur Marianne Maierhofer. Verzeihung, ich meine Schwester Felicitas.«
»Ach ja? Eine sehr nette Person und äußerst tüchtig. Man merkt ihr an, dass sie schon früh Verantwortung hat übernehmen müssen. Offensichtlich hat sie viele Angehörige mitgebracht.«
»Ja, ja, wir sind eine große Familie«, bestätigte ich. »Ganz im Gegensatz zu Ihrer, scheint mir.«
»Das kann man wohl so sagen. Ich bin als Einzelkind aufgewachsen und meine Mutter ebenfalls. Übrigens, darf ich sie Ihnen vorstellen?« Bei diesen Worten lehnte sie sich ein wenig zurück und gab den Blick auf ihre Tischnachbarin frei. Wir reichten uns die Hände, und ich nannte meinen Namen. Dabei war mir, als würde im Gesicht der noch immer attraktiven Dame ein Funke des Erkennens aufleuchten. Für einige Sekunden schien sie angestrengt darüber nachzudenken, wo und wie ich einzuordnen sei. Dann fragte sie plötzlich unverblümt: »Sind Sie nicht die Hebammenschülerin, die meiner Tochter die Nottaufe gespendet hat?«
Überrascht nickte ich: »Donnerwetter, dass Sie mein Gesicht wiedererkennen, zumal nach zwanzig Jahren, die schließlich ihre Spuren hinterlassen haben.«
»Es ist nicht nur das Gesicht – es ist auch der Name.«
»Sind Sie mir noch immer böse?«, steuerte ich direkt auf das Thema zu, das uns verband.
»Ich? Nein. Ich war Ihnen niemals böse. Ich habe nur zu gut verstanden, dass Sie mit der Taufe meinem Kind etwas Gutes tun wollten, obwohl ich damals der Kirche ebenfalls fernstand. Allerdings wagte ich es seinerzeit nicht, meinem Mann zu widersprechen, weil er in dieser Hinsicht völlig kompromisslos war.«
Tamara oder Schwester Gertrudis, die unser Gespräch schweigend, aber mit sichtlichem Interesse verfolgt hatte, mischte sich nun ein: »Sie sind also die Frau, die mich getauft hat! Dafür danke ich Ihnen von Herzen.« Ohne recht zu begreifen, wie mir geschah, erfasste sie meine Rechte und schüttelte sie kräftig.
Da wir alle drei das Bedürfnis hatten, uns ausgiebig und ungestört zu unterhalten, sonderten wir uns von der Tischgesellschaft ab und begaben uns in den gepflegten Klostergarten. Während wir uns zwischen den Blumen- und Kräuterbeeten, zwischen Zierbüschen, Beerensträuchern und Obstbäumen ergingen, lauschte ich gebannt der Geschichte, die mir Mutter und Tochter erzählten.
Dem Ehepaar war weiterer Kindersegen versagt geblieben, und so hatte der Vater seine ganze Liebe und all seine Hoffnungen auf seine einzige Tochter gesetzt. Sie galt ihm nicht nur als Garantin für den Fortbestand der Familie, sondern auch für den seiner Firma, die schon seit Generationen in Familienbesitz war. Konsequent hatte er auch eine nicht kirchliche Erziehung verfolgt und sie in der Schule vom Religionsunterricht abgemeldet.
Doch er hatte die Rechnung ohne seine Tochter gemacht. Die nämlich war neugierig geworden und ließ sich von der Freundin und Banknachbarin erzählen, was im Religionsunterricht durchgenommen wurde, und saugte alles begierig in sich auf. Nachdem sie das erste Schuljahr hinter sich gebracht hatte, wollte sie mehr wissen und bat ihren Vater, ob sie nicht doch am Religionsunterricht teilnehmen dürfe. Er antwortete mit einem klaren Nein und erklärte ihr, es sei alles nur Humbug, was man da lerne. Nichts, was einem im wirklichen Leben nütze.
Diese Abfuhr schürte ihr Interesse für alles Religiöse noch mehr, und so fasste sie sich eines Tages ein Herz und zog ihre Klassenlehrerin ins Vertrauen. Die beiden schmiedeten ein Komplott: Tamara besuchte ab sofort inoffiziell den Religionsunterricht, und sie versicherten einander, dem Vater gegenüber kein Sterbenswörtchen verlauten zu lassen.
Mit Traurigkeit im Herzen erlebte das Kind, wie die Mitschülerinnen zur ersten heiligen Kommunion gehen durften. Und später im Gymnasium, wo sie wiederum eine verständnisvolle Lehrerin fand, die ihr den heimlichen Besuch des Religionsunterrichts ermöglichte, sah sie wehmütig zu, wie die anderen im Alter von vierzehn Jahren die heilige Firmung empfingen. Da nahm sie sich vor, dass sie, sobald sie erwachsen war, das alles nachholen wollte.
Sie empfand es als persönliches Geschenk, dass just zu dieser Zeit das Alter der Volljährigkeit auf achtzehn gesenkt wurde. Drei Jahre weniger, die sie warten musste. Gleich nach Erreichen dieser magischen Altersgrenze wollte sie sich taufen lassen und vertraute ihre Pläne der Mutter an. Eingestellt auf einen kleinen Kampf, war sie maßlos überrascht, als diese ganz anders als erwartet reagierte. »Ja, Kind, du brauchst dich nicht taufen zu lassen, du bist es bereits!« Und wie zu sich selbst war sie fortgefahren: »Demnach scheint die Taufe doch mehr zu sein als eine bloße Zeremonie, und den lieben Gott gibt’s wohl auch. Mir kommt es so vor, als habe er im Augenblick deiner Taufe seine Hand auf dich gelegt und dich nicht mehr losgelassen.«
»Da könntest du recht haben«, erwiderte die Tochter, »so habe ich das immer empfunden, deshalb will ich dir noch mehr anvertrauen. Gott lässt mich nicht mehr los. Sobald ich die Matura in der Tasche habe, werde ich in ein Kloster eintreten.«
»O mein Gott!«, hatte die Mutter geseufzt. »Dein Vater wird toben. Du solltest doch die Familientradition fortsetzen, nach einem Wirtschaftsstudium die Firma übernehmen, und einen passenden Mann hat er auch schon für dich ins Auge gefasst.«
Aber Tamara war entschlossen, ihr Leben Gott zu weihen. Natürlich blieben heftige Kämpfe mit dem Vater nicht aus, der die Hoffnung nicht aufgeben wollte, die Tochter doch letztlich wieder auf den Weg der Vernunft zurückzuführen, wie er es ausdrückte. Aber keine Vorhaltungen, keine Argumente fruchteten, sodass am Ende die bitteren Worte fielen: »Dass du am Ende von diesem Bazillus infiziert worden bist, kann nur an der heimlichen Taufe durch diese Hebammenschülerin liegen.«
»Ja, Vater, und vielleicht sollte dir das zu denken geben, dass es doch einen Gott gibt.«
Am Ende hatte er resigniert. »Meinetwegen, geh ins Kloster«, waren seine letzten Worte gewesen, die er ihr zum Abschied mit auf den Weg gab. »Ich sehe es ein, man kann Gott nicht in den Rücken fallen. Auch wenn man ihn ignoriert, ist er da. Die Hauptsache ist, du wirst glücklich, mein Kind. Aber erwarte nicht, dass ich mitgehe und zuschaue, wie dort meine ganzen Hoffnungen zunichte gemacht werden.«
Die Mutter hatte sie zum Kloster begleitet, als sie um Aufnahme bat. Zunächst allerdings musste sie offiziell Mitglied der Kirche werden und eine entsprechende Unterweisung durchlaufen. Schließlich empfing sie am Tag ihres Klostereintritts in Gegenwart der Mutter noch einmal die Taufsakramente. Diesmal war es eine feierliche Zeremonie in der Klosterkapelle, vorgenommen von dem alten Priester. Obwohl die von mir gespendete Taufe nicht ungültig war, benötigte Tamara für ihren Eintritt ins Kloster einen offiziellen Taufschein. Gleich im Anschluss an die heilige Handlung durfte die junge Postulantin zum ersten Mal zum Tisch des Herrn gehen, ein für sie beseligender Augenblick. Und wenige Wochen später wurde sie in der Pfarrkirche des Ortes vom Weihbischof gemeinsam mit Dreizehn- und Vierzehnjährigen gefirmt.
Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie bewegt ich von dieser Lebensgeschichte war, die ihre ganz eigene, unerwartete Wendung genommen hatte, und dachte an das alte Sprichwort: Der Mensch denkt und Gott lenkt. Als sich die Angehörigen der jungen Ordensfrauen verabschieden mussten, drückte mir Schwester Gertrudis ganz fest die Hand und flüsterte mir zu: »Sie haben damals Ihre Sache gut gemacht. Sie sehen selbst, Gottes Wege sind nicht unsere Wege.« Und ich wurde bestärkt in meinem festen Glauben, dass es sich hier nicht um eine Laune des Schicksals, sondern um eine Fügung des Himmels handeln musste.
Fiakerkinder
Es war im Mai meines ersten Dienstjahres. Die Luft war mild, die Sonne strahlte vom blauen Himmel, und ich hockte gerade vor den Beeten in meinem Nutzgarten, um Pflänzchen zu setzen, als ich von ferne munteres Pferdegetrappel vernahm. Sollte das etwa Kundschaft für mich sein? Ich erhob mich aus meiner gebückten Haltung, streckte meinen geschundenen Rücken und machte einen langen Hals in die Richtung, aus der das Geräusch kam. Das Gefährt näherte sich schnell, und ich erkannte, dass es sich um den Fiaker Burger handelte, der mir längst aus dem Ortsbild vertraut war. Die Fiaker – so nennt man in Österreich nicht nur die Pferdekutschen, sondern auch deren Lenker – pflegten die Urlaubsgäste, die nach und nach in größerer Zahl unser Tal entdeckten, vom Bahnhof abzuholen und zu ihren Quartieren zu bringen und umgekehrt. Autos gab es damals nur ganz wenige in unserer Region.
Ein bisschen enttäuscht, dass für mich kein Geschäft in Aussicht schien, gleichzeitig aber auch erleichtert, dass ich meine Gartenarbeit nicht unterbrechen musste, wandte ich mich erneut meinen Beeten zu. Kaum hatte ich meine hockende Haltung wieder eingenommen, vernahm ich ein lautes »Brrr«. Neugierig richtete ich mich abermals auf und sah gerade noch, wie sich der Burger vom Kutschbock schwang. Er eilte geradewegs auf mich zu.
»Ich hab dich nicht bestellt«, rief ich ihm statt einer Begrüßung zu.
»Du net«, erwiderte er lachend, »aber meine Frau dich. Ich soll ihr die Hebamme bringen, hat sie mir angeschafft, bei ihr würd’s losgehen. Bring also alles mit, was du zu einer Entbindung brauchst.«
Das ließ ich mir nicht zweimal sagen. Zunächst aber holte ich mir die wichtigsten Informationen ein. Es handelte sich um das erste Kind, und die Wehen waren bei seiner Abfahrt im Abstand von zwanzig Minuten gekommen. Mir blieb also genügend Zeit, mich umzuziehen und mir die Hände gründlich zu waschen. Gartenerde enthält nämlich zahlreiche Krankheitskeime, die für eine Gebärende gefährlich werden können. Bald darauf schwang ich mich neben den Burger auf den Kutschbock und genoss es, mich wie eine Königin durch meinen Wohnort fahren zu lassen, dabei nach allen Seiten blickend, ob ich nicht Bekannte entdeckte. Im Fiaker fahren, so etwas konnten sich Einheimische kaum leisten.
Während der Fahrt blieb dem Burger Wastl genug Zeit, mir von seinem Beruf zu erzählen. Demnach hatte schon sein Vater dieses Unternehmen gehabt beziehungsweise es als junger Bursche im Jahr 1920 selbst gegründet. Allerdings diente sein Fuhrbetrieb damals nicht in erster Linie der Personenbeförderung – das hätte sich kaum gelohnt –, nein, der Burger transportierte als Besitzer von vier starken Rössern alles, was halt transportiert werden musste: Kohle, Holz, Baumaterial.
So wuchs der Wastl schon früh in das Fuhrgeschäft hinein und konnte sich für sein Leben nichts anderes vorstellen, als eines Tages stolz auf seinem eigenen Kutschbock zu sitzen.
Ab 1941, nach zwei Jahren Krieg, kam das Geschäft weitgehend zum Erliegen, weil der Vater samt seinen beiden besten Pferden zum Militär eingezogen wurde. Mit den verbliebenen älteren Tieren fuhr statt seiner der zehnjährige Wastl bei Bedarf Kohlen und andere Güter aus. 1943, der junge Burger stand kurz vor der Schulentlassung, tauchte dort zum Zweck der Berufsberatung ein strammer Hitlerjugend-Führer auf. Was er denn werden wolle, fragte der Mann den Wastl.
»Ein Fiaker«, antwortete der Bub im Brustton der Überzeugung.
»Fiaker?«, fragte der HJ-Mann, »was ist denn das?«
»Das ist einer, der mit einer Pferdekutsche umeinanderfährt«, klärte ihn der Wastl auf.
»Diese Berufsbezeichnung gibt’s bei uns nicht mehr«, belehrte ihn der NS-Mann, »heutzutage heißt das Kutscher.«
Darauf antwortete der Fiakersohn nichts. Im Stillen dachte er nur: Und ich werd doch Fiaker. Denn die wird’s noch geben, wenn’s euch schon längst nimmer gibt. Er sollte recht behalten.
Damit das Fuhrgeschäft einigermaßen weiterexistieren konnte, teilte man der Familie im Jahr 1943 einen Volksdeutschen als Aushilfskutscher zu, einen alten Mann, für den man im Krieg keine Verwendung mehr hatte und der blieb, bis Vater Burger 1945 wohlbehalten zurückkam.
Als Erstes schaffte der sich zwei neue Pferde an, und der Wastl stieg im Alter von vierzehn Jahren voll in den väterlichen Betrieb ein. Ein paar Jahre später, als es plötzlich steil aufwärtsging mit der Wirtschaft, blühte auch das Fuhrgeschäft in unserem Sprengel mächtig auf. Besonders der wachsende Tourismus tat das Seine und brachte dem Unternehmen ganz schöne Sümmchen ein. Damit alles reibungslos ablief und keine unnötigen Konkurrenzkämpfe unter den Fiakern entstanden, handelten die untereinander aus, wer wann wo Dienst hatte. Beispielsweise mussten zu jeder Tages- und Nachtzeit zwei Fiaker am Bahnhof bereitstehen, ein Zwei- und ein Einspänner.
So weit zur Vergangenheit. Nun sollte also die nächste Fiakergeneration geboren werden, und der Wastl betonte unablässig, wie dringlich es sei, dass ein Sohn zur Welt kam. Als hätte ich darauf irgendeinen Einfluss! Unter Reden und Erzählen langten wir an seinem Haus an, das von einer großen Wiese umgeben war, auf der zwei Pferde friedlich grasten. »Aha, die haben heute ihren freien Tag«, stellte ich im Vorbeigehen fest. Aber ich hielt mich nicht länger mit der Betrachtung dieses hübschen Bildes auf, sondern eilte gleich an das Bett der werdenden Mutter, die mich schon voller Ungeduld erwartete. Die Wehen kamen bereits im Abstand von zehn Minuten.
»Marika, das ist die Nanni«, stellte mich ihr Mann vor, während ich mich gleich an die üblichen Untersuchungen machte. Ich beruhigte sie: »Es ist alles in Ordnung. Aller Voraussicht nach werden wir eine ganz normale Entbindung haben.«
»Und – wird’s ein Bub?«, wollte sie wissen.
»Aber geh, Marika, das lässt sich doch weder durch Abtasten noch durch Abhorchen feststellen. Da musst schon abwarten, bis das Spatzerl da ist.«
Die Enttäuschung stand ihr ins Gesicht geschrieben. »Ja, weißt«, erklärte sie mir dann, »der Wastl wünscht sich halt so sehr einen Buben. Fürs Fiakergeschäft braucht er den, damit der es von ihm übernehmen kann, so wie er es von seinem Vater hat.«
»Ich weiß, dein Mann hat mich während der Herfahrt ausführlich darüber aufgeklärt.«
»Ach so, dann weißt ja, was für uns auf dem Spiel steht.«
Über diese Formulierung musste ich lächeln. »Verstehen kann ich euch schon«, räumte ich ein. »Aber ich hab’s nicht in der Hand, das Geschlecht des Kindes zu bestimmen. Zudem ist es fraglich, ob der Sohn – falls es einer wird – wirklich später das Geschäft weiterführen kann. Bis dahin wird’s immer mehr Autos geben. Da will sich bald keiner mehr mit dem Fiaker befördern lassen.«
»Da magst recht haben«, stimmte sie mit bekümmertem Gesicht zu. »Aber Güter müssen doch nach wie vor transportiert werden, selbst in die entferntesten Winkel, wo nie eine Bahn hinkommen wird.«
Eine Bahn nicht, dachte ich, aber Lastwagen. Die würden bald Einzug halten, zumal man bereits damit begonnen hatte, sogar kleine Gebirgsstraßen auszubauen und zu asphaltieren.
Diese Meinung behielt ich jedoch für mich. Eine werdende Mutter sollte man nicht zusätzlich deprimieren. Für die Entbindung war es besser, wenn die Schwangere guter Stimmung war. Schnell wechselte ich also das Thema: »Dann wollen wir mal schauen, ob am Ende ein kleiner Fiaker herauskommt. Gönnen würd ich’s euch.«
Auf dieses Thema fuhr sie gleich ab: »Schau, ich hab schon alles für ihn vorbereitet.« Voller Stolz deutete sie in die Ecke mit der Wickelkommode. »Da, die Wiege ist blau ausgeschlagen, und blaue Jackerl hab ich auch zurechtgelegt.«
Wirklich, einen so sorgfältig vorbereiteten Wickeltisch hatte ich bisher in meinem Sprengel noch nicht zu sehen bekommen. Nichts fehlte, was man für die Ankunft eines neuen Erdenbürgers brauchte: Eine weiche Wickeltischauflage war da, Windeln, Handtücher, eine Badewanne, sogar Babycreme und Puder.