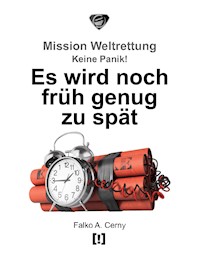
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine längst überfällige Abrechnung mit einem Zeitgeist und seiner 'Generation Z', die sich im vollkommenen und endgültigen Wissen wähnt, auf ihrer Mission der umfassenden Weltrettung, in dem Glauben, uns alle vor allem Möglichen retten zu müssen, mit Vorliebe auch Betroffene, die bisher noch gar nicht wussten, dass sie betroffen sind und wovon überhaupt. Ein Zeitgeist, in dem es keinerlei Problem ist, in einer vollproblematisierten Welt zu leben. Immerhin: Es gibt Hoffnung! Es könnte sein, dass sich diese Gesellschaft gerade noch rechtzeitig vor der anstehenden Apokalypse erfolgreich selbst zerlegt haben wird. Mit fein dosierter beißender Ironie widmet sich Cerny dem zeitgeistig radikal-überdrehten Aktivismus von (u.a.) Klimawandel, Vegetarismus und Gesundheitswahn, Diskriminierungen aller Art und kulturell angeeignetem Rassismus, bis zu Sexismus, 'Gender'-Psychose und ein paar anderen Pathologien, die ausnahmslos alle und jede für sich unweigerlich in den sicheren Weltuntergang führen. Dieses Buch ist ein therapeutisches Erste-Hilfe-Angebot.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Wir hätten ganz sicher auch die Dinosaurier vor dem Aussterben gerettet. Und ein paar Jahre vorher hätten wir alles unternommen, um den Urknall zu verhindern.“ Cerny
Der Autor entzieht sich weitestmöglich dem Zeitgeist, den er kritisiert, und verzichtet aus diesem Grund auf sog. „geschlechtersensible Sprache“ (auch als „gendergerecht“ bezeichnet). In seinen Werken richtet sich Cerny an den geneigten Leser als (der) Mensch, gänzlich unabhängig von dessen etwaigem Geschlecht, seiner Haarfarbe, Schuhgröße oder sonstigen Merkmalen.
Inhalt
Vorwort
Der Zeitgeist des endgültigen Wissens
Vegetarisch gesunde Weltrettung
Klimawandel: atmosphärische Störungen
Rassismus mit zwanghafter Willkür
Diskriminierung: Wer suchet, der findet
Vielfalt, Gender und Identitäten
sonstige Weltuntergänge
Stichwortverzeichnis
VORWORT
Damit hinterher niemand sagen kann, er hätte von nichts gewusst, sei vorab zumindest schon einmal so viel vorgewarnt: Das hier ist ein hochgefährliches Buch! Erst recht: dessen Inhalt. Zum einen, weil hierin Gesellschaftskritik zu einem ganz erheblichen Teil mit Humor verbunden wird. Beides jedoch wird mittlerweile, in diesem Zeitgeist, dieser Generation und dieser Gesellschaft, kaum noch erkannt. Und wenn es erkannt wird, wird es immer öfter nicht verstanden; weder das eine, noch das andere, geschweige denn: das eine mit dem anderen in Verbindung. Für ziemlich viele Menschen (und erschreckend zunehmend mehr) ist das quasi eine doppelte intellektuelle Überforderung. Wer sich davon direkt betroffen fühlen sollte, hat damit hier nun Gelegenheit, dieses Buch genau jetzt, gerade noch rechtzeitig, wegzulegen.
Dummerweise werden inzwischen solche Gelegenheiten allerdings gern zu dem genau gegenteiligen Zweck verwendet: gerade, um sich aufzuregen, zu empören und (vornehmlich: sozial-medial) herumzupoltern – ...ohne sich darüber bewusst zu sein, die soeben erwähnten Defizite dadurch auch noch unfreiwillig, aber höchstpersönlich selbst zu bestätigen. Was es mit diesem zeitgeistigen Phänomen und mit dieser gesellschaftlichen Malaise genauer auf sich hat, ist ein thematischer Bestandteil dieses Buches.
Wer allerdings Gesellschaftskritik nicht als solche erkennt und/oder nicht versteht, neigt ungefähr so stark, wie damals die „Titanic“ unmittelbar vor ihrem Untergang dazu, eine rein gesellschaftskritische Betrachtung auf sich selbst zu beziehen, sie persönlich zu nehmen, und sich nicht nur falsch behandelt, sondern gar persönlich angegriffen zu fühlen. So jemand verfällt spontan wutschnaubend empört in eine Verteidigungshaltung, mit der er alles Geschriebene durch diesen gedanklichen Vor-Filter jagt. Es ist immer wieder sowohl faszinierend wie tragisch, was daraufhin zwanghaft in Textzeilen so alles freihändig hineininterpretiert und aus ihnen herausgelesen wird, doch an keiner einzigen Stelle tatsächlich geschrieben steht.
Dieses Phänomen wird inzwischen seit mindestens rund zwanzig Jahren noch parallel begleitet von regelmäßigen Auswertungen der sogenannten „PISA“-Bildungsstudien, wonach es ohnehin schon allgemein und generell eklatant am grundsätzlichen Leseverständnis hapert – von dem Verständnis, worum es sich bei dem Gelesenen (das schon nicht wirklich verstanden wurde) handeln könnte, zum Beispiel etwa um Gesellschaftskritik, noch ganz abgesehen.
Bedenkt man dazu noch, dass in diesen „PISA“-Studien die Lesekompetenz von ausschließlich fünfzehnjährigen Schülern auf die Probe gestellt wird, und das eben: seit mittlerweile zwanzig Jahren, dann sind demnach vor allem die heute Unter-35-Jährigen (soziologisch als „Generation Y“ bezeichnet) von solchem Verständnisdefizit leider besonders betroffen. Das tut mir leid.
Darauf folgt zwar zwangsläufig, aber nicht gerade sonderlich ermutigend, die „Generation Z“ (im beliebten Denglisch auch wahlweise „Post-Millennials“ oder „Digital Natives“ genannt), die bereits in die digitalisierte schöne, neue Welt des Internet und der „Sozialen Netzwerke“ hineingeboren wurde, und ohne ihr Smartphone ziemlich rat- und hilflos dasteht – ...sich jedoch gerade aufgrund des ganzen Digitalkrams gern sämtlichen vorherigen Generationen hochüberlegen wähnt. Das hat schon einen leicht ironischen Witz.
Zu diesem Aspekt, der dieses Buch potenziell brandgefährlich macht, gesellt sich hierin mindestens noch ein zweiter erschwerend hinzu: Humor. Und zwar nicht irgendein Humor, sondern in Form von Ironie und Satire; also pointierte Anmerkungen, die erst um zwei/drei Ecken herum, von hinten durch die Brust ins Auge, ihre volle Wirkung entfalten. Oder eben auch nicht. In einem Zeitgeist und einer Gesellschaft nämlich, wo ohnehin einiges an Verständnisfähigkeit erschreckend brach liegt, ist parallel auch das Erkennen und Verstehen von Humor zunehmend unter- oder gar nicht erst entwickelt (wobei - zugestanden - sicherlich schon immer nur eine relative Minderheit einen humorellen Zugang zu Ironie und Satire hatte). Die Fähigkeit, auch über sich selbst lachen zu können, sich selbst nicht allzu ernst zu nehmen, in diese Beobachtung mit eingeschlossen.
Solches Überaus-Ernstnehmen (ob irgendetwas oder sich selbst) ist jedoch in dieser Gesellschaft in diesem Zeitgeist mindestens so stark ausgeprägt, wie einige andere Defizite. Das ist auf den ersten flüchtigen Blick (bei dem es mit wachsender Beliebtheit auch belassen wird) kein großes Wunder: Angesichts einer scheinbaren Unmenge aktueller Missstände, Probleme und Krisen, die allesamt und ausnahmslos zu Tod, Elend und Verderben führen, und letztlich sowohl das Ende allen menschlichen Seins als auch die Zerstörung unseres Planeten zur Folge haben werden... selbstverständlich muss das alles überaus ernst genommen werden, und muss sich jeder Einzelne selbst überaus ernst nehmen mit seinem ganz persönlichen Anliegen zur Weltrettung. Erst recht, wenn sich daraus aktivistische Bewegungen formiert haben, die sich alle überaus ernst nehmen. In dieser Gesamtlage gibt es eben nichts zu lachen!
Wer mit solchem Gedankengut abgefüllt durch sein Leben geht, hat natürlich auch noch zusätzliche Verständnisprobleme, wenn er auf Mitmenschen trifft, die das alles ein wenig anders sehen: nicht ganz so dramatisch, nicht ganz so bedrohlich, nicht ganz so apokalyptisch, vielleicht sogar noch: mit Humor. Einmal abgesehen davon, dass Sozialpsychologen schon seit mehreren Jahren auch über einen erschreckenden Mangel an Empathie in unserer Gesellschaft klagen: Prompt fühlt man sich inklusive seines Anliegens nicht nur nichternst-genommen, sondern schon wieder höchstpersönlich angegriffen; auch wenn es sich um Gesellschaftskritik, also um eine kritische Betrachtung rein gesellschaftlicher Entwicklungen, handelt; siehe oben.
Wobei es in einem solchen Zeitgeist, in dem es keinerlei Problem darstellt, sich gedanklich in einer vollproblematisierten Welt zu wähnen, schon etwas leicht Ironisches hat, wenn laut einer Umfrage1 im Jahr 2022 ausgerechnet die Generation der jetzt Unter-35-Jährigen mehrheitlich zu 56% angab, sie würde „lieber in der Vergangenheit leben“, weil „früher alles besser war“. Ein Spruch, der als verbitterte Floskel bislang schließlich nur „den Alten“ vorbehalten war, die sowieso an allem Schuld sind.
In einem solchen Zeitgeist mit einer solch zielsicher problematisierenden Grundmentalität führt das gesamtgesellschaftlich (u.v.a.) ebenso zielsicher zu einem zusätzlich verschärften Generationenkonflikt, wie zu einer weiteren gern deklarierten „Spaltung der Gesellschaft“: wenn Mitmenschen ob ihrer anderen Sichtweise und Meinung als Gegner und Feinde betrachtet werden, die es zu bekämpfen gelte, gedanklich minimalisiert auf die 'Gutmenschen' gegen die „Skeptiker“ und „Leugner“ aller Art; und das natürlich: im Namen des Guten und für eine „bessere Welt“. Dass sich (auch) das in diesem Zeitgeist ein wenig widerspricht, wird nicht einmal ansatzweise bemerkt.
Apropos Grundmentalität: Zu Beginn der 1990er Jahre stieß ich durch die generell und völlig zurecht hochgeschätzte Vera F. Birkenbihl (die jüngere Generation sollte das Internet nach ihr durchsuchen, es könnte sich lohnen) erstmals auf die Erkenntnis „Die Welt ist, was ich von ihr denke“. Ohne hier nun ins Detail zu gehen, nur grob angerissen erläutert:
Wer mit der Einstellung durch das Leben geht, die Welt sei grundsätzlich ein äußerst gefährlicher Ort, der sieht auch in allem eine potenzielle Gefahr und Bedrohung, und hat vor allem möglichem Angst: vor Krankheit, Kriminalität, Lug und Trug und Vertrauensbruch, vor Job- und Geldverlust, etc, etc. Ein solcher Mensch sieht sich inmitten lauter Gefahren, ist dem entsprechend übervorsichtig, misstrauisch und zurückhaltend, und schließt alle möglichen Versicherungen ab. So jemand führt ein ziemlich anstrengendes Leben.
Ein anderer Mensch, der die Welt hingegen als wundervollen Ort betrachtet, sieht grundsätzlich das Positive (auch in seinen Mitmenschen), richtet seinen Blick eher auf Chancen und Möglichkeiten als auf Risiken und Gefahren, ist offenherzig, vertrauensvoll, spontan und abenteuerlustig.
Dazwischen und daneben gibt es natürlich unzählige Überschneidungen und Abstufungen. Das waren nur lediglich zwei extreme Beispiele, beispielhaft für die Erkenntnis „Die Welt ist, was ich von ihr denke“: Es leben beide in ein- und derselben Welt und dennoch sehen beide darin jeweils anderes, denken daher jeweils anders, verhalten sich daher anders, und: machen dem entsprechend auch jeweils andere Erfahrungen in ihrem Leben. Und wie die Chinesen sagen: „Ein Mensch ist die Summe seiner Erfahrungen“.
Absurd ist es vielmehr, wenn jemand auf seine Sichtweise als die „richtigere“ von beiden (überhaupt: von allen sonst noch möglichen) pocht, während alles andere falsch, unwahr, unvernünftig, anormal, dumm, wasauchimmer ist, und sich (deshalb) selbst auch noch für den „besseren Menschen“ hält.
So scheint es unsere Gesellschaft in diesem Zeitgeist voller tatsächlicher und scheinbarer Missstände, Probleme und Krisen mit dem „Terminator“ aus dem gleichnamigen Kinofilm zu halten, der im dritten Teil der Filmreihe in aller Weisheit feststellt: „Zorn ist sinnvoller als Verzweiflung“. Gegenüber einer Lethargie der Verzweifelten, die „es aufgegeben“ und „sich abgefunden haben“ und denen man ein Nichtstun vorwirft, verschaffen sich andere Luft und Gehör als sogenannte „Wutbürger“, während wiederum andere und meist Jüngere es vorziehen, ihre Wut und ihren Zorn als radikale Aktivisten zu kanalisieren; als diejenigen, die „wenigstens etwas tun“ und „etwas verändern wollen“. Dabei lauert der gedankliche Fallstrick jedoch in der scheinbaren Alternative zwischen entweder Zorn oder Verzweiflung; als gäbe es sonst keine andere mögliche Reaktion. Gibt es allerdings doch, nämlich eben mindestens noch: Humor (wobei sich nun einmal gerade die Satire dadurch auszeichnet, auf Missstände aller Art hinzuweisen).
Wer sich noch grob an seine Schulzeit erinnert, an den Biologie-Unterricht und den Lehrstoff Verhaltensbiologie, dem sind womöglich noch die beiden Hähne bekannt, die sich im Streit gegenüberstehen. Gemäß einer Theorie des Physiologen Walter Cannon werden die beiden nun entweder mit Kampf oder mit Flucht reagieren. Es sei denn, beide Reizimpulse sind etwa gleich stark, sodass ein Hahn weder mit Kampf reagiert noch mit Flucht, sondern plötzlich beginnt, nach Körnern zu picken; eine sogenannte Übersprungshandlung. Womöglich jedoch zeigt ein Hahn mit einer solchen Reaktion vielmehr etwas ganz anderes: Humor! ...und lässt den anderen in seiner ganzen angespannten Aufregung einfach leicht verblüfft und etwas ratlos dastehen.
1 „Stiftung für Zukunftsfragen“ Hamburg, repräsentative Onlinebefragung im April 2022
DER ZEITGEIST DES ENDGÜLTIGEN WISSENS
„Meine Mutter sagte früher zwischendurch leicht ironisch: 'Man kann ruhig dumm sein. Man muss nur Ideen haben.' Sie hatte Recht. Man ist äußerst ideenreich in diesem Zeitgeist“
(Cerny)
Ich kann nicht umhin festzustellen: beeindruckend! Wirklich: beeindruckend! Finden Sie nicht auch? Ich meine diesen Zeitgeist, in dem wir gerade leben, mit dieser Generation, die wir gerade haben; die sogenannte „Generation Z“.
Wobei ich mich übrigens, als ich das zum ersten Mal hörte, ganz spontan fragte: Was soll eigentlich dieses „Z“ bedeuten2? Wofür steht das? Soll das etwa „Z“ wie „Zukunft“ heißen? Ist die aktuelle Generation dann also quasi die „Generation Zukunft“? Und wenn das so ist, was ist denn dann mit uns Älteren? Soll das vielleicht heißen: wir haben die Zukunft schon hinter uns? Ich muss gestehen: ein durchaus interessanter Gedanke.
Doch abgesehen davon, wie gesagt: Ich bin beeindruckt. Denn schließlich wird jetzt, in diesem aktuellen Zeitgeist von dieser aktuellen Generation, in aller Konsequenz radikal aufgearbeitet, was in den letzten zwei Millionen Jahren Menschheitsgeschichte so alles schiefgelaufen ist. Toll! Das heißt nun einmal nichts Geringeres, als dass diese aktuelle „Generation Z“ in diesem aktuellen Zeitgeist über das absolute, vollkommene und endgültige Wissen verfügt, was mehr als zwei Millionen Jahre lang von sämtlichen vorherigen Generationen falsch gemacht wurde – ...und wie das alles richtiger wäre und allesamt jetzt, sofort, und auf der Stelle korrigiert werden muss! Und sogar noch weit mehr: Damit kann also diese Generation in diesem Zeitgeist auch absolut ausschließen, dass sie sich eventuell, vielleicht und womöglich selbst auf dem Holzweg befinden könnte. Das ist ziemlich erleichternd. Denn immerhin können sich damit „die Alten“, die schließlich der Mitschuld an allem angeklagt sind, nun in aller Seelenruhe zurücklehnen, während die „Generation Z“ sämtliche Fehler der letzten zwei Millionen Jahre ausbügelt.
So durfte ich kürzlich in einem „Sozialen Netzwerk“ die Statusmeldung einer jungen Frau lesen, die meinte, der ganzen Welt unbedingt folgendes mitteilen zu müssen: „Da ich mich nicht vervielfachen kann, um überall gleichmäßig über das Unrecht dieser Welt aufzuklären, finde ich es nur gerecht, meine Stimme für diejenigen Wesen zu erheben, die am wenigsten Stimmen für sich haben“. Mit den „Wesen“ waren übrigens die Tiere gemeint, die das Opfer uneinsichtiger und unbelehrbarer Fleischverzehrer sind, gegen die sie als Vegetarierin wettert. Tja. Wirklich bedauerlich, dass diese junge Frau leider nicht überall sein kann, um uns über all das böse Unrecht auf dieser Welt aufzuklären – von dem wir anderen (vor allem natürlich: „die Alten“) in unserer Ahnungslosigkeit noch gar nichts wussten. Beruhigend ist immerhin: sie ist damit nicht allein! Von solch tapfer engagierten jungen Menschen, die uns in ihrem Einsatz für die Weltrettung endlich eines Besseren belehren, gibt es in diesem Zeitgeist und in dieser „Generation Z“ ziemlich viele. Zwangsläufig. Schließlich haben wir heute eine Unmenge von Missständen, Problemen und Krisen, die unbedingt allesamt jetzt angeprangert gehören – vielleicht gerade noch rechtzeitig, bevor es für uns alle zu spät ist.
Auch wenn manch einer doch tatsächlich munkelt, es könnte sich vielleicht eher umgekehrt verhalten: In einem Zeitgeist, in dem die Selbstinszenierung der „Generation Z“ sogar noch das pausenlose mediale Dauerfeuer der sog. Offizialmedien locker toppt, hecheln und geifern alle nach Aufmerksamkeit und Beachtung, nach Klicks und „Likes“ und „Followern“ und Abonnenten, und nimmt sich jeder mit seiner Weltsicht ungeheuer wichtig. Da steigert man sich gern in alles hinein, was mindestens Empörungspotenzial bietet, idealerweise direkt verkoppelt mit dem kurz bevorstehenden Weltuntergang, je radikaler und dramatischer, desto besser. Und so schaukelt man sich gegenseitig hoch: die Offizialmedien (die Fernsehsender, die Zeitungen und Magazine mit all ihren Websites und „Social Media“-Kanälen) zusammen mit allem, was jeder Hans und Franz mittlerweile jederzeit in den „Sozialen Netzwerken“ als seinen absolut unverzichtbaren Beitrag von weltrelevanter Bedeutung veröffentlichen kann, ungeprüft und umgebremst. Wenn es früher noch lapidar hieß, es würde sich bei einigem doch bloß nur um unbedeutende „Stammtischmeinungen“ handeln, dann befinden wir uns heute, in diesem Zeitgeist, mit den „Sozialen Medien“ wohl unbestreitbar in einem einzigen großen Bierzelt: „Prost!“. Umso schlimmer, wenn heute sogar Politiker und Wissenschaftler meinen, sich an diesem Zirkus beteiligen zu müssen.
Da drängt sich die Frage auf: Woher bezieht eigentlich diese „Generation Z“ diese gewisse Überheblichkeit, die Arroganz, den Hochmut, die Anmaßung, sich im absoluten, vollkommenen und endgültigen Wissen zu befinden, und zwar gerade gegenüber jeglicher sonstigen älteren Generation. Dazu darf man getrost erst einmal feststellen: Es war möglicherweise schon immer so, dass sich die jüngeren Generationen von den älteren unverstanden fühlten, jeweils mehr oder weniger. „Die Alten“ hatten schon immer keine Ahnung und nur das eine einzige langweilige Argument ihrer Lebenserfahrung. Das war in meiner Jugend auch nicht anders und ganz selbstverständlich fühlten auch wir uns gegenüber „den Alten“ äußerst überlegen. Denn schließlich kamen in unserer Generation der Walkman, die CD, der Videorekorder, der GameBoy und (vor allem) der Heimcomputer auf – das konnten „die Alten“ mit ihrer ganzen Rückständigkeit doch alles gar nicht hinterblicken, geschweige denn: verstehen, in welcher Welt wir lebten. Insofern... soll das natürlich auch der „Generation Z“ voll zugestanden sein. Also: So weit.
Ein eminenter Unterschied besteht jedoch darin, dass sich „die Jugend“ in unterschiedlichen Szenen tummelte, Computerfreaks, „Popper“ und „Punker“ und „Ökos“, und welche, die sich aus allem gleichermaßen heraushielten; doch sie alle machten innerhalb ihrer Szenen „ihr Ding“, und maßten sich nicht an, alle anderen eines (vor allem: ihres) Besseren belehren zu wollen – nicht einmal pauschal „den Alten“ gegenüber. Und schon gar nicht: in umfassender Weise so ziemlich alles Mögliche anzuprangern und besser zu wissen. Noch nicht einmal die „Punks“, die „das System“ ganz generell, das Spießbürgertum und die Kleinbürgerlichkeit strikt ablehnten, sich mit ihremMotto „No Future“ einfach konsequent heraushielten, und sich in ihrem Generalprotest und ihrer Rebellion darauf beschränkten, untereinander in Fußgängerzonen abzuhängen und allenfalls noch Häuserwände mit Lackfarbe besprühten. Das alleine reichte in dieser Zeit allerdings schon, um die klein- und spießbürgerliche Mehrheit auf die Palme zu bringen und als doch nur „asoziale, faule Arbeitsverweigerer“ angefeindet zu werden. Sicherlich. Es scheint jedoch, als hätte sich das Ganze bis heute in eine erheblich andere, erschreckende Dimension gesteigert. Auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick wiederum scheint es, als hätte es den potenziellen gesellschaftlichen Sprengstoff längst schon damals, womöglich spätestens schon in den 1970ern gegeben. Es fehlte bis hin zu meiner Generation lediglich noch die passende Zündschnur. Und diese Zündschnur liefern inzwischen die Digitalisierung, das Internet und vor allem äußerst gerne die „Sozialen Medien“.
So kann man dazu neigen, den entscheidenden Unterschied zwischen der heutigen „Generation Z“ und jeder früheren Generation genau darin zu sehen, was tatsächlich frappierend anders ist: nämlich das übermedialisierte und fast volldigitalisierte Umfeld, in das diese „Generation Z“ hineingeboren wurde, und für so normal hält, wie meine Generation damals etwa das Telefon und den Fernseher als wenig aufregende Alltagsgegenstände. Ungefähr so, wie es für uns damals meist eher seltsam anmutete, wie sich etwa ein Neil Postman gesellschaftskritisch über das Medium Fernsehen und den Medienkonsum ereiferte (u.a. „Wir amüsieren uns zu Tode“), so darf man das ohne Weiteres dieser „Generation Z“ sowohl attestieren als auch zugestehen, wenn es heute um Digitalisierung, Internet und „Soziale Netzwerke“ geht. Dieses Phänomen führt dazu, dass zwar jede Generation rückblickend glaubt, schlauer zu sein, doch für den eigenen Zeitgeist, für das, was sich gerade darin abspielt, sowie für potenzielle Probleme und Gefahren, die sich gerade daraus zu entwickeln drohen, ziemlich blind ist. Und weil sie es ist, fehlt ihr das Verständnis dafür, wenn (zwangsläufig: nur ein paar wenige) darauf aufmerksam machen. Ein paar wenige, die in der Lage sind, sich dem Zeitgeist zu entziehen und aus einer gewissen Distanz zu betrachten und zu beurteilen.
Dieses Phänomen ist dabei recht einfach erklärbar mit einer ebenso einfachen Frage: Warum merken wir eigentlich nichts davon, dass unser Planet mit über 100.000 km/h (der 30-fachen Geschwindigkeit einer Pistolenkugel) durch den Weltraum rast, und dazu noch die Erde mit rund 1.670 km/h (fast 500 Meter pro Sekunde) rotiert? Wir merken nichts davon, weil uns die Anzeichen dafür fehlen, die uns das merken lassen würden. Rein physikalisch betrachtet ähnelt ein Objekt, das sich in konstanter Bewegung befindet, eher einem Objekt, das stillsteht: Eine Kraft, die wir spüren könnten und würden, wirkt eben nur bei einem Beschleunigen oder Abbremsen, also wenn (für uns) etwas langsamer oder schneller wird. Zum anderen bewegt sich alles auf unserem Planeten auf dieselbe Weise, in derselben Geschwindigkeit. Wenn wir auf dem Fahrrad fahren, spüren wir den Luftwiderstand im Gesicht, wenn wir im Auto fahren, spüren wir das Beschleunigen und Abbremsen noch besser, und in einem Zug sehen wir die Landschaft quasi am Fenster vorbeirasen. Weil sich allerdings auf der Erde alles gleichermaßen mitbewegt, fehlen unserer beschränkten menschlichen Wahrnehmung sämtliche Anhaltspunkte dafür, dass sich das alles, inklusive uns selbst, mit einem rasenden Tempo bewegt.
Ebenso verhält es sich mit dem Zeitgeist, in dem man sich gerade befindet: So, wie man zwar sehr bewusst wahrnimmt, wenn man sich auf ein Fahrrad schwingt und losradelt, einem dagegen völlig unbewusst ist, gleichzeitig mit einer Geschwindigkeit von über 100.000 km/h durch das Weltall zu rasen, so nimmt man zwar sehr bewusst wahr, dass da kürzlich ein Apparat erfunden wurde, der sich „Smartphone“ nennt, und was man damit alles machen kann, doch es entgeht einem völlig unbewusst, was dadurch gerade passiert. Recht bekannt ist das Ganze auch als „Der gekochte Frosch“-Effekt: Dabei handelt es sich um ein Gedankenexperiment, wonach ein Frosch, den man in siedend heißes Wasser setzt, sofort alles mögliche versuchen wird, um sich aus dieser Lage zu befreien und sein Leben zu retten. Setzt man dagegen einen Frosch in ein lauwarmes, angenehmes Wasserbad, und erhitzt es nur ganz langsam und allmählich bis zum Siedepunkt, bleibt das von dem Frosch unbemerkt und er wird bei lebendigem Leib gut durchgekocht.
Das ist auch die Erklärung dafür, dass die heutige „Generation Z“ in diesem Zeitgeist alles Mögliche anprangert, nur eines nicht: die Digitalisierung mit allem, was dazugehört, das Internet mit (u.v.a.) den „Sozialen Medien“, die geheiligten Algorithmen, die zunehmende Roboterisierung und das Werkeln an sog. „Künstlicher Intelligenz“. Das alles läuft in diesem Zeitgeist lediglich irgendwie nebenher, deklariert als (technischer) „Fortschritt“, und deshalb auch jenseits jeglicher allgemeiner Kritik, in keiner Weise angeprangert von irgendwelchen Aktivisten und Bewegungen, die sich – ganz im Gegenteil – voller Begeisterung auf jede kleinste Innovation stürzen: Man fordert stetig noch mehr Digitalisierung, vor allem in der so quälend langsamen deutschen Bürokratie und ihren Behörden, die „Digitalisierung der Schulen“ und „der Ausbau des Glasfaserkabelnetzes“ gehen nicht schnell genug, von „3G“ über „4G“ bis aktuell „5G“ jagt ein neuer Mobilfunkstandard den nächsten, um noch mehr Daten noch schneller zu übertragen, und wird gejammert, wie sehr Deutschland den internationalen Anschluss verpasst hat und hinterher hinkt, und das alles unbedingt aufholen muss. Und niemand weit und breit, der das alles oder zumindest irgendetwas davon infrage stellen würde. Das ist unser aktueller Zeitgeist zu Beginn der 2020er Jahre. Und in der gerade erklärten zeitgeistigen Blindheit sieht man nicht einmal das, was sich unmittelbar vor den eigenen Augen abspielt, wenn erst aufgrund der „Corona“-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021, anschließend aus anderen Gründen, die bis dahin ausgeklügelten („Just-In-Time“) Lieferketten zusammenbrechen, Mikrochips nicht mehr geliefert und daher bestimmte Produkte nicht mehr produziert werden können, in denen mittlerweile so alles Mikrochips verbaut werden: außer Automobilen sogar Kaffeemaschinen, Rasenmäher und Kühlschränke, und das bringt niemanden auch nur ansatzweise zum Stutzen. Wenn es sich anfangs noch nur darauf beschränkte, dass Bordcomputer in Automobilen lediglich auf eher luxuriöse Weise über den generellen technischen Zustand und die wichtigsten Funktionen informierten, hat man das mittlerweile dahin getrieben, dass selbst der Reifenluftdruck elektronisch überwacht wird, und ein Auto ohne Computer gar nicht mehr fährt – und diese Feststellung für so lapidar gehalten wird, dass nur wenige verstehen, worauf ich damit eigentlich hinaus will. Bei den meisten hilft nicht einmal die zusätzliche Anregung, dass sogar Kaffeemaschinen prompt keinen Kaffee mehr kochen, wenn es den eingebauten Mikrochip zerlegt – weil heute sogar das Kaffeekochen offenbar zwingend mittels Computertechnik stattfinden muss. Und auch das zudem inzwischen dermaßen überdreht, dass umgangssprachliche Kaffeemaschinen, die eigentlich Kaffeeautomaten heißen, längst nicht mehr nur automatisch funktionieren, sondern „intelligent“, und jedem einzelnen Angehörigen eines Haushalts seinen ganz persönlichen Kaffee zubereiten können, je nach ganz persönlich speziell individuellem Geschmack, selbstverständlich auch zeitlich programmierbar, mitunter sogar ferngesteuert über das „Smartphone“, weil man das offenbar nicht nur für unverzichtbar hält, sondern mittlerweile für eher „normal“, in diesem Zeitgeist und dieser „Generation Z“, statt vielleicht eventuell für ein klein wenig an der Grenze zur Dekadenz kratzend. Dasselbe mit inzwischen weiteren Haushaltsgeräten von der Waschmaschine bis zum Kühlschrank, wahlweise als „intelligent“ oder „smart“ bezeichnet, die früher noch als simple Automaten funktionierten, sobald sie am elektrischen Strom angeschlossen waren; heute muss auch der eingebaute Mikrochip in Ordnung sein, damit diese Geräte funktionieren, und hält das für „Fortschritt“. Auf dem unvermeidlich unausweichlich fortschreitenden Weg zum sogenannten „SmartHome“, dem vollelektronisch digitalisierten Haushalt, in dem alles mit allem anderen vernetzt ist, und niemand fragt, was das – abgesehen davon, dass es technischer Fortschritt ist – eigentlich soll.
Dabei ist auf der einen Seite glasklar absehbar als auch unvermeidlich, wohin das führen wird: Bei einem irgendwie eingefangenen „Virus“ stürzt nicht ein Gerät ab, sondern der komplette Haushalt liegt vollständig lahm, benötigt ein „Update“ und muss mehrmals „rebootet“ werden, „Bitte melden Sie sich mit Ihrem Microsoft-Konto an“, wonach anschließend das TV-Programm von der Mikrowelle empfangen wird und sich der Backofen im Kühlschrank befindet. Allesamt zwangsläufig. Ich sage immer: Wenn heute sogar Briefmarken- und Leergutautomaten als „Roboter mit künstlicher Intelligenz“ gelten, dann brauchen wir vor dieser Entwicklung nun wirklich keine Angst zu haben – oder gerade deshalb vielleicht doch. Jedenfalls habe ich keinerlei Lust darauf, mich morgens von meiner „intelligenten“ Kaffeemaschine zurechtweisen zu lassen, dass ich mir schon zwölf Tassen gekocht habe, dass das ungesund ist, und ich mir doch bitte vom smarten Kühlschrank einen Orangensaft geben lassen soll. Es reicht mir schon, mich zwischendurch von einem TV-Receiver pädagogisch belehren zu lassen, ich hätte das Gerät „nicht ordnungsgemäß ausgeschaltet“. Wir sind auf dem allerbesten Weg, von der Technologie, die uns einmal zweckdienlich sein sollte, zum Diener degradiert zu werden; zu deren Diener. Wissen Sie eigentlich, was ein „Amnesty Responder“ macht? Das ist ein neumodischer Job, der sich aus der Roboterisierung entwickelt hat: In den heutigen hochmodernen HighTech-Paketlogistikzentren nämlich arbeiten nicht mehr Hunderte Angestellte, um Waren aus Lagern zu holen und in versandfertige Pakete zu verpacken. All diese Menschen werden nicht mehr gebraucht. Das machen jetzt Zehntausende „intelligenter“ Roboter, natürlich viel rasanter und effizienter und ohne Urlaubsanspruch, letztlich viel schneller und preiswerter für den Kunden, der das toll findet. Wenn es passiert, dass diesen Zehntausenden Robotern einmal ein Karton von der Palette rutscht, blockiert das den Gesamtbetrieb und wird Alarm ausgelöst. An dieser Stelle kommt tatsächlich doch ein Mensch aus Fleisch und Blut zum Einsatz, der sich auf die Suche nach dem verlorenen Karton macht, um den Robotern den Weg freizuräumen. Diesen Job nennt man hochtrabend „Amnesty Responder“. Ein Hilfsjob, den so ziemlich jeder ausüben kann, natürlich auf Niedrigstlohnniveau. Die eigentliche Arbeit wird also von schnöden Maschinen erledigt, Menschen dienen ihnen nur noch; so weit sie überhaupt noch gebraucht werden. Und das: ist immer noch erst der Anfang. Da ist noch jede Menge Potenzial. Was passiert, wenn uns selbstfahrende Autos allmählich als Normalität aufgezwungen wurden, kann sich zwar jeder ausmalen, interessiert jedoch offenbar niemanden. Und das noch abgesehen davon, „Künstlicher Intelligenz“ so etwas wie eine „Entscheidungsmacht“ zu übertragen, u.a. weil es Entscheidungsträgern bequem ermöglicht, sich von jeder eigenen, persönlichen Verantwortung zu befreien (schon alleine, wenn die erkenntnistheoretische Frage, was eine Entscheidung überhaupt ist, sehr elegant umgangen wird). Zumal inzwischen festgestellt worden sein soll, dass auch „Künstliche Intelligenz“ tatsächlich schummelt und mogelt! Davor hat etwa Klaus-Robert Müller, Professor für „Maschinelles Lernen“ an der TU Berlin, im April 2019 vor der „Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz“ des Deutschen Bundestages gewarnt3: In Forschungen am Heinrich-Hertz-Institut der Fraunhofer-Gesellschaft in Zusammenarbeit mit der Singapore University of Technology and Design zeigte sich, dass in bis zu 50%(!) aller Fälle die Algorithmen mit der sogenannten „Clever-Hans-Strategie“ tricksen, und quasi nur so tun als ob („Clever Hans“ geht auf ein Pferd zurück, das auf Jahrmärkten vorgeführt wurde, weil es scheinbar in der Lage war, zählen zu können, was allerdings nur ein Trick durch clevere Dressur war). Woraufhin Müller vor den versammelten Abgeordneten anmerkte, er wolle nicht gerade von einer solch tricksenden „Künstlichen Intelligenz“ medizinisch behandelt werden. Von anderen kritischen Einsatzbereichen ganz abgesehen. Zumal das, was Algorithmen produzieren, im vollsten menschlichen Vertrauen auf die digitale Technik nur seltenst überprüft wird. Doch das nur nebenbei.
Auf der anderen Seite wird damit einsichtig: Diese berüchtigte „Generation Z“ kann nichts dafür! Ich stelle das mit äußerstem Nachdruck fest, um hier nochmals hinzuweisen, dass ich lediglich gesellschaftskritisch beobachte, und es nicht etwa pauschal auf „die Jugend“ abgesehen hätte. Diese Jugend kann nichts für die Welt, in die sie hineingeboren wurde und in der sie aufwächst, aber man darf und sollte darauf aufmerksam machen, was das für eine Welt ist, wenn man sie aus einer gewissen Distanz heraus betrachtet, und sich dem herrschenden Zeitgeist weitestmöglich entzieht. So, wie das alles gerade eben beschriebene für diesen Zeitgeist und diese „Generation Z“ die Normalität darstellt, die größtenteils unbewusst ihre Nebenwirkungen entfaltet, lässt sich das prima an einem weiteren Beispiel festmachen: Früher, als bekannterweise noch alles besser war, schaltete man den Fernseher ein, und: dann war da das laufende Fernsehprogramm zu sehen. Das war noch zu einer Zeit, als nur ein simples Kabel von der Zugangsdose in der Wand zum Fernsehgerät führte, beide Kabelenden eingesteckt, fertig. Doch irgendwann muss irgendjemand auf die Idee gekommen sein, dass es aus irgendeinem Grund besser wäre, ein Zusatzgerät dazwischen zu schalten: den sogenannten „Receiver“. Seit dem geht ohne solchen „Receiver“ nichts mehr, der jedoch nach dem Einschalten erst einmal minutenlang „hochfahren“ muss und über die Zugangsdose in der Wand nach „Updates“ sucht, die ggf. erst noch installiert werden müssen, mit einem anschließenden Neustart natürlich, bevor man doch tatsächlich endlich das laufende Fernsehprogramm genießen darf. Und das... soll „Fortschritt“ sein, wahrscheinlich weil es digital ist, und alles, was digital ist, auch gut und sogar noch besser ist als jemals zuvor. Die „Generation Z“ kennt es jedoch nicht anders, sie hat diesen direkten Vergleich nicht zur Verfügung, und sie bemerkt die Anzeichen nicht, weil sie sich in ihrem Zeitgeist mitbewegt, und sich damit so angenehm fühlt, wie ein Frosch in lauwarmem Wasser.
Ein anderes Beispiel ist das heutige „Festnetztelefon“, das heute nur deshalb so genannt wird, weil es ab den 1990er Jahren auch Mobiltelefone zu kaufen gab, die heute „Smartphones“ heißen. Für uns damals waren das damals ganz einfach: Telefone(!) – ganz ohne „Festnetz“; allein schon dieser Begriff hätte ziemlich irritiert. Heute jedoch: völlig normal. Jedenfalls funktionierten diese damaligen ganz simplen Apparate noch über ganz simplen Telefondraht und benötigten im Gegensatz zu den heutigen keinen zusätzlichen elektrischen Strom. Das hatte zur Folge, dass bei einem Stromausfall immerhin eines noch funktionierte: das Telefon, um in einem Notfall Hilfe zu rufen, die Polizei oder die Feuerwehr. Heute dagegen muss man bei all diesem digitalen Fortschritt laut aus dem Fenster heraus rufen, weil ohne Strom weder das Festnetztelefon funktioniert, noch der Zugang zum Internet, noch der Akku des „Smartphones“ aufgeladen werden kann. So macht man sich in diesem Zeitgeist – zudem dazu auf dem Weg zum „SmartHome“, siehe oben, und mitsamt den immer mehr Elektroautos, mit denen wir tröstlicherweise die globale Erwärmung verhindern – immer abhängiger von elektrischem Strom, und fragt sich, wie wir den permanent ansteigenden Stromverbrauch und Energiebedarf mit welcher Energiewende in Zukunft bewältigen sollen, und fürchtet sich vor der parallel zunehmenden Gefahr eines totalen „Blackout“, dass also Stromnetze vor Überlastung zusammenbrechen werden. Das könnte alles ein wenig undurchdacht wirken, wenn nicht sogar widersprüchlich. Und das ist es tatsächlich, sowohl als auch.
Werfen wir beispielsweise noch einen Blick auf die heutige „Generation Z“ mit ihrer Generalanklage gegen „die Alten“, die den menschengemachten Klimawandel sowohl mitverschulden, als auch schuldig sind, nichts dagegen unternommen zu haben. Und so steht diese Generation demonstrierend auf den Straßen, bunt bemalte Pappplakate hochhaltend, und von allen anderen größtmögliche Veränderungen fordernd – doch drei Viertel tragen Jeans und Sportschuhe, sicherlich besitzen einhundert Prozent ihr „Smartphone“, und wieder zu Hause setzen sie sich vor ihre Spielkonsole und ihr „SmartTV“, allesamt Produkte irgendwo in Fernost hergestellt und mit Containerschiffen quer über den Planeten transportiert. Als Elektroschrott wird das ganze Zeug irgendwann billig nach Afrika verschifft statt aufwendig teuer fachgerecht entsorgt, dort von Kindern in Brand gesetzt, um sich aus dem geschmolzenen und hochgiftigen Plastikrestmüll die wertvollen Kupferdrähte herauszuholen, die ein bisschen Geld einbringen. Das jedoch nimmt diese „Generation Z“ als quasi bedauerlich unvermeidlich hin. Auch das ist widersprüchlich.
Nicht viel anders mit dem zeitgeistigen „Influencertum“, wenn jugendliche „Social Media“-Stars dafür gefeiert werden, vollständig belanglose Videos und/oder Fotos ins Internet zu stellen: Die Selbstinszenierung als Normalität, mit der sich sogar richtig gutes Geld verdienen lässt. Wobei schon alleine das simple Übersetzen der Bezeichnung „Influencer“ ausreichen müsste, um zu erkennen, dass hier Menschen von ihren „Stars“ beeinflusst werden sollen, um etwas zu kaufen, was sie nicht brauchen. Und diejenigen, die beeinflusst werden sollen, nehmen das nicht etwa übel, sondern sind erklärte Fans ihrer Beeinflusser. Zumal gerade diejenigen, die mit diesem Geschäftsmodell zum Teil erstaunliche Summe verdienen, ganz gern den Kapitalismus als Teil des Weltuntergangs anprangern. Nicht zuletzt, wenn professionelle, berufsmäßige „Influencer“, die ihr Geld damit verdienen, Mitmenschen zu beeinflussen, ansonsten gern auf Ethik und Moral pochen, um Tiere und/oder das Klima zu retten. Und auch das ist insgesamt: ein klein wenig widersprüchlich.
In der oben beschriebenen Blindheit gegenüber dem eigenen Zeitgeist ist man sich zudem zwar tatsächlich voll bewusst, und dennoch vollständig ignorant, welche immensen Gefahren mit der ungebremsten Digitalisierung verbunden sind. So haben böse Geister vor ein paar Jahren erkannt, was sich anrichten lässt, wenn man die sogenannte „kritische Infrastruktur“ (Strom-, Wasser- und Lebensmittelversorgung, Kommunikation, Krankenhäuser, etc) lahmlegt, und zwar per Mausklick, durch sogenannte „Hacker“. Ganz abgesehen von etwaigen düsteren militärischen Absichten, dem sogenannten „Cyber War“, mit gezielten Hacker-Angriffen auf Flugverkehr, Atomkraftwerke, usw. So hat man inzwischen alle Hände voll zu tun, dass der Fettnapf, in den man mit Anlauf und voller Begeisterung gesprungen ist, bloß nicht überschwappt.
Allerdings wirken andere Folgen der totalen Digitalisierung weitaus subtiler und damit sowohl jenseits bewusster Aufmerksamkeit als auch fern jeglichen sonst so gern anprangernden Aktivismus. So ist es eigentlich kaum zu fassen, dass im Jahr 2018 in Großbritannien beschlossen wurde, in Prüfungsräumen die analogen Uhren durch digitale zu ersetzen. Ein Mr Malcolm Trobe von der Association of School and College Leaders begründete das gegenüber dem 'Telegraph' damit4, dass immer weniger Kinder in der Lage seien, die Zeiger auf einer konventionellen Uhr zu lesen: „Sie sind daran gewöhnt, eine digitale Zeitangabe auf dem Handy und ihrem Computer zu sehen. Fast alles, was sie haben, ist digital“. Anders gesagt: Statt es den Kindern, wie früher, mühsam beizubringen, tauscht man, viel einfacher, die Uhren aus. Oder anders gesagt: Man macht das Defizit zum Maßstab. Werfen wir beispielhaft dazu noch einen anderen Blick auf den geheiligten Algorithmus in all seinen Erscheinungsformen. Innerhalb der „Sozialen Netzwerke“ etwa tarnt sich diese technische Methode mit dem Versprechen, die Inhalte „individueller“, also: „persönlicher“, zu gestalten, sodass man vorrangig oder ausschließlich zu sehen bekommt, wofür man sich vermeintlich auch tatsächlich interessiert – während alles andere als weniger oder gar nicht relevant herausgefiltert wird. Der Hintergedanke der Anbieter war dabei anfangs noch, die Werbung „zielgenauer“ auf die Nutzer abfeuern zu können und die sogenannten „Streuverluste“ für die Werbungtreibenden zu minimieren. Mittlerweile hat man diese Methode clever ausgeweitet, um – vermeintlich – „Nutzerprofile“ zu erstellen und ggf. abzustrafen, indem man ihre „Relevanz“ herunterstuft, also deren Sichtbarkeit für andere Nutzer einschränkt, wenn sie sich auf unerwünschte Weise verhalten („gegen die Gemeinschaftsregeln verstoßen“), das sogenannte „Shadow Banning“. Eine subtile Form der automatisierten Pädagogik, ausgeübt von globalen Konzernen. Ein Effekt, der sich daraus zwangsläufig außerdem ergibt, ist die sogenannte „Filterblase“, die jedem Nutzer unvermeidlich aufgezwungen wird: Wenn man nämlich nur noch das vorgesetzt bekommt, was einen – vermeintlich – interessiert, alles andere dagegen bestmöglich algorithmisch vorgefiltert herausgefiltert wird, fühlt man sich dauerhaft permanent bestätigt, in seinem Denken, seinen Ansichten, Überzeugungen und Meinungen – und kommt mit anderem nur noch dann in Berührung, wenn dem Algorithmus eine Detailinformation entgangen ist. So wähnen sich ständig alle selbst im Recht und halten andere Ansichten und Meinungen für sonderbare Ausnahmen. Eine besonders trickige Erfindung ist dabei die Möglichkeit, etwas mit „Gefällt mir“ markieren zu können. So kann der Algorithmus sich allmählich zusammenbasteln, was das Nutzerprofil vermeintlich zusätzlich schärft. Auf der anderen Seite wird den Nutzern ermöglicht, sich über diese Funktion die Selbstbestätigung zu holen, die ihnen ansonsten (vor allem: in der Realität da draußen) fehlt: Wer auf diese Weise nach solchen sogenannten „Likes“ hechelt und geifert, veröffentlicht natürlich auch nur, was potenziell großen Zuspruch haben dürfte, und bloß nichts, was Nichtgefallen provozieren könnte. So bewirkt der Algorithmus letztlich eine gesteigerte Konformität: Man richtet sich nach der Masse.
Ganz ähnlich verhält es sich mit 'Spotify', dem aktuell führenden sogenannten „Audio-Streaming-Dienst“. Mit Konfuzius („Setze niemals etwas voraus“) sei vorab geklärt: Beim auf Denglisch sogenannten „Streaming“, das auf Deutsch ein „Strömen“ wäre, handelt es sich um ein simples Senden und Empfangen von Daten. Gemeint sind hiermit allerdings vornehmlich Videos, Filme, Musik, Hörbücher usw, die quasi im Internet auf Abruf bereitstehen. Man muss für den Genuss solcher Unterhaltung also keinen langwierigen Download mehr abwarten, und ist bei Videos und Filmen unabhängig vom vorgegebenen Zeitplan eines klassischen Fernsehprogramms. Witzigerweise hat eine Studie unlängst die sensationelle Erkenntnis geliefert, dass Kinder und Jugendliche erstmals seit Jahrzehnten weniger fernsehen(!) – dafür aber jedes Jahr umso mehr „streamen“. Als ob das ein wesentlicher Unterschied wäre. Was nun den Dienst 'Spotify' betrifft, analysiert (natürlich, wie sollte es anders sein) ein Algorithmus die zurzeit über 35 Millionen Songs, die sich „streamen“ (also lapidar: anhören) lassen. Was dabei herauskommt, ist u.v.a. eine Auswertung von Genre, Stimmung, Tonart, Klangfarbe, Rhythmus und etlichen anderen spezifischen Merkmalen, die mit einer Zeitsignatur versehen werden. Selbstverständlich liegt auch hier das Versprechen zugrunde, dass der Dienst dem Nutzer Vorschläge präsentiert, die seinen Musikgeschmack, dank des Algorithmus, optimal treffen. Doch auch diese Sache hat natürlich einen kleinen Haken. Und zwar sogar: wortwörtlich, wenn auch auf Englisch, nämlich einen „Hook“5. Die Musikindustrie hat sich nämlich längst auf den Algorithmus von 'Spotify' ausgerichtet, um in die Empfehlungslisten dieses Dienstes zu kommen. Einem kursierenden Leitfaden zufolge sollen in einem Song deshalb verschiedene Merkmale (u.a. Refrain, Strophe und „Hook“) innerhalb der ersten dreißig Sekunden untergebracht werden – und zwar, weil ein Song erst ab der einunddreißigsten angehörten Sekunde als „gestreamt“ gilt und für die Musik-Charts gewertet wird. Der Zuhörer darf also den Song keinesfalls vorher abbrechen und muss daher sichergestellt werden, dass das Wesentliche schon in den ersten dreißig Sekunden passiert – natürlich nicht etwa für den Musikfan, sondern aus Sicht der Musikindustrie. So ist laut einer Studie6 der Ohio State University die Dauer instrumentaler Intros von Popsongs in den letzten paar Jahren um ein glattes Viertel geschrumpft, von rund zwanzig auf nur noch fünf Sekunden Länge; natürlich nicht etwa für den Musikfan, sondern für den Algorithmus von 'Spotify'. Und der knallharte geldwerte Nutzen (nicht etwa für den Musikfan) geht noch darüber hinaus, indem die Musikindustrie über die algorithmischen Auswertungen immerhin bessere Ahnungen davon bekommt, was einen Hit zu einem Hit macht, sowie ganz nebenbei auch die Werbekunden von 'Spotify' glauben, einen besseren Einblick in die aktuellen Vorlieben von Konsumenten zu erhalten, während der echte Musikfan – wie in anderen „Netzwerken“ und Diensten auch – vor allem als lukrativer bloßer Datenlieferant funktioniert: „Die Rechnung zahlen Musikfans, denen zwar die Illusion einer Auswahl aus über 30 Millionen Songs vorgegaukelt wird, denen der Weg zu wirklich interessanten Inhalten jedoch erschwert wird. Von einer musikalischen Monokultur profitiert am Ende niemand. Außer Spotify“, so der 'Spiegel'7.
Tja. Die „Illusion einer freien Auswahl“. Wenn es nur das wäre. Allerdings hängt daran noch weitaus mehr: Das Ganze hat handfeste Konsequenzen auf die Art und Weise, wie populäre Musik komponiert und produziert wird, wie Musiker und Bands von vorn herein einen Song nach bestimmten Regeln zu arrangieren haben, wenn sie damit erfolgreich sein wollen. Aus dieser immer gleichartigeren Musik erfolgt ein ebenso gleichartigerer Massengeschmack, der ebenso, wie es in den „Sozialen Netzwerken“ der Fall ist (siehe oben), die Konformität immer weiter verstärkt: Die Gewöhnung daran, wie Songs jetzt inzwischen standardmäßig aufgebaut und arrangiert zu sein haben, und das schon in den ersten dreißig Sekunden, beeinflusst dem entsprechend die Erwartungshaltungen, wie neue Songs wahrgenommen und beurteilt werden, ob sie gefallen oder nicht. Der Algorithmus von 'Spotify' bestimmt darüber, welche Musik wir überhaupt noch zu hören bekommen, aus der wir dann scheinbar „frei auswählen“ und „frei entscheiden“ können, welche davon wir gut finden. Dagegen können wir natürlich gar nicht erst beurteilen, was uns womöglich sehr viel besser gefallen hätte, weil es einfach gar nicht erst stattfindet, weil es von vorn herein verhindert wird. Kurz gesagt: Auch hier diktiert uns ein Algorithmus die Welt, in der wir leben. Und niemand weit und breit, der das angesichts der Auswirkungen auf unser aller Denken und Verhalten und das gesellschaftliche Miteinander anprangern würde. Vielmehr noch im Gegenteil lässt man inzwischen sogar die Partnersuche auf digitale Weise von Algorithmen erledigen, die aus einer Menge möglicher Partner angeblich die „besten Treffer“, die „am ehesten Passenden“ herausfiltern; und hält das für (technischen) „Fortschritt“. Es könnte vielleicht auch pure Verzweiflung sein, angesichts der – gerade durch die Digitalisierung – stetig schrumpfenden Empathie und gleichzeitig zunehmenden Unfähigkeit, auf die klassische Weise persönliche Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. Es ist anzunehmen, dass man sich in diesem Zeitgeist und in dieser „Generation Z“ auch hierüber lieber keine größeren Gedanken macht. Etwa darüber, dass der Partnersuche per Algorithmus nackte Zahlen, Daten und Formeln zugrunde liegen, damit also Berechnung und Kalkül, und ob man auf dieser Grundlage tatsächlich menschliche Beziehungen aufbauen (lassen) will. Jedenfalls ist im Zweifelsfall die Frage vollauf berechtigt, warum einem ausgerechnet solche potenziellen Partner vorgeschlagen werden. Andererseits sage ich immer: sogar Statistikern passiert zwischendurch mal etwas, womit sie einfach nicht gerechnet haben. Ein Hoch auf die Mathematik.
Schon diese Beispiele zeigen eigentlich: Sehenden Auges und trotzdem blind geifert man sich voller Begeisterung in eine Welt, die nicht digital genug sein kann. Es werden momentan sehr viele Frösche gekocht. Angesichts dessen, dass die ungebremste und als „Fortschritt“ nur bejubelte Roboterisierung mit ihrer „künstlichen Intelligenz“ enorme absehbare Folgen auf die gesamte Gesellschaft haben, nicht erst beim „Amnesty Responder“ und „Clever Hans“ angefangen, ist es leicht verwunderlich (andererseits eben auch wiederum nicht), dass das von keinem einzigen Aktivisten und von keiner Bewegung anprangert wird. Damit vollführt die „Generation Z“ genau das gleiche wie das, was sie „den Alten“ vorwirft: So, wie die ältere Generation natürlich die Schuld daran hat, nichts gegen die Entwicklungen der Industrialisierung unternommen zu haben, hört man heute keinen leisesten Piep, wenn es etwa um „selbstfahrende Autos“ geht oder um „künstliche Intelligenz“. So wird der „Generation Z“ in ein paar Jahren von ihren eigenen Kindern gleichfalls vorgeworfen werden: „Warum habt ihr das nicht verhindert“. Darauf ist jedenfalls Verlass.
Nach diesem kleinen Vorlauf können wir nun zurückkommen auf die Frage, woher eigentlich diese „Generation Z“ diese gewisse Überheblichkeit, die Arroganz, den Hochmut und die Anmaßung bezieht, sich in einem absoluten, vollkommenen und endgültigen Wissen zu befinden. Die Antwort ist: genau daraus! Sie bezieht es aus ihrem Zeitgeist heraus, in dem sie lebt, und aus der übermedialisierten, volldigitalisierten Welt, in die sie hineingeboren wurde. Genau das nämlich ist tatsächlich der entscheidende Unterschied zu jeder früheren Generation – und verleiht der jetzigen sowohl die Wissensallmacht als auch die Generalermächtigung, restlos alles anzuprangern, was sämtliche Generationen zuvor in zwei Millionen Jahren Menschheitsgeschichte so alles falsch gemacht haben. Und auch hierbei ist es – wie könnte es anders sein – ein Algorithmus, der der „Generation Z“ diese umfassende Macht verleiht, nämlich der von 'Google'.
Unter dem sowohl gedanken- als auch deshalb bedenkenlosen Eindruck, was Algorithmen scheinbar auf fast mystische Weise ermöglichen, ist man in diesem Zeitgeist und dieser Generation darauf trainiert und nahezu dressiert, bei jeder kleinsten Notwendigkeit (und davon gibt es im 'PISA'-geschädigten Bildungsnotstand nun einmal viele) das „Smartphone“ zu zücken und sich im weltweiten Internet zu suchen, was man gerade braucht. Das hat sich seit ein paar Jahren als neudeutsches „googeln“ etabliert, weil sich 'Google' als der quasi Monopolist der „Suchmaschinen“ herausbilden konnte. So kann man sich darauf verlassen, dass heute so ziemlich jede Suchanfrage über 'Google' erfolgt, und daher etwaige andere Suchergebnisse anderer Suchmaschinen nicht einmal in Erwägung gezogen werden – sofern überhaupt bekannt ist, dass sie existieren. Das verleiht 'Google' eine gehörige Macht, der man sich bereitwillig fügt und sie dadurch täglich mehrfach stärkt.
![[ Wirkung! ] - Falko A. Cerny - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/fe2a9ce635f2b7c4fb134d93b866f158/w200_u90.jpg)




























