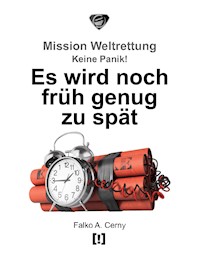![[ Wirkung! ] - Falko A. Cerny - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/fe2a9ce635f2b7c4fb134d93b866f158/w200_u90.jpg)
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In [ WIRKUNG! ] zeigt Cerny: Wir leben in einem steinalten, hoffnungslos überholten Denksystem ... auf dem Stand des Mittelalters! Und weil das so ist, denken wir praktisch immer nur "die Hälfte". Deshalb sind wir vollauf damit beschäftigt, etliche enorme Probleme zu lösen, die wir gar nicht haben müssten. Doch das bedeutet auch: Mit der noch "fehlenden Hälfte" können wir unsere Intelligenz glatt "verdoppeln" und unsere Möglichkeiten vervielfachen - wortwörtlich: denkbar einfach!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
WIDMUNG
VORWORT
EINFÜHRUNG: Immer knapp daneben gedacht
ANNO 1605 – FRANCIS BACON
Die Verwissenschaftlichung unserer Denkwelt
Zusammenfassung/Übersicht
ANNO 1619 – RENE DESCARTES
Gefangen im Maschinendenken
Die Weltmaschine – Das mechanistische Weltbild
„Ja, aber…“ – Der Zweifel aus Prinzip
Dualität: Eine zwiespältige Wirklichkeit
Körper+Geist: Die Abspaltung vom Leben
Analytik: Ordentlich zerlegte Denkwelt
Methodik: Fehldenken mit System
Zustände: Gedanklich abgestorben
Die Mathematisierung der Welt
Zwangsmathematisiertes Leben
Zusammenfassung/Übersicht
ANNO 1632 – GALILEO GALILEI
Die Welt zwischen Berechnung und Kalkül
Die Definition der Wissenschaft
Wissenschaftlicher Etikettenschwindel
Objektiv realistischer als die Realität
Zweckmäßig, aber sinnlos
Wissenschaftlich unmoralisch
Künstlich intelligent
Zusammenfassung/Übersicht
ANNO 1667 – SIR ISAAC NEWTON
Gedanklich angekettet im Maschinenraum
Mechanisch gedacht: Ursache und Wirkung
Wenn→Dann: Logisches Stolpern
Finalität: Gezielt in die Sackgasse gedacht
Wenn mehr weniger ist
Zusammenfassung/Übersicht
ANNO 1676 BIS 1776 – VON PETTY BIS SMITH
Wirtschaft: Wert(e)los jenseits aller Moral
Anno 1667: William Petty systematisiert den Handel
Anno 1683: John Locke atomisiert die Welt
Anno 1776: Adam Smith gibt der Wirtschaft den Rest
Wohlstand: Liegestühle auf der Titanic
Arbeit auf dem Stand des 18. Jahrhunderts
Zusammenfassung/Übersicht
ANNO 1810 – WILHELM VON HUMBOLDT
Bildungsapparat auf Dampfmaschinenniveau
Bildung als (Wett-)Kampf
Zweckmäßig fehlgebildet
Genormes Lernen: Gewollte Durchschnittlichkeit
Bildung… was ist das überhaupt?
Meinungsbildung: Fehlanzeige
Zusammenfassung/Übersicht
ANNO 1876 – ROBERT KOCH
Die Natur als Todfeind: Leben gefährdet die Gesundheit
Kränklich gedacht: Natürliches Feindbild
Pharmaindustrie: Heilung vom Fließband
Die Psyche: Krank im Kopf
Topfit im Gesundheitswahn
Gesund durch Berechnung und Kalkül
Zusammenfassung/Übersicht
ANNO 1913 – HENRY FORD
Massenhaft auf dem morschen Holzweg
Erst und nur die Masse macht’s
Fordismus: Alles in bester Ordnung
Die Masse als Teil der Methode
Der Motor stottert
Zusammenfassung/Übersicht
ANNO 1450 – JOHANNES GUTENBERG
Gedanklich verlaufen im Mittelalter
Die literale Kultur: Buchstäblich umgedacht
Telematik: Unsere alte Wirklichkeit löst sich auf
Digitalisierung: Leben zwischen Nullen und Einsen
Punkt-Zeit: Unsere innere Uhr tickt anders
Unverbindlichkeiten: Alles wabert vor sich hin
Zusammenfassung/Übersicht
DIE TYPISCH EUROPÄISCHE DISSOZIATION
Willkommen im 21. Jahrhundert!
Entproblematisieren Sie Ihr Leben!
Alphafaktor: Wie Sie andere Gedanken denken
mimesisPrinzip: Erfolg geht auch anders.
Ganz
anders
ANHANG
Über den Autor
Literaturverzeichnis.
Stichwortverzeichnis.
Widmung
Ich widme dieses Buch meinem Sohn Vincent, stellvertretend für seine junge Generation, auf dass in Zukunft nicht mehr nur „die Hälfte“ gedacht wird; und man das auch noch für intelligent und vernünftig hält. Möge es mir gelingen, u.a. mit diesem Buch und meinem sonstigen Wirken dazu beizutragen, dass jeder in Zukunft sein volles Potenzial entfalten kann.
Vorwort
Was denken Sie? Jetzt gerade? Oder auch: ganz allgemein? Im Prinzip ist das relativ schnurz, denn leider denken Sie grundsätzlich falsch. Nein, nicht nur Sie. Sondern: Sie, und ich, wir alle. Wir denken in einem steinalten, hoffnungslos überholten Denksystem auf dem Stand des Mittelalters! Und weil das so ist, denken wir praktisch immer nur „die Hälfte“. Das ist mein Thema und darum geht es unter anderem in diesem Buch.
Ich weiß: Manch einer denkt an dieser Stelle „Na, das fängt ja gut an. Wir denken auf dem Stand des Mittelalters… was wird denn das für ein Unsinn?“ Aber natürlich: Wir leben in einem hochtechnisierten Zeitalter. Wir sind die höchst entwickelte Zivilisation seit überhaupt. Was hat die Menschheit in letzter Zeit nicht alles zustande gebracht: Wir haben das Auto erfunden, das Flugzeug, den Computer und den Mikrowellenherd. Wir haben Menschen ins Weltall und sogar bis auf den Mond geschossen. Und die Atombombe haben wir nicht nur erfunden, wir haben auch bewiesen, dass sie funktioniert. Grandios.
Wer über diese Angelegenheit ein wenig nachdenkt, könnte bemerken, dass es sich bei dem Ganzen ausschließlich um rein technologische Errungenschaften handelt. Doch was das Denken, Verhalten und Handeln betrifft, wird (unter anderem) noch immer exact genau so gelogen und betrogen und aufeinander eingedroschen, wie im tiefsten Mittelalter. Nur auf einem anderen Niveau.
Ein derart rückständiges Denksystem im Kopf zu haben – und das auch noch völlig unbewusst, ohne es zu wissen – hat natürlich Folgen. Eine davon ist, dass wir durchgehend vollauf damit beschäftigt sind, etliche enorme Probleme zu lösen, …die wir gar nicht haben müssten. Und das in sämtlichen Bereichen unseres Lebens, überall, vom eigenen Privatleben bis zur großen Politik.
Mindestens ebenso tragisch ist, dass das ganze übliche Trara, das heute um das Denken und Verhalten gemacht wird, um Lernen, Wissen und Bildung, nichts anderes bewirkt, als die Optimierung eines Fehldenkens. Man unternimmt quasi alles Mögliche, um immer besser falsch zu denken. In solch einem Denksystem sind diejenigen erfolgreich, die besser falsch denken als andere.
Nur einmal angenommen, ich könnte vielleicht recht haben, und wir denken heute tatsächlich auf dem Stand des Mittelalters und (deshalb) immer nur „die Hälfte“… Das hieße auch: Wenn wir die „fehlende andere Hälfte“ noch dazu gewinnen, dann könnten wir dadurch unsere Intelligenz glatt „verdoppeln“ – und unsere Möglichkeiten vervielfachen; wortwörtlich: denkbar einfach. Warten Sie es ab. Lassen Sie sich überraschen.
Einführung: Immer knapp daneben gedacht
Was Sie hier in diesem Buch erfahren, wird Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit ziemlich überraschen; und das gleich mehrfach. Denn was immer Sie über unser Denken, Verhalten und Handeln, sowie über Lernen, Wissen und Bildung ganz generell, bereits kennen und/oder zu wissen glauben… genau darum geht es im Prinzip [ WIRKUNG! ] und u.a. hier in diesem Buch gerade eben nicht.
Wenn wir uns einmal anschauen, von wem wir eigentlich permanent über diese Themen informiert werden, dann sind es vor allem Experten aus der Psychologie und Gehirnforschung, die ständig dazu befragt werden und bereitwillig Auskunft geben. Ansonsten melden sich immer wieder gern Pädagogen und Soziologen, zuweilen auch Verhaltens- und sogar Genforscher zu Wort. Man kann ihnen einfach nicht entrinnen. Das ist Teil eines gehörigen Problems. So hat man dem Laien nämlich sehr erfolgreich beigebracht, dass genau diese Berufsgruppen und Experten tatsächlich für diese Themen zuständig wären. Wer auch sonst.
Das gehörige Problem besteht gleich zu Beginn darin, dass über das Denken völlig falsch nachgedacht wird – damit zwangsläufig auch über das Verhalten, das Handeln, sowie Lernen, Wissen und Bildung allgemein. Dieses Fehldenken ist grundsätzlich der Fall. So geht man in einem Domino-Effekt auch von sehr falschen Grundannahmen aus und liegt andauernd haarscharf daneben. Und das eben bei (allen!) Experten angefangen bis – letztlich – zu Otto Normalmensch.
Wenn es etwa um die Heerscharen von Experten geht, die uns gefragt oder auch ungefragt alles Mögliche erklären, dann ist das ungefähr so, als ob man die Jahresinspektion an seinem Auto einem Stauforscher überlässt, oder sich ein Bademeister für kompetent hält, auch einen Rohrbruch beheben zu können. Doch genau das ist die merkwürdig normale Realität. Und ähnlich abstrus, wie im Fall einer Quizshow, deren Moderator erklärte, in seiner Sendung ginge es gar nicht um Wissen, sondern nur um bloße Unterhaltung.
Der unschuldige Otto Normalmensch hat so eine Menge sehr unterhaltsamer Informationen in seinem Kopf, mit denen er seit frühester Kindheit abgefüllt und vollgestopft wird: Begriffsverständnisse, Auffassungen, Überzeugungen und Glaubenssätze, zum Großteil pendelnd zwischen Mythen und Gerüchten, mit denen er sich sein Weltbild basteln darf. Wissenschaftler haben für so etwas die schöne Formulierung, das sei immerhin „brauchbar“. Mehr aber auch nicht.
Nehmen wir – beispielsweise – den Begriff „Denken“. Schon alleine die harmlos anmutende Frage, was Denken eigentlich ist, kann sofort und auf der Stelle ins gedankliche Holpern und Stolpern führen. Der hochinteressante Grund dafür ist, dass wir meinen, dass das doch schließlich eine völlig klare Angelegenheit sei, über die man allenfalls herumphilosophieren könne. Und diese Auffassung ist nicht nur allgemein verbreitet, sie betrifft auch den Großteil von Begriffen in unserer Sprache, die ebenso unbedacht und leichtfertig verwendet werden. Das Problem liegt also deutlich weiter vorne, als üblicherweise geglaubt wird, wo Vorne ist. Nämlich bereits in unserer Sprache, im Begriffsverständnis.
Ein Knackpunkt ist – eben: hier nur beispielsweise – dass wir unbewusst und unbemerkt glauben, das Denken würde etwa so funktionieren, wie man einen Papierhut faltet oder einen Nagel in die Wand schlägt. Das Denken wird als Handlung missverstanden. Schließlich macht man sich Gedanken und setzt das noch nicht einmal in Anführungszeichen. Ein Vorhaben soll daher mindestens „gut bedacht“, besser noch „perfekt durchdacht“ sein, und schon Kindern wird erklärt „Denk‘ nach, dann kommst du drauf“.
Wir denken das Denken als eine Handlung, die man sich (durch Lernen, Arbeit, Fleiß und Leistung) aneignen, trainieren und optimieren könne: Je mehr man dadurch lernt und dazulernt, desto größer das Wissen, desto besser die Bildung. Das ist so dermaßen reduziert (noch) nicht eklatant falsch – doch es ist nur ein Bruchteil von dem, was erheblich richtiger wäre.
Beispielsweise führt diese gehörig versimpelte Reduktion (u.v.a.) zu dem Fehldenken, das Gehirn als „Festplatte“ und „Denkapparat“ zu verstehen: Input gleich Output, je besser der Rohstoff und die Laufleistung, desto besser wird das, was dabei herauskommt. Diesen Apparat sollte man eingeschaltet haben, muss aber auch einmal „abschalten“ können, man kann daran schrauben, feilen und justieren, etwa mittels Denksport, Gehirnjogging und Logik-Training, in Lernportalen im Internet, mit Fördermaßnahmen und Bildungsoffensiven, etc, etc. Sie ahnen es: diese Auffassung ist ziemlich falsch.
Dabei setzt man auch noch freihändig voraus, das Denken würde sich im Kopf abspielen. Natürlich. Wo auch sonst. Denken ist schließlich „Kopfsache“, man „hat Köpfchen“, es kommt vor, dass „der Kopf raucht“, man hat sich etwas „in den Kopf gesetzt“ und nicht etwa ins Knie, und Kinder haben oft „Unsinn im Kopf“. So ist dann auch nicht verwunderlich, dass das Denken landläufig immer noch als Gegenteil des Fühlens betrachtet wird: Gefühle und Emotionen sind eben „unvernünftig“ und „stören“ das Denken. Doch auch diese Auffassungen sind ganz erheblich falsch.
Dabei verlautet selbst aus der Gehirnforschung schon lange, dass jeder mentale Vorgang und damit auch jeder Denkprozess immer aus vier parallel und gleichzeitig auftretenden Faktoren besteht: Wahrnehmungen, Erinnerungen bzw. Erfahrungen, Empfindungen und situative Handlungen. Allerdings sind auch diese vier Faktoren vor allem wieder eines: Begriffe! So, wie „das Denken“. Tatsächlich gibt es also eine Unmenge an Einflüssen, die permanent auf uns einwirkt. Auf den Punkt gebracht: Alles Mögliche(!) beeinflusst unser Denken, andauernd, jederzeit, zum Großteil völlig unbewusst.
Das Denken findet eben nicht nur allein im Kopf statt, geschweige denn „im Gehirn“. Und das ist (beispielhaft, unter anderem), warum das Denken eben keine Handlung ist, so wie man einen Papierhut faltet oder einen Nagel in die Wand schlägt. Und weil hierbei keine definitiven Ursachen wirken, wird auch in Psychologie, Gehirnforschung, Pädagogik, Soziologie, etc, etc generell und grundsätzlich immer knapp daneben gedacht.
Punkt 1 ist: Es ist bis heute noch kein Säugling auf die Welt gekommen, der gefragt hätte „Wie spät ist es denn eigentlich?“. Grundsätzlich nämlich gilt: Wir haben das Denken erlernt! Punkt 2 ist: Man hat uns parallel und gleichzeitig beigebracht, auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu denken – und eben nicht auf irgendeine andere. Und in diesem Denksystem gehört es äußerst clever mit dazu, diese Art des Denkens für die ultimative, einzig richtige zu halten.
Das geschieht von frühester Kindheit an, sodass wir erstens später gar nicht mehr wissen, dass das überhaupt je passiert ist, und zweitens fehlt den meisten von uns deshalb und dadurch jede Einsicht, die eigene Denkweise ernsthaft infrage zu stellen. Im glatten Gegenteil wird uns schließlich penetrant erklärt, dieses Denksystem müsse auch noch ständig optimiert werden. Und gerade die Kinder und Jugendlichen bräuchten immer mehr davon („mehr Bildung“).
Dabei ist die Denkweise, die Art und Weise wie wir denken, der entscheidende Schlüssel für alles(!), was wir denken. Die Denkweise geht jedem Gedanken immer voraus! Daraus wird eigentlich klar, dass alles, was über das Denken für gewöhnlich gedacht und theoretisiert wird, einen Tick zu spät ansetzt. Auch deshalb ermöglichen (u.v.a.) Psychologie und Hirnforschung allenfalls sehr interessante Antworten …auf völlig falsche Fragen.
Die Denkweise umgrenzt also den gedanklichen Rahmen dessen, was überhaupt gedacht werden kann bzw. dessen, was einem überhaupt in den Sinn kommt. Durch unsere angelernte Denkweise gibt es daher quasi Gedanken, die wir gar nicht erst denken. Es gibt (eine ganze Menge) Gedanken, Denkwege, Ideen und Lösungen, an denen wir glatt vorbeidenken. Und das auch noch: ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Dadurch geht uns ein enormes Potenzial flöten.
Man sollte zudem wissen, dass das Denken im Wesentlichen auch das Verhalten bestimmt: Wie man denkt, so verhält man sich auch. Und weil ein Großteil des Denkens nun einmal unbewusst stattfindet, wirkt sich das dem entsprechend auf das Verhalten aus. Doch auch hierüber wird (man möchte fast sagen: natürlich) jede Menge blanker Unsinn verbreitet. Und auch hier wieder in aller Regel aus der Psychologie, Hirnforschung und sogar Genforschung, die uns alle erklären wollen, was an unserem Verhalten nicht stimmt, was wir tun oder lassen sollen. Damit wird prompt auch unser Handeln hinterfragt und infrage gestellt, als ob beides dasselbe wäre. Dem Laien kann man das erzählen. Und das tut man auch.
Es sei vorweg genommen: Man muss sich zunächst einmal bewusst machen, dass es sich hierbei um Bereiche der Medizin handelt! Das heißt: Wenn wir uns auf irgendeine Weise verhalten, dann tun wir das nicht etwa nur „normal“ oder „nicht normal“. Und wenn wir handeln, dann sind unsere Entscheidungen nicht etwa nur richtig oder falsch. Sondern demnach verhalten wir uns und handeln entweder „gesund“ oder „krankhaft“. Das ist nicht einmal als schlechter Witz geeignet. Zumal sich dessen kaum jemand bewusst ist. Übrigens auch nicht die Journalisten, die so über sämtliche Medien jeden Unfug verbreiten, der aus irgendwelchen Experimenten, Statistiken und Studien aus Psychologie, Hirn- und Genforschung auf ihren Schreibtisch flattert.
Dabei wird aus dem Verhalten eines Menschen u.a. ganz gern geschlossen, wie er „ist“, welchen Charakter und welche Persönlichkeit er „hat“. Wobei diese An- und Abführungszeichen unbedingt zu beachten sind. Und auch das ist zwar eine allgemein verbreitete Ansicht, doch ebenfalls wieder etwas zu kurz und knapp gedacht. Tatsächlich nämlich ist es noch nicht einmal einfach umgekehrt.
In der ersten Erkenntnisstufe sollte man wissen: Menschen „sind“ nicht, sondern Menschen verhalten sich. Das heißt: Wie man sich verhält, hängt entscheidend vom jeweiligen Kontext ab, vom situativen und/oder Lebenskontext. Situativ meint beispielsweise ein Rendezvous, eine Prüfung, oder auch die Situation im Wartezimmer eines Arztes gegenüber der Fankurve im Stadion. Der generelle Lebenskontext umfasst alles Private wie etwa die familiäre Situation, sowie die berufliche und finanzielle Lage, das soziale Umfeld, etc.
Mit der zweiten Erkenntnisstufe wird es noch etwas kniffliger, denn Verhalten ist immer und ausnahmslos eine Beobachtung! Und zwar sowohl abhängig von der eigenen Beobachtung als auch den Beobachtungen anderer (Feedback). Um es mit dem Anthropologen Gregory Bateson zu sagen: Verhalten ist immer ein Effekt doppelter Beschreibung. Und (deshalb): „Nichts hat eine Bedeutung, solange man es nicht im Kontext begreift“. Ein Verhalten ist so u.v.a. abhängig davon, was man überhaupt beobachten kann und auch will, sowie abhängig von Erwartungen, Stimmungen, Normen, Werten, Konventionen, Ethik, Moral, etc.
Mit anderen Worten: „Das Verhalten“ gibt es so nicht. Genauso wie etwa auch im Falle des Denkens stolpern Experten wie Laien regelmäßig darüber, es mit einem vermeintlich klaren Begriff zu tun zu haben. Doch mit dem korrekteren Wissen erscheinen etwa „Verhaltensauffälligkeiten“ oder gar „-störungen“ schon in einem ganz anderen Licht. Wird jemandem beispielsweise ein „aggressives Verhalten“ attestiert, heißt das vielmehr korrekter: In einem bestimmten Kontext ist bei diesem Menschen ein Verhalten beobachtbar, dass man als „aggressiv“ beurteilen kann – wobei auch „Aggression“ lediglich wieder ein Begriff ist.
Nebenbei erwähnt heißt das Ganze übrigens auch: Verhalten kann nicht vererbt werden! Schließlich sind sowohl Begriffsbestimmungen, Begriffsverständnis, wie auch Beobachtungen und Zuschreibungen etwas, das rein kulturbedingt lediglich im Kopf stattfindet; in wessen auch immer. Daraus wird hoffentlich sehr klar, dass man alles das, was auch aus der Genforschung über das Denken, Verhalten und Handeln erklärt wird, mindestens ignorieren kann und sollte.
Kommen wir in dieser Einführung so noch zu unserem Handeln: Wie schon erwähnt, werden Verhalten und Handeln gern über einen Kamm geschoren. Das Handeln zeichnet sich allerdings vor allem dadurch aus, dass Entscheidungen getroffen werden. Eine Handlung ist somit zwar eine Erscheinungsform des Verhaltens, jedoch unter der kleinen Voraussetzung, dass es beabsichtigt, ziel- und zweckgerichtet ist, vornehmlich durch rationale Abwägung.
Eine Pflanze, zum Beispiel, wächst und blüht und lebt mit einem entsprechenden Stoffwechsel, reagiert auf Stress, auf äußere Einflüsse, etc, und könnte man ihr durchaus so etwas wie ein Verhalten zuschreiben. Ein beabsichtigtes, ziel- und zweckgerichtetes Handeln dagegen will man Pflanzen eher nicht zugestehen, weil das wohl auch eine Art Bewusstsein voraussetzen würde. Nichtsdestotrotz wollen Verhaltensforscher an der Oxford University bei Erbsenpflanzen genau das festgestellt haben: Erbsenpflanzen würden beim Wurzelwachstum Risiken abwägen, je nach dem, wo und wie die Nährstoffversorgung am besten sei.
Wenn es allerdings nun um das menschliche Handeln geht, möchte man gern dazu noch Qualitäten wie etwa Intelligenz und Vernunft voraussetzen (selbst wenn man zuweilen daran zweifeln muss). Doch auch hierbei wird eben immer nur „die Hälfte“ gedacht und einen Tick zu spät angesetzt. Denn geht es um die (Hunderte von) Entscheidungen, die wir tagtäglich bewusst oder unbewusst treffen, stürzt man sich ausgiebig auf die Frage, wie das eigentlich stattfindet, wie man richtige Entscheidungen trifft, falsche vermeidet, etc, etc. Wie Sie im Verlauf dieses Buches allerdings noch erfahren werden, ist das so grundsätzlich schon „zu spät“ gedacht. Das eigentliche Problem liegt ein Stück weiter vorn.
Im Prinzip [ WIRKUNG! ] machen wir etwas völlig Verrücktes: Im Gegensatz zu allem Üblichem und nahezu allen Experten fangen wir einfach einmal vorne an. Ganz vorn. Wir beschäftigen uns mit dem Prinzip unseres Denkens, mit der grundsätzlichen Art und Weise, wie wir denken, und warum überhaupt. Wir decken auf, dass wir tatsächlich immer nur „die Hälfte“ denken, und wie Sie mit einer alternativen Denkweise Ihr Potenzial glatt „verdoppeln“ können. Und das wortwörtlich: denkbar einfach.
Es handelt sich im Folgenden – im Prinzip – um frei verfügbares Wissen! Nichts davon ist mutwillig am Schreibtisch zusammengezimmert. Dabei dürfte es den einen oder anderen ziemlich überraschen, dass das Ganze noch nicht einmal etwas mit Wissenschaft zu tun hat (außer, dass sie zwangsläufig thematisiert werden muss). Und „trotz dem“ es um das Denken, Verhalten und Handeln geht, um Lernen, Wissen und Bildung, wird im Prinzip [ WIRKUNG! ] nirgends auf (u.a.) Psychologie, Hirnforschung oder gar Genforschung verwiesen, sondern vielmehr „sogar“ im Gegenteil. Wir werden auch ohne jegliche Studien und/oder Statistiken auskommen, auf die sonst üblicherweise immer gern verwiesen wird, um irgendetwas untermauern zu wollen. Das ist in keiner Weise notwendig.
Allerdings müssen auch die leidenschaftlichen Rationalisten und diejenigen, die wissenschaftliche Beweisführungen und Nachweise für unverzichtbar halten, keineswegs befürchten, einem pseudo-esoterischen Geschwafel ausgesetzt zu werden oder sonstiges Halbwissen ertragen zu müssen. Der Erkenntnisgewinn des Prinzip [ WIRKUNG! ] verbirgt sich in etwas ganz anderem. Und zwar an einer Stelle, an der man sonst kaum danach sucht; und deshalb auch nicht findet: in der Zeitgeschichte! Wir machen daher eine Zeitreise in unser Denksystem.
Das heißt: Das Prinzip [ WIRKUNG! ] basiert einzig und allein auf knallharten Fakten und Tatsachen, die in jeder mittelmäßig eingerichteten Stadtbibliothek zu finden sind, im Internet unseres „Zeitalters der totalen Information“ sowieso. Die kleine Raffinesse besteht allerdings darin, die entscheidenden Meilensteine zu erkennen, mitsamt ihren Einflüssen und Auswirkungen zu verknüpfen, und das Ganze auf den Punkt zu bringen – so, dass auch Otto Normalmensch ohne großartige besondere Vorbildung einiges damit anfangen kann.
Das habe ich in den letzten 25 Jahren als Urheber und Autor getan. Entstanden ist daraus eine Trilogie. Dieses Buch dient als Grundwerk für die grundlegenden Erkenntnisse. Dazu der „Alphafaktor“, der sich ausführlich der „anderen Hälfte unserer Wirklichkeit“ widmet. Sowie das „mimesisPrinzip“ („Erfolg geht auch anders. Ganz anders“) als erste und einzige Alternative für die sonst üblichen Vorgehensweisen per u.a. Methodik und Strategie.
Was Sie in jedem Fall bekommen, ist die Möglichkeit, jede Lebenslage und jede Situation, jedes Vorhaben und jedes Problem mit einer anderen, alternativen Denkweise anders zu durchdenken als bisher und als üblich. Starten wir damit nun die Zeitreise in unser Denksystem. Schnallen Sie sich bitte an.
ANNO 1605 – FRANCIS BACON
Die Verwissenschaftlichung unserer Denkwelt
Wir beginnen die Zeitreise in unser Denksystem – zunächst – im Jahr 1605. Im Prinzip müssten (und: werden) wir sogar noch einige Jahre früher ansetzen, doch es ist sinnvoller, wenn wir das etwas später nachholen. Keine Sorge: das klingt nur vielleicht etwas paradox. Doch das ist es nicht.
Wir befinden uns je nach willkürlicher Epocheneinteilung damit also im späten Mittelalter oder schon in der frühen Neuzeit. Das können Sie sich gerade frei aussuchen, es spielt keine wirklich große Rolle. Deutlich wichtiger ist an dieser Stelle vielmehr ein bestimmter Engländer namens Mr Francis Bacon; von dem Sie womöglich glauben, noch nie gehört zu haben.
Jedoch: von wegen. Mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nämlich ist Ihnen der Spruch „Wissen ist Macht“ bestens bekannt. Und der stammt von Mr Bacon, anno 1605, noch heute, im 21. Jahrhundert, in aller Munde! Wir kommen auch auf dieses merkwürdige Machtverständnis noch zurück, doch dieser flotte Spruch allein ist natürlich nicht der Grund, warum wir unsere Zeitreise zunächst ausgerechnet bei Francis Bacon beginnen…
Bacon (1561-1626) wird als „Vater der empirischen Wissenschaft“ gepriesen. Er selbst betrachtete sich lediglich als einfacher Naturphilosoph. Doch wie sich zeigte, hat Bacon mit seinen Theorien und Werken das Verständnis dessen, was Wissenschaft eigentlich ist, damals merfach komplett umgekrempelt – und so entscheidend mitbewirkt, was noch bis heute unter dem Begriff „Wissenschaft“ verstanden und praktiziert wird.
Francis Bacon nämlich war der erste, der sich erlaubte, den damaligen Anspruch der Philosophie infrage zu stellen, als intellektuelle Elite über die Rätsel der Welt und des Lebens nachzudenken und neues Wissen zu schaffen. Bacon interessierte, wie sich neue Erkenntnisse, neues Wissen und Erfindungen auf das Leben des einzelnen Menschen und auf die Gesellschaft auswirken.
Vor allem in seinem Werk The Advancement of Learning veröffentlichte Bacon im Jahr 1605 Ideen, die für diese Zeit revolutionär waren. Man muss sich dazu vor Augen halten, wie das Leben zu Bacons Zeit ausgesehen hat: Der Großteil der Menschen schuftete auf dem Land in bitterer Armut, zum Teil von Geburt an Leibeigene von Gutsherren. So etwas wie Bildung war nur ein paar glücklichen Auserwählten an Klosterschulen vorbehalten. Selbst der Adel war ziemlich ungebildet; vor allem wohl deshalb, weil er es einfach nicht nötig hatte.
In dieser Zeit also legte Francis Bacon jede Menge intellektuellen Sprengstoff. Er wetterte, dass „die Verbesserung des Loses der Menschen“ nur durch „die Verbesserung des menschlichen Geistes“ möglich sei. Dazu müsse der Mensch lernen, „sich nicht von seinen Wahrnehmungen täuschen zu lassen“, dürfe nicht mehr länger „irrige Ideen aus der Vergangenheit übernehmen“, sich nicht mehr von Wörtern und Begriffen in die Irre führen lassen und nicht mehr länger den Dogmen der Philosophen folgen (die zu dieser Zeit ungefähr das waren, was für uns heute die Wissenschaftler sind).
Bacon forderte, das Wissen-Schaffen zu systematisieren und Erkenntnisgewinn und Erfindungen an Zweck und Nützlichkeit auszurichten, um durch Fortschritt an Wissen und Technik auch das Leben der Menschen stetig zu verbessern. Er entwarf dazu ein Forscherkolleg, und schlug vor, der Staat solle Forschungen und Experimente von Erfindern und Wissenschaftlern finanziell fördern. Auch seine Idee, Wissenschaftler sollten in internationalen Verbänden kooperieren, war zu dieser Zeit revolutionär, denn schließlich waren z. B. Da Vinci, Kepler, Galilei und später auch noch Newton schwer damit beschäftigt, Methoden zu entwickeln, um ihre Arbeiten vor anderen geheim zu halten.
Zudem regte Bacon an, Wissenschaftler sollten öffentliche Vorträge über ihre Forschungen halten, und dafür auch gut bezahlt werden: Die Menschen über die Nützlichkeit einer Erfindung, Entdeckung und Erkenntnis zu unterrichten, sei mindestens genauso wichtig, wie der erforschte Kenntnisgewinn selbst.
Kurz gesagt: Francis Bacon holte die Forschung aus dem Himmel der elitären Philosophen auf den harten Boden des Lebens des einfachen Menschen; in der Tat mit den besten Absichten, um den Fortschritt an Erkenntnis, Wissen und Technik zu systematisieren, um das Alltagsleben der Menschen zu verbessern.
Wie unschwer zu erkennen, wird Wissenschaft heute genau so verstanden und praktiziert, wie Bacon es vor über 400 Jahren ersann: Als vom Staat geförderte öffentliche Institution, ausgerichtet an Zweck, Nutzen und Fortschritt; und Otto Normalmensch permanent über neue Theorien und Erkenntnisse informiert, ob er will oder nicht. Bacon im 21. Jahrhundert. Er würde sich diebisch freuen.
Was sich bis hierhin vielleicht noch prima liest, hat jedoch auch ein paar kleine Haken. Bacon sinnierte, theoretisierte und praktizierte zwar sicher mit den besten Absichten „das Los der Menschheit zu verbessern“ – allerdings sind dadurch, dass jemand etwas mit besten Absichten tat, schon Kriege entstanden.
Ein Knackpunkt dabei: Bacon fehlten damals natürlich noch einige Kenntnisse, die wir heute haben. Er konnte auch nicht wissen, welch enorme Auswirkungen u.a. die Religionskriege, die Epoche der Aufklärung, die Französische und die Industrielle Revolution haben würden. Und er konnte nicht vorhersehen, wie einige seiner Kollegen, u.v.a. Descartes, Galilei und Newton, das Leben der Menschen noch gehörig verändern würden.
Und schließlich war da noch Bacons – aus heutiger Sicht – ziemlich seltsame Weltanschauung. „Das Los der Menschheit zu verbessern“ hieß für ihn nämlich auch, den Menschen von den Widrigkeiten der Natur zu befreien: Erdbeben, Stürme, Fluten, Dürren, Missernten, Krankheiten, sowie Berge, Täler, Flüsse, Wälder, usw, die dem Menschen aus irgendeinem Grund im Weg stehen, sowie Bodenschätze wie Salz, Kohle, Erdöl und Gold, usw, die mühsam aus dem Boden geholt werden müssen. Die Fortschritte in Wissen und Technik sollten dazu dienen, als menschliche Krone der Schöpfung den Naturgewalten nicht mehr ausgeliefert zu sein.
Bacon selbst formulierte das ein wenig radikaler: „Das Ziel der Wissenschaft ist die Beherrschung und Kontrolle der Natur“, „Die Natur soll auf ihren Irrwegen mit Hunden gehetzt werden“, „Die Natur muss auf die Folter gespannt werden, bis sie ihre Geheimnisse preisgibt“ und „Man muss sich die Natur gefügig und sie zur Sklavin machen“. Das alles scheint ihm allerdings nur unzureichend gelungen zu sein: Bacon starb an einer Lungenentzündung, als er herausfinden wollte, ob sich ein Huhn konservieren lässt, indem man es im Schnee vergräbt.
Auf den Punkt gebracht: Bacon hatte im Sinn, die Natur unter Kontrolle bringen und beherrschen zu wollen – während bis dahin Wissenschaft betrieben wurde, um die Natur und das Leben besser zu verstehen. Bereits angefangen damit, den Menschen als von der Natur getrennt zu sehen, verschwand so die Vorstellung von der Erde als lebendige Nährmutter und wurde statt dessen zum bloßen Objekt, zu einem Ding, zu einem Etwas degradiert.
Francis Bacon prägte damit sämtliche Naturwissenschaften, die nach ihm entstanden – bis heute! So ist es auf Bacon, anno 1605, zurückzuführen, was noch heute im 21. Jahrhundert unter dem Begriff „Wissenschaft“ verstanden wird: Die Wissenschaft als einzige legitimierte Institution, um die Welt und das Leben zu erforschen und „die Wahrheit“ darüber zu verkünden. Dazu die Ausrichtung an Zweck, Nutzen und Fortschritt, das Kriterium der „Objektivität“ als Freibrief, um dabei jeden Hauch von („nur subjektiver“) Ethik und Moral außer Acht lassen zu dürfen – …und sogar zu müssen, damit die Forschung überhaupt als wissenschaftlich anerkannt wird.
Und es ist auf Francis Bacon, anno 1605, zurückzuführen, was heute im Namen der Wissenschaft so alles praktiziert und mit ihr gerechtfertigt wird. Die Liste ist endlos: Wo – ganz nach Bacon – die Natur zum bloßen Objekt degradiert wird, unterscheidet man u.v.a. zwischen Nutztieren und Schädlingen. Die einen darf man in Massen produzieren, massenhaft abschlachten und als Massenware stückchenweise verpackt in Supermärkten zu Schleuderpreisen anbieten. Die anderen darf man in Massen rücksichtslos und gnadenlos auf jede erdenklich grausame Weise vernichten. Sowohl die einen wie auch die anderen dürfen in Versuchslaboren malträtiert und getötet werden, als Versuchsobjekte, reduziert auf den Zweck, Nutzen und Fortschritt, alles als rein „wissenschaftlich objektiv“ legitimiert, „nur subjektive“ Fragen nach Ethik und Moral überflüssig.
Ganz ähnlich ist es mit Tunnelsprengungen, Flussbegradigungen, Staudämmen, Aufschüttung künstlicher Inseln, Bohrinseln und Bergbau, mit Abholzungen für Flugzeuglande- und Autobahnen, sowie Gentechnik zur „Optimierung“ der Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion, die Stammzellen-, Neuro- und Gehirnforschung, sowie „Anti-Aging“-Produkte und kosmetische Chirurgie zur Kaschierung von Alterserscheinungen, dazu die medizinische Forschung allgemein im Kampf gegen Krankheiten aller Art, vom Schnupfen bis zum Krebs, gegen alle Naturgewalten, vom Erdbeben bis zum Klimawandel.
Beispiele dafür, wie alle Wissenschaft heute noch immer ganz nach Bacon die Natur „auf ihren Irrwegen hetzt“ und „auf die Folter spannt, bis sie ihre Geheimnisse preisgibt“, mit dem Versuch „sich die Natur gefügig und zur Sklavin“ zu machen, mit dem Ziel der „Beherrschung und Kontrolle der Natur“, nur Zweck, Nutzen und Fortschritt vor Augen – ansonsten blind.
So wurde etwa im Dezember 2017 in der Hauptausgabe der „Tagesschau“ des Ersten Deutschen Fernsehens vermeldet: „Auf einer Konferenz in Paris warnte Frankreichs Präsident Macron vor einem Scheitern des vor zwei Jahren vereinbarten Klimaabkommens. Die Staaten hatten sich damals auf eine Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad geeinigt“. Damit wurde uns unterschwellig erklärt: Was mit dem Planeten Erde geschieht, ist offenbar eine Frage der Vereinbarung und reine Beschlusssache. Ganz nach Bacon: Die Erde als bloßes Objekt, der Krone der Schöpfung ausgeliefert.
Der Mensch (insbesondere: die Wissenschaft) konsequent verharrend auf dem intellektuellen Stand des Jahres 1605, mit geballter High-Tech gedanklich im Mittelalter. Oder wie der Anthropologe Gregory Bateson meinte: „Bewusstsein und Zwecksetzung sind seit mindestens einer Million Jahren Charakteristika des Menschen […] Was mir aber Sorge bereitet, ist die Erweiterung des alten Systems um die moderne Technologie. Bewusste Zwecksetzung hat nun die Macht, das Gleichgewicht des Körpers, der Gesellschaft und der biologischen Welt über den Haufen zu werfen“.
Apropos „Macht“: Francis Bacon war nach eigenem Bekunden vielleicht kein Wissenschaftler. In jedem Fall jedoch war er ein exzellenter Verkäufer seiner Ideen, Theorien und Werke. Schon zu Lebzeiten war er so etwas wie ein „Star“, dessen Slogan „Wissen ist Macht“ auch nach 400 Jahren noch bestens bekannt ist und alle Nase lang verwendet wird. Das muss man erst einmal schaffen.
Umso fataler, wenn man sich kopfüber in ein „Zeitalter der totalen Information“ gestürzt hat, in dem das Denken, Lernen, Wissen und Bildung nahezu zwanghaft und zuweilen dümmlich glorifiziert werden, wenn man eine „Bildungsrepublik“ ausruft und sich in einer „Wissensgesellschaft“ wähnt… dann wird aus dem flotten Spruch „Wissen ist Macht“ ganz nebenbei auch ein Schlachtruf für die persönliche Lebensgestaltung mit einer Ellbogenmentalität.
„Wissen ist Macht“ beinhaltet dann nämlich die Aussicht, mit mehr Wissen mächtiger zu sein als andere, die weniger wissen und deshalb weniger mächtig sind; oder gar: ohn(-)mächtig. Damit gleitet das Ganze dann prompt in den Bereich der Selbstbehauptung, der Überlegenheit und Auslese à la Darwin: Das Denken, Lernen und der Zugewinn an Wissen nicht etwa zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, sondern vor allem als Wettbewerbsvorteil im Kampf gegen seine Mitmenschen, für Erfolg in Schule, Beruf, Privatleben, Karriere und Unternehmertum, heute bereits wehrlosen Kleinkindern eingetrichtert.
Und auch das ganz nach Bacon, anno 1605: Der bloße Zweck und Nutzen des Denkens, Lernens, Wissens und der Bildung im Mittelpunkt, beurteilt nach Zweckmäßigkeit und Nützlichkeit. Man muss „etwas damit anfangen können“. Eine künstlerische, musische, literarische oder auch soziale Bildung ist damit nur in Ausnahmefällen gemeint, gilt vielmehr als „brotlos“ und kommt allenfalls als Zusatznutzen, Benefit und nettes Gimmick in Frage.
Doch Bacons Einfluss geht über dieses Ideelle und Ideologische noch erheblich weit hinaus. Denn obwohl er sich selbst eben nicht als Wissenschaftler sah, beeinflusste er die Wissenschaft auch äußerst praktisch; und gilt eben deshalb noch bis heute als „Vater der Empirie“. Zunächst einmal erfand Bacon das Experiment. Das klingt auf Anhieb vielleicht wenig aufregend, doch zu Bacons Zeit war das eine echte Revolution:
Aus der theoretischen Idee eine Hypothese zu formulieren, daraus wiederum einen Versuchsaufbau zu entwerfen, um die Theorie in einem praktischen Experiment und dann durch Versuchsreihen und anhand von Stichproben zu überprüfen… was heute selbstverständlich anmutet, musste schließlich erst einmal erfunden werden. Nämlich: von Francis Bacon, anno 1605.
Und dann ist da eben noch die auch von Bacon erfundene Empirie. Für Otto Normalmensch klingt es heute immer noch beeindruckend, wenn irgendetwas angeblich „durch empirische Studien nachgewiesen“ ist, oder wenn unpopuläre Maßnahmen dadurch gerechtfertigt werden, dass „die Zahlen empirisch belegt“ sind. Wer will da noch ernsthaft zweifeln. Oder gar widersprechen.
Empirische Wissenschaft jedoch bedeutet nichts anderes, als dass irgendjemand irgendetwas – schlicht und einfach – beobachtet und/oder nachgezählt hat! Empirie ist Erkenntnisgewinn durch bloße Beobachtung und bloßes Zählen von Zahlen; inklusive der anschließenden Interpretation und Erklärung, was man (vor allem: Otto Normalmensch) davon zu halten hat.
An einem simplen Beispiel: Wenn jemand beobachtet, dass Sie wochentags jeden Morgen um 7 Uhr mit dem Auto ins Büro fahren, sich das in einer Liste notiert, und daraus schließt, dass Sie offenbar berufstätig sein müssen, dann ist das damit „empirisch belegt“. Anderes triviales Beispiel: Wenn Sie von einem Forscher befragt werden, ob die Regierung Ihrer Meinung nach genug für den Umweltschutz tut, notiert sich der Forscher eine „1“ falls Sie zustimmen, andernfalls eine „0“, zählt die Einsen und die Nullen aller Befragten, und ermittelt daraus die prozentuale Zustimmung und Ablehnung; und damit ist das Ergebnis der Befragung „empirisch belegt“.
Wissenschaft à la Bacon, anno 1605, noch heute, im 21. Jahrhundert. Und das Ganze ist nicht etwa nur deshalb falsch, weil es sich um Ideen und Methoden handelt, die mittlerweile über 400 Jahre alt sind. Sondern es ist auch ziemlich verrückt angesichts dessen, dass die Fallstricke dieser Art von Erkenntnisgewinn auch für den Laien relativ leicht zu erkennen sind.
Es wird jede Menge Schindluder damit getrieben, dass Otto Normalmensch sich damit nicht auskennt, weil er in seinem Alltag schließlich andere Probleme hat, als sich mit den Grundlagen der Wissenschaft allgemein und (u.a.) der Empirie im Speziellen zu beschäftigen.
Machen wir an dieser Stelle ein kleines Päuschen und überfliegen erst einmal, wie unsere heutige Denkweise (und damit immer auch: unser Verhalten, unsere Entscheidungen, unsere Ziele, Pläne, Probleme, Ängste, etc) auf Francis Bacon, anno 1605, zurückgeht; warum wir uns heute, im 21. Jahrhundert – unbewusst – gedanklich mindestens im 17. Jahrhundert befinden…
- - - FRANCIS BACON, ANNO 1605 - - -
Bacon erfindet das Experiment und die Prüfung der Ergebnisse
in Versuchsreihen und durch Stichproben.
Bacon erfindet die Empirie: Erkenntnisgewinn durch unmittelbare
Erfahrung, durch bloße Beobachtung und das Zählen von Zahlen.
Bacon prägt bis heute das Ziel der Wissenschaft, die Natur in den
Griff zu bekommen, unter Kontrolle zu bringen und zu beherrschen.
Bacon betrachtet als Erster den Menschen gedanklich getrennt von
der Natur, die damit zum Objekt, zum Ding und zum Etwas wird.
Bacon ersinnt den Spruch „Wissen ist Macht“: Das Denken, Lernen,
Wissen, Kenntnisgewinn und Bildung ausschließlich ausgerichtet an
Zweck, Nützlichkeit und Fortschritt.
ANNO 1619 – RENÈ DESCARTES
Gefangen im Maschinendenken
Auf der Spurensuche, wie sich unser heutiges Denksystem entwickelt hat, findet sich der nächste Meilenstein im Jahr 1619. Von da an nämlich ließ sich ein junger Franzose in seinem Ideenreichtum nicht mehr stoppen – und veränderte damit die (westliche) Welt gleich mehrfach, bis heute: René Descartes.
Für Descartes (1596-1650) gilt ähnliches, wie für Francis Bacon: Während Bacons Ausspruch „Wissen ist Macht“ noch heute in aller Munde ist, er selbst dagegen nahezu unbekannt, so ist der Spruch „Ich denke, also bin ich“ („cogito ergo sum“) zwar allgemein bekannt, doch kann Otto Normalmensch mit dem Namen René Descartes ansonsten nur vergleichsweise wenig anfangen.
Auch hier ist es sinnvoll, einen kurzen Seitenblick auf den zeitgeschichtlichen Hintergrund zu werfen: René Descartes stand voll unter dem Eindruck der Religionskriege: Die acht Hugenottenkriege in Frankreich, die nach 36 Jahren im Jahr 1598 endeten, worauf 1618 der Dreißigjährige Krieg ausbrach. An letzterem war Descartes, wenn auch nur kurz, als Soldat beteiligt. Es waren Glaubenskriege zwischen Katholiken und Protestanten mit zahllosen Greueltaten und Massakern von enormer Grausamkeit auf beiden Seiten.
Descartes begann sich Gedanken zu machen, ob überhaupt eine Religion, eine Kirche, ein Glaube für sich in Anspruch nehmen dürfe, „die Wahrheit“ zu kennen. Im Jahr 1619 hatte Descartes daraufhin eine Vision, wonach er von Gott persönlich die Aufgabe erhalten habe, sich an die Arbeit einer „universalen Methode zur Erforschung der Wahrheit“ zu machen. So entstand Descartes’ erstes Werk Regulae ad directionem ingenii („Regeln zur Ausrichtung der Erkenntniskraft“), das er allerdings nie vollendete.
Damit läutete Descartes nicht nur das Zeitalter der Aufklärung ein, sondern zudem auch eine grundsätzlich neue Denkweise, die bis heute das Denken in der westlichen Welt kennzeichnet und – unbemerkt – dominiert: Die so genannte typisch Europäische Dissoziation, die Suche nach „der“ einen, zweifelsfreien, endgültigen Wahrheit.
Die Weltmaschine – Das mechanistische Weltbild
In seinem Sinnieren über „die Wahrheit“ und wie man sie erforschen könne, ließ sich Descartes von den damals hochmodernen Automaten, etwa Springbrunnen mit beweglichen Skulpturen, inspirieren. Er fragte sich, ob nicht auch Tiere, der Mensch, die gesamte Natur nichts weiter seien als mechanische Apparate aus Getrieben, Pumpen und Flüssigkeiten:
„Ich sehe keinen Unterschied zwischen Maschinen,
hergestellt von Handwerkern, und den Körpern,
die allein die Natur zusammengesetzt hat“
(René Descartes)
Den intellektuellen Rest gab ihm die mechanische Uhr, deren Herstellung zu Descartes’ Zeit nahe an der technischen Perfektion war, und als Vorbild für den Bau von Automaten aller Art diente. Tiere beispielsweise, so Descartes, seien „aus Rädchen und Sprungfedern zusammengesetzt“. Und schließlich: