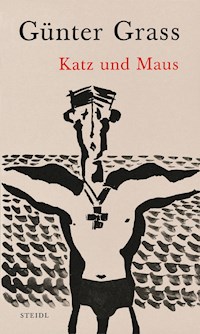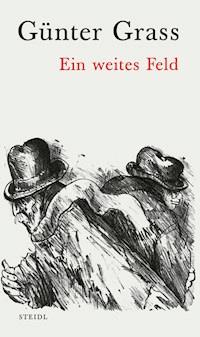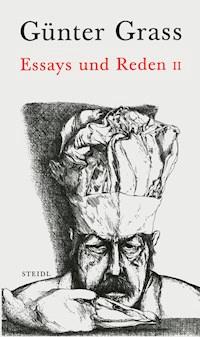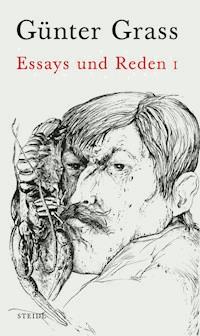
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Steidl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von den poetologischen Texten des jungen Autors bis zu den Wahlkampfreden 2007 spannt sich der Bogen dieser Essays und Reden. Damit zeichnet er zugleich die Entwicklung nach, die Grass seit 1955 genommen hat: Begriff der Bildhauerschüler und Nachwuchsdramatiker Freiheit zunächst allein als eine der Kunst, wurde ihm mehr und mehr die Unmöglichkeit einer Existenz im Elfenbeinturm bewusst. Wachsendes gesellschaftliches Engagement führte ihn deshalb mitten hinein in das politische Alltagsgeschäft. Die Absage an jegliche Heilslehre, komme sie von rechts oder von links, ließ ihn jene Position zwischen allen Stühlen einnehmen, die ihm bis heute zu eigen ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1510
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Günter Grass
Essays und Reden I
1955
September 1955
Der Autor sagt zu seinem Gedicht
In der ersten Strophe des Gedichtes versucht der Wachende den Übergang in den Schlaf zu finden, die andere Form (Lilie) anzunehmen und alles zurückzulassen, das in dieser Form keine Herberge finden würde. Sein Gedächtnis (darauf bezieht sich die Textstelle »Lachenden Tieres trockenes Horn«) sollte zurückbleiben. Er sucht nach einer Möglichkeit, nach Zahl und Mittel: Er möchte es mit dem Regen löschen. Doch dieses Tier-»Gedächtnis« zeigt immer wieder ungebeten sein geräumiges Horn vor, diesen Spieß, der alles aufbewahrt: Daten, Gespräche, die kurzen Beziehungen zwischen Namen, welche am Sonntag beginnen, am Montag enden, den ganzen Terminkalender, dem kein Schlafloser entgeht.
Erst die zweite Strophe verdeckt der Traum. Abgeschieden voneinander, ohne direkte Begegnung, nur von Tier und Stern beobachtet, bewegen sich die Akteure der dunklen Traumwelt. Von unten (tief unterm Schnee) nach oben (überm Kristall) zählt sich die Reihe der Bewegung auf. Ein tiefverborgenes Lachen bewegt die Toten und damit die Erde mit ihrem Sand zwischen den unruhigen Schläfern. Über allem, über den Schnee gleitet ein Schlitten davon, vom Lachen (tief unterm Schnee) verfolgt.
Die dritte Strophe bringt den Morgen (die Nähte der Nacht). Die letzten beängstigenden Attribute des Traumes haben ein Kind erwachen lassen. Wie bei einer Treibjagd steigern sich Rufe zu Ringen, Ringe verengen sich, werden zum Punkt. Wieder breitet sich die gleiche, trockene Landschaft. Wieder tritt die Zeit in ihr Recht, beginnt wieder zu »messen«; fast schien sie vom Traum überwunden zu sein. Der beginnende Tag bringt scharfe Konturen, zeigt seine Ware: Ersatzstoffe, die wir für das Leben ansehen, jedes Dunkle, nur schwer zu Begreifende bewertet er, nennt einen Preis und verkauft es (der Venus Blut…).
Diese Deutung eines Gedichtes kann und darf nicht mehr sein, ein Hinweis. Denn setzt das Gedicht nicht erst dort an, wo der alles erklärende Finger der Logik nicht mehr hinreicht? Die letzten Beziehungen zwischen Schlüssel und Schloß, der Augenblick, da das Ohr zur Muschel wird, am Strand liegt und den Lärm des Sandes vernimmt, das fast Unsagbare gehört dem Gedicht. Immer wieder wird es der Vogelflug sein, der den Lyriker zum Nachzeichnen zwingt, der Regen, der auf eine Trommel schlägt, diktiert ihm, die Großstadtstraße, in deren Fluß Neonschrift zu Versen wird und der Atem des Zeitungsverkäufers, sind seine Anliegen.
1956
November 1956
Die Ballerina
In der Wohnung eines Restaurateurs fand ich einige Stiche, welche Szenen in der Manier der Commedia dell’arte, pantomimische Schaustellungen, allerlei allegorischen Bühnenzauber illustrierten. Von einem dieser Bildchen soll hier die Rede sein.
Kleine, sichere, in der Tiefe des Zimmers, im offenen Dunkel des Fensters netzartig übereinandergelegte Striche, ein hochbeiniges, zerwühltes Bett - als hätte ein Schlafloser es verlassen -, im Hintergrund der schmale Schrank, ein Bücherbord halb geahnt, zuvorderst mit kühner Hand entworfen, sorgsam den Ton des Papiers bewahrend, entwickelt sich die bewegteste Szene: Auf seinem armen Stuhl, nachlässig mit Hemd, Tuch und Hose bekleidet, sitzt der Dichter. Er hat sich zurückgelehnt, läßt die Hand mit der Feder hängen, hat links das blanke Papier ergriffen. So, ungläubig noch, erblickt er die Ballerina. In spitzem Schuh steht sie auf seinem Tisch. Man sieht noch die gekreuzten Bänder über dem Knöchel, dann wölbt sich ein reicher, gewichtloser Rock, unter Perlen und durchbrochenem Besatz atmet die Büste. Schlank von der Taille aufwärts streckt sie sich mit erhobenen Armen bis in den letzten Finger. Unter dem leichten Schmerz in der Zeichnung der Brauen lächelt sie kaum und blickt den Beschauer des Blattes an, als tanze sie für ihn und nicht für den Dichter. Die ruhigen Konturen dieser Positionen lassen glauben, daß eine Folge ausgesuchtester Bewegung so abschließt. Vielleicht jedoch wird sie von neuem beginnen, wird diesen mit Schrank, Tisch, Stuhl und zerwühltem Bett fast verstellten Raum nun auch mit Pirouetten füllen, oder sie wird in zerbrechlicher Arabeske, einer Waage gleich, Harmonie bedeuten. Vielleicht aber wird sie ein Sprung, ein langsamer, bis ganz zum Schluß deutlicher Sprung in aufsteigender Linie durch das offene Fenster in den Nachthimmel tragen und den leeren Tisch zurücklassen. Er, Papier und Feder in den Händen, wird nach ihr greifen wollen, wird halten wollen, was nicht zu halten ist; gewiß nicht von einem, der mit gefüllten Händen greift. So wird er wieder zu seinem Stuhl finden, wird lange sitzen, hängend die Hand mit der Feder, links das jäh ergriffene Papier, wird auf dem Tisch die Stelle suchen, an welcher alles stattfand, und wird einen Kratzer finden - dumm wie alle Kratzer. Und dann wird er schreiben, der Dichter, auf jenem Stich.
Wir mögen lächeln bei der Betrachtung dieses naiven Bildchens und mit dem Finger die Stellen suchen und finden, welche uns gar zu peinlich den staubigen Porzellanschnörkeln in großmütterlichen Vitrinen gleichen. Die Intimität dieser Begegnung zwischen Poet und Muse werden wir in die Gartenlaube verbannen und derlei unbestellte Darbietungen auf unserer Schreibtischplatte nicht dulden. Und dennoch könnte es sein, daß heute, da wir Gartenzwerge und sehr zerbrechliche Schäferidylle gegen Bakelitaschenbecher und die Vitrine gegen den Nierentisch um einen fragwürdigen Gewinn eintauschen, der Dichter mit seiner Schreibmaschine dieses besondere Ereignis nötig hat. Auch heute entsteht kein Gedicht, wenn sich nicht hilfreich eine der Musen beugt.
Wenn es den Dichter ankommen sollte, die Ballerina zu beschreiben - Anlaß genug gab ihm ihr Tanz, der sprödkühle Raum aus ihrer Bewegung entworfen -, wird er näher treten, wird er dahinterblicken, entzaubern wollen. Er gleicht dem Briefmarkensammler, welcher ein kleines, begehrtes Viereck prüfend ins Licht hält, um Zahnung und Wasserzeichen deutlich zu haben. Krone und Lächeln der bunten Königin, so wohlgelungen die Miniatur sein mag, beeinflussen niemals sein wertendes Auge.
Kehren wir zu unserem Stich zurück. Jenem Dichter hinterließ ein Augenblick künstlichster Darbietung nur die Spur der Ballettschuhe auf der Tischplatte. Davon wird er schreiben. Die Darbietung wird zur Erscheinung, der Kratzer zum Zeichen werden. Die Ballerina jedoch? Von dem Fenster, durch welches sie kam und ging, wird die Rede sein, und sollte ein guter Dichter dort an dem Tisch gesessen haben - nach dem Bildchen können wir es nicht beurteilen -, wird er darauf verzichten, der Ballerina Augen gülden, ihr Antlitz hold und ihre Füßlein gar fein zu nennen. Derlei Feststellungen über Augen, Gesicht und Füße machen sich nicht in so vagen Momenten. Dafür bedarf es der Erlaubnis, hinter der Kulisse zu stehn, in die Garderobe zu schauen.
Ihr Körper, ihr Requisit.
Jeder Tenor, wenn es seine Stimme verlangt, wird hinter sich nach der Stuhllehne fassen - und immer wird ein Stuhl oder sonst Greifbares in seiner Nähe stehen -, wird mit diesem Griff neue Kraft seinem Organ geben, gewinnender wird ihm die Arie gelingen. Nicht so die Ballerina. Ihr ist nicht viel erlaubt. Ihr Körper, dieser dem leicht hysterischen Weinen nahe Auswuchs gequälter, auswärtsgedrehter Schönheit, bleibt, sobald sie mit winzigen Pas de courus aus der Kulisse entlassen, ihr einziges Requisit. Einsam zeichnet sie ihre Figuren und erreicht zwischen der dritten und vierten Pirouette jenen Grad der Verlassenheit, den selbst das deutscheste Dichterlein nicht erreicht. Wird nun mit jeder beliebigen Drehung, wenn sie nur schwungvoll genug ist, dieser Ort der Verbannung bezogen? Ist es genau so, wenn Irmchen sich im Walzertakt dreht und die Augen selig dabei schließt? Wir werden sehen, daß mit der Pirouette, dieser geschraubten, gekünstelten Abstraktion, die letztmögliche Drehung geglückt scheint, daß hier das Kunststück gezeigt wird. Kunst, weil nicht mehr Natur, weil hier die papierne Rose - wir kennen sie von den Schießbuden her - aller Vegetation voraus ist und niemals welken wird. Und nochmals Kunst, weil Gewaltsamkeit, Verleugnung der dummen, begrenzten Glieder, kleinliches Feilen an einer leeren Form hier und immer wieder zu gewichtloser Schönheit ohne Vor- und Zunamen gereicht.
Der Garderobe bleibt es dann vorbehalten, diesem nun schwitzenden siebenundzwanzigjährigen Geschöpf ein Vera oder Tascha zuzurufen, einen von harter Arbeit gezeichneten Körper aufzunehmen, welcher lispelt und keinen Blinddarm mehr hat. Nun zeigt es sich, wie harmlos und banal die Pause zwischen zwei anmutig anstrengenden Spitzenleistungen verbracht werden kann. Die Ballerina strickt Wollsocken für ihren kleinen Bruder, die Ballerina redet dummes Zeugs, die Ballerina hat sich kürzlich verlobt, jedoch ist es nicht ausgeschlossen, daß sie sich bald wieder entlobt. Die Ballerina setzt eine Brille auf, sie ist etwas kurzsichtig, und blättert in der Illustrierten, bis das Kreuzworträtsel gefunden und auch zur Hälfte gelöst wird. Nun weint die Ballerina ein bißchen. Sie hat heute eine schlechte Balance gehabt, sie hat »die Arabeske verwackelt« und ist während der dritten Pirouette »von der Spitze geknallt« - und das darf sie nicht.
Der Tenor darf hilfesuchend nach der Stuhllehne greifen, wenn er nur singt. Irmchen darf sogar mitten im Walzer ein wenig torkeln und tiefsinnig feststellen, daß sich ja alles dreht. Niemand wird ihr deshalb böse sein. Nur wenn die Ballerina »von der Spitze knallt«, dann gefriert das Parkett, dann wird es heiß auf den Rängen, taghell und nüchtern dehnt sich die Bühne, Programme werden gefaltet, entfaltet, und alles Flüstern besagt, daß die Ballerina schon siebenundzwanzig ist, lispelt und keinen Blinddarm mehr hat.
Vom Barfußtanz.
Feind und todernstes Gegenteil der Ballerina ist die Ausdruckstänzerin. Während die Ballerina ihren Körper nach festen Regeln bewegt und dabei lächelt, als sei ihr die Belanglosigkeit in die Mundwinkel gepinselt, tanzt die Ausdruckstänzerin mit ihrer schwierigen Seele und rührt ihre Glieder dazu, als sei ihr privates und obendrein krummes Knie Anlaß genug, das achtel Parkett und halbvolle Ränge zwei lange Stunden zu fesseln. Die Ballerina wohnt bei ihrer Mutter, raucht nicht, ißt Joghurt und Bananen, füttert ein Hündchen und fühlt sich vor und nach dem Training müde, nichts als müde.
Die Ausdruckstänzerin ist gebildet. Sie weiß die Weise von Liebe und Tod auswendig herzusagen und hat Cocteaus »Orphée« schon fünfmal gesehen. In ihrem möblierten Zimmer hängt eine afrikanische Maske, eine Reproduktion nach Paul Klee und das Foto einer siamesischen Tempeltänzerin. Sie schneidert sich ihre Kleider selber und trägt ihre langen, wunderschönen Haare niemals zum Friseur. Da die Ballerina früh zu Bett geht, ist ihr Nachtleben, bis auf einige Kinobesuche, auf recht harmlose Art geregelt. Die Ausdruckstänzerin hat einen Pianisten zum Freund. Beide leben in ständiger Angst vor dem Kinde, wünschen sich aber ein Kind, sie sogar Kinder, Mutterschaft. Nun, wie zum Ersatz, tanzt sie mit aufgelöstem Haar - daher die Scheu vor dem Friseur - in sackähnlichem Gewand Wiegenlieder, Erwartungen, Erlösungen - ihre letzte Kreation hieß: Weinendes Embryo.
Die Ausdruckstänzerin tanzt barfuß, deshalb könnte man sie auch Barfußtänzerin nennen. Monotonem, preußischem Reglement gleich ist das Exercice der Ballerina. Ein zerquältes, zerdrücktes Fleisch versteckt sich in weißen, roten, gar silbernen Ballettschuhen. Die Füße der Ballerina sind häßlich zu nennen. Geschundene, offene Zehen, ein übergroßer Spann. Sie scheinen die wahren Opfer all dieser gültig gezeigten Schönheit zu sein. Hier unten sammelt sich, was oben harmonisierte Geste und weiches Lächeln kaschiert. Das Maß dieser Schuhe bestimmt noch Mittelalter und Inquisition. So dürfen wir denn die erstrebenswerten zweiunddreißig Fouettés als ein Geständnis werten, und nichts, kein Barfußtanz, wird dieses Geständnis, diesen Schmerz ersetzen können.
Askese vor dem Spiegel.
Die Ballerina lebt, einer Nonne gleich, allen Verführungen ausgesetzt, im Zustand strengster Askese. Dieser Vergleich darf deshalb nicht überraschen, da alle auf uns gekommene Kunst stets Ergebnis konsequenter Beschränkung und nie genialischer Maßlosigkeit war. Auch wenn zeitweise Ausbrüche ins Unerlaubte zu denken gaben und geben, der Kunst sei alles erlaubt, erfand sich immer, und gerade der beweglichste Geist, Regeln, Zäune, verbotene Zimmer. So ist auch der Raum unserer Ballerina beschränkt, übersehbar und erlaubt Veränderungen nur innerhalb der zur Verfügung stehenden Grundfläche. Die Erfordernisse der Zeit werden der Ballerina immer wieder ein neues Gesicht abverlangen, werden ihr exotische und pseudoexotische Masken vorhalten wollen. Sie wird diese dekorativen Spielchen mitmachen, wissend, daß alle Mode ihr gut steht. Die wahre Revolution wird sich jedoch im eigenen Palast ereignen müssen.
Wie ähnlich verhält es sich in der Malerei. Wie sinnlos scheinen doch alle Versuche, grundlegende Entdeckungen im Erfinden neuer Materialien, im Austausch der Ölmalerei gegen ein Lackspritzverfahren auf Aluminium zu sehen. Niemals wird der Dilettantismus, an seinen Manieriertheiten leicht zu erkennen, das zähflüssige, selbst in der Revolution konservative Metier verdrängen können.
Der Spiegel wird durch die Ballerina zum unnachsichtigen Werkzeug der Askese. Hellwach trainiert sie vor seiner Fläche. Ihr Tanz ist nicht der Tanz mit geschlossenen Augen. Nichts anderes ist ihr der Spiegel als ein Glas, welches alles zurückwirft, überdeutlich, ein unerbittlicher Moralist, dem zu glauben ihr zum Gebot wird. Was tut der Dichter alles dem Spiegel an. Welch mystische, unleserliche Postkarten steckt er in seinen Barockrahmen. Ihm ist er Ausgang, Eingang, er sucht wie junge, noch unwissende Katzen hinter der Scheibe und findet dort allenfalls ein zerbrochenes, mit ungleichen Knöpfen gefülltes Kästchen, den Stoß alter Briefe, welchen er nie mehr zu finden hoffte, und einen Kamm voller Haare. Nur in den Augenblicken endgültiger Wandlung, da unser Körper bereichert oder verarmt scheint, stehen auch wir mit gleich wachen Augen wie sie vor dem Spiegel. Er zeigt den Mädchen die Pubertät an, ihm entgeht keine Schwangerschaft, kein fehlender Zahn - falls ihn ein Lachen provozieren will. Vielleicht daß der Friseur, der Taxichauffeur, der Schneider, der Maler beim Selbstportrait, die Prostituierte, welche ihr Zimmerchen mit einer Zahl solch deutlichmachender Scherben versehen hat, etwas Gemeinsames mit der Ballerina haben. Es ist der sorgenvolle Blick des Handwerkers, des Menschen, der mit dem Körper arbeitet, es ist der Blick in den Beichtspiegel.
Applaus und Vorhänge.
Der Applaus ist das Kleingeld der Ballerina. Sie zählt es sehr sorgfältig, und hätten diese Münzen, wie anderes Hartgeld, die Eigenschaft, sich in einen Strumpf stecken zu lassen, sie würde sie sparen für spätere Zeiten, da es an Händen fehlen wird, da niemand mehr klatschen will, da das Klatschen weh tun könnte, da der Mann, der dem Vorhang befiehlt, keinen Grund mehr haben wird, auf einem Täfelchen Striche zu machen, bis daß es heißt: Sechzehn Vorhänge heute, zwei mehr als gestern.
Dieselbe Gründlichkeit und Besorgnis, mit der wir die Rufe des Kuckucks während eines Sonntagsspazierganges im Stadtforst zählen, zeigt auch die Ballerina, wenn es gilt, der Dauer und Dichte des Beifalls die mögliche Zahl der Vorhänge zu entnehmen. Sie zählt und möchte Parkett und Ränge mit ihren präzisen und anmutigen Reverenzen versuchen, wie wir den Kuckuck versuchen, der unsere Jahre ausruft. - Dann, nach dem letzten Vorhang, fällt die Ballerina gleich einem Kartenhaus, das plötzlich der Zugluft ausgesetzt wird, in sich zusammen. Jedes ihrer sonst so gewogenen Glieder rutscht ins Beliebige. Die Ordnung in ihrem Gesicht, in diesem Teller voll kosmetischer Speisen, lockert sich. Ihren Augen gelingt kein Blick mehr, überspannt rutschen sie ab und erweitern sich schreckhaft. Desgleichen der Mund. Jederzeit bereit, in Hysterie laut zu werden, strengt ihn ein Lächeln, harmlos gemeint, derart an, daß ihm der Krampf in den Winkeln sitzt. Wozu dieses ständige Stirnrunzeln, dieses Heben der Brauen. Jedes Stück der mit viel Mühe und Können arrangierten Ausstellung verläßt seinen Platz. Die Ballerina scheint außer Rand und Band.
Das Pünktchen.
Sie hebt den Arm in leichter Beugung. Oben ergibt sich die Hand, ein unnütz vielgliederiger Fortsatz. All das ohne Bedeutung, nur tauglich zum Ansehen, nicht mal ein Gruß oder die Einladung, näher zu treten. Halb auf dem Wege zum Ornament, will es nur zeigen, was da ist, daß sich ein Arm da beugt und den Hintergrund einteilt, daß dort, wo der kleine Finger hindeutet, ein Pünktchen ist, welchem alle Schönheit gehorcht - und so auch die Ballerina. Nie käme ihr der Gedanke, man könne den Arm auch anders beugen, daß er nur Kraft, Verzweiflung oder gar häßlich geknickt einen Unfall bedeutet. Nie würde sie anderen Punkten den Finger hinschicken als jenem, welcher sinnlos ist wie ein Goldfisch und doch so geräumig, so unersättlich, daß all unser Ballast sich in ihm verlieren könnte. Denn sagten wir zu unserer Ballerina: »Ach, tanzen Sie uns doch einmal die Atombombe!«, sie würde sieben Pirouetten drehen und hernach lächelnd zum Stand kommen. Und käme einer und wünschte das Verkehrsproblem oder die Wiedervereinigung getanzt zu sehen, sie zeigte ihm sofort jene Kombination ästhetischer Figuren, an deren Ende dann eine Arabeske die Wiedervereinigung vollzieht und das Verkehrsproblem löst, indem sie aufs Pünktchen weist.
Zu all diesen Demonstrationen erklingt der »Türkische Marsch« oder ein Stückchen aus der Nußknackersuite, es bleibt sich gleich, die Ballerina ist nicht unbedingt musikalisch zu nennen. Sie läßt sich vom Pianisten den Takt ansagen, erklären, vorzählen und übergibt sich in schöner Gläubigkeit dem Ballettmeister, damit er Zahl und Reihenfolge der Attitüden, Touren, Relevés bestimmt und ihren Auftritt insgesamt formuliert.
Es darf auch der Radetzky-Marsch sein, dessen unüberhörbare Klänge in verblüffender Abwegigkeit ihren Weg auf der Bühne begleiten, wenn nur am Ende, mit dem letzten Ton und Paukenschlag, der Finger wieder aufs Pünktchen weist, dann ist es schon recht.
Natur und Kunst.
Noch einmal zurück zu dem Bildchen. Die Ballerina, in steifen, leicht knüllenden Stoffen, tanzte auf dem Tisch. Das geöffnete Fenster ließ ahnen, daß Auftritt und Abgang keiner Tür bedurften. Leicht läßt sich Zimmer, Tisch und Fenster mit einer Bühne, Podest, Kulissen vertauschen. Der Dichter, auf dem Stich etwas schmalbrüstig, wandelt sich gleichfalls, wird zum springenden, tanzenden Troubadour. In einem Pas de deux nimmt die Geschichte ihren weiteren Verlauf. Liebe, Trennung, Versuchung, Eifersucht und Tod. Einfach ist diese Handlung, bloßer Vorwand, die Ballerina in ihrer schwierigen Existenz, auf Spitzen tanzend, zu zeigen. Im reichsten Décor erfüllt sich hier, was tägliches Exercice zu den Klängen eines verstimmten Klaviers dem Körper und nur dem Körper vorschreibt.
Wer zwingt die Ballerina, dieses empfindliche, im Alltag fast ein wenig fade Wesen, sich an die Stange zu stellen und unter der Aufsicht einer ältlichen, oftmals recht zynischen Ballettmeisterin Jahr um Jahr zu trainieren? Ist es nur Ehrgeiz, nur Sucht zum Erfolg hin? - Widerstrebend betritt sie den Übungssaal, sucht ihren Platz auf. Widerstrebend kommt sie den ersten Bewegungen nach. Und dann packt es sie. Plötzlich ist ihr dieser Kampf gegen den Körper auf ähnliche Art faszinierend wie einem erklärten Pazifisten ein todernster Vorbeimarsch im Stechschritt.
Ist es schon ein hausbackener Witz, dem Dichter den allzu gut gemeinten Rat auf den Weg zu geben, immer recht natürlich zu schreiben, um wieviel unerträglicher wäre dem feinen Auge die Tänzerin, welche es wagte - weiß ich, welchem Drang immer folgend -, natürlich, das heißt ohne jeden Anstand, geschwätzig und maßlos wie die Vegetation eines Urwaldes oder auch Treibhauses über die Bühne zu hüpfen.
Es ist uns zur Selbstverständlichkeit geworden, ein Stück Hammel nicht in rohem, noch blutigem Zustand barbarisch zu verschlingen. Nein, wir braten, kochen oder dünsten es, tun immer wieder noch ein Gewürz in den Topf, nennen es am Ende gar und schmackhaft, essen es manierlich mit Messer und Gabel, binden uns eine Serviette um. So sollte nun endlich den anderen Künsten dieselbe Ehre wie der Kochkunst zuteil werden und - wenn dann und wann Stimmen laut werden und das klassische Ballett totsagen wollen - bewundernd festgestellt werden, daß bislang diese Kunst, mehr noch als Kochkunst und Malerei, eine der unnatürlichsten und damit formvollendetsten aller Künste zu nennen ist.
Erst wenn es gelingen sollte, aus all den Experimenten - und bisher wurden nur Experimente gezeigt - gleichstarke Formeln der tänzerischen Bewegung zu kristallisieren, welchen gleich dem Ballett alle Zufälligkeit abgeht, wird sich die Ballerina zum letztenmal verbeugen.
Vielleicht zeigt sich dann die große, ganz und gar künstliche Puppe. In seinem Traktätchen über das Marionettentheater weist Kleist auf sie hin, Kokoschka ließ sich solch ein unempfindliches Mädchen schneidern, in Schlemmers Triadischem Ballett machten kühn entworfene Figurinen den ersten, wichtigen Schritt. Vielleicht werden sich beide vertragen und eine Ehe eingehen, die Marionette und die Ballerina. -
1957
Mai 1957
Der Inhalt als Widerstand
Kandinsky sagte: »Die richtig herausgeholte Form drückt ihren Dank dadurch aus, daß sie selbst ganz allein für den Inhalt sorgt.« - Ein schöner Satz, ein einleuchtender Satz, ein Satz, dem wir klein- und großgemusterte, klein- und großgeschriebene Tapeten verdanken. Alle haben ihn verstanden. Die Maler, die Poeten, die Verpackungsindustrie und die Erfinder der Musiktruhen. Schütteln wir ihn, den Satz; seinem Sinn nach müßte er es vertragen: »Ein richtig herausgeholter Inhalt drückt seinen Dank dadurch aus, daß er selbst ganz allein für die Form sorgt.« Da nun auch diese Umkehrung nicht so recht stimmen will, da sich über Form und Inhalt, Inhalt und Form nicht in einem Satz sprechen läßt und diese Maximen sich allenfalls für die erste Seite eines Kunstausstellungskatalogs oder als Sinnspruch für die Rückseite eines fortschrittlichen Kalenderblattes eignen, soll hier versucht werden, zwischen mehreren Satzzeichen Mißtrauen auszubreiten, ja Mißtrauen zwischen Form und Inhalt zu säen.
Es bedeutet menschliche Tugenden aufzählen, wenn Tätigkeiten nacheinander genannt werden, deren Sinnlosigkeit sprichwörtlich geworden ist: Gegen den Wind spucken, gegen die Strömung schwimmen, gegen die Wand rennen, tauben Ohren predigen. Und eine Tugend mehr nennen heißt, jener zu gedenken, die sich da abplagten und gegen den Inhalt schrieben, malten oder sich, wie Maillol, Jahr für Jahr dasselbe rundliche Mädchen ansahen, um der formenden Hand zu helfen, um eine Kniescheibe deutlich zu machen und einen Halswirbel so einzubetten, daß nur die wahren Halswirbelfetischisten ihn entdecken. -
Der Inhalt ist der unvermeidliche Widerstand, der Vorwand für die Form. Form oder Formgefühl hat man, trägt es wie eine Bombe im Köfferchen, und es bedarf nur des Zünders - nennen wir ihn Story, Fabel, roter Faden, Sujet oder auch Inhalt -, um die Vorbereitungen für ein lange geplantes Attentat abzuschließen und ein Feuerwerk zu zeigen, das sich in rechter Höhe, bei günstiger Witterung entfaltet; mit dem dazugehörigen Knall, einige Sekunden nachdem das Auge etwas zu sehen bekam. Denn - und alle Attentäter, auch jene literarischer Herkunft, mögen mir hier zustimmen - bleibt der Zünder oder der Inhalt zu lange im Köfferchen, wird voreilig, vorzeitig entschärft, ist das Verhältnis zwischen Bombe und Zündung unverhältnismäßig, kurz, wird mit Kanonen auf Spatzen oder mit Spritzpistolen auf Pottwale geschossen, lacht das noch zu benennende Surrogat der vormals so leicht zu belustigenden Götter.
Flüchtig seien noch jene Formverächter erwähnt, die den ganz dicken Inhalt am Busen wärmen und nichts außer ihrer Begeisterungsfähigkeit zu Tinte werden lassen.
Ein echter Inhalt, das heißt ein widerspenstiger, schneckenhaft empfindlicher, detaillierter, ist schwer aufzuspüren, zu binden, obgleich er oftmals auf der Straße liegt und zwanglos tut. Inhalte nutzen sich ab, verkleiden sich, stellen sich dumm, nennen sich selbst banal und hoffen dadurch, der peinlichen Behandlung durch Künstlers Hand zu entgehen.
Wenn Künstlers Hand eine Zeitlang gesucht hat, doch leer blieb oder Gefundenem nicht geschickt genug war, schimpft Künstlers Mund über Inhalte, und Künstlers Kopf erinnert sich ureigenster, formaler Fähigkeiten und Qualitäten. »Es kommt nicht auf das Was an, nur auf das Wie. Der Inhalt stört nur, ist Konzession, fürs Publikum, die Kunst will die Form an sich, die Kunst ist zeitlos, muß Raum und Zeit überwinden, hat schon überwunden, nur die im Osten, die machen noch auf sozialen Realismus. Wir aber (inhaltfeindliche Künstler reden meistens in der Mehrzahl) sind uns selbst voraus, der Flug unserer Ideen sprengt tagtäglich und von Berufs wegen alle lästigen Formate.« - Was kann man nicht alles machen, wenn man Phantasie hat. Neue Perspektiven, Konstellationen, Strukturen, Aspekte, Akzente; und alles noch nie dagewesen. Die Maler entdecken die Fläche (als hätte Raffael Löcher in die Leinwand gebohrt), die Lyriker verweisen auf ihr Unterbewußtsein und träumen, wenn auch literarisch ergiebig, nicht ohne Angst, selbst in diesem Metapherneldorado zu Epigonen werden zu können oder, was noch schlimmer wäre, von epigonalen Traum- und Unterbewußtseinsräubern ausgeplündert zu werden. -
Unterdessen liegen die Inhalte, ihrer selbst überdrüssig, nach wie vor auf der Straße und schämen sich ihres Inhaltes.
Ein mißtrauischer Dialog
Die Poeten Pempelfort und Krudewil wandeln auf einer blumenreichen Wiese. Krudewil trägt einen kleinen Koffer und stochert mit einem Stock in den Maulwurfshügeln. Pempelfort bückt sich und pflückt mit ausgemachtesten Bewegungen eine Blume.
PEMPELFORT: Oh, ich habe eine Metapher gefunden.
KRUDEWIL: Du solltest mit deinen botanischen Halbkenntnissen nicht die Lyrik füttern. Außerdem hast du schon wieder aus nur ornamentalen Gründen »Oh« gesagt.
PEMPELFORTdie Blume betrachtend: Wie war es doch? Löwenzahn der Umnachtung? - Nein. Tam tam, taram tamtam. Blüht mir in Wahn und Traum… Auch nicht. - Jetzt hab ich es wieder:
Denn in den Planquadraten des Löwenzahn
Sind schon des Todes Späher verzeichnet. -
Was sagst du nun?
KRUDEWIL: Unter zwei Genitiva in einem Satz tust du es nicht. Mich langweilen diese Wiesenspaziergänge.
PEMPELFORT: Dabei sind sie so ergiebig.
KRUDEWIL: Allenfalls reizt es mich mit diesem Stock…
PEMPELFORT: Es ist ein Nußbaumast.
KRUDEWILwütend: Stock ist Stock, sage ich. Und mit diesem oder einem anderen Knüppel stoße ich in die Maulwurfshügel. - Ich bin ein mißtrauischer Mensch.
PEMPELFORTrezitierend: Nußbaumstock / Maulwurfstod / Sternenstaub / Fiel aufs Brot.
KRUDEWILschlägt mit dem Stock um sich: Schluß jetzt mit dieser Kosmetik. Sternenstaub, Mann im Mond. Und kein einziger Vers, in dem nicht der Tod vergewaltigt wird. Du bist ein Lügner, Pempelfort!
PEMPELFORTmit priesterhaften Handbewegungen: Ich träume gerne. Auf eine unsägliche Weise benimmt mich der Schlaf. Manchmal habe ich das Gefühl…
KRUDEWIL: Du hast vergessen, »irgendwie« zu sagen.
PEMPELFORT: Manchmal habe ich irgendwie das Gefühl, ich weile nur als Gast. Meine Zeit hier gleicht einem Exil; niemand versteht meine Sprache, und nur die Sterne gehorchen meinen Gebärden. Nachts…
KRUDEWIL: Du kennst unsere Vereinbarung. Wir wollten nicht mehr von Träumen reden.
PEMPELFORT: Nur diesen Satz noch. Nachts rufen sie mich. Der Traum ist meine wahre Heimat, ich lebe von diesen Konstellationen aus den Archiven verschütteter Kindheit.
KRUDEWIL: Gestern sagtest du statt Konstellationen Montagen.
PEMPELFORT: Es bleibt sich gleich, Krudewil. Begeistert: Wenn nur die Archive bleiben! Er bückt sich. Schon wieder eine Metapher:
»Ich halte dich mit hellen Händen
Du Pusteblume des Augenblicks.«
KRUDEWIL: Pustekuchen, Feierabend. Ich habe dich durchschaut, Freundchen, ich bin dir auf die Schliche gekommen, ich kenne deinen Speisezettel. Jeden Abend, kurz vor dem Schlafengehen, ißt du, nicht etwa weil es dir schmeckt, drei gehäufte Teller Kartoffelsalat mit Gurken, Zwiebeln und Würstchen. Dann haust du dich in die Falle, legst die Ohren an und schläfst ein. Stimmt’s?
PEMPELFORT: Ja.
KRUDEWIL: Und dann?
PEMPELFORT: Dann träume ich. Schwere Träume, dunkle Träume.
KRUDEWIL: Kein Wunder bei der Kost.
PEMPELFORT: Ich wälze mich von einer Seite auf die andere.
KRUDEWIL: Und bei jeder Drehung fällt ihm etwas Metaphysisches ein.
PEMPELFORT: Und wenn ich dann erwache…
KRUDEWIL: Er erwacht alle zwei Stunden regelmäßig.
PEMPELFORT: Dann zünde ich mein Nachttischlämpchen an.
KRUDEWIL: Vor dem Schlafengehn, den Mund noch voller Kartoffelsalat, hat er den Bleistift schön fein angespitzt.
PEMPELFORT: Man muß gerüstet sein für den Traum. Du darfst nicht spotten, Krudewil. Jeder hat seine Methode. Am Morgen sichte ich dann die Träume. Schließlich ist nicht alles fürs Gedicht geeignet. Du kannst mir schon glauben. Richtig wissenschaftlich geht es dabei zu. Die Träume sind sozusagen nur die Rohprodukte. Es muß ja noch alles ins Versmaß gebracht werden.
KRUDEWIL: Tröste dich, Pempelfort. Eines Tages träumst du mit Endreim, und wenn du erwachst, steht ein Verleger an deinem Bettchen und freut sich außerordentlich, in dir einen hoffnungsvollen, durchaus begabten, natur-, traum-, klangverbundenen Poeten zu begrüßen, der darüber hinaus im Zeichen echtester, legitimster, nachvollziehbarster Schwermut geboren, wenn auch lebensfern, doch nicht lebensfeindlich ist. Darüber hinaus, darüber hinaus… Hunde, die träumen, beißen nicht. - Er entnimmt seinem Handkoffer zwei große Knäuel graue Wolle und Stricknadeln. Hier, zwei glatt, zwei kraus. Wir wollen jetzt nicht mehr von Träumen reden. Wir wollen uns eine neue Muse stricken. Beide stricken.
PEMPELFORT: Wie soll sie denn beschaffen sein?
KRUDEWIL: Grau, mißtrauisch, ohne botanische - Himmels- und Todeskenntnisse, fleißig, doch wortarm in der Erotik und völlig traumlos. - Du weißt, wie ich es mache. - Bevor ich ein Gedicht schreibe, schalte ich dreimal das Licht an und aus. Damit sind alle Wunder entkräftigt. - Du hast eine Masche fallen lassen. Sei vorsichtig, Pempelfort. Unsere neue Muse ist eine akkurate Hausfrau. Ein fehlerhaftes Oberteil würde ihr mißfallen. Sie gäbe uns erbarmungslos den Abschied, ließe sich aufribbeln und von einer Maschine aufs neue stricken.
Pempelfort und Krudewil widmen sich aufmerksam ihrer Handarbeit. - Ende.
Der Phantasie gegenüber
Von Eiern, die als weich gekocht serviert wurden, überzeugt man sich am besten mit dem Löffel. Denn mit dem Frühstück beginnt das Mißtrauen. Und mit dem Mißtrauen stellt sich die Post ein. Warum sollte der Poet jetzt, kurz nach dem Frühstück, da ihm die ersten Inspirationen kommen, leichtgläubig werden? Hellwach sitzt er seiner Phantasie gegenüber und bedenkt alle ihm dargebotenen Sätze und Doppelpunkte mit mürrischem teelöffelhartem Abklopfen. Er will ein Gedicht über eine bestimmte Sorte Drahtzäune schreiben. In Berlin ist es die Firma Lerm & Ludewig, die nicht nur einen großen Teil der Schrebergärten, nein, auch so manche stolze Grunewaldvilla mit einem gleichmäßig engen, rautenförmige Maschen bildenden Drahtnetz umspannt. An jedem dieser Zäune hängen ein, manchmal zwei Schildchen und besagen, daß es die Firma Lerm & Ludewig war.
Unser Poet hat das Gedicht Zeile unter Zeile in seinem Kopf. Auf dem Papier steht die Überschrift: Engmaschige Drahtzäune. - Jetzt löst sich der erste Satz: »Wenn ich an engmaschigen Drahtzäunen vorbeigehe, verberge ich die Hände in den Hosentaschen und stelle mich unmusikalisch.« Befriedigt setzt er den Punkt, wechselt mit dem Federhalter zum nächsten Zeilenanfang, und schon beginnt ein zäher Kampf mit der Tischgenossin, der Phantasie. »So kann man kein Gedicht anfangen«, sagt sie, »das ist zeitlich und lokal zu begrenzt.« Der Kosmos müsse unbedingt einbezogen werden, die motorischen Elemente des geflochtenen Drahtes müßten zum überzeitlichen, übersinnlichen, völlig aufgelösten und zu neuen Werten verschmolzenen Stakkato anschwellen. Auch könne man ohne weiteres vom engmaschigen zum elektrisch geladenen Draht übergehen, sinnbildlich den Stacheldraht streifend, und so zu kühnen Bildern, gewagtesten Assoziationen und einem mit Tod und Schwermut behangenen Ausklang kommen.
Der Poet lehnt sich zurück. Nie hat er einen Stacheldrahtzaun gesehen, an den die Firma Lerm & Ludewig ihr Schildchen gehängt hätte. So leid es ihm tut, so schön das alles klingt, er muß die Gaben zurückweisen und seiner Phantasie mit augenblicklicher Entmündigung drohen, wenn sie nicht bei der Sache, beim engmaschigen Lerm & Ludewig bleiben will. Schließlich ist er doch kein Phantast. Und eine Beweglichkeit des Geistes, die jedem Geldschrankknacker und Heiratsschwindler suspekt wäre, darf ihm nicht genügen. Ein wahrer Poet muß eine solche und unentwegt wuchernde Menge Phantasie haben, daß er auf sie nicht mehr angewiesen ist.
Das Mittagessen bietet Grund genug, vom Papier abzulassen und ein mißlungenes Gedicht aufzugeben. Zwar ist das Blatt voll, nein, mehrere Blätter tragen dieselbe Überschrift. Vieles ist gestrichen, umgestellt, dennoch wuchert der Stacheldraht; eine herrliche Stelle: »Mein Herz ist ein Käse hinter dem Fliegendraht«, mußte mehrmals getilgt werden. Offensichtlich lag sie dem Poeten am Herzen, doch Lerm & Ludewig war dagegen. Er wird es morgen noch einmal versuchen. Gleich nach dem Frühstück, den Teelöffel noch in der Hand, mißtrauisch vor weißem Papier sitzend, wird er den Widerstand spüren, besonders wenn ihm etwas einfällt.
1958
1958
Über das Schreiben von Gedichten
In meinen Gedichten versuche ich, durch überscharfen Realismus faßbare Gegenstände von aller Ideologie zu befreien, sie auseinanderzunehmen, wieder zusammenzusetzen und in Situationen zu bringen, in denen es schwerfällt, das Gesicht zu bewahren, in denen das Feierliche lachen muß, weil die Leichenträger zu ernste Miene machen, als daß man glauben könnte, sie nehmen Anteil.
1959
Juli 1959
Es lebe die Erzählung
Lenzburg, am 13.Juli 1959
Lieber Herr Bender,
Ihr Brief liegt lange bei mir. Auch habe ich ihn mehrmals gelesen und mich an Ihrer Schrift erfreut, allein, aus dem Aufsatz »Es lebe die Erzählung« ist bisher nichts geworden, weil, erstens, eine bevorstehende Polenreise mich von Kopf bis Fuß besetzt hat, weil, zweitens, dieser Aufsatz im Grunde offene Türen einrennen müßte; eine Beschäftigung, die, obgleich schmerzlos, sicher nicht ohne Langeweile ist.
Ich frage mich: Wenn Robbe-Grillet morgen einen geschliffenen Essay veröffentlicht, darin seitenlang behauptet, der Mensch habe keine Nase mehr; muß ich dann, womöglich gleichfalls und seitenlang, die Existenz der menschlichen Nase beweisen und obendrein hochleben lassen? Seit Jahren werden nacheinander die Ölmalerei, der Endreim im Gedicht, der Roman, das Theater, die Kunst überhaupt totgesagt, man scheut sich nicht, dem Fahrrad die Zukunft abzusprechen; daß nun all diese Dinge weiterhin munter am Leben sind, verdanken sie gewiß nicht vorzüglichen Essays, sondern der eigenen vitalen und unersetzlichen Form. Vielleicht aber fällt mir in Polen etwas für Ihre Zeitung ein; zumal mir in Polen leicht etwas einfällt.
Inzwischen habe ich auch den Umbruch hinter mir, bin arbeitslos und genieße das.
1960
November 1960
Wir schreiben in der Bundesrepublik
1. Ich sorge für meine Familie, indem ich zeichne, schreibe und koche. Das Kochen bezahlt mir zwar weder der Rundfunk noch ein Verlag, doch fällt mir zumeist über dem Kochtopf ein, was ich zeichnen, was ich schreiben will. Da meine Zeichnungen und literarischen Werke käuflich zu erwerben sind, lebe ich, je nach Umsatz meiner Produktion, mehr oder weniger gut; zur Zeit kann ich nicht klagen.
2. Da ich alle drei Tätigkeiten nacheinander ausübe, also niemals gleichzeitig koche und schreibe oder links schreibe und rechts zeichne, komme ich schwerlich ins Gedränge, sondern finde zwischendurch noch genügend Zeit, um ins Kino gehen zu können.
November 1960
Das Gelegenheitsgedicht oder Es ist immer noch, frei nach Picasso, verboten, mit dem Piloten zu sprechen
Vortrag auf der Arbeitstagung »Lyrik heute« in Berlin
Wer nur wenige Minuten reden darf, darf auch verallgemeinern. Deshalb steht hier zu Anfang der Satz: Jedes gute Gedicht ist ein Gelegenheitsgedicht; jedes schlechte Gedicht ist ein Gelegenheitsgedicht; nur den sogenannten Laborgedichten ist die gesunde Mittellage vorbehalten: Nie sind sie ganz gut, nie ganz und gar schlecht, aber immer begabt und interessant.
Der das hier sagt und behauptet, zählt sich zu den Gelegenheitsdichtern, und sein Ärgernis sind Dichter, die ihre Gelegenheit nicht abwarten können, die Herren im Labor der Träume, die Herren mit den reichhaltigen Auszügen aus Wörterbüchern, die Herren - es können auch Damen sein -, die von früh bis spät mit der Sprache, dem Sprachmaterial arbeiten, die geschwätzig und als Dauermieter nahe dem Schweigen wohnen, immer dem Unsäglichen auf der Spur sind, die ihre Gedichte Texte nennen, die nicht Dichter genannt werden wollen, sondern ich weiß nicht was, die - sagen wir es - ohne Gelegenheit sind, ohne Muse.
Während der Labordichter seitenlang seine Methoden beschreiben kann, oftmals als Essayist Außerordentliches leistet, wird es dem Gelegenheitsdichter schwerfallen, seiner Methode eine ernste Erklärung zu liefern; denn sagte ich als eingefleischter Gelegenheitslyriker: Sobald ich das Gefühl habe, es liegt wieder mal ein Gedicht in der Luft, vermeide ich streng, Hülsenfrüchte zu essen, und fahre oft, obgleich mich das teuer zu stehen kommt, sinnlos sinnvoll mit dem Taxi, damit sich jenes in der Luft liegende Gedicht löst - wird der Labordichter mokant die Augenbraue heben und mich einen altmodischen, sogar reaktionären Esoteriker nennen, der an den Einfluß von Hülsenfrüchten, Taxifahrten, mithin an einen Individualismus glaubt, den er, der Labordichter, mittels konsequenter Kleinschreibung und verdienstvoller Tilgung aller Hauptwörter - sein Kollege tilgte nur die Verhältniswörter - schon seit langem und noch vor XYZ überwunden hat.
Dennoch lockt es mich, einige Kniffe des Gelegenheitsdichters zu verraten. Da es sich nicht um Laborgeheimnisse, also um Nachahmbares handelt, kann ich getrost offenherzig sein; denn meine Gelegenheiten sind nicht die Gelegenheiten eines anderen Gelegenheitsdichters. Wenn also ein Gedicht in der Luft liegt und ich ahne, diesmal will sie, nämlich die Muse, mich mit etwas Fünfstrophigem, Dreizeiligem heimsuchen, helfen mir weder der Verzicht auf Hülsenfrüchte noch unmäßiges Taxifahren, dann hilft nur eines: grüne Heringe kaufen, ausnehmen, braten, in Essig einlegen, Einladungen zu Leuten, die gerne über elektronische Musik reden, ablehnen, dafür Parties besuchen, auf denen Professoren Intrigen spinnen, zuhören, mitspinnen, um Gottes willen nicht mit dem Taxi nach Hause fahren, aber konsequent ohne Kopfkissen schlafen. Freilich hilft diese Methode nicht immer. Einmal, ich muß es gestehen, verhalf mir die krasse Umkehrung - ich kaufte einen halben Schweinekopf, machte Schweinekopfsülze, sprach mit Leuten über elektronische Musik, ging Professoren und ihren Intrigen aus dem Wege, fuhr tolldreist mit dem Taxi nach Hause, schlief auf zwei Kopfkissen - zu einem fünfstrophigen dreizeiligen Gedicht, das inzwischen in die Literaturgeschichte eingegangen ist.
In der Hoffnung, daß Sie meinen eigentlich simplen Ausführungen folgen können, verrate ich Ihnen jetzt den Trick mit dem Vierzeiler. Er ist das typische, das Urgelegenheitsgedicht. Am Anfang steht immer ein Erlebnis; es muß kein großes sein. So ging ich zum Schneider, um mir für einen Anzug Maß nehmen zu lassen. Der Schneider nahm Maß und fragte mich: »Tragen Sie links oder rechts?« Ich log und sagte: »Links.« Kaum hatte ich das Schneideratelier verlassen, war froh, daß mich der Schneidermeister nicht erwischt hatte, da roch ich es und gestand mir ein: Es liegt ein Gedicht, und wenn mich nicht alles täuscht, ein Vierzeiler in der Luft. So ziemlich vier Wochen brauchte es, bis die Wolke sich entlud und der Vierzeiler niederkam. Ich holte den Anzug ab und siehe: Trotz lügnerischer Angabe saß er gut, die Lüge war sozusagen gegenstandslos geworden, ich mußte nur noch, wie ich es immer kurz vor der Niederkunft eines Vierzeilers tue, einem Freund, der mir seit nunmehr acht Jahren zwanzig Mark schuldet, die übliche mahnende, vierzeilige Postkarte schreiben: Und schon warf ich - die Postkarte war noch nicht trocken - Überschrift und vier Zeilen aufs vorher bereitgelegte Papier:
Die Lüge
Ihre rechte Schulter hängt,
sagte mein Schneider.
Weil ich rechts die Schultasche trug,
sagte ich und errötete.
Ich muß zugeben, daß man diesen Vierzeiler kein modernes Gedicht nennen kann. Wenn ich mich auch damit abgefunden habe, altmodisch und nur mit den üblichen Dimensionen ausgestattet, auf Gelegenheiten warten zu müssen, beneide ich dennoch, besonders dann, wenn in meiner unmittelbaren Nähe wieder mal ein Gedicht in der Luft liegt, aber keine Anstalten macht, jenen Labordichter, der nicht von Gelegenheit zu Gelegenheit warten muß, der nicht wie ich dreimal in der Woche mit ungeschälten Erbsen in den Schuhen den Hohenzollerndamm bis zum bitteren Ende hinunterlaufen muß, weil das Laufen auf ungeschälten Erbsen jene Muse erfreut, die meine Gelegenheiten fördert. Nein, der Labordichter sitzt erbsenlos, mit kleingeschriebenen Hausschuhen in seinem Labor, hat Max Bense im Rücken, die Zettelkästchen griffbereit und geht zwanglos mit immer bereitem Sprachmaterial um, spottet aller Gelegenheit, montiert und verhackstückt Beliebiges und Botanisches, tut das mit Ernst, Selbstkritik und Fleiß, weiß nach seinem Achtstundentag - sofern man ihm, dem Zeitaufheber, von einem Achtstundentag sprechen kann -, was er getan hat: Er hat experimentiert, und morgen darf er weiter experimentieren.
Bei allem Neid bin ich dem Labordichter - es sei zugegeben - dankbar. Nimmt er mir doch Arbeit ab, indem er recht hübsche Versuche auf Gebieten anstellt, die auch ich, in den Pausen zwischen Gelegenheit und Gelegenheit, beackern müßte, doch, da es ihn, den Labordichter, gibt, nicht beackern muß; frech und epigonal packe ich ihn bei seinen Ergebnissen und verwende, immer hübsch bei Gelegenheit, die Frucht seiner Experimente, indem ich sie mißverstehe.
Nach diesen Ausführungen wird auch der letzte begriffen haben, daß ein Gelegenheitsdichter nicht frei von jeglichem Arbeitsethos ist. Auch ich weiß von Gelegenheiten zu berichten, die keine waren; monatelang liegt kein Gedicht in der Luft, dann schweigt der Gelegenheitsdichter, ohne damit sagen zu wollen, er wohne nahe dem sogenannten Unsäglichen, dem Schweigen.
1961
Februar 1961
Mein Ungedicht
Rudolf Alexander Schröder (geb. 1878):
Deutscher Schwur
Heilig Vaterland
In Gefahren.
Deine Söhne stehn,
Dich zu wahren.
Von Gefahr umringt,
Heilig Vaterland,
Schau, von Waffen blinkt
Jede Hand.
Ob sie dir ins Herz
Grimmig zielen,
Ob dein Erbe sie
Dreist beschielen,
Schwören wir bei Gott
Vor dem Weltgericht:
Deiner Feinde Spott
Wird zunicht.
Nord und Süd entbrennt,
Ost und Westen;
Dennoch wanken nicht
Deine Festen.
Heilig Herz, getrost,
Ob Verrat und Mord
Dräue West und Ost,
Süd und Nord.
Bei den Sternen steht,
Was wir schwören;
Der die Sterne lenkt,
Wird uns hören:
Eh der Fremde dir
Deine Krone raubt,
Deutschland, fallen wir
Haupt bei Haupt.
Heilig Vaterland,
Heb zur Stunde
Kühn dein Angesicht
In die Runde.
Sieh uns all entbrannt
Sohn bei Söhnen stehn:
Du sollst bleiben, Land!
Wir vergehn.
Mein Gedicht wechselt, und wollte ich über »Mein Gedicht« schreiben, müßte ich es mir vermiesen; aber mein »Ungedicht« bleibt, ist nicht kleinzubekommen, es sei denn, es gelingt mir heute: Wer als Dreiunddreißigjähriger vom zehnten bis zum sechzehnten Lebensjahr Gelegenheit hatte, dieses Gedicht anläßlich Morgenfeiern, Weihestunden, beim Fahnehissen, im Zeltlager nahe dem Lagerfeuer, in Jungvolk- und Hitlerjugenduniform nach choralähnlicher Melodie, mit Todesschauern im Rücken oder sonstwo halb zu singen, halb in den Ostwind zu sprechen, wird gewiß heute noch aus unruhigem Schlaf aufschrecken und nicht frei von kaltem Schweiß »Deutschland, fallen wir Haupt bei Haupt« ins stockdunkle Schlafzimmer schwören und sein Eheweib erschrecken.
Dabei ist dieses Gedicht dem abendländischen Kopf unseres christlichen erzabendländischen Rudolf Alexander Schröder entsprungen. Formkühn ist es, frühexpressionistisch - man achte nur auf den gewagten Reim am Ende der dritten Strophe: »Heilig Herz, getrost… Dräue West und Ost…«
Zudem handelt es sich um ein engagiertes Poem, hat seinen realen Hintergrund, denn »Ob Verrat und Mord / Dräue West und Ost, / Süd und Nord« bezieht sich auf die verzwickte Lage Deutschlands während des Ersten Weltkrieges; R. A. Schröder spendete diese Verse, neben anderen, die auch die Front stärken sollten, etwa um 1914.
Insgesamt könnte man das Gedicht perfekt nennen, wäre das Schlußbild der vierten Strophe »Eh der Fremde dir / Deine Krone raubt, / Deutschland, fallen wir / Haupt bei Haupt« dem eingefleischten Humanisten nicht zu dekorativ geraten; damals war die moderne Kriegsführung schon soweit gediehen, daß jenes von R.A. Schröder vorgeschlagene »Haupt-bei-Haupt-Fallen« schwerfallen mußte. Doch nicht nur dem Ersten Weltkrieg schrieb unser aller Wahrer deutschen Geistes diesen Schwur ins feldgraue Poesiealbum; für die Ewigkeit hatte R.A. Schröder geschrieben. Die Nazis nahmen ihn beim Wort: »Du sollst bleiben, Land! / Wir vergehn.«
Weil aber unser Dichter über den Alltäglichkeiten schwebt und einem höheren Gesetz gehorchen mag, auch schlecht und recht die politischen Systeme, Krone, Weimar und Führerstaat, überlebte, dabei immer älter, weiser und gütiger wurde, muß diesem Gedicht noch eine weitere Kraft innewohnen, die solch beängstigende Langlebigkeit speist. Wir gehen nicht fehl, anzunehmen, der üppige Umgang mit »Heilig Vaterland«, mit »Schwören wir bei Gott«, dem prompt folgenden »Weltgericht« und der Hinweis auf die Sterne und den Sternelenker, der für uns Landsleute schon immer ein Ohr gehabt haben muß, habe dem Gedicht »Deutscher Schwur« jenen gottgewollten Unterbau gegeben, der es - um einen Vorschlag zu machen - christlichen Jungmännern, gleich welcher Konfession, heute noch erlaubte, nahe der Zonengrenze, unter einigermaßen ausgesterntem Himmel, mittels Fackeln ins rechte Licht gesetzt, feierlich zu schwören und dem Alptraum meiner Jugendzeit über die nächste politische Runde zu helfen.
Nun frage ich Sie, R.A. Schröder, wie wollen Sie mich, der ich oft und todernst nach Ihren Worten den »Deutschen Schwur« leistete, von eben diesem Schwur, der mir bei unpassendsten Gelegenheiten durchs »Heilig Herz, getrost« hinkt, für alle Zeiten entbinden?
Dieses Gedicht erschien erstmals 1914 in dem Band R.
Mai 1961
Wer könnte uns das Wasser reichen?
Rede auf dem V. Schriftstellerkongreß in Ostberlin
Zuerst etwas Erfreuliches und Verbindendes. Beim Zuhören hat sich bei mir mehr und mehr der Eindruck verstärkt: Dieses Deutschland mag politisch zweigeteilt sein, aber die Sprache als Gemeinsames ist ihm geblieben. Formulierungen wie »wirkliche Kunst«, »echte Kunst«, »echte Kultur«, »der Glaube an das…«, »wir sind stolz auf…«, »der Humanismus…« können auch in Westdeutschland, etwa auf Oberlehrertreffen oder bei den Diskussionen katholischer Jugendlicher, gehört werden.
Dann möchte ich Herrn Bentzien, dem Minister für Kultur, seine Frage beantworten. Herr Bentzien fragt, nachdem er die Errungenschaften dieses Staates auf dem Gebiet der Kultur gerühmt hat: »Wer könnte uns das Wasser reichen?« Diese Frage kann ich konkret mit einigen Namen beantworten. Zeigen Sie Ihren Lesern in diesem Staat Musil, Kafka, die westdeutschen Schriftsteller, französische Schriftsteller, gleich welcher Schule, gleich welcher formalen Entwicklung, gleich, ob Sie sie formalistisch nennen, und Sie werden merken: Es gibt in Westdeutschland, in Frankreich und in England Schriftsteller, die in der Lage sind, Ihnen das Wasser zu reichen.
Jetzt möchte ich direkt Herrn Kant antworten und mit seinem Satz beginnen: »Uwe Johnson will der DDR eins auswischen.« Ich kenne Uwe Johnson. Er wohnt in Westberlin. Ich sehe ihn oft und bin über sein Buch und seinen Weg nach Westberlin gut unterrichtet. Er mußte die Republik verlassen, weil ihm seine Arbeitsmöglichkeiten genommen wurden. Er hat ein Buch eingereicht, das nicht das Gefallen des Aufbau-Verlages fand, und danach wurden ihm alle wirtschaftlichen Möglichkeiten, in der DDR zu existieren, entzogen. Er konnte keine Bücher mehr besprechen, keine Übersetzungen mehr machen. Er mußte den Staat verlassen. Er ist durch kein Flüchtlingslager gegangen, sondern hat, wie er sagt, »seinen Wohnsitz nach Westberlin verlegt«. Was hat er getan, daß man ihn zwingt, diesen Staat zu verlassen? Er hat als Marxist, der er heute noch ist, in einer literarisch gültigen Form, über die man streiten kann - natürlich sind einige Passagen schlechter, andere sind besser -, ein Buch geschrieben, das sich mit den Arbeitern, mit den Menschen in der DDR auseinandersetzt und zeigt, wie diese Menschen dem Staat gegenüberstehen: mehr oder weniger ablehnend, mehr oder weniger positiv. Er hat all diese Dinge aufgegriffen, die eigentlich die Voraussetzung für Prosa bilden. Dieses Buch hat er in einer interessanten, leicht Faulkner entlehnten Manier geschrieben. Warum soll er nicht beeinflußt sein; wir alle haben unsere Väter. Die weitere Entwicklung zeigt, daß Uwe Johnson, als er noch in der DDR war, ein Buch von Melville, »Israel Potter«, übersetzt hat. Es ist jetzt ohne Nennung des Übersetzers in der Sammlung Dieterich herausgekommen. Ich will hierüber nicht viele Worte machen. Das ist eine Schweinerei.
Nun zum Vortrag des Herrn Kant. Es wird gleich zu Anfang - wie ich festzustellen glaube, sehr demagogisch - Enzensberger ein Wort in den Mund gelegt. Kant spricht von der Bereitschaft zum Bürgerkrieg und warnt davor. Aber Enzensberger sieht, nach Herrn Kants Meinung, diese Gefahr und Bereitschaft zum Bürgerkrieg nur in Westdeutschland. Ich glaube, wenn Enzensberger hier wäre, würde er diese Bereitschaft oder Nichtbereitschaft zum Bürgerkrieg, die Gefahr des Bürgerkrieges in beiden Staaten sehen. Das gleiche kann ich von Walser sagen. Wenn Walser sieht, daß der Schriftsteller degradiert worden ist in seiner Bedeutung zu einer Randfigur wie die Topfpflanzen hier am Podium, so ist der Schriftsteller nicht nur in Westdeutschland dazu degradiert, er ist es auch hier.
Den Schluß des Vortrages von Herrn Kant, in dem er darauf hinweist, daß man einen Weg öffnen müßte und ins Gespräch kommen muß, finden wir sehr angenehm. Jetzt müssen aber Vorschläge kommen: Wie können wir ins Gespräch kommen trotz dieser gegensätzlichen Einstellung? Für mich gibt es keinen Staat, hinter den ich mich stelle, vor den ich mich stelle. Mir ist die Demokratie eine Welt, in der ich zwar lebe und die ich bejahe, die ich aber für sehr umstritten und gefährdet halte. Das ist nun einmal das Wesen Demokratie, wie ich sie sehe. Diese Demokratie erlaubt mir aber, meine Bücher zu schreiben und zu veröffentlichen. Keines meiner Bücher, die ich geschrieben habe, hätte ich in diesem Staat veröffentlichen können, und so geht es meinen Kollegen auch.
Was fehlt diesem Staat nach meiner Meinung? Ein Lyriker wie Enzensberger dürfte hier gar nicht den Mund aufmachen, wenn er Bürger der DDR wäre. Natürlich, eine kleine Reise nach Leipzig oder nach Jena darf man machen, bekommt seinen Blumentopf, hält seine Rede, und es wird etwas vorgespielt, die Koexistenz, man besucht sich, es bleibt aber unverbindlich.
Lassen Sie Taten sehen! Geben Sie den Schriftstellern die Freiheit des Wortes! Geben Sie einem Enzensberger in Ihrem Land die Freiheit, die er noch in Westdeutschland hat, obgleich diese Freiheit des Wortes gefährdet ist. Hier ist sie aber gar nicht vorhanden. Mit diesen Worten möchte ich schließen.
Juni 1961
Wer wird dieses Bändchen kaufen?
Wird es jener Kassierer der Berliner Bank sein, der die Menschen vom Dienst hinterm Kassenschalter kennt, sich privat und aus Berufsgründen den Blick bewahrt hat, der montags im »Spiegel« liest, nicht alles glaubt, was geschrieben steht, der den Ulbricht nicht mag und den RIAS abstellt; wird er das Bändchen kaufen, er, der ohnehin seit Jahren das kleinere Übel, die SPD, wählt; wie ich sie wähle, die rührende ungeschickte, die laue brave muffige SPD, die Tante SPD, mein schlechtes Gewissen, mein Ärgernis, meine schwach begründete Hoffnung SPD? Soll ich für ihn, der ohnehin seufzt und sie wählt, seufzen und schreiben: Mein lieber Kassierer der Berliner Bank, der Sie mein Konto wachsen und schwinden sehen, wählen auch Sie diesmal die alte Tante, sie meint es gut mit uns und ist jünger, als sie sich kleidet? Nein, lieber Bankangestellter, Ihnen muß ich die Tante nicht schmackhaft machen. Ich habe gesehen, wie selbstsicher und melancholisch Sie Hundertmarkscheine und Fünfzigmarkscheine auszuzahlen verstehen. Sie kennen alle Wasserzeichen, stellen den RIAS ab, seufzen und werden dieses Bändchen kaufen. Wer aber wird dieses Bändchen nicht kaufen? Wie viele Neuwähler gibt es? Denen will ich ins Ohr kriechen und in jeder Milchbar flüstern: Wählt SPD, und möbelt die alte Tante auf, sonst kommt jener Vormund aus Bayern.
Ich meine den jungen Mann, der Jura studiert, die Studentenzeitung »konkret« liest, ihn, der immerzu und zu allen seinen Freundinnen sagt: »Na, drüben haben sie wenigstens keinen Globke!«
Ich sage zu jener frischausgebildeten Kindergärtnerin, die so stolz ist auf ihr frischgewonnenes Wahlrecht, eigentlich SPD wählen möchte, aber nun, da sie merkt, daß auch ihr Verlobter nach links neigt, störrisch dem alten Rosengärtner das Wort redet, zu ihr, die auf keinen Fall ihrem Verlobten hörig sein will, sage ich: Wählen Sie dennoch SPD. Wie schön ist es, in jungen Jahren dem Verlobten voll und ganz hörig sein zu dürfen.
Und ich versuche jenem katholischen Automechaniker zu beweisen, daß der heilige Franziskus heute nicht mehr die KPD, sondern resignierend die SPD wählen würde.
Und die ganz jungen Snobs meine ich, die der allerchristlichsten Partei ihr atheistisches Stimmchen nur deshalb geben wollen, weil ihre Väter kreislaufgestörte Gewerkschaftsfunktionäre sind. Ein Generationenproblem? Ach, wie veraltet ist euer Snobismus; der wahre Snob wählt nur noch SPD! Weiterhin - und die Höhe meiner Auflagezahlen verpflichtet mich dazu - spreche ich zu allen, die die »Blechtrommel« gelesen oder zumindest gekauft haben. Nicht, daß ich sagen will, Oskar Matzerath wählt SPD, aber sein Sohn und Halbbruder Kurt - Sie erinnern sich? -, ein blasses, inzwischen wahlberechtigtes Bengelchen, hat mir versprochen, wieder fleißig zur Kirche zu gehen und SPD zu wählen; ein Beweis mehr, wie einflußreich Schriftsteller sein können.
Doch nun zu euch, ihr arbeitsamen Klarissinnen, ihr klugen Ursulinen, ihr barmherzigen Vinzentinerinnen. Wie oft habe ich euch mit schwarzer Tusche, mit grauer Kohle gezeichnet und mit kühnen Worten bedichtet. Noch jüngst verkaufte ich ein Blatt, betitelt: »Dreizehn Nonnen mit Regenschirmen«, an einen Säufer, Arzt und Gotteslästerer: Der Mann besserte sich, will konvertieren und SPD wählen. Wie ist es mit euch, meine frommen Musen? Dürft ihr wählen? Ich glaube schon. Ihr habt doch Humor, Nonnenhumor: Schlagt der Äbtissin ein Schnippchen, wählt SPD!
Doch nicht zuletzt: Hochverehrter Herr Bundeskanzler, wäre es nicht an der Zeit, Ihr Lebenswerk zu krönen und jene infame Behauptung vom »Starrsinn des Herrn Adenauer« aus der Welt zu schaffen, indem Sie laut, deutlich und auf dem Fernsehschirm SPD wählen! Haben sich nicht Ihre verläßlichsten Freunde für diese Partei ausgesprochen? Predigt doch Sonntag für Sonntag unser aller Kardinal Frings von der Kanzel des Kölner Domes auf entblößte Häupter herab: »Wahrlich, ich sage euch, wer diesmal nicht SPD wählt, dem soll…« Und die »Frankfurter Allgemeine«? Betreibt dieses Weltblatt nicht seit geraumer Zeit und bis in den Wirtschaftsteil und Wetterbericht hinein offene Werbung für die SPD? Besonders im Literaturteil jener meinungsbildenden Zeitung wird eine zwar erklärliche, dennoch übertriebene Sympathienahme brillant formuliert: Der renommierte Kritiker und Dichter Friedrich Sieburg bespricht nur noch die Bücher jener Autoren, die der SPD nahestehen.
Und nun kann ich nicht anders und muß zu euch sprechen, liebe Landsleute, die ihr in Danzig geboren und mit Mottlauwasser getauft worden seid. Jüngst war ich in Polen und suchte die alte Heimat auf. Gewiß, alles ist fremd geworden, nicht mehr hört man den vertrauten Dialekt; aber die gute alte Ostsee rauschte wie einst und immer schon; und die Radaune raunte; und die Tauben um Sankt Marien flüsterten. Und was rauschte die Ostsee, raunte die Radaune, flüsterten die Tauben: »Birrjer dä Fraien Stadt Danzich!« hörte ich und schrieb mit: »Äs werrd sswar nuscht nitzen, ond nie nech wä ä zurrick kennen inne alte Haimat, wählt abä dänooch os rainem Värjniegen dem Brandt, dem Sozi; wennä och dwatsch is ain besschen ond häd nuscht wie Glumse im Deetz.«
Soweit der Wortlaut der Ostsee, Radaune und Tauben um Sankt Marien. Wie aber soll nun ich begründen, warum ich die Neuwähler, die katholischen Automechaniker, die Söhne der Gewerkschaftsfunktionäre, die Leser meiner Werke, die sanften Nonnen, unseren Herrn Bundeskanzler und meine lieben Landsleute auffordere, die gute alte Tante zu wählen?
Ich könnte mich auf die vorliegenden Parteiprogramme einlassen und die fast gleichlautenden Versprechungen beider zu schnell gewachsener Parteien untersuchen und die Verfasser der Weinpanscherei bezichtigen. Das werden wohl meine Vor- und Nachredner kenntnisreich tun; mir möge vorbehalten bleiben, private Einsichten zu formulieren, etwa: Wählt SPD. Unter diesem Zeichen werdet ihr zwar nicht siegen, aber auch nicht vor die Hunde gehn.
Oder: Wählt schon auf Erden SPD, damit uns im Himmel einst eine SPD-Regierung gewiß sein wird.
Oder: Macht keine Experimente: Franz Josef Strauß ist eines. Oder: Laßt uns SPD wählen, damit uns die SPD nicht verkauft. Oder schließlich: Im Wahlmonat September wird die Sonne im Zeichen der Jungfrau stehen. Vorsicht bei kleinen Geschäften, Redlichkeit und Skepsis legt uns die Jungfrau nahe. Auch Goethe war eine Jungfrau und würde Carlo Schmid wählen. Glaubt seinem Horoskop. Die Sterne lügen nicht. Wählt SPD!
August 1961
Und was können die Schriftsteller tun?
Berlin, am 14.August 1961
An die Vorsitzende des Deutschen Schriftstellerverbandes in der DDR
Verehrte Frau Anna Seghers,