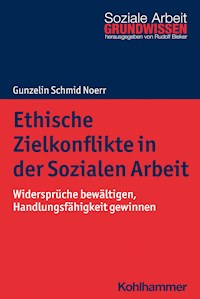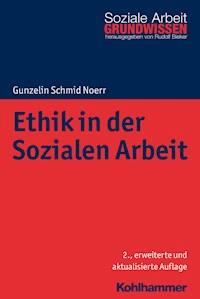
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In der Sozialen Arbeit spielt die Ethik - also die Analyse, Begründung oder auch Kritik von Moral - eine wichtige Rolle, weil Entscheidungen, die Sozialarbeiterinnen treffen, stark in die Lebensführung ihrer Klienten eingreifen können. Sie verstehen ihre Arbeit als Hilfe, aber auch als Kontrolle. Ethisch klärungsbedürftig ist jedoch, wie diese Zielvorstellungen überhaupt zu rechtfertigen sind und inwieweit sie durch die Soziale Arbeit eingelöst werden. Wie lassen sich professionsethische Ansprüche auf den unterschiedlichen Ebenen des individuellen Handelns und der institutionellen Kooperationen praktisch umsetzen? Wie lernt man Moral und wie verhalten sich Moral und Gewalt zueinander? Was können wir uns unter Menschenwürde und einem gelingenden Leben vorstellen? Damit sind Kernfragen einer Ethik in der Sozialen Arbeit angesprochen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
Gunzelin Schmid Noerr, Jg. 1947, wurde 1977 in Philosophie promoviert. 1978 baute er an der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt a. M. das Max-Horkheimer-Archiv auf und leitete es bis 1995. In dieser Zeit edierte er, zusammen mit Alfred Schmidt, die „Gesammelten Schriften und Briefe“ Max Horkheimers in 19 Bänden (Frankfurt a. M. 1985–1996). 1991 wurde er mit der Arbeit über „Das Eingedenken der Natur im Subjekt. Zur Dialektik von Vernunft und Natur in der Kritischen Theorie Horkheimers, Adornos und Marcuses“ (Darmstadt 1990) an der Universität Frankfurt a. M. habilitiert. 1992–2001 übernahm er verschiedene Vertretungsprofessuren für Soziologie und Philosophie an den Universitäten Frankfurt a. M. und Dortmund sowie an der Hochschule Darmstadt. 2002–2015 war er Professor für Sozialphilosophie, Sozialethik und Anthropologie am Fachbereich Sozialwesen der Hochschule Niederrhein, Mönchengladbach.
Schwerpunkte seiner Forschungen und Publikation sind neben der Kritischen Theorie der Gesellschaft u. a. Ethik (insbesondere Angewandte Ethik der Sozialen Arbeit), Kulturtheorie sowie das Verhältnis von Philosophie und Psychoanalyse.
Weitere Buchpublikationen: Sinnlichkeit und Herrschaft. Zur Konzeptualisierung der inneren Natur bei Hegel und Freud, Meisenheim/Glan, 1980. – Gesten aus Begriffen. Konstellationen der Kritischen Theorie, Frankfurt a. M. 1990. – Kultur und Unkultur (Hrsg.), Mönchengladbach 2005. – Geschichte der Ethik. Leipzig 2006. – Geflüchtete Menschen. Ankommen in der Kommune. Theoretische Beiträge und Berichte aus der Praxis (Hrsg. mit Waltraud Meints-Stender), Opladen, Berlin und Toronto 2017.
Gunzelin Schmid Noerr
Ethik in der Sozialen Arbeit
2., erweiterte und überarbeitete Auflage
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
2., erweiterte und überarbeitete Auflage 2018
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-034438-9
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-034439-6
epub: ISBN 978-3-17-034440-2
mobi: ISBN 978-3-17-034441-9
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Vorwort zur Reihe
Mit dem so genannten „Bologna-Prozess“ galt es neu auszutarieren, welches Wissen Studierende der Sozialen Arbeit benötigen, um trotz erheblich verkürzter Ausbildungszeiten auch weiterhin „berufliche Handlungsfähigkeit“ zu erlangen. Die Ergebnisse dieses nicht ganz schmerzfreien Abstimmungs- und Anpassungsprozesses lassen sich heute allerorten in volumigen Handbüchern nachlesen, in denen die neu entwickelten Module detailliert nach Lernzielen, Lehrinhalten, Lehrmethoden und Prüfungsformen beschrieben sind. Eine diskursive Selbstvergewisserung dieses Ausmaßes und dieser Präzision hat es vor Bologna allenfalls im Ausnahmefall gegeben.
Für Studierende bedeutet die Beschränkung der akademischen Grundausbildung auf sechs Semester, eine annähernd gleich große Stofffülle in deutlich verringerter Lernzeit bewältigen zu müssen. Die Erwartungen an das selbstständige Lernen und Vertiefen des Stoffs in den eigenen vier Wänden sind deshalb deutlich gestiegen. Bologna hat das eigene Arbeitszimmer als Lernort gewissermaßen rekultiviert.
Die Idee zu der Reihe, in der das vorliegende Buch erscheint, ist vor dem Hintergrund dieser bildungspolitisch veränderten Rahmenbedingungen entstanden. Die nach und nach erscheinenden Bände sollen in kompakter Form nicht nur unabdingbares Grundwissen für das Studium der Sozialen Arbeit bereitstellen, sondern sich durch ihre Leserfreundlichkeit auch für das Selbststudium Studierender besonders eignen. Die Autor/innen der Reihe verpflichten sich diesem Ziel auf unterschiedliche Weise: durch die lernzielorientierte Begründung der ausgewählten Inhalte, durch die Begrenzung der Stoffmenge auf ein überschaubares Volumen, durch die Verständlichkeit ihrer Sprache, durch Anschaulichkeit und gezielte Theorie-Praxis-Verknüpfungen, nicht zuletzt aber auch durch lese(r) freundliche Gestaltungselemente wie Schaubilder, Unterlegungen und andere Elemente.
Prof. Dr. Rudolf Bieker, Köln
Zu diesem Buch
Jedes zwischenmenschliche Handeln hat einen moralischen Anteil. Denn in ihm drückt sich eine bestimmte Beziehung zur sozialen Mitwelt aus, ein bestimmtes Maß an Wahrnehmung und Achtung Anderer, an Berücksichtigung ihrer Interessen und ihres Wohlergehens, an Schuldigkeit und an Fürsorge. Das Maß des in dieser Hinsicht Wünschenswerten wird als moralischer Wert bezeichnet, die Orientierungsleitlinie des entsprechenden Handelns als moralische Norm. Wenn wir uns über moralische Fragen Klarheit verschaffen, Situationen erklären, Handlungen verstehen und bewerten, betreiben wir Ethik. In diesem Sinn ist Ethik die Reflexion der Moral. Ethische Fragen haben es einerseits mit dem zu tun, was mit guten Gründen erstrebenswert ist, andererseits mit dem normativ Verpflichtenden.
In der Sozialen Arbeit spielt die Ethik vor allem deshalb eine wichtige Rolle, weil Entscheidungen, die Sozialarbeiterinnen treffen, stark in die Lebensführung ihrer Klienten eingreifen können. Wie die professionsethische Verpflichtung des Arztes den Patienten davor schützen soll, dass der Arzt die Grenze ihrer körperlichen Integrität mehr als unbedingt notwendig und nur zu seinem Wohl verletzt, unterliegt auch die Soziale Arbeit der ethischen Verpflichtung, Schaden zu vermeiden und Gutes zu tun. Aber diese Verpflichtung gilt allgemein, nicht nur in der Sozialen Arbeit, und insofern gibt es auch nur eine umfassende Ethik und keine „Ethik der Sozialen Arbeit“ im Sinne eines Systems spezieller Werte und Normen. Wohl aber kann die ethische Orientierung in der Sozialen Arbeit andere Formen annehmen als in anderen Lebensbereichen und Berufstätigkeiten. Deshalb lautet der Titel dieses Buches „Ethik in der Sozialen Arbeit“.
Moralische Vorstellungen werden im Alltag zwar häufig verwendet – wir finden Handlungen richtig oder falsch, akzeptabel oder unakzeptabel, empörend oder bewundernswert usw. –, aber selten als solche thematisiert. Wir verwenden sie eher intuitiv als begrifflich. Wir beurteilen Handlungen oder Zustände als ungerecht oder menschenunwürdig, aber was Gerechtigkeit oder Menschenwürde an sich sind, wissen wir im Alltag kaum zu sagen. Wir verhalten uns ähnlich wie ein Maurer, der eine Wand hochzieht und dabei, ohne Wasserwaage und Metermaß zu benutzen, nur „über den Daumen peilt“.
Das zentrale Thema der Ethik ist das moralisch Gute. Was aber ist das Gute (und das Schlechte) in der Sozialen Arbeit? Endgültig vorbei sind die Zeiten, in denen die Soziale Arbeit an sich als gut, richtig, gerecht oder verdienstvoll angesehen wurde. Deshalb ist heute zu fragen und zu beantworten, ob und wie die Soziale Arbeit in ihrer Alltagspraxis ethischen Maßstäben gerecht wird.
Um diese Frage in konkreten Zusammenhängen überhaupt formulieren zu können, ist es einerseits notwendig, sich über zentrale Begriffe der allgemeinen Ethik zu verständigen: Was ist Moral? Was sind moralische Werte und Normen? Was ist Menschenwürde? usw. Andererseits diese Begriffe auf die Praxis der Sozialen Arbeit zu beziehen. Die ethische Reflexion lebt von der persönlichen Motivation und Bereitschaft der Einzelnen, das zunächst Selbstverständliche, Gewohnte und Alltägliche auf seine Geltung hin zu befragen. Aber sie ist auch nicht nur etwas Persönliches, sondern baut auf Argumenten und Prinzipien auf, die im geschichtlichen Verlauf entwickelt wurden. Philosophiegeschichtliche Rückgriffe müssen jedoch nicht unbedingt in ausdrücklicher Form erfolgen, und so tauchen auch im vorliegenden Buch, das der Einführung in die Thematik dient, Darstellungen von Ansichten oder Theorien aus der Geschichte der Ethik nur ausnahmsweise auf. Im Vordergrund stehen vielmehr konkrete ethische Problemstellungen.
Der Praxisbezug der theoretischen Überlegungen soll auch durch Passagen aus Interviews deutlich werden. Diese wurden von Teilnehmerinnen und Teilnehmern meiner Hochschul-Seminare über die ethischen Grundlagen der Sozialen Arbeit im Laufe der letzten Jahre mit professionellen Praktikern durchgeführt. Sofern es sich dabei um unveröffentlichte Transkriptionen dieser Interviews handelt, werden diese nicht bibliographisch nachgewiesen. Die Interviewauszüge sind selbstverständlich hinsichtlich der Personen und Orte anonymisiert. Die Interviews werden nicht jeweils als ganze interpretiert, vielmehr dienen die Auszüge nur als praxisnahe Illustrationen der theoretischen Fragestellungen. Den Studierenden, die die Interviews durchgeführt haben, und den Praktikern, die die Interviews gegeben haben, danke ich hiermit.
Das Verständnis der Darlegungen soll dadurch erleichtert werden, dass jedem Kapitel eine kurze Vorschau vorangestellt wird, durch die die Leserinnen und Leser erfahren können, was sie inhaltlich erwartet. Längere Begriffserläuterungen oder historische Hintergrundinformationen sind in separaten Textfeldern untergebracht. Am Ende eines jeden Kapitels befindet sich unter der Zwischenüberschrift „Gut zu wissen – gut zu merken“ eine knappe Zusammenfassung.
Auf eine einheitliche Verwendung der männlichen oder weiblichen Form bei der Bezeichnung von Personengruppen wird in diesem Buch verzichtet. Aus stilistischen Gründen konnte ich mich zu einer andauernden Berücksichtigung beider Geschlechter mittels Verdoppelungen oder künstlicher Wortzusammensetzungen nicht durchringen. Die Verwendung von geschlechtssignifikanten Ausdrücken wie „Sozialpädagogin“, „Sozialarbeiter“ und anderen ist der jeweiligen Fallgeschichte angepasst. Sofern dabei, ausdrücklich oder darin mit enthalten, allgemeine Aussagen über die Soziale Arbeit gemacht werden, ist das jeweils andere Geschlecht mit gemeint.
Mönchengladbach, September 2012
Gunzelin Schmid Noerr
Für die zweite Auflage wurden inhaltliche und formale Fehler korrigiert. Außerdem wurden zum Zweck der besseren Benutzbarkeit des Buches ein Personen- und ein Sachregister hinzugefügt.
Frankfurt am Main, April 2018
Gunzelin Schmid Noerr
Inhalt
Vorwort zur Reihe
Zu diesem Buch
1 Soziale Arbeit ohne „Sandalen“
1.1 Vier geläufige, aber fragwürdige Ansichten über das Verhältnis von Sozialer Arbeit und Moralität
1.2 Ethische Reflexion in der Sozialen Arbeit
2 Wozu Ethik in der Sozialen Arbeit?
2.1 Ein Fall aus der Bewährungshilfe: Moralische Verpflichtungen und Verletzungen
2.2 Verankerung der Moral in Persönlichkeit und Kultur
2.3 Von der moralischen Orientierung zur ethischen Reflexion
2.4 Welchen Nutzen hat die Ethik in der Sozialen Arbeit?
3 Was ist Ethik?
3.1 Herkunft und Bedeutung des Ausdrucks „Ethik“
3.2 Moralische Werte und Normen
3.3 Verschiedene Reflexionsweisen der Moral
3.4 Das ethisch Gute
4 Was ist Moral?
4.1 Moral in der Alltagskommunikation
4.2 Ungenauigkeiten und Schwächen der moralischen Grammatik
4.3 Moralische Regeln im Unterschied zu anderen sozialen Regeln
4.4 Muss jeder selbst wissen, was moralisch richtig ist?
5 Deskriptive und normative Ethik – Individualethik und Sozialethik – Strebensethik und Sollensethik
5.1 Aus einem Interview mit einer Praktikerin der Sozialen Arbeit
5.2 Deskriptiv-explanatorische und normative Ethik
5.3 Individualethik und Sozialethik
5.4 Strebensethik und Sollensethik
6 Was ist warum moralisch gut? Grundmodelle der Sollensethik
6.1 Asymmetrie der Macht und deren ethische Begrenzung
6.2 Ethischer Egoismus: Kontraktualismus
6.3 Folgenethik: Utilitarismus
6.4 Gesinnungsethik (1): Deontologische Ethik
6.5 Gesinnungsethik (2): Mitleidsethik
6.6 Verantwortungsethik
7 Professionsethik der Sozialen Arbeit
7.1 Der geschichtliche Ursprung der Berufsethik
7.2 Professionalisierung der Sozialen Arbeit: Vom beruflichen Ethos zur Professionsethik
7.3 Vom Doppelmandat zum Tripelmandat der Sozialen Arbeit
7.4 Formen der Professionsethik
7.5 Die Berufsfeldstruktur der Sozialen Arbeit
7.6 Vier Bereiche der Professionsethik
8 Zur Entwicklung der moralischen Kultur
8.1 Vom Partikularismus zum Universalismus in der Moral
8.2 Soziale Hilfe in archaischen Gesellschaften
8.3 Soziale Hilfe in hochkulturellen Gesellschaften
8.4 Soziale Hilfe in der modernen Gesellschaft
8.5 Drei Wurzeln der sozialen Kultur heute
8.6 Universelle und partikulare Orientierungen: Minimal- und Maximalmoral
9 Wie lernt man Moral?
9.1 Ein Schritt moralischen Lernens
9.2 Mittel und Wege des moralischen Lernens
9.3 Neuronale Grundlagen des moralischen Lernens
9.4 Stufen der moralischen Entwicklung des Individuums
10 Moralskeptische Perspektiven
10.1 Moralfallen
10.2 Moralische Täuschung und Selbsttäuschung
10.3 Moral zwischen Bindung und Selbstbehauptung, Fürsorge und Kampf
11 Moral und Gewalt
11.1 Wie aus Opfern Täter werden
11.2 Tätermoral
11.3 Erosion der moralischen Bindekräfte
12 Individuelle und institutionelle Verantwortung
12.1 Strukturmerkmale der Verantwortung
12.2 Kausale und fürsorgende Verantwortung
12.3 Korporative und kooperative Verantwortung
12.4 Institutionsethik als kollektive Reflexion
13 Was ist Menschenwürde?
13.1 Menschenwürde als sollensethischer Terminalwert
13.2 Die Achtung der Menschenwürde im Selbstverständnis von Praktikerinnen
13.3 Zur Geschichte des Begriffs der Menschenwürde
13.4 Dimensionen der Menschenwürde heute
13.5 Das Menschenwürdegebot im Alltag der Sozialen Arbeit
14 Für einen besser gelingenden Alltag
14.1 Vier mögliche Bedeutungen des „gelingenden Lebens“
14.2 Eine strebensethische Beratung
14.3 Eine Minimaltheorie des gelingenden Lebens
Literatur
Personenregister
Sachregister
1 SOZIALE ARBEIT OHNE „SANDALEN“
Was Sie in diesem Kapitel lernen können
Hat das, was Sozialarbeiterinnen tun, in sich einen besonderen moralischen Wert, oder ist Soziale Arbeit heute in moralischer Hinsicht ein Beruf wie jeder andere? Darüber gehen die Ansichten in der Öffentlichkeit wie auch bei Studierenden und Praktikern der Sozialen Arbeit auseinander. In diesem Kapitel wird gezeigt, dass diese geläufigen Ansichten die eigentliche Aufgabe einer ethischen Reflexion zumeist verfehlen, und worin alternativ dazu die Aufgabe der Ethik besteht.
1.1 Vier geläufige, aber fragwürdige Ansichten über das Verhältnis von Sozialer Arbeit und Moralität
Alle zwei Jahre treffen sich Sozialarbeiter aus aller Welt zu Konferenzen, die von den drei Dachverbänden „International Federation of Social Workers“, „International Association of Schools of Social Work“ und „International Council on Social Welfare“ organisiert werden. Als eine dieser Weltkonferenzen mit mehr als tausend Fachteilnehmerinnen vor einiger Zeit in Deutschland abgehalten wurde, brachte ein Nachrichtenmagazin darüber einen Artikel mit dem Titel „Die Sandalen des Guten. Ortstermin: In München tüfteln Sozialarbeiter an der Veredelung des Menschen“. Warum die Sandalen im Titel?
In dem Bericht wurden viele Vorträge und Workshops zum Elend dieser Welt aufgeführt. Dabei ging es u. a. um Hilfe für die Opfer von Naturkatastrophen und Vergewaltigungen, für HIV-Patienten, Drogenabhängige, Menschen mit Sprachbarrieren und emotionalen Störungen. Thema waren auch Möglichkeiten der Konfliktlösung in Kriegs- und Bürgerkriegsgebieten und bei Vertreibungen: Tibet, Kongo, Naher Osten. „Sozialarbeiter“, hieß es in dem Bericht, „gehen in die Ecken der Welt, in die sonst niemand will, sie sind unentbehrlich, werden lausig bezahlt, sie bringen die Dinge in Ordnung, die unser schönes Erste-Welt-Leben in der Dritten Welt hinterlässt, und man möchte ihnen Glück wünschen, aber dann sieht man die Sandalen. Viele Konferenzteilnehmer tragen Sandalen. Sandalen sind die Besohlung des Weltgewissens“ (Gutsch 2006, 72).
Na und?, mag sich die Leserin und der Leser denken, sagt denn das Schuhwerk etwas über die Qualität der jeweiligen Sozialen Arbeit aus? Aber die „Sandalen“ sind ja symbolisch zu verstehen. Ihre Bedeutung erschließt sich im Kontrast zu den Schuhen der Politiker und Militärs: „Es ist nur leider so, dass man mehr an die Jungs in den harten polierten Schuhen glaubt. Man glaubt eher an Sicherheitskonferenzen, […] an schnelle Eingreiftruppen.“ Währenddessen laufen die Konferenzteilnehmer „von einem Raum in den nächsten, von einem Weltproblem zum anderen. Kinderarmut, sexuelle Gewalt, Drogen, Rassismus. Es hört nie auf. […] Der Mensch ist schlecht, dunkel und verloren. Man kann aber auch sagen, dass es glücklicherweise ein paar Leute gibt, die daran arbeiten, ihn besser zu machen“ (ebd.). Im Allgemeinen lassen sich die Menschen, dieser Darstellung zufolge, allenfalls mit Zwang und Gewalt zur Vernunft bringen. Angesichts dessen erscheinen die Sozialarbeiter und Sozialpädagogen, die von einer heilen Welt träumen, als hoffnungslos naive Möchtegern-Weltverbesserer.
Dieses Bild ist zweifellos eine Karikatur. Aber sie entspricht einer teilweise immer noch verbreiteten Vorstellung davon, was für eigenartig moralselige Menschen doch Sozialarbeiter seien. Vertreten wird diese Ansicht von Leuten, die offenbar davon überzeugt sind, dass das Leben ein Kampf ist, in dem man sich keine Schwächen erlauben darf. Solche Schwächen werden für sie durch den „Sozialarbeiter“ verkörpert. Demnach muss man sich eine weiche, „sozialarbeiterische“ Einstellung verbieten, wenn man in dieser harten Welt bestehen will.
Zwei weitere Beispiele für dieses Bild von Sozialer Arbeit: Als im September 2001 kurz nach den Anschlägen auf das New Yorker World Trade Center in Deutschland einige Politiker und Publizisten in Deutschland vor einer kriegerischen Reaktion darauf warnten, ja überhaupt ein Verstehen (nicht ein Entschuldigen!) der politischen, sozialen, kulturellen, psychischen und geschichtlichen Hintergründe des Terrorismus einforderten, da wurde dies in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als „deutscher Sozialarbeitermodus“ verspottet, dem zufolge man angeblich nur „geeignete Jugendhilfe-Maßnahmen zur Resozialisierung“ der Terroristen durchzuführen habe (Gaschke 2001, 2).
Auf der anderen Seite, und gleichsam spiegelbildlich dazu, beschworen auch deutsche Terroristen selbst das Kontrastbild des Sozialarbeiters, um sich diesem gegenüber zu profilieren. Nachdem RAF-Mitglieder der so genannten dritten Generation einen US-Soldaten erschossen hatten, um mit Hilfe seines Dienstausweises innerhalb eines zugangskontrollierten militärischen Areals eine Autobombe zünden zu können, sahen sie sich der Kritik von ehemaligen Sympathisanten ausgesetzt und verkündeten trotzig: „Wir haben nicht diesen verklärten, sozialarbeiterischen Blick“ (zit. in: Bönisch;Sontheimer 2007, 68).
Ist Moral insgesamt, wie ein bekannter Liedermacher einmal in der Frankfurter Rundschau provokatorisch schrieb, nur etwas für die „weiblich-süß-weiche Kinder-Küchen-und Kirchen-Welt“, während in der „männlich-herb-rauen Berufswelt“ Eigennutz, Ellbogen, ja Betrug die wichtigsten Tugenden sind? Produziert „die Moral das Kanonenfutter fürs Kapital“, während „das Kapital unermüdlich Anlässe für die moralische Schadensabwicklung“ (Kiesewetter 2007) bietet – wofür dann offenbar die Soziale Arbeit zuständig ist?
Gegenüber der spöttisch-abschätzigen Bewertung eines angeblich vorhandenen sozialarbeiterischen Moralismus kann man aber auch darauf beharren, dass es (wie der „Sandalen“-Autor sich am Ende zu sagen erlaubte) doch immerhin erfreulich ist, dass Menschen sich für andere einsetzen. Tun denn Sozialarbeiterinnen nicht tatsächlich „Gutes“ in dem Sinn, dass sie anderen Menschen bei ernsthafter Gefährdung ihrer Lebensqualität beistehen? Leisten sie nicht Hilfe bei sozialen Problemlagen, denen die Betroffenen sonst weitgehend schutzlos ausgeliefert wären? Sind nicht soziale Benachteiligung, Gewalt und Gewalterfahrung, Sucht, Krankheit, Wohnungs- oder Arbeitslosigkeit als Problembereiche, mit denen es die Soziale Arbeit zu tun hat, auf selbstverständliche Weise das „Schlechte“, durch das die Soziale Arbeit selbst als etwas „Gutes“ ausgewiesen ist?
Wenn man derartiges von anderen Menschen im Alltagsleben berichten kann, zum Beispiel von einer Zahnärztin, die einmal in der Woche, an ihrem freien Nachmittag, in einem kirchlichen Gemeinderaum auf eigene Kosten nicht krankenversicherte Wohnsitzlose behandelt (vgl. Billerbeck 2001), oder von einer anderen, die ehrenamtlich in einem Hospiz Sterbende betreut, oder von einer weiteren, die Kindern von in Vollzeit arbeitenden Eltern nachmittags bei den Hausaufgaben hilft, oder schließlich von den vielen, die Geld in einer für sie spürbaren Höhe an Bedürftige spenden, dann bewerten wir im Alltag solche Einstellungen, Handlungen oder Menschen als moralisch sehr achtbar. Wenn nun Sozialarbeiter Ähnliches von Berufs wegen tun, dann besteht der Unterschied, so könnte man zunächst einmal sagen, weniger im Resultat als in dem „Von-Berufs-Wegen“. Ist also Soziale Arbeit allein auf Grund ihrer Zielsetzung und ihrer Ergebnisse ebenso moralisch achtbar?
In den vergangenen Jahrhunderten vor der staatlichen Institutionalisierung der Sozialen Arbeit war die Fürsorge für Arme, Kranke, Verletzte, Behinderte, Wohnsitzlose, Bettler, Aussätzige, Ausgestoßene davon abhängig gewesen, ob sich Andere von diesen Schicksalen rühren und Barmherzigkeit walten ließen. Auch die öffentliche Armenpflege wurde von ehrenamtlich Tätigen besorgt, bis dann – in Deutschland etwa seit 1910 – eigens dafür eingestellte und kommunal bezahlte Bedienstete sich der Menschen in besonderen Notlagen anzunehmen begannen. Dabei ist aber fast nur noch Historikern bekannt, dass mit den in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, zur Zeit der Industriellen Revolution, eingeführten Absicherungen gegen Krankheit, Armut und Arbeitslosigkeit in erster Linie der politische Zweck verfolgt wurde, die öffentliche Ordnung zu sichern und mögliche soziale Unruhen einzudämmen.
Im allgemeinen Bewusstsein geblieben ist dagegen das persönliche Engagement der Pioniere der Sozialen Arbeit und ihrer Mitarbeiter für die damaligen Modernisierungsverlierer, die verwahrlosten Jugendlichen, die Landflüchtigen, die Armen und Kranken. So zehrt der moralische Ruf der heutigen professionellen Sozialen Arbeit teilweise immer noch von ihrer privaten und kirchlichen Vorgeschichte. Man sieht diese Profession als eine „moralische“ (Pantucek/Vyslouzil 1999) an.
Bisher war von zwei Sichtweisen auf die Soziale Arbeit die Rede:
a) von einer, in der die angebliche Naivität eines moralischen Einspruchs gegenüber den Übeln der Welt belächelt wird, und
b) von einer anderen, in der die fürsorgende und emanzipatorische Tätigkeit der Sozialen Arbeit von sich aus als Grund ihrer moralischen Wertschätzung gilt.
Beide aber sind offensichtlich unzureichend und erfassen nicht die spezifisch moralische Dimension der Sozialen Arbeit: die erste, weil sie Moralität mit unaufgeklärter Naivität gleichsetzt, die zweite, weil sie den Unterschied zwischen der Moral des alltäglichen Handelns und der des professionellen sozialarbeiterischen Handelns vernachlässigt. Wenn überhaupt Moral keine bloße Illusion ist, kann sie nicht in Realitätsangepasstheit aufgehen, aber ebenso wenig auf Realitätssinn verzichten. Und dieser Realitätssinn besteht im Rahmen der professionellen Sozialen Arbeit nicht nur in Alltagserfahrung, sondern lässt sich theoretisch und methodisch absichern.
Über die tatsächlich in der Bevölkerung heute am meisten verbreiteten Einschätzungen der Sozialen Arbeit gibt eine Umfrage Auskunft, die vom Deutschen Berufsverband für Soziale Arbeit in Auftrag gegeben wurde. Erkundet werden sollten „Stellenwert und Funktionen der Sozialen Arbeit im Bewusstsein der Bevölkerung in Deutschland“ (DBSH 1998). Hier kommt
c) eine weitere Meinung über den Wert der Sozialen Arbeit zum Vorschein, der besonders stark an der sozialen Problemlösung orientiert ist.
Die Ergebnisse dieser Umfrage beziehen sich nicht schlicht und einfach auf „die deutsche Bevölkerung“, vielmehr wird zwischen vier Bevölkerungsgruppen bzw. sozialen Milieus mit unterschiedlichen Werthaltungen unterschieden: zwischen einem „konservativen“ und einem „progressiven“ sowie zwischen einem konsummaterialistisch „außengerichteten“ und einem postmaterialistisch-idealistisch „innengerichteten“ Milieu. Dabei zeigt sich, dass eher progressiv eingestellte und innengerichtete Bevölkerungsteile die Soziale Arbeit vor allem deshalb wertschätzen, weil sie sie als Beitrag zur Lösung drängender gesellschaftlicher Probleme ansehen, während in konservativen und außengerichteten Milieus eher der individuelle Bezug von Hilfeangeboten in prekären Lebenssituationen gewürdigt wird. Hier wird deutlich, wie sich die jeweils eigenen Werthaltungen der Bevölkerung in der Bewertung der Sozialen Arbeit wiederfinden.
Immer noch wird der Hilfeaspekt der Sozialen Arbeit hoch geschätzt, aber noch wichtiger wird offenbar die Ansicht, dass die Soziale Arbeit für die Allgemeinheit nützlich ist, weil sie dabei hilft, soziale Konflikte und deren Folgen wie zum Beispiel Kriminalität zu vermeiden und die Folgen des wirtschaftlichen Konkurrenzkampfes in der Gesellschaft zu mildern. Daraus lässt sich der Schluss ziehen, „dass Soziale Arbeit ihre Erfolge und ihre gesellschaftliche Funktion über moralische und ethische Ansprüche hinaus gegenüber der Gesellschaft deutlicher machen muss als bisher“ (DBSH 1998, 5). Diese Funktion des Nutzens der sozialen Konfliktentschärfung wird der Sozialen Arbeit, der Umfrage zufolge, im gleichen Maße (nämlich nach der Ansicht von fast zwei Dritteln der Befragten) zugeschrieben wie einer „starken Wirtschaft“.
Der im Prinzip anerkannte moralische Wert der Sozialen Arbeit wird nach Ansicht von etwa einem Drittel bis der Hälfte der Befragten (vor allem aus dem konservativ-konsummaterialistischen Milieu) dadurch gemindert, dass es nach ihrer Ansicht unter den Hilfeempfängern allzu viele „Simulanten und Faulpelze“ gebe (in diesem Sinn unterschied man im 19. Jahrhundert zwischen denjenigen Notleidenden, die der Hilfe für „würdig“, und denen, die ihrer für „unwürdig“ erachtet wurden). „Beachtenswert ist, dass Soziale Arbeit häufig von denen kritischer gesehen wird, die selbst eher in die Lage kommen könnten, entsprechende Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen“ (DBSH 1998, 9). Dahinter stecken offenbar Motive der Wahrung von Selbstwertgefühlen und der Abgrenzung nach „unten“. Zugleich erkennen zwei Drittel der Befragten an, dass Sozialarbeiter wichtige Ansprechpartner für sozial Schwache und Ausgegrenzte seien und dass der Einsatz für deren Sache bewundernswert sei. Prägend für die Wertschätzung der Sozialen Arbeit ist dabei aber weniger die von ihr geleistete individuelle Hilfe als vielmehr ihr präventiver Nutzen für den sozialen Frieden.
Gegenüber den spöttisch abwertenden wie auch den moralisch aufwertenden Ansichten über Soziale Arbeit scheint heute also eher ein nüchterner Blick auf den gesellschaftlichen Nutzen verbreitet zu sein, wie er sich in der entsprechenden dritten Sichtweise ausdrückt. Kann man diesen Nutzen immerhin noch als eine Art sozialethischer Rechtfertigung der Sozialen Arbeit verstehen, so wird demgegenüber in einer vierten Ansicht das Moralische an der Sozialen Arbeit eher in den Hintergrund gedrängt. Es handelt sich dabei um den Blick der professionell Tätigen beziehungsweise derer, die diese Profession ergreifen wollen. In deren Auffassung geht es
d) vorwiegend um das Interesse am „Sozialen“, dem man sich stärker als etwa zum Technischen oder Ökonomischen hingezogen fühlt.
Mit diesem Bild von Sozialer Arbeit sind keine emanzipatorisch-politischen Ansprüche verbunden. Das unterscheidet sie von den beiden erstgenannten Bildern, in denen immer noch Motive der „68er“-Zeit nachzuleben scheinen. Schon ein flüchtiger Blick auf die angehenden angeblichen Gutmenschen zeigt: Sozialarbeiterinnen (Studierende wie Praktikerinnen) tragen heute längst keine lila Latzhosen oder Strickkleider mehr, und Rauschebärte oder Sandalen sind in dieser Berufsgruppe nicht häufiger anzutreffen als bei Förstern, Fotografen oder Fond-Managern. Auch ist das Ziel, für das „Gute“ in der Welt einzutreten, indem man das „Schlechte“ zu verstehen und zu bessern versucht, bei heutigen Studierenden der Sozialen Arbeit kein maßgeblicher Grund für die Berufswahl. An erster Stelle wird stattdessen der viel schlichtere, aber auch umfassendere Wunsch geäußert, unmittelbar mit Menschen (statt in der Industrie oder im Handel) alltagsnah zu arbeiten, und dafür nimmt man auch eine tatsächlich oft lausige Bezahlung (wie es im „Sandalen“-Artikel heißt) in Kauf.
In ihrem Studium eignen sich Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter unterschiedliches fachliches Wissen an. Dazu gehören pädagogische, psychologische, soziologische, medizinische, ökonomische und andere Kenntnisse, aus denen die Sozialarbeitswissenschaft, die diese unterschiedlichen Ansätze integriert, die Möglichkeit und Wirksamkeit sozialarbeiterischer Interventionen ableitet. Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, Rechtfertigungen und Zielsetzungen dieses Handelns werden durch weitere Theorien erschlossen, vor allem durch rechtliches Wissen, Politische Theorie und Organisationslehre. Nach dem Ende des Studiums teilen sich dann üblicherweise die Wege. Während die einen ihren methodischen Zugang, angepasst an ihr besonderes Arbeitsfeld, mehr oder weniger auf eine bestimmte Bezugswissenschaft (zum Beispiel Psychologie oder Recht) einengen, verzichten die anderen weitestgehend auf theoretische Orientierungen und verlassen sich vor allem auf ihr berufspraktisches Erfahrungswissen. Gleichermaßen in beiden Fällen scheint das, was Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter tun, auf vielfache Weise festgelegt zu sein. Für jeweils bestimmte Fälle gibt es entsprechende Gesetze und Vorschriften, bewährte Vorgehensweisen und Strategien, eingeübte Verhaltensmuster, Routinen und ein Wissen um typische Verläufe, an denen sie sich orientieren können. Für das berufliche Handeln sind solche verlässlichen Regeln tatsächlich ebenso nützlich wie unerlässlich. Für Ethik und Moral scheint freilich in diesem Bild von Sozialer Arbeit kaum Platz oder Bedarf zu bestehen.
Fassen wir die bisher wiedergegebenen Ansichten zum Verhältnis von Sozialer Arbeit und Ethik noch einmal zusammen. Zu unterscheiden ist eine Außenansicht und eine Innenansicht der Sozialen Arbeit. Nach der Außenansicht ist die Soziale Arbeit eine „moralische Profession“. Je nachdem nun, welche Rolle man der Moral in der Gesellschaft zuerkennt,
a) grenzt man sich gegen die moralische Naivität der Sozialarbeiterinnen ab oder
b) man erkennt ihre moralische Motivation an.
c) In einer dritten, zahlenmäßig inzwischen wohl überwiegenden Ansicht gesteht man der sozialen Arbeit weniger einen moralischen Auftrag als eine soziale Nützlichkeit durch die Entschärfung möglicher Konfliktpotenziale zu.
d) Auch in der Innenansicht der Studierenden der Sozialen Arbeit scheint die Moral eine eher geringere Rolle zu spielen. Hier gilt die Soziale Arbeit in erster Linie als Aufgabe der Kompensation lebenspraktischer Defizite. Man eignet sich die Verfahrensweisen seines künftigen Jobs an, der durch die verschiedensten Vorschriften und Gesetze vielfach geregelt ist, man orientiert sich in seinen Methoden an praktischen Erfahrungen und (eher weniger) an wissenschaftlichen Erkenntnissen und man grenzt sich als professionelle Kraft von eventuell moralisch motivierten Ehrenamtlichen ab.
Jedoch haben alle diese vier Positionen jeweils spezifische Schwächen, die es notwendig machen, weiter zu fragen.
a) Ist es in jedem Fall naiv, dass eine nachhaltige Verbesserung individueller oder sozialer Miseren bei einer Veränderung moralischer Einstellungen anzusetzen hat? Kann es nicht ebenso naiv sein, hier vordergründig auf Macht, Gewalt und Zwang zu vertrauen?
b) Ist es ein besonderes moralisches Verdienst, das als bezahlten Beruf zu leisten, was andere moralisch verdienstvoll in altruistischer Einstellung tun? Auch ist auf moralische Absichten nicht viel zu geben, denn der Wert des konkreten Handelns erweist sich erst in der Verwirklichung der Absichten und in ihren Folgen.
c) Welche moralischen Wertschätzungen liegen dem Ziel der sozialen Reibungslosigkeit zugrunde? Kann es nicht unter Umständen moralisch gerade erforderlich sein, Konfliktpotenziale zu stärken?
d) Welchen Wertvorstellungen und moralischen Normen folgt die Soziale Arbeit, wenn sie bestimmte Verhältnisse als defizitär und andere als erstrebenswert anzieht? Ist ein Begriff wie der der Hilfe rein technisch-funktional zu begreifen, wenn man bedenkt, dass Helfen auch dazu benutzt werden kann, über den Hilfeempfänger Macht auszuüben und ihn in Abhängigkeit zu halten?
Diese Art kritischer Nachfragen nach den jeweils vorausgesetzten Vorstellungen von Moral ist nun genau die, die die ethische Reflexion der Profession Sozialer Arbeit ausmachen. Wichtig zu sehen ist hier, dass die Ethik keineswegs von vorn herein vom Wert und von der Richtigkeit einer Moral ausgeht. Während sie in den Fällen (a), (c) und (d) die moralische Dimension gegenüber ihrer Vernachlässigung zu verteidigen sucht, stellt sie sie im Fall (b) eher in Frage. Es gibt viele ‚Moralen‘ und viele ‚Nicht-Moralen‘, die sich alle mit dem Anschein der Selbstverständlichkeit umgeben, während es die Aufgabe der Ethik ist, nach ihrer Berechtigung zu fragen.
1.2 Ethische Reflexion in der Sozialen Arbeit
Für eine Professionsethik der Sozialen Arbeit ist die Tatsache, dass durch Soziale Arbeit Menschen in professionell bestimmten Notlagen geholfen werden soll, noch keineswegs eine ausreichende ethische Grundlage. Vielmehr werden in ethischen Überlegungen zur Sozialen Arbeit Fragen der folgenden Art zu erörtern sein: Wird das Hilfemotiv durch andersartige Motive oder Folgen des Handelns eventuell zunichte gemacht? Wie verhält es sich mit dem „moralischen und ethischen Anspruch“ an die Soziale Arbeit und ihrer tatsächlichen Wirkung? Wie lässt sich dies auf den unterschiedlichen Ebenen des individuellen Handelns, der institutionellen Kooperationen und der gesellschaftlich-strukturellen Ebene konkretisieren? Wieweit haben die Entscheidungen, die in der Sozialen Arbeit täglich zu treffen sind – jenseits aller moralistisch-illusionsbehafteten „Sandalen des Guten“ –, ein ethisches Gewicht? Welche Rolle spielen ethische Werthaltungen in der Sozialen Arbeit angesichts ihrer heute verbindlichen wissenschaftlichen (psychologischen, juristischen, soziologischen, medizinischen, ökonomischen usw.) Fundierung? Gibt es berufsethische Normen, die die Handlungsmöglichkeiten der sozialarbeiterisch Tätigen gleichsam mit Leitplanken und Stoppschildern begrenzen? Wie ist der von der Allgemeinheit finanzierte Aufwand der Sozialen Arbeit zugunsten der Betroffenen sozialethisch zu rechtfertigen?
Dabei ist im Sinne der zitierten Umfrage davon auszugehen, dass die Beziehung von Sozialer Arbeit und Ethik heute keine mehr ist, die sich von selbst versteht.
Soziale Arbeit ist weder moralisch naiv noch gleichsam automatisch moralisch wirksam. Ebenso wenig ist ihr ethischer Wert auf die Entschärfung sozialer Konflikte zu reduzieren, und schließlich ist sie auch keine moralfreie Sozialtechnik. Die Aufgabe der Ethik ist es nicht, das Gute bloß zu verkünden, sondern vielmehr zu prüfen, ob das Gute wirklich gut ist und unter welchen Bedingungen es seine Qualität verlieren kann.
In der Praxis der Sozialen Arbeit wird der Einsatzpunkt ethischer Überlegungen besonders in solchen Situationen deutlich, in denen alternative Entscheidungen gleichermaßen richtig und falsch erscheinen können. Das hat dann vielleicht zur Folge, dass, wie auch immer man sich entscheidet, ein ungutes Gefühl zurückbleibt. Solche Konfliktsituationen machen deutlich, dass in jeder professionellen Handlungssituation auch persönliche Ansichten und Abwägungen ins Spiel kommen. In jeder Entscheidung, in jeder Handlung drückt sich auch eine bestimmte Grundhaltung, eine Einstellung zum Gegenüber, eine Vorstellung vom Sinn des eigenen Tuns aus. Hierbei geht es nicht allein um die Frage, welche fachlichen Regeln zu befolgen sind, sondern um die eigentlich ethische Frage der persönlichen Verantwortlichkeit des Tuns. Verantwortlichkeit ist gefordert, weil die Soziale Arbeit in nahezu allen ihren Anteilen in das Leben der Betroffenen eingreift.
Dabei geht es nicht darum, bestimmte Lösungsmöglichkeiten solcher Konfliktsituationen als die einzig legitimen vorzuführen. Vielmehr kann eine Einführung in die Professionsethik sinnvollerweise nur das Ziel verfolgen, die Leserinnen und Leser zu einer eigenen ethisch begründeten Urteilsbildung anzuregen und damit deren (immer schon vorausgesetzte) ethische Kompetenz zu erweitern und zu stärken.
Wenn man die Grundidee der Sozialen Arbeit nicht allein als professionelle Lebenshilfe, sondern als Hilfe zur Selbsthilfe bezeichnen kann, dann gilt dies nicht weniger für eine Auseinandersetzung mit der Ethik der Sozialen Arbeit. Auch zu ethischem Wissen und Können kann einem nicht eigentlich von außen verholfen werden, denn das würde dem immanenten Sinn der Ethik, der moralischen Selbstbestimmung und Mündigkeit, zuwiderlaufen. Was Ethiktheorien (und dieses Buch über Ethik) stattdessen leisten sollten, ist gleichsam eine Hilfe zur Selbsthilfe, nämlich eine Hilfestellung zur Entwicklung einer ethischen Selbstorientierung. Diese ist eine notwendige Bedingung für ethisches Handeln, wenn auch keine hinreichende. Eine ethische Haltung, in der die zunächst kognitiven Orientierungen dauerhaft verinnerlicht sind, bedarf darüber hinaus der praktischen Einübung, der Bildung von Gewohnheiten.
Die ethische Selbstbesinnung lebt von der persönlichen Motivation und Bereitschaft der Einzelnen, das zunächst Selbstverständliche, Gewohnte und Alltägliche auf seine Geltung hin zu befragen. Aber sie ist auch nicht nur etwas Persönliches, sondern kann als ethische Reflexion aus einem ein über einen langen Zeitraum gewachsenen Arsenal von Prinzipien und Argumenten schöpfen. Auf dieses begriffliche Instrumentarium muss auch eine Ethik der Sozialen Arbeit zurückgreifen, will sie nicht gleichsam das Rad neu erfinden. Diese Rückgriffe müssen jedoch nicht unbedingt in ausdrücklicher Form erfolgen, und so tauchen auch im vorliegenden Buch, das der Einführung in die Thematik dient, Darstellungen von Theorien oder Theoremen aus der Geschichte der philosophischen Ethik nur ausnahmsweise auf. Im Vordergrund stehen vielmehr konkrete ethische Problemstellungen aus der sozialarbeiterischen Praxis. Die jeweils geeigneten Formen ethischer Reflexion sind auf diese Problemstellungen nicht einfach „anzuwenden“, sondern diesen auch immer wieder neu anzupassen.
Gut zu wissen – gut zu merken
Die Profession der Sozialen Arbeit ist von vornherein weder gegenüber den gesellschaftlich bestimmenden Kräften naiv noch moralisch gerechtfertigt, noch besteht ihr moralischer Wert in ihrer Funktion der sozialen Beruhigung. Auf der anderen Seite ist sie auch nicht moralisch neutral, sondern sie ist grundlegenden Werten des modernen Verständnisses von Individualität und Sozialität verpflichtet. Die Aufgabe der Ethik besteht in der nachhaltigen Prüfung unserer Gefühle und Meinungen über das Richtige und Gute in der Sozialen Arbeit. Ethische Reflexion wirkt, wie Soziale Arbeit, sinnvoll nur als „Hilfe zur Selbsthilfe“.
Literaturempfehlung
Kuhrau-Neumärker, Dorothea (2005): „War das o. k.?“ Moralische Konflikte im Alltag Sozialer Arbeit. Einführung in die Berufsethik. Münster u. a.: Waxmann.
2 WOZU ETHIK IN DER SOZIALEN ARBEIT?
Was Sie in diesem Kapitel lernen können
An einem ausführlicheren Beispiel lernen Sie die Vielfalt moralischer Bezüge im sozialarbeiterischen Handeln kennen. Es wird untersucht, wie es zu verstehen ist, dass wir Moral einerseits als etwas Individuell-Persönliches, andererseits als etwas Sozial-Verbindliches ansehen. Sodann wird gezeigt, wie die ethische Reflexion der Moral bei der lebensgeschichtlich erworbenen Moral ansetzt, um sie auf ihre guten Gründe hin transparent zu machen. Dies gilt auch für eine Sozialarbeitsethik. Worin aber besteht ihr Nutzen, wenn sie sich nicht den jeweils gegebenen Vorstellungen von Nützlichkeit unterwirft?
2.1 Ein Fall aus der Bewährungshilfe: Moralische Verpflichtungen und Verletzungen
Die 18-jährige Jennifer Mertens hat reichlich das genossen, was man üblicherweise eine „schwere Kindheit“ nennt. Diese war geprägt durch den Alkoholismus des Vaters sowie diverse Krankheiten der Mutter und überschattet von häuslicher Gewalt. Als Jennifer mit ihrem Freund in der S-Bahn unterwegs ist, legen sich beide mit einem zwölfjährigen Schüler an. Sie bedrohen und schlagen ihn, dann rauben sie ihm sein Taschengeld und seine teure Lederjacke.
Die Polizei hat die beiden Täter auf Grund von Zeugenaussagen bald ermittelt. Jennifer wird wegen Körperverletzung in Tateinheit mit Raub zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wird. An den Geschädigten muss sie ein Schmerzensgeld zahlen. Dazu erhält sie die Auflagen, den Kontakt zu ihrer Bewährungshelferin zu halten und sich um einen Psychotherapieplatz zu bemühen.
Bei der nun anlaufenden Bewährungshilfe zeigt sich Jennifer wenig kooperativ. Sie gibt zu verstehen, dass sie keinerlei Unterstützung nötig habe und wolle. Zwar kommt sie zu den vereinbarten Terminen mit der Bewährungshelferin, aber es entsteht keine vertrauensvolle Beziehung. Dies ändert sich jedoch nach einigen Wochen, als Jennifer, die bislang noch bei den Eltern wohnte, um Unterstützung bei einer Wohnungssuche bittet. Sie war im Streit von zu Hause ausgezogen und ist nun wohnungslos.
Die Bewährungshelferin hilft Jennifer dabei, einen Antrag auf Kostenübernahme der Unterkunft zu stellen. Diese wird ihr in Verbindung mit einer Regelung über ambulant betreutes Wohnen gewährt. Auf Grund der erfolgreichen Bemühungen der Bewährungshelferin bei der Wohnungsbeschaffung verändert sich das Betreuungsverhältnis deutlich zum Besseren. Die Gespräche über die alltäglichen Probleme Jennifers und ihre weitere Lebensplanung werden intensiver, die Atmosphäre ist fast vertrauensvoll.
Dann aber, nach wenigen Wochen, erfolgt ein Rückschlag: Jennifer kommt mehrmals nicht zu vereinbarten Terminen, sie verringert den Kontakt zur Helferin beim ambulant betreuten Wohnen. Hinweise auf die Folgen dieser Nichteinhaltung der gerichtlichen Auflagen gehen ins Leere. Schließlich zerreißt das gesamte Hilfenetz, bestehend aus betreutem Wohnen, Bewährungshilfe und Jugendamt. Der zuständige Richter hat nun zu entscheiden, wie es mit Jennifer weitergeht.
Eine Studierende der Sozialen Arbeit berichtet diese Fallgeschichte in einer Seminarveranstaltung, in der es um die Reflexion der Erfahrungen im Praxissemester geht. Der Bericht bezieht sich, wie ersichtlich, auf ein Praktikum bei der Bewährungshilfe, einem Fachbereich im Ambulanten Sozialen Dienst der Justiz. In der Seminardiskussion über solche Fallgeschichten geht es vor allem darum, die verschiedenen Aspekte der jeweiligen eigenen beruflichen Rolle zu reflektieren.
Im Zusammenhang der vorliegenden Einführung in die Berufsethik der Sozialen Arbeit soll jedoch von vielen der hier möglichen Nachfragen zum Beispiel rechtlicher oder psychologischer Art abgesehen werden. Vielmehr beschränken wir uns auf ethische Aspekte. Wir suchen einen ersten Zugang zu der Frage, wozu Ethik in der Sozialen Arbeit gebraucht wird, wo die Orte ihres Einsatzes sind. Dazu tragen wir zunächst diejenigen ethischen Anteile zusammen, die die Fallgeschichte aufweist. Die Seminardiskussion über den Fall bringt eine Vielzahl von ihnen an den Tag, und mehr als die einzelnen Teilnehmer zunächst vermutet haben:
• Da ist zunächst die Verletzung elementarer moralischer Regeln der Achtung, die Jennifer gegenüber dem Opfer ihrer Tat begangen hat. Zwar handelt es sich hier vorrangig um rechtliche Regeln, die als gesetzliche Bestimmungen im Strafgesetzbuch festgeschrieben sind, aber die Regeln, die körperliche Unversehrtheit und das persönliche Eigentum eines Anderen zu achten, sind zugleich auch moralische. Es sind universale, in allen Kulturen geltende Regeln des friedlichen Zusammenlebens und der Rücksichtnahme.
• Das wird auch am Ziel der Bewährungshilfe deutlich. Diese soll nicht nur kurzfristig darauf hinwirken, dass die Probandin die Bewährungszeit ohne erneute Straftat verbringt, sondern sie soll die Betroffene auch möglichst nachhaltig in einer straffreien Lebensführung unterstützen und ihre soziale Integration fördern. Eine auf Dauer straffreie Lebensführung setzt aber voraus, dass die Regeln des sozialen Zusammenlebens genügend verinnerlicht werden und damit als moralische Einstellungen gefestigt sind.
• In der Sicht des Opfers der Straftat dient die Strafverfolgung dem Bedürfnis nach Ausgleich des Schadens und Wiederherstellung von Gerechtigkeit. Das Opfer hat einen moralischen Anspruch darauf, dass anerkannt wird, dass ihm Schaden zugefügt wurde. Dabei geht es um die Bewältigung nicht nur physischer, sondern auch psychischer Gewalt, also nicht nur um materielle, sondern auch um psychosoziale Gerechtigkeit.
• In einem umfassenderen und langfristigen Sinn ist aber auch Jennifer ein Opfer, nämlich eines von psychosozial destruktiven Familienverhältnissen, auf Grund derer sie in ihrer kindlichen und jugendlichen Entwicklungsmöglichkeit benachteiligt wurde. Schon der Raub kann möglicherweise als – untauglicher – Versuch der Wiederherstellung von sozialer Gerechtigkeit verstanden werden, als Versuch endlich nicht mehr Opfer zu sein, ihr Geschick selbst in die Hand zu nehmen.
• Indem die Bewährungshilfe darauf abzielt, Jennifer vor einem verhängnisvollen Kreislauf von Strafsanktion, sozialer Ausgrenzung und erneuten Straftaten zu bewahren, versucht sie, auf eine sinnvolle und nachhaltige Weise zum Abbau jener sozialen Ungerechtigkeit und zum Schutz der Gesellschaft vor den Folgen abweichenden Verhaltens beizutragen.
• Die Bewährungshelferin versucht – was ihr allerdings nicht von Anfang an und nur vorübergehend gelingt –, ein Vertrauensverhältnis mit Jennifer herzustellen. Vertrauen ist eine Bedingung dafür, dass überhaupt eine pädagogische Einwirkung stattfinden kann. Aber Vertrauen hat nicht nur ein solches Mittel zum Zweck, sondern darüber hinaus auch Ausdruck und Folge des moralischen Wertes der intersubjektiven Anerkennung. Indem die Bewährungshelferin sich als „Vertraute“ anbietet und ihrerseits der Probandin Vertrauen entgegenbringt, antizipiert sie neben ihrer professionellen Kontrollfunktion eine „normale“ Beziehungsform der moralischen Achtung.
• Diese Anerkennung lässt sich auf Dauer nur als wechselseitige verwirklichen. Der Bereitschaft zur Hilfeleistung muss die Bereitschaft entsprechen, sich helfen zu lassen. Als die letztere (aus Gründen, die wir nicht erfahren) nachlässt, bleibt der Bewährungshelferin offenbar nichts anderes übrig als moralisch an Jennifer zu appellieren, das gegebene Versprechen einzuhalten. Dem moralischen Versprechen entspricht auf juristischer Ebene die Auflage. Wird sie nicht erfüllt, so droht die Sanktion der ursprünglich verhängten, aber ausgesetzten Strafe.
• Zwei hauptsächliche Mittel und Wege stehen der Bewährungshelferin zur Verfügung, um bei Jennifer soziale Konformität zu erzeugen: Kontrolle und Hilfe. Während die Kontrollmaßnahmen eine äußere Überprüfung des Verhaltens darstellen, zielen die Hilfemaßnahmen kurzfristig auf eine Verbesserung der Lebensbedingungen und langfristig auf eine innere Umstrukturierung der Verhaltensmöglichkeiten und -bereitschaften. Aber diese beiden Mittel schließen sich weitgehend aus. Wo Zwang vorherrscht, kann kein Vertrauen entstehen, und wenn Vertrauen entsteht, wirkt Zwang kontraproduktiv.
• Um diesen Widerspruch wenigstens ein Stück weit zu entschärfen, muss die Bewährungshelferin versuchen, eine moralische Grundnorm des Sprechens möglichst zu befolgen, nämlich die, wahrhaftig zu kommunizieren, „mit offenen Karten zu spielen“. Wenn sie von vornherein möglichst klarmachen kann, welche der Gesprächsinhalte sie vertraulich behandeln, und zugleich, unter welchen Verpflichtungen der Informationsweitergabe sie arbeitet, dann kann im Sanktionsfall das Gefühl des Vertrauensbruches vielleicht vermieden werden.
• Die Bewährungshelferin hat bei allen Gesetzen und Vorschriften, die ihr Handeln bestimmen, einen großen Spielraum bei der Frage, wie weit und in welchem Sinne sie sich für die ihr anvertraute Probandin engagiert. Zwar hat diese einen rechtlichen Anspruch auf umfassende Beratung, aber dieser Anspruch ist nicht derart objektiv festgelegt, dass seine Erfüllung ganz unabhängig vom Wohlwollen und von der Einsatzbereitschaft der Bewährungshelferin wäre. Sofern diese sich über das Vorgeschriebene hinaus für die Probandin einsetzt, realisiert sie damit die moralischen Werte der Zuwendung und Fürsorge.
• Die Beziehung von Bewährungshelferin und Probandin ist in ihrer Struktur grundsätzlich asymmetrisch. In einem Zwangskontext wie dem der Bewährungshilfe ist es schwierig, die richtige Balance zwischen Distanz und Nähe zu finden und zu halten. Vom Geschick der Bewährungshelferin im Umgang mit der Probandin, von ihrer fachlichen und sozialen Kompetenz, von ihrer Beurteilung möglicher Fortschritte und von ihrer Informationsweitergabe hängt teilweise das Schicksal der Probandin ab. Sie kann ihre Macht zum Besseren, aber auch zum Schlechteren gebrauchen. Deshalb unterliegt der Gebrauch der Macht ethischen Kriterien.
Die Fallgeschichte der Jennifer Mertens kann in gewisser Weise als typisch für die Soziale Arbeit angesehen werden, auch wenn der Zwangs- und Kontrollaspekt in der Bewährungshilfe ein deutlich größeres Gewicht hat als sonst in der Sozialen Arbeit. Aber zum Beispiel auch die Unterstützung durch eine Flexible Erziehungshilfe, auch die Hausaufgabenhilfe bei der Nachmittagsbetreuung von Kindern enthalten, neben der helfenden Zuwendung, immer auch ein Stück Kontrolle oder Zwang. Hier wie dort ist die Kontrolle, ethisch betrachtet, aber vor allem Mittel zum Zweck, und dieser Zweck liegt in der fördernden Begleitung der Klienten und der Verbesserung ihrer Lebenschancen.
Wir können die Vielzahl von ethisch relevanten Aspekten der vorliegenden Fallgeschichte zu einigen wenigen Bereichen zusammenfassen. Es geht
1. um das Verhalten der Klientin,
2. um das Verhalten der Sozialarbeiterin,
3. um die institutionellen Bedingungen der Klientenbeziehung und
4. um die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.
zu (1) Die Klientin und ihre psychosoziale Problemlage: Die Klientin hat zunächst durch ihr Verhalten andere geschädigt, wurde aber auch selbst geschädigt, das heißt sie ist Täterin, aber auch hilfebedürftiges Opfer. Praktisch geht es nicht zuletzt um die Weiterentwicklung der Moralvorstellung und des moralischen Handelns der Klientin.
zu (2) Die Anforderung an die Bewährungshelferin: Sie steht bei ihrer Arbeit unter der berufsethischen Regel, die ihr zukommende Macht nicht zu missbrauchen, sondern zum Wohl aller Betroffenen auszuüben, in erster Linie aber ihrer Klientin zu helfen.
zu (3) Die institutionellen Bedingungen: Die Begegnungen von Bewährungshelferin und Probandin sind durch die institutionellen Regeln der Justiz und der Bewährungshilfe geprägt. Die durch diesen Rahmen vorgegebenen Mittel und Ziele können und müssen auf ihre ethische Legitimität hin geprüft werden. Insbesondere müssen die Mittel der Kontrolle und der Hilfe, die sich in ihrer Wirkung teilweise behindern, ausbalanciert werden, wobei der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses für nachhaltige Hilfe unabdingbar ist.
zu (4) Der Anspruch der Gesellschaft auf Schutz vor den Folgen kriminellen Verhaltens: Der geschädigte Schüler hat ein Recht darauf, als Opfer anerkannt zu werden, und die Gesellschaft insgesamt ein Interesse an schadloser Öffentlichkeit.
In diesen vier Bereichen sind ethische Fragen jeweils dort bedeutsam, wo der Bestand des menschlichen Lebens und Zusammenlebens betroffen ist. Während die Justiz dazu dient, mit Blick auf die einzelne Tat durch Strafe und Strafandrohung Gesetzeskonformität zu erzwingen, geht der ethische und sozialarbeiterische Blick darüber hinaus auf den Lebenszusammenhang der Täterin als Klientin, um ihr, und indirekt dadurch auch der Gesellschaft, zu einem geordneten Leben zu verhelfen.
Noch weiter verallgemeinert, können wir sagen, dass Moral und Ethik dann ins Spiel kommen, wenn es darum geht, berechtigte von unberechtigten Interessen zu unterscheiden, die Verwirklichung der als unberechtigt erkannten Interessen innerlich zu hemmen und die eigenen als berechtigt anerkannten Bedürfnisse mit denen anderer Menschen auszubalancieren. Dies gilt für das alltägliche Zusammenleben, aber auch für die Sozialarbeiterin, die durch ihr professionelles Handeln auf das Wohlergehen ihrer Klienten und anderer Betroffener positiv oder negativ Einfluss nimmt. Eben dadurch haben ihre Handlungen unvermeidlich auch eine ethische Bedeutung. Die ethische Reflexion dient dann dazu, in ihrem Handeln die Verantwortung für die davon Betroffenen zur Geltung zu bringen.
2.2 Verankerung der Moral in Persönlichkeit und Kultur
Wie soll es nun aber mit Jennifer weitergehen? Wie weit soll ihr die Bewährungshelferin „nachlaufen“? Ist es nicht für alle hilfreicher, dass uneinsichtige Klienten in bestimmten Fällen einen deutlichen „Schuss vor den Bug“ erfahren? Die Diskussionen mit Studierenden über ethische Probleme in der Sozialen Arbeit weisen in der Regel einige Eigentümlichkeiten auf, die dazu beitragen können, die Funktion der Ethik für die Soziale Arbeit weiter zu erläutern.
• Die Studierenden haben in den meisten Fällen eine ausgeprägte Auffassung vom „ethisch richtigen“ Handeln, auch wenn sie fachlich über das jeweilige Arbeitsfeld zunächst noch wenig Bescheid wissen.
• Die Auffassungen lassen sich bis zu einem gewissen Grad durch Gründe und Argumente kritisieren oder verteidigen. Jenseits dessen liegen Grundanschauungen oder persönliche Identitäten, die kaum noch rational zur Disposition gestellt werden (können).
• Die moralischen Auffassungen können inhaltlich in der Gruppe der Diskutanten sehr weit auseinandergehen. Diese Unterschiede betreffen aber eher die Frage, wie bestimmte Grundwerte umgesetzt werden sollen, als die Grundwerte und letzten Handlungsziele selbst wie zum Beispiel den Schutz des Lebens und die Achtung der Persönlichkeit.
Damit rücken die folgenden Besonderheiten des ethischen Wissens und Handelns in den Blick:
• Das Wissen um das „Gute“ an einer Handlung ist weitgehend in der jeweiligen Persönlichkeit verwurzelt, so dass man es nicht eigentlich, wie etwa rechtliches oder ökonomisches Wissen, lernen kann. Vielmehr handelt es sich um ein „praktisches Wissen“, das vor allem durch die Teilnahme an einem sozialen Lebenszusammenhang erworben und verinnerlicht wird.
• Dennoch können wir unser eigenes moralisches Handeln oder das anderer Menschen problematisieren, an Kriterien messen, mit Argumenten begründen und rechtfertigen.
• Indem Lebenszusammenhänge unterschiedlich strukturiert sind, unterschiedliche Traditionen, Bedürfnisse und Überzeugungen zusammenwirken, kommt es auch zu unterschiedlichen ethischen Bewertungen. Hinter unterschiedlichen Bewertungen von Handlungen können aber gleiche Grundwerte stehen. Die Unterschiede beziehen sich dann auf die Auslegung der Grundwerte auf verschiedene Lebenssituationen hin.
Dies ist näher zu erläutern: Die genannten Merkmale des ethischen Wissens hängen eng zusammen. Um über ethische Probleme nachzudenken, müssen wir normalerweise nichts über ethische Theorien wissen. Stattdessen gehen wir immer schon von einem Vorverständnis des moralisch richtigen Handelns aus, das uns mehr oder weniger selbstverständlich ist. Dieses haben wir im Laufe unseres Lebens erworben, es ist ein Teil unserer Persönlichkeit, durch die wir uns von Anderen unterscheiden, aber zugleich auch ein Teil unserer Kultur, der wir angehören und die wir mit Anderen gemeinsam haben. Moralische Einstellungen werden insbesondere während der Kindheit und Jugend ausgebildet. In dieser Phase lernen wir, zwischen „gut“ und „böse“ zu unterscheiden, indem wir das übernehmen, was uns Eltern und andere Autoritäten und Vorbilder vorgeben. Dieser Prozess verläuft nie konfliktfrei, vielmehr als lang andauernde Auseinandersetzung um die Durchsetzung von individuellen Bedürfnissen und sozialen Regeln. Typischerweise in der Adoleszenz stellen wir die so errungenen Überzeugungen wieder in Frage, machen sie uns ausdrücklich zu eigen oder verwerfen sie. Wir finden zunehmend zu unserer eigenen, „persönlichen“ Moralüberzeugung.
Daraus resultieren die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten zwischen den moralischen Einstellungen der Menschen. Einerseits gibt es Unterschiede zwischen den großen und kleineren Kulturkreisen, Milieus und Subkulturen, Geschlechtern und Generationen, also zwischen den verschiedenen Kollektiven, denen die Individuen angehören. Teilweise geht es aber auch um Unterschiede zwischen den verschiedenen individuellen Wertsetzungen. Das jeweils eigene Selbst- und Weltverständnis schlägt sich auch in der persönlichen Auffassung vom moralisch Richtigen nieder. Andererseits haben wir es mit Gemeinsamkeitender individuellen Wert- und Normvorstellungen zu tun, und eben diese gemeinsamen Werte und Normen bilden den Kern einer Kultur. Und darüber hinaus gibt es auch kulturübergreifende Gemeinsamkeiten, die in den universellen Lebensbedingungen und -bedürfnissen der Menschen wurzeln.
Die unterschiedlichen moralischen Auffassungen beziehen sich zumeist weniger auf die Bejahung oder Verneinung ethischer Grundsätze als auf die Art und Weise ihrer Anwendung. Kaum jemand bestreitet zum Beispiel, dass Freiheit, Gleichheit, Solidarität, Gerechtigkeit, Verantwortlichkeit, Fürsorge, Toleranz, Menschenwürde, Respekt, Rücksichtnahme zentrale zu bejahende moralische Werte darstellen. Uneinigkeit besteht aber darüber, was unter Gerechtigkeit, Würde usw. im Einzelfall inhaltlich zu verstehen ist und welches Gewicht man den verschiedenen Werten beimessen sollte, wenn sie im besonderen Fall miteinander konkurrieren. Eine daraus oft gezogene Folgerung lautet, dass jeder für sich selbst entscheiden müsse, welchen moralischen Orientierungen er folgen wolle. Das Problem dabei ist jedoch, dass Moral dann nicht mehr auch als soziale Regelung, sondern nur noch als individueller Lebensentwurf verstanden wird. Das stimmt dann aber nicht mehr mit unserer ebenfalls tief sitzenden Überzeugung von der zwischenmenschlichen Verbindlichkeit und Notwendigkeit der Moral überein.
2.3 Von der moralischen Orientierung zur ethischen Reflexion
Deshalb bleibt die ethische Reflexion bei den kulturellen oder persönlichen Unterschieden der moralischen Gefühle und Ansichten nicht stehen, sondern befragt sie auf ihre Gründe und Gegengründe hin. Sie kann dabei an den Prozess der persönlichen moralischen Entwicklung anknüpfen, der von der Orientierung an Autoritätspersonen hin zu einer eigenen Gewissensbildung, zur Einbeziehung von vernünftigen Erwägungen im Austausch mit Anderen und zur Einsicht wechselseitiger Anerkennung führt. In den unwillkürlich wirkenden moralischen Einstellungen und Gefühlen sind immer auch Wertungen, Überzeugungen, Situationsdeutungen enthalten, die jeweils überprüfbar sind. In diesem Sinne können auch Gefühle richtig oder falsch, angemessen oder unangemessen sein. Ob zum Beispiel eine Empörung über Ungerechtigkeit angemessen ist, kann davon abhängen, ob eine dabei vorausgesetzte Annahme über Benachteiligung zutrifft oder nicht.
Dies gilt nun entsprechend auch für die Reflexion ethischer Probleme in der Sozialen Arbeit. Sozialarbeiter bringen immer schon moralische Gefühle, Ansichten und Urteile, aber auch ethische Kompetenz mit. An dieser alltäglich wirksamen Moral orientieren sie sich in zunächst selbstverständlicher Weise auch in ihrer Profession. Und hier setzt subjektiv auch die Beschäftigung mit der beruflichen Ethik an. Ethische Reflexion ist dann nicht die Anwendung eines Systems von ethischen Normen auf eine davon unabhängige Praxis, sondern zunächst einmal Aufklärung (und Selbstaufklärung) über die jeweils schon praktisch wirksamen moralischen Gefühle und Meinungen in einem nicht alltagspraktischen, sondern berufsspezifischen Zusammenhang. Es geht nicht um eine Anleitung zu einem bestimmten Handeln, das als moralisch einzig richtiges qualifiziert wird, sondern um die ethische Sensibilisierung der Wahrnehmung und Kommunikation und um eine entsprechend umsichtige Urteilsbildung. Diese bezieht sich idealer Weise auf alle moralischen Verhältnisse, wie sie oben am Fall Jennifer Mertens erläutert wurden: das Verhalten der Klientin, das Verhalten der Sozialarbeiterin sowie die gesellschaftlichen und institutionellen Rahmenbedingungen.
Gerade im Berufsfeld der Sozialen Arbeit, in dem Hilfe und Machtausübung sich oft auf eine kaum noch durchschaubare Weise miteinander vermischen, ist es wichtig, die eigenen Überzeugungen gegebenenfalls einer kritischen Überprüfung zu unterziehen. Es genügt nicht, sich einfach vom moralischen „gesunden Menschenverstand“ leiten zu lassen, ebenso wenig, wie dies in fachlichen Fragen der Psychologie, Pädagogik oder Medizin genügt.
2.4 Welchen Nutzen hat die Ethik in der Sozialen Arbeit?
Das heißt aber nicht, dass die Ethik eine in Spezialfelder aufteilbare Disziplin wäre – hier Ethik der Medizin, da Ethik der Technik, dort Ethik der Sozialen Arbeit usw. Vielmehr ist das ethisch Gute in den unterschiedlichen Lebensbereichen und Handlungsfeldern letztlich ein und dasselbe. Die Überschrift dieses Kapitels lautet denn auch nicht „Wozu Ethik der Sozialen Arbeit“, sondern „Wozu Ethik in der Sozialen Arbeit“. Und das „Wozu“ sollte nicht derart missverstanden werden, als gehe es darum, die Ethik den Zwecken der Profession unterzuordnen. Vielmehr ist umgekehrt zu fragen, ob mögliche professionelle Handlungen ethischen Kriterien entsprechen und damit nicht nur fachlich, sondern auch ethisch als zulässig oder nicht zulässig erscheinen. Beispielsweise könnte das Abhören von Telefongesprächen einer Klientin wie Jennifer erweisen, ob ihre Auskünfte gegenüber der Bewährungshelferin wahr sind oder nicht, was wiederum ermöglichen würde, den Sinn weiterer Interventionen besser einschätzen zu können. Dies wäre jedoch eine krasse Verletzung elementarer Persönlichkeitsrechte. Die ethische (wie auch die rechtliche) Reflexion verwiese auf die Unverhältnismäßigkeit und damit auf die Unzulässigkeit einer solchen Handlungsoption.