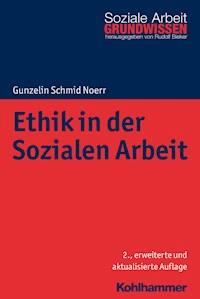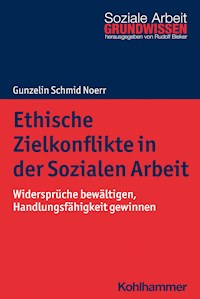
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Hilfe und Kontrolle, Fürsorge und Achtung der Selbstbestimmung - das sind nur zwei der ethischen Zielkonflikte der Sozialen Arbeit. Die Soziale Arbeit folgt bei ihrer Praxis gesetzlichen Regelungen, aber auch den Vorgaben der jeweiligen Einrichtung und den Bedürfnissen der Klientel. Die verschiedenen Anforderungen greifen nicht immer konfliktlos ineinander, sondern wirken in der einen oder anderen Richtung als Zwänge. Um daraus einen fruchtbaren und ethisch zulässigen Ausweg zu finden, ist es erforderlich, die Problematiken zunächst als "ethische Antinomie" von Regeln zu erkennen, um sodann nach praktikablen Lösungen zu suchen. Dieses Buch stellt die häufigsten ethischen Zielkonflikte der Sozialen Arbeit vor, erörtert detailliert die fachlichen Hintergründe und zeigt Wege zur Bewältigung solcher Konflikte auf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
Gunzelin Schmid Noerr, Jg. 1947, wurde 1977 in Philosophie promoviert. 1978 baute er an der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt a. M. das Max-Horkheimer-Archiv auf und leitete es bis 1995. In dieser Zeit edierte er, zusammen mit Alfred Schmidt, die »Gesammelten Schriften und Briefe« Max Horkheimers in 19 Bänden (Frankfurt a. M. 1985–1996). 1991 wurde er mit der Arbeit über »Das Eingedenken der Natur im Subjekt. Zur Dialektik von Vernunft und Natur in der Kritischen Theorie Horkheimers, Adornos und Marcuses« (Darmstadt 1990) an der Universität Frankfurt a. M. habilitiert. 1992–2001 übernahm er verschiedene Vertretungsprofessuren für Soziologie und Philosophie an den Universitäten Frankfurt a. M. und Dortmund sowie an der Hochschule Darmstadt. 2002–2015 war er Professor für Sozialphilosophie, Sozialethik und Anthropologie am Fachbereich Sozialwesen der Hochschule Niederrhein, Mönchengladbach.
Schwerpunkte seiner Forschungen und Publikation sind neben der Kritischen Theorie der Gesellschaft u. a. Ethik (insbesondere Angewandte Ethik der Sozialen Arbeit), Kulturtheorie sowie das Verhältnis von Philosophie und Psychoanalyse.
Weitere Buchpublikationen: Sinnlichkeit und Herrschaft. Zur Konzeptualisierung der inneren Natur bei Hegel und Freud, Meisenheim/Glan, 1980. – Gesten aus Begriffen. Konstellationen der Kritischen Theorie, Frankfurt a. M. 1990. – Kultur und Unkultur (Hrsg.), Mönchengladbach 2005. – Geschichte der Ethik. Leipzig 2006. – Geflüchtete Menschen. Ankommen in der Kommune. Theoretische Beiträge und Berichte aus der Praxis (Hrsg. mit Waltraud Meints-Stender), Opladen, Berlin und Toronto 2017 – Zur Kritik der regressiven Vernunft. Beiträge zur »Dialektik der Aufklärung« (Hrsg. mit Eva-Maria Ziege), Wiesbaden 2019.
Gunzelin Schmid Noerr
Ethische Zielkonflikte in der Sozialen Arbeit
Widersprüche bewältigen, Handlungsfähigkeit gewinnen
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2022
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-030803-9
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-030804-6
epub: ISBN 978-3-17-030805-3
Vorwort zur Reihe
Mit dem so genannten »Bologna-Prozess« galt es neu auszutarieren, welches Wissen Studierende der Sozialen Arbeit benötigen, um trotz erheblich verkürzter Ausbildungszeiten auch weiterhin »berufliche Handlungsfähigkeit« zu erlangen. Die Ergebnisse dieses nicht ganz schmerzfreien Abstimmungs- und Anpassungsprozesses lassen sich heute allerorten in volumigen Handbüchern nachlesen, in denen die neu entwickelten Module detailliert nach Lernzielen, Lehrinhalten, Lehrmethoden und Prüfungsformen beschrieben sind. Eine diskursive Selbstvergewisserung dieses Ausmaßes und dieser Präzision hat es vor Bologna allenfalls im Ausnahmefall gegeben.
Für Studierende bedeutet die Beschränkung der akademischen Grundausbildung auf sechs Semester, eine annähernd gleich große Stofffülle in deutlich verringerter Lernzeit bewältigen zu müssen. Die Erwartungen an das selbständige Lernen und Vertiefen des Stoffs in den eigenen vier Wänden sind deshalb deutlich gestiegen. Bologna hat das eigene Arbeitszimmer als Lernort gewissermaßen rekultiviert.
Die Idee zu der Reihe, in der das vorliegende Buch erscheint, ist vor dem Hintergrund dieser bildungspolitisch veränderten Rahmenbedingungen entstanden. Die nach und nach erscheinenden Bände sollen in kompakter Form nicht nur unabdingbares Grundwissen für das Studium der Sozialen Arbeit bereitstellen, sondern sich durch ihre Leserfreundlichkeit auch für das Selbststudium Studierender besonders eignen. Die Autor/innen der Reihe verpflichten sich diesem Ziel auf unterschiedliche Weise: durch die lernzielorientierte Begründung der ausgewählten Inhalte, durch die Begrenzung der Stoffmenge auf ein überschaubares Volumen, durch die Verständlichkeit ihrer Sprache, durch Anschaulichkeit und gezielte Theorie-Praxis-Verknüpfungen, nicht zuletzt aber auch durch lese(r)-freundliche Gestaltungselemente wie Schaubilder, Unterlegungen und andere Elemente.
Prof. Dr. Rudolf Bieker, Köln
Zu diesem Buch
»Feldgendarmen kennen immer nur zwei Möglichkeiten.« Mit diesen spöttischen Worten beschreibt Günter Grass in seinem großen Roman Die Blechtrommel (Grass 2009, 21) das Verhalten dieser Ordnungshüter in einer Entscheidungssituation: Im Jahre 1899 verfolgen zwei pommersche Feldgendarmen den flüchtenden Brandstifter Joseph Koljaiczek. Am Rande eines Ackers treffen sie auf die vor einem Kartoffelfeuer hockende Bäuerin Anna Bronski. Sie fragen sie nach dem Verbleib des Flüchtenden. Anna weist in Richtung des nächsten Dorfes. Nachdem die Verfolger den Verfolgten nicht in der Nähe des Ackers finden, machen sie sich schließlich in Richtung des Dorfes davon. Joseph aber hat sich – dies war die von den Gendarmen nicht erkannte dritte Möglichkeit – unter Annas weiten Röcken versteckt, wo er mit dieser ohne weitere Umstände das Kind Agnes, die spätere Mutter des Ich-Erzählers, zeugt.
Die Episode bezeichnet bildhaft das Thema des vorliegenden Buches: Zwei Möglichkeiten, sich zu verhalten, liegen auf der Hand. Wenn man die eine realisiert, ist man in Gefahr, die andere aus dem Blick zu verlieren. Soweit scheint die Sache klar zu sein. Der amerikanische Journalist und Publizist Walter Lippmann hat sie, wie Stephen Toulmin berichtet, zugespitzt so formuliert: »Zu jedem menschlichen Problem gibt es eine Lösung, die einfach, sauber und falsch ist« (Toulmin 1991, 321). Grass’ Gendarmen laufen einer solchen einfachen, sauberen und falschen Lösung ihres Problems hinterher. Daraus folgt: Nicht nur das wechselseitige Für und Wider ist gut zu überlegen, sondern auch, wie vielleicht eine dritte Option aussehen könnte. Denn diese könnte die eigentlich fruchtbare sein.
Auch in der Sozialen Arbeit kennt man das Gefühl gut, sich in einem Spannungsfeld der Interessen und Handlungsoptionen zu bewegen. Vielleicht ist ja die Vorstellung eines Entweder – Oder und eines erlösenden Dritten immer noch zu einfach. Dies jedenfalls deutet die Schulsozialarbeiterin Johanna Voss in einem der hier verwendeten Interviews an:
»Man hat den einzelnen Schüler, die Eltern, die Klasse, die Lehrer, und man steht da so zwischen und hat oft so die Aufgabe halt, zu gucken, wie man das miteinander in Verbindung bringt.« Das Resümee ist: »In der Sozialarbeit steht man immer dazwischen.«
Die Soziale Arbeit, als Teil eines umfassenderen sozialpolitischen Konzepts, ist ein Interventionsinstrument der Gesellschaft zum Ausgleich defizitärer Lebenslagen. Sie soll Menschen in Notlagen der verschiedensten Art zu einem jeweils besser gelingenden Alltag verhelfen. Die Soziale Arbeit stellt ein Set von Leistungen bereit, die von Hilfsbedürftigen zum größten Teil in Anspruch genommen werden, weil sie von ihrem sozialen Umfeld dazu gedrängt werden, und zu geringeren Teilen, weil sie nach ihnen freiwillig nachfragen oder weil sie ihnen gesetzlich oktroyiert werden. Gesellschaftliche Hilfeleistung und individueller Hilfebedarf greifen ineinander, freilich nicht als gleichsam gut geölte Maschinerien, sondern oft stockend, als unterschiedliche Instanzen, deren Miteinander kollektiv wie individuell immer wieder ausgehandelt werden muss.
Dementsprechend kann die theoretische Reflexion der Sozialen Arbeit grundsätzlich von zwei Seiten aus erfolgen. Einerseits kann nach ihrer gesellschaftlichen Funktion im Zusammenhang mit anderen gesellschaftlichen Teilbereichen, andererseits nach dem Vollzug der Praxis, der Interaktion zwischen Fachkräften und Klienten gefragt werden. Diese Doppelperspektive von System und Handlung spiegelt eine Zweiteilung der Wissenschaften vom Menschen wider, die entweder gesellschaftliche Strukturen oder individuelle Handlungen – oder auch beides in unterschiedlicher Gewichtung – in den Focus nehmen. Die Soziale Arbeit befindet sich auf der Schnittlinie beider Felder. Zwar ist sie als interaktive Praxis eine personenbezogene Dienstleistung, diese aber ist nicht möglich und kann nicht begriffen werden ohne Rekurs auf ihre gesellschaftlichen Voraussetzungen.
Auch die Ethik lässt sich in diesem Sinn entweder als Sozial- oder als Individualethik betreiben. Die Sozialethik betrachtet nicht unmittelbar die Moralität von Individuen und ihren Handlungen, sondern von sozialen Systemen, insofern sich in ihnen Normierungen des Handelns zu Institutionen verfestigt haben. Die Soziale Arbeit selbst ist eine solche Institution, insofern die Gesellschaft durch die Schaffung von Hilfeagenturen ihre Mitglieder von individuellen moralischen Verpflichtungen gegenüber Notleidenden entlastet. Die Institutionen können sozialethisch zum Beispiel daraufhin untersucht werden, ob sie den eigenen Ansprüchen auf Hilfeleistung oder Gerechtigkeit strukturell entsprechen. Dies ist etwas anderes als die individualethische Frage nach dem moralisch richtigen Verhalten in der Interaktion von Fachkraft und Klientin.
Das ehemals verbreitete Selbstverständnis der Sozialen Arbeit, eine »moralische Profession« zu sein und damit von vornherein »auf der Seite des Guten« zu stehen, ist in der Gegenwart kaum noch vorhanden. Die praktische Soziale Arbeit sieht sich heute eingezwängt zwischen den gesetzlichen Regelungen, den Vorgaben der Einrichtungen, in denen sie tätig ist, den Rahmenbedingungen seitens der Träger der Einrichtungen sowie den Bedürfnissen der Klientel. Sie hat diese verschiedenen Ansprüche unter Kriterien des fachlich Richtigen, des ökonomisch und organisatorisch Effektiven und Effizienten, des rechtlich und ethisch Zulässigen und Gebotenen zu filtern, das Unangemessene vom Angemessenen zu unterscheiden und das letztere praktisch umzusetzen.
Die Erwartungen seitens der Gesellschaft, der Einrichtungen, der Träger oder der Klientel können in besonderen Fällen untereinander und mit der Überzeugung der Fachkraft kollidieren. Diese hat sich dann nach den Maßstäben der Profession zu richten. Trotz sozialstaatlicher Steuerung kann und muss die Soziale Arbeit selbst über ihre Ziele, Mittel und Methoden entscheiden. Als Profession nimmt sie ein gewisses Maß an Autonomie in Anspruch, die sich auf ihr wissenschaftlich begründetes und methodisch bewährtes Wissen sowie ihr praktisch eingeübtes Können stützt. Die Gesellschaft stattet sie mit einem institutionellen Vorschuss an Vertrauen auf ihre Expertise aus. Diesen Vorschuss soll sie durch ihre verantwortungsethischen Grundsätze einlösen, fachliches Handeln sowohl im Sinne des Gemeinwohls als auch im Sinne des Wohls ihrer Klientel einzusetzen.
Die rechtlichen Grundlagen und Rahmenbedingungen der Sozialen Arbeit stellen ein System von Normen dar, aus denen Handlungsanweisungen abzuleiten sind. Anders die professionsethischen Grundsätze. Sie fungieren als Eröffnung eines Reflexionsraums, innerhalb dessen die Fachkräfte Ziele, Mittel, Folgen und Grenzen der Interventionen hinsichtlich ihrer Verantwortbarkeit zu bedenken haben. Die Professionsethik ist Teil der sozialberuflichen Fachlichkeit, weil sich diese auf das Alltagsleben ihrer Klientel richtet, nicht auf ein davon abtrennbares, isoliertes Problem. Diese relative Offenheit des Ethischen hängt mit der Mehrdimensionalität der Problemlagen zusammen, mit denen es die Soziale Arbeit zu tun hat. Dabei geht es um die Bewältigung von Interessenkonflikten, von unterschiedlichen Situationsdeutungen und von widersprüchlichen Anforderungen.
So sehen sich die Fachkräfte der Sozialen Arbeit oft Situationen gegenüber, in denen sie, wie sie sich auch entscheiden, das Gefühl haben, unvermeidlicher Weise etwas falsch zu machen oder zu versäumen. Solche ethischen Zwickmühlen bestehen darin, ein Gutes nur auf Kosten eines anderen Guten verwirklichen zu können. In der alltäglichen beruflichen Praxis kann man aber nicht bei der Analyse solcher Widersprüche stehen bleiben, vielmehr müssen pragmatische Lösungen gefunden werden. Diese können zum Beispiel darin bestehen, sich auf Kompromisse einzulassen oder unerwünschte Nebenfolgen erwünschter Handlungsziele durch weitere Maßnahmen abzuschwächen oder auch einen Weg zu finden, der es erlaubt, einem solchen Dilemma von vornherein auszuweichen.
Um einen fruchtbaren wie ethisch zulässigen Kompromiss oder Ausweg zu finden, ist es zunächst erforderlich, die zugrundeliegende Problematik als »Antinomie« von Regeln oder Gesetzen zu erkennen. »Ethische Antinomien« sind dementsprechend Anforderungen prinzipieller Art, die im strikten Sinn miteinander unvereinbar sind. Dabei wird die logische Unvereinbarkeit von Anforderungen/Regeln/Gesetzen erst unter besonderen situativen Bedingungen zum Problem, die es nicht erlauben, beiden Seiten zugleich gerecht zu werden. So widersprechen sich zum Beispiel die Anforderungen von Mitgefühl und Gerechtigkeit als solche nicht. Wohl aber gibt es Situationen, in denen die eine Anforderung nur zu erfüllen ist, wenn die andere verletzt wird.
Die in der Sozialen Arbeit vielleicht am häufigsten genannte Antinomie dieser Art ist die von Hilfe und Kontrolle. Sie resultiert aus unterschiedlichen Entwicklungssträngen und Auftragslagen, die beiderseits als unverzichtbar gelten. Als sozialstaatliche Institution und im gesellschaftlichen Auftrag dient die Soziale Arbeit der Lösung, Minderung oder Prävention sozialer Konfliktlagen. Das kann bedeuten, das Verhalten von Klienten zu sanktionieren. Zugleich versteht sie sich – und das zunehmend mehr – als Hilfsangebot für Individuen in ernsthaft gefährdeten Lebenslagen. Kontrolle und Hilfe müssen sich nicht ausschließen, können aber durchaus zu unterschiedlichen Anforderungen führen, die nicht zugleich zu verwirklichen sind.
Weitere Antinomien, die sich auf das Handeln der Fachkräfte beziehen, sind zum Beispiel die folgenden:
• Nähe oder Distanz,
• Klientenwohl oder Allgemeinwohl,
• Machtgefälle oder Kommunikation auf Augenhöhe,
• Problemdiagnostik oder intersubjektives Aushandeln,
• Gerechtigkeit oder Mitgefühl,
• Aufrichtigkeit oder Rücksichtnahme,
• Direktivität oder Non-Direktivität,
• Loyalität gegenüber Arbeitgebenden oder gegenüber Klientinnen,
• Gesinnungs- oder Verantwortungsethik.
Gegen die Vergegenwärtigung von Antinomien der Sozialen Arbeit könnte eingewandt werden, dass dadurch Entscheidungen eher blockiert als gefördert werden könnten. Ist es nicht überflüssig, über Alternativen weiter nachzudenken, wenn sie alle unvermeidliche Nachteile haben? Bestünde vielleicht die beste Entscheidung darin, einer Entscheidung möglichst aus dem Weg zu gehen? Jedoch liefe eine solche Enthaltsamkeit den professionsethischen Ansprüchen entgegen, sich der Verantwortung für das eigene Handeln (oder Unterlassen) zu stellen. Gerade wenn Widersprüche nicht praktisch aufzulösen sind, macht ein entsprechendes Problembewusstsein Entscheidungen letztlich umso besser.
Die antinomischen Anforderungen, die in diesem Buch erörtert werden, sind als solche überwiegend keine spezifisch ethischen Begriffe. Von ihnen, wie zum Beispiel von Hilfe und Kontrolle oder von Nähe und Distanz, ist in Praxis und Theorie sonst eher unter psychologischen, soziologischen, kommunikationstheoretischen, sozialhistorischen und anderen Aspekten die Rede. Demgegenüber geht es hier um die ethische Bedeutung dieser Begriffe und der von ihnen bezeichneten Handlungskonstellationen. Diese Bedeutung besteht im geforderten Maß der Achtung Anderer, der Berücksichtigung ihrer legitimen Interessen und ihres Wohlergehens, der Achtsamkeit und Fürsorge.
Die antinomische Struktur der Sozialen Arbeit wurde und wird in der Fachliteratur immer wieder festgestellt. Weniger Aufmerksamkeit wird jedoch im Allgemeinen darauf verwendet, wie diese Struktur von den Fachkräften erlebt wird und wie diese mit ihr umgehen. Um diesen Mangel ein Stück weit auszugleichen, wird in diesem Buch auf entsprechende empirische Materialien in Gestalt von Transkriptionen der Interviews mit Fachkräften zurückgegriffen. Anhand dieser Protokolle werden Bedingungen und Möglichkeiten des sozialberuflichen Handelns angesichts widersprüchlicher Anforderungen reflektiert.
Ein Auswahlkriterium für die Behandlung der Antinomien in diesem Buch war ihre Gewichtung in den Interviews. Diese wurden von Studierenden (in der Regel zu zweit) mit Praktizierenden der Sozialen Arbeit im Rahmen meiner Seminarveranstaltungen zur Praxisforschung der Sozialen Arbeit an der Hochschule Niederrhein, Mönchengladbach, durchgeführt. Das Verfahren war an die Methodik des Narrativen Interviews angelehnt, wobei die Ausgangsfrage auf den persönlichen Umgang mit ethischen Problemen in der alltäglichen Praxis gerichtet war. Die transkribierten Interviews wurden dann in der Großgruppe der Seminarteilnehmenden besprochen. Im Zusammenhang des vorliegenden Buches werden die zitierten Interviews nicht als ganze hinsichtlich ihrer verschiedenen Bedeutungsebenen interpretiert, sondern nur auszugsweise zur praxisnahen Veranschaulichung der theoretischen Fragestellungen verwendet. Als unveröffentlichte Typoskripte werden sie nicht bibliographisch nachgewiesen. Sie sind selbstverständlich anonymisiert, die Namen der Interviewten wurden zufällig gewählt. Mit den Kursivierungen werden betonte Wörter wiedergegeben. Den interviewenden Studierenden wie auch den interviewten Fachkräften sei hiermit herzlich gedankt.
Über die Verwendung von weiblichen und männlichen Sprachformen in öffentlichen Diskursen einschließlich wissenschaftlichen Texten ist viel gestritten worden und wird weiterhin diskutiert. Einerseits sind Bezeichnungen wie »Sozialarbeiter« oder »Klient« Gattungsbegriffe. Sie haben, wie andere Wörter auch, ein grammatisches Geschlecht, das in der großen Mehrzahl ohne Bezug zum biologischen Geschlecht steht. Sie beziehen sich auf Menschen, die durch geschlechtsunabhängige Kriterien wie Beruf oder institutionelle Funktion gekennzeichnet sind. Von daher ließe sich die entsprechende traditionelle Redeweise rechtfertigen, die sich in vielen Fällen aufs männliche generische Geschlecht beschränkt.
Andererseits werden solche Bezeichnungen aber auch als Individualbegriffe verwendet, die in einem gegebenen Zusammenhang bestimmte Individuen mit Bezug auf ihre soziale Funktion bezeichnen. Demgemäß wäre bei der Verwendung der Begriffe das biologische Geschlecht zu berücksichtigen. Da aber Gattungs- und Individualbegriffe sich nur logisch, nicht aber von ihrem Erscheinungsbild her unterscheiden und da im allgemeinen Sprachgebrauch über logische Grenzen hinweg biologische Konnotationen wirkmächtig sind, hat man zur Vermeidung geschlechtsbezogener sozialer Diskriminierung Zeichen wie Binnen-I, Sternchen, Unterstriche, Schrägstriche, Klammern, Doppelpunkte eingeführt. So möchte man biologisch-geschlechts-neutrale Gattungsbegriffe erschaffen. Sie haben nur den Nachteil, stilistisch unschön oder nicht oder nur holpernd aussprechbar zu sein.
Bei der Bezeichnung von Personen durch Gattungsbegriffe verzichte ich deshalb auf eine einheitliche Verwendung der weiblichen oder männlichen Form und verwende stattdessen, sofern nicht neutrale Bezeichnungen möglich sind, zufällig die eine oder andere. Sofern damit allgemeine Aussagen über die Soziale Arbeit und ihre Fachkräfte gemacht werden, ist das jeweils andere Geschlecht mitgemeint. Stehen die Bezeichnungen dagegen als Individualbegriffe im Zusammenhang mit der Erörterung eines bestimmten Falls, dann richten sie sich nach dem biologischen Geschlecht der jeweiligen zitierten Fachkraft.
Gunzelin Schmid Noerr, Frankfurt am Main
Inhalt
Vorwort zur Reihe
Zu diesem Buch
1 Riskante Entscheidungen treffen Werte im Konflikt
1.1 Der Kreidekreis
1.2 Ethik und Moral: Orientierung an berechtigten Bedürfnissen/Interessen Anderer
1.3 Suspendierung und Umdeutung von Moralfragen
1.4 Soziale und ethische Antinomien
1.5 Top-down und Bottom-up
2 Sich ethisch orientieren Allgemeine Ethik und Professionsethik
2.1 Professionsethische Leitlinien
2.2 Verschiedene Formen der Ethik
2.2.1 Deskriptiv-explanatorische, normative und kritische Ethik
2.2.2 Individualethik und Sozialethik
2.2.3 Strebensethik und Sollensethik
2.3 Grundlagen der ethischen Entscheidungsfindung
2.3.1 Motive
2.3.2 Ziele
2.3.3 Mittel
2.3.4 Folgen
2.4 Die Balance der Werte
3 Im Rahmen des Tripelmandats handeln Sollen und Wollen der Klientel
3.1 Das Tripelmandat
3.2 Ziele vereinbaren – sollensethisch
3.2.1 Dritte nicht schädigen
3.2.2 Zusagen einhalten
3.2.3 Erziehungsaufgaben bewältigen
3.2.4 Sollen, was leistbar ist
3.2.5 Sollen ohne moralisches Gefühl
3.3 Ziele vereinbaren – strebensethisch
3.3.1 Gute Beziehung
3.3.2 Zuhören
3.3.3 Toleranz, nicht moralisieren
3.3.4 Akzeptanz
3.3.5 Angstfrei nachdenken können
3.3.6 Suche nach neuen Lebensperspektiven
3.4 Der doppelte ethische Blick
4 Mit Fremdheit umgehen Die andere und die eigene Moral
4.1 Moral im Plural
4.2 Moralische Entwicklungsstufen
4.3 Moralische Interkulturalität
4.3.1 Kulturen und Klienten
4.3.2 Förderung interkultureller Kompetenz
4.4 Anerkennung und Toleranzgrenzen
5 Den Fall (nicht) mit nach Hause nehmen Nähe und Distanz – individualethisch
5.1 Bezug, Qualität und Dimension von Nähe und Distanz
5.2 Lebenswelt und Berufsrolle
5.3 Die Person der Fachkraft als ihr eigenes Handwerkszeug
5.4 Nähe und Distanz im Selbstverhältnis
6 Sich auf Hilfebedürftige einlassen Nähe und Distanz – sozialethisch
6.1 Gefühl und Vernunft
6.2 Ich-orientierte und Du-orientierte Hilfe
6.3 Fürsorge- oder Gerechtigkeitsmoral?
6.4 Hilfe und Kontrolle
7 Selbstverantwortlichkeit und soziale Inklusion fördern Hilfe und Kontrolle
7.1 Der Sozialarbeitspolizist hat ausgedient
7.1.1 Ansichten der Bevölkerung
7.1.2 Handlungsmotive der Klientel
7.1.3 Geschichtliche Konstellationen
7.1.4 Gegenwärtige Konstellation
7.2 Strukturebene und Handlungsebene
7.3 Wann ist Kontrolle gerechtfertigt?
7.4 Das Tripelmandat als ›Checks and Balances‹
7.4.1 Das Klientenmandat
7.4.2 Das sozialstaatliche Mandat
7.4.3 Das Mandat der Profession
7.5 Formen des Umgangs mit der Antinomie von Hilfe und Kontrolle
7.5.1 Der Doppelagent
7.5.2 Der Guerillero
7.5.3 Guter Bulle – böser Bulle
7.5.4 Expertentum oder Diskursivität
8 Für Andere und mit ihnen entscheiden Fürsorge und Achtung der Selbstbestimmung
8.1 Selbstbestimmung als ethischer und rechtlicher Grundwert
8.2 Antinomien der rechtlichen Betreuung
8.3 Vermeintliche Selbstbestimmung
8.4 Beeinträchtigung des freien Willens
8.5 Ein professionsethisches Entscheidungsmodell für die Betreuung von Menschen mit eingeschränkter Autonomie
9 Mit knappen Mitteln arbeiten Fachlichkeit und Wirtschaftlichkeit
9.1 Ökonomisierung
9.2 Unter dem Druck der Mittelknappheit
9.3 Die richtigen Dinge richtig tun
9.4 Grenzen der Ökonomisierung der Sozialen Arbeit
10 Widersprüchliche Anforderungen bewältigen Die Struktur ethischer Antinomien
10.1 Professionsethik als Orientierung in einer Interaktionsparadoxie
10.2 Diversität der Werte
10.3 Was ethische Entscheidungen erschwert
10.3.1 Mangelnde Gewissheit über den Sachverhalt
10.3.2 Sich widersprechende ethische Leitlinien
10.3.3 Konflikt zwischen ethischen und nicht ethischen Werten
10.4 Was heißt ›abwägen‹?
10.4.1 Mangelnde Gewissheit über den Sachverhalt
10.4.2 Sich widersprechende ethische Leitlinien
10.4.3 Konflikt zwischen ethischen und nicht ethischen Zielen
10.5 Urteilskraft
Übersicht über die Interviewausschnitte
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Abbildungen
Tabellen
Literatur
Stichwortverzeichnis
Personenverzeichnis
1 Riskante Entscheidungen treffen Werte im Konflikt
Was Sie in diesem Kapitel lernen können
Ein Beispiel aus der Kinder- und Jugendhilfe leitet in die Problematik der sich widerstreitenden Werte ein. Um deren Bedeutung zu ermessen, müssen zunächst die Grundbegriffe »Ethik« und »Moral« und ihr Stellenwert im Rahmen der Sozialen Arbeit vorläufig geklärt werden. Sodann wird in die Thematik der ethischen Antinomien in der Sozialen Arbeit eingeführt. Die ethische Reflexion der Sozialen Arbeit wird als gegenläufige Suchbewegung von »Top-down« und »Bottom-up« charakterisiert.
1.1 Der Kreidekreis
In einer altchinesischen Dichtung aus dem 14. Jahrhundert wird die folgende Geschichte erzählt: Ein reicher Mann hat zwei Frauen, eine Hauptfrau, die kinderlos geblieben ist, und eine Nebenfrau, die ein Kind von ihm bekommen hat. Der Hauptfrau, die intrigant und skrupellos ist, gelingt es, das Kind als ihres auszugeben und der Nebenfrau wegzunehmen. Die Frauen streiten heftig darüber, schließlich kommt der Fall vor Gericht. Der Richter verfügt, dass beide Frauen gleichzeitig versuchen sollten, das Kind aus einem mit Kreide markierten Kreis jeweils zu sich zu ziehen. So werde sich zeigen, wem es gehöre. Das Gezerre beginnt. Schließlich lässt die Nebenfrau das Kind los, damit es nicht verletzt werde. Dadurch aber erweist sie sich vor den Augen des Richters als die wahre Mutter. Der Richter spricht ihr das Kind zu.
Dieser Stoff wurde in der Moderne mehrfach literarisch bearbeitet, u. a. in den 1940er Jahren von Bertold Brecht in seinem Theaterstück Der kaukasische Kreidekreis. Dabei veränderte Brecht auf bezeichnende Weise die Grundkonstellation. Er lässt die leibliche Mutter mit einer Magd um das Kind streiten. Diese Mutter hatte zuvor ihr Kind schmählich im Stich gelassen, während die Magd aufopferungsvoll für es gesorgt hatte. Bei Brecht, der nicht an eine ›Stimme des Blutes‹ glaubt, reißt die leibliche Mutter im Kreidekreis gewaltsam das von ihr vernachlässigte Kind an sich, während die Magd es rücksichtsvoll loslässt, woraufhin der weise Richter der Magd das Kind zuspricht. Die »Moral der Geschichte« ist bei Brecht, »dass da gehören soll, was da ist, denen, die gut für es sind, also die Kinder den Mütterlichen, damit sie gedeihen« (Brecht 1977, 2105).
Der Richter aus einem früheren Jahrhundert hatte zu beurteilen, welcher der beiden Frauen das Kind zustand. Das Besondere an der Geschichte ist, dass er der Fragestellung eine ethische Bedeutung gab, nämlich die, welche der streitenden Parteien die Gewähr dafür bot, sich wahrhaft, d. h. nicht nur aus Berechnung, um das Kind zu kümmern, und dass er eine unerwartete Methode erfand, dies herauszubekommen. Es ging, nach heutigen rechtlichen und sozialarbeiterischen Fachbegriffen, um die Abwehr einer Gefährdung des Kindeswohls bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Elternrechts. Sehen wir von der heute gegebenen Möglichkeit ab, mittels Gentests die biologische Abkunft des Kindes zweifelsfrei zu ermitteln, dann stellt der Richter bei Brecht das Kindeswohl über das elterliche Erziehungsrecht, was durchaus unseren modernen wohlfahrtsstaatlichen Prinzipien entspricht. Wenn die leibliche Mutter das Kind misshandelt, hat der Staat als »Wächter« über sein Wohlergehen für einen Familienersatz zu sorgen. »Kindeswohl« ist ein sogenannter unbestimmter Rechtsbegriff, der u. a. im Jugendhilferecht von größter Bedeutung ist. Unbestimmte Rechtsbegriffe sind in ihrer Bedeutung letztlich von Gerichten auszulegen, die individuelle Prüfungen der Sachverhalte vornehmen müssen, wobei sie sich an den jeweils geltenden fachlichen Wissensbeständen und Normvorstellungen zu orientieren haben.
Ein hilfloses Kind im Stich zu lassen oder ihm Gewalt anzutun, ist geradezu ein Urbild von Unrecht. Auch wenn in den erwähnten Dichtungen vielleicht allzu plakativ Gut und Böse gegenübergestellt werden und wenn sich Soziale Arbeit und Justiz heute anderer Mittel der Wahrheitsfindung bedienen als eines dramatischen Rollenspiels im Kreidekreis, ist doch die dargestellte Entscheidungsproblematik an sich durchaus lebensnah. Dies zeigt das folgende Fallbeispiel aus einem Interview mit einer Mitarbeiterin eines Jugendamts. Diese wird von einem Krankenhaus über ein Baby informiert, das dort wegen einer Gehirnverletzung mit Blutungen in den Augen behandelt wurde. Die Information erfolgte, weil man den Verdacht hatte, es mit einem »Schüttelbaby« zu tun zu haben (überforderte Eltern, die ihr schreiendes Kind durch heftiges Schütteln seines Kopfes zur Ruhe bringen wollen, können damit ein »Schütteltrauma« mit gravierenden Schäden verursachen). Elke Ahlers, Sozialarbeiterin im Jugendamt, berichtet:
»Wir haben das Baby dann erst mal in Obhut genommen. Dieses Kind ist auf ganz aufwendige Weise entstanden. Die Eltern haben eine künstliche Befruchtung gehabt, das Kind verloren, das ist das zweite Kind aus einer künstlichen Befruchtung. Die kämpfen natürlich wie die Löwen, sie behaupten, sie hätten das Kind nicht geschüttelt, es wäre ein Impfschaden. […] Also ich kann gut verstehen, was für Nöte die haben. Dass die das zurückhaben wollen. Aber da läuft natürlich in erster Linie das Kinderschutzthema an, das steht an erster Stelle. Dieses Kind ist jetzt in ’ne Bereitschaftspflegefamilie gegangen, die Eltern haben zweimal wöchentlich Besuchskontakte. Und wir müssen da jetzt abwägen und aufpassen. Das Kind hat natürlich noch ’ne Bindung zu seinen Eltern, das muss man ja, mit Bindungstheorie usw., auch beachten. Und sollte es sich rausstellen, das ist ein Impfschaden, dann ist das so tragisch –. Es gibt inzwischen zwei Gutachten, die besagen, das ist kein Impfschaden. Die Eltern wenden sich gerade an ’n Fachmann, der den Impfschaden darlegen soll. Dann würde für uns allerdings immer noch zwei zu eins stehen und die Entscheidung würde nicht für die Familie ausfallen. Das Kind würde dann in ’ne Bereitschaftspflege- oder in ’ne Dauerpflegefamilie vermittelt werden. Als Mutter selber kann ich die Tragik total nachvollziehen und die Sorgen, Ängste und Nöte, die die haben.« [Mit den Kursivierungen werden hier und in den anderen Interview-Passagen Betonungen wiedergegeben.]
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter kommunaler Jugendämter haben öfters darüber zu entscheiden, ob in einer Familie eine Vernachlässigung eines Kindes oder Gewalthandlungen gegenüber diesem vorliegen und ob diese so schwerwiegend sind, dass sie eine sogenannte »Inobhutnahme« wegen Gefährdung des »Kindeswohls« veranlassen sollen. Das ist für alle Beteiligten, für die Familienmitglieder wie für die professionellen Kräfte, eine besonders belastende Situation. Die Entscheidung über das relevante Maß der Kindeswohlgefährdung ist schwierig, da diese zumeist im Verborgenen geschieht. Die Vielfalt der möglichen Fallvarianten ist groß. Was als unbedingt zu wahrendes Kindeswohl gilt und wie die allgemeinen Kriterien des körperlichen, geistigen und seelischen Wohls auf den besonderen Fall anzuwenden sind, muss jeweils nach dem verfügbaren Wissen über den Sachverhalt, nach fachlichen Standards und gemäß kultureller Übereinkünfte und ethischer Kriterien ausgelegt werden.
Die Sozialarbeiterin Elke Ahlers ist sich der Notwendigkeit einer nachhaltigen Entscheidung ebenso wie des möglichen Risikos einer Fehlentscheidung vollständig bewusst. Die Notwendigkeit bezieht sich auf die Wahrung des »Kindeswohls«. Dieses gilt dann als unmittelbar gefährdet, wenn ein von der Familie drohender erheblicher Schaden für das körperliche, seelische oder geistige Wohl des Kindes sicher anzunehmen ist. Dem gegenüber steht das Elternrecht, das den Schutz der Eltern vor staatlichen Eingriffen in die Erziehung der Kinder beinhaltet. Das Risiko resultiert nicht nur aus der Ungewissheit darüber, was tatsächlich vorgefallen ist, sondern auch aus der Befürchtung, dass auch eine richtige Entscheidung unerwünschte Nebenfolgen haben könnte.
Während nun die Wahrung des Kindeswohls einen klaren Vorrang gegenüber dem Elternrecht hat (was zur Inobhutnahme des Kindes führt), werden die Verhältnisse dadurch komplizierter, dass zum Kindeswohl auch die psychische Bindung des Babys an die Eltern gehört, die wiederum durch die Inobhutnahme gefährdet wird. Einerseits könnte die Überstellung des Kindes in eine Pflegefamilie zur Störung der psychologisch so wichtigen Elternbindung des Kindes führen. Andererseits könnte die Rückführung des Kindes zu nicht gefestigten Eltern erneut Misshandlungen heraufbeschwören. Die Sozialarbeiterin hat also unter Bedingungen unsicheren Wissens mit den unterschiedlichen Gefährdungen des Kindeswohls zu rechnen.
Eine (annähernd) richtige Entscheidung setzt eine (annähernd) richtige Erkenntnis des Sachverhalts voraus. Für die Version der Eltern scheint die Vorgeschichte zu sprechen: Sie haben das Kind nicht irgendwie oder ungewollt bekommen, und insofern wäre ihnen wohl eher eine besondere Sorgfalt bezüglich des Kindes zuzutrauen. Aber psychologisch wären auch andere gegenläufige (bewusste oder unbewusste) Motive von vornherein nicht auszuschließen. Andererseits mag man den medizinischen Gutachten ein größeres Maß an Objektivität und Tatsachenfeststellung zutrauen. Aber auch Gutachter sind nicht von vornherein gegen Irrtümer gefeit. Und was, wenn sich mehrere Gutachten widersprechen? Dann scheint nichts anderes übrig zu bleiben als die quantitative Abwägung »zwei zu eins« oder ein weiteres (Ober-)Gutachten.
Die Inobhutnahme stellt eine vorläufige Unterbringung eines Kindes außerhalb seiner Familie (Heim, Pflegefamilie) dar, bis eine familiengerichtliche Entscheidung getroffen wird. Diese hängt im Wesentlichen von der weiteren Aufklärung des Sachverhalts und der Hilfemöglichkeiten seitens des Jugendamts ab. Allerdings könnte das Jugendamt auch auf Maßnahmen zurückgreifen, mit denen die Gefahren zu vermindern wären, die aus einer wie auch immer ausfallenden Entscheidung resultieren könnten. Der hier einschlägige § 1666 BGB sieht eine Reihe entsprechender Maßnahmen vor, u. a. solche wie Hilfeplanerstellung oder Erziehungsberatung, die dazu geeignet sein können, eine vollständige Entziehung des elterlichen Sorgerechts ebenso wie ein unkontrolliertes Verbleiben des Kindes in einer gefährdenden Umwelt zu vermeiden. Am Ende stünde statt einer aufgrund von Unwissenheit riskanten Entscheidung ein Kompromiss in Gestalt von praktischen Maßnahmen.
Ethische Zielkonflikte gehören auch in anderen Bereichen der Sozialen Arbeit sozusagen zum täglichen Brot der professionell Tätigen. Wie ist beispielsweise bei der Schwangerschaftskonfliktberatung das gesetzlich festgelegte Ziel, das Leben des Kindes zu erhalten, mit der für Beratungen notwendigen Ergebnisoffenheit zu vereinbaren? Wie verhalten sich bei der Drogenarbeit oder beim Umgang mit Suizidgefährdeten Eingriffspflicht und Selbstbestimmungsrecht? Welches Maß an Selbstbestimmung sollen rechtliche Betreuerinnen ihren Klienten zugestehen und zumuten, für die sie zu entscheiden und zu handeln haben? Derartige Fragestellungen weisen darauf hin, dass die verschiedenen ethischen Prinzipien oder Leitlinien nicht ohne weiteres harmonisch zusammenstimmen.
Am bekanntesten, und oft genannt, sind die Gegensatzpaare Nähe und Distanz sowie Hilfe und Kontrolle, die nicht nur, aber auch ethische Anteile haben. Auch sonst lassen sich vielfältige ethische Konfliktbereiche dieser Art nennen, etwa zwischen dem gesellschaftlichen und dem klientelbezogenen Mandat der Sozialen Arbeit, zwischen Anforderungen der fachlichen Intensität und der ökonomischen Sparsamkeit, zwischen Gerechtigkeit und Gleichheit oder zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik. Nach welchen ethischen Kriterien solche Beurteilungen und Entscheidungen unter dilemmatischen Bedingungen vorzunehmen sind, ist die Fragestellung dieses Buches. Zunächst ist zu bestimmen, was hier unter »Ethik« und »Moral« zu verstehen ist.
1.2 Ethik und Moral: Orientierung an berechtigten Bedürfnissen/Interessen Anderer
Die Ethik thematisiert das Empfinden, Denken und Handeln hinsichtlich seiner Lebensförderlichkeit und sozialen Verantwortlichkeit. Sie ist die Theorie des »Ethos« bzw. der »Moral«. Was ist nun Moral? Hier ist von vornherein ein immer noch verbreiteter, viel zu enger Begriff von Moral auszuräumen. Cornelia Holsten, eine sehr erfahrene Sozialarbeiterin – sie war schon in vielen Feldern der Sozialen Arbeit tätig, arbeitet nun als Fallmanagerin bei der Arbeitsagentur –, erweist sich sonst in dem Interview, aus dem hier zitiert wird, als sehr umsichtig. Ganz zu Beginn dieses Interviews antwortet sie auf die Frage: »Siehst du irgendwo Moralprobleme in der täglichen Arbeit?«:
»Nö, ich eigentlich nicht. Ich geh da sehr offen und frei mit um. Moral hab’ ich nicht so viel mit am Hut, ich bin nicht in der Kirche. Es gibt ethische Probleme schon mal, aber die sind zum Teil darin begründet, wenn es ausländische Mitbürger sind oder Mitbürger bestimmter Religionen, wo man einfach drauf Rücksicht nehmen kann, soll, muss – das. Aber ansonsten, nee. Fallmanagement ist immer offen. Fallmanagement spricht alles an. Also alle Drogenprobleme, Schulden, Missbrauch, häusliche Gewalt, quer Beet. Fallmanagement ist immer ein ganz offenes Gespräch, weil sonst ist es kein Fallmanagement. Also gibt’s da auch eigentlich keine Einschränkungen.«
An dieser Antwort fällt Mehreres auf, das auf Missverständnisse des Moralischen verweist:
• Die Sozialarbeiterin bezieht Moral nur auf ihre eigene Arbeit als Fallmanagerin, nicht auch auf Probleme ihrer Klienten.
• Sie versteht Moral offenbar als gegensätzlich zu ihrer eigenen »offenen und freien« Umgangsweise – »Fallmanagement ist immer ein ganz offenes Gespräch« – als geschlossen, unfrei. Sie berücksichtigt nicht, dass Moral ebenso Motivation für Befreiung von Zwängen sein kann.
• Sie setzt Moral mit religiöser oder kirchlicher Moral gleich (mit der sie »nichts am Hut hat«). Aber auch außerhalb derer gibt es Moral.
• Sie unterscheidet nicht zwischen Moral und Ethik. Die letztere verengt sie wiederum auf eine Rücksichtnahme auf nicht einheimische religiöse Bräuche.
Die Gründe für diese Fehlinterpretationen des Moralischen sind wohl darin zu suchen, dass in unserer Gesellschaft die meisten Menschen, sofern sie einen christlichen kulturellen Hintergrund haben, Moral nach wie vor als kirchliche Lehre kennenlernen. Auf die Frage nach Beispielen für moralische Gebote fallen ihnen in der Regel als erstes die Zehn Gebote ein. Eine andere, weit verbreitete Assoziation zum Moralischen ist ebenfalls immer noch die von sexuellen Einschränkungen. Das ist insofern nicht verwunderlich, als Sexualität ein Feld aktiver oder passiver Grenzüberschreitungen ist und eng mit Erfahrungen nicht nur von Glück, sondern auch von Leiden verbunden ist. Glück, Leid, Leidvermeidung und damit Sexualität waren in traditionalen Gesellschaften durch viele Bräuche, Werte, Normen und Regeln eingehegt, die heute in der säkularisierten und individualisierten Gesellschaft immer weniger strikt gelten. Die Menschen weisen in ihrer Mehrheit kirchliche Einschränkungen und verpflichtende Sexualverbote ab. Damit verliert auch »Moral« ihre Reputation.
Dies aber ist, wie schon angedeutet, ein Missverständnis. Betrachten wir, um es aufzuklären, Moral nicht (wie die zitierte Sozialarbeiterin) aus der Innenperspektive (»Moral hab’ ich nicht so viel mit am Hut«), sondern von außen, aus psychologischer, soziologischer oder anthropologischer Perspektive. Dann lässt sie sich als eine Gesamtheit von Einstellungen und Praktiken bestimmen, die die Individuen auf teils bewusste, teils nicht bewusste Weisen dazu orientiert, auf die berechtigten Interessen Anderer Rücksicht zu nehmen. Die Moral fungiert, anthropologisch gesehen, als psychosoziale Barriere gegenüber der hohen Verletzbarkeit der Menschen untereinander und als Richtschnur für die Berücksichtigung ihrer Bedürftigkeit. Moral ist Ausdruck der psychosozialen Bindung einer wie immer gearteten Gruppe (vgl. Durkheim 1967, 87).
Moral haben die Menschen grundlegend, da ihr Zusammenleben nicht wie das tierische, wesentlich instinktgesteuert verläuft, sondern durch kulturelle Bedeutungen, Lernvorgänge und Traditionen vermittelt ist. Die Individuen entwickeln ihre moralischen Einstellungen während der Kindheit und Jugend, aber auch noch im Erwachsenenalter, in den Dimensionen der sozialen Wahrnehmung, der emotionalen Intelligenz und der kognitiven Urteilsfähigkeit. In der frühen Kindheit, sobald die Nahbeziehungen Kontur gewinnen, wirkt eine fremde Person ängstigend. Sie wird zunächst auch nicht oder nur reduziert in moralisch inkludierender Perspektive wahrgenommen werden. Entsprechend ist auch in gesellschaftlich-geschichtlicher Hinsicht eine universalistische Moral, die den Menschen thematisiert, eine relativ späte Errungenschaft (in unserem Kulturkreis in der Antike und im frühen Christentum).
Die moralischen Bindungen fallen, je nach Gruppe, enger oder lockerer aus. Dementsprechend empfinden wir in der Regel gegenüber den eigenen Kindern engere Bindungen als gegenüber den anderen Familienmitgliedern, diesen gegenüber wiederum engere als gegenüber Nachbarinnen, Fremden oder der Menschheit insgesamt. Entsprechend unterschiedlich empfinden wir auch moralische Anforderungen. Wir verhalten uns ihnen gegenüber grundsätzlich auf zweierlei Weise, entweder in der subjektiven Perspektive einer bestimmten Person in einer bestimmten Situation mit bestimmten Anderen oder in der intersubjektiven Perspektive auf für alle geltende Verpflichtungen im Sinne des Allgemeinwohls. Demzufolge hat die Moral zwei Seiten, eine sozial verbindliche und eine individuell wahlfreie. Die Individuen müssen Wertkonflikte vielfach in eigener Verantwortung entscheiden, indem sie je eigene Prioritäten setzen. Demgegenüber bildet der Bereich der sozialen Moral die Grundlage und die Begrenzung der individuellen moralischen Entscheidungen.
Beide Moralformen können unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen miteinander harmonieren oder disharmonieren. Unsere heutige Kultur schreibt der selbstbestimmten Individualität eine sehr hohe Bedeutung zu. Die individuellen und gruppentypischen Unterschiede der Moralen können zwischen verschiedenen Individuen oder gesellschaftlichen Gruppen zu Missverständnissen, Gegensätzen und Konflikten beitragen. So kann auch heute noch eine enge Familiensolidarität durchaus mit einer menschenfeindlichen Einstellung gegenüber Fremden einhergehen.
Man kann die Moral als eine Art Grammatik verstehen, mittels derer die Mitglieder einer sozialen Gemeinschaft ihre Ansprüche und Rücksichten regeln. Dabei beziehen sie sich auf bestimmte Standards des sozialen Miteinanders wie Respekt, Wohltun, Rücksicht, Wahrhaftigkeit o. ä. Dies kann auch indirekt geschehen, indem sie jemandem das jeweilige Gegenteil (Respektlosigkeit, Verletzung, Rücksichtslosigkeit, Lüge) vorwerfen. Die moralische Grammatik funktioniert wie die der verbalen Sprache vielfach nicht bewusst. Man könnte dies die implizite Sprache der Moral nennen. D. h., wir wenden die Moral zumeist intuitiv an, ohne uns ausdrücklich auf sie zu beziehen. Wenn Moral in diesem Sinn eine Art Sprache ist, dann ist Ethik eine »Metasprache«, eine Sprache über Sprache, eine Reflexion darüber, wie es zu den im moralischen Sprechen enthaltenen Ansprüchen kommt und ob sie berechtigt sind oder nicht.
Wie die Sprache bei den einzelnen Angehörigen einer Sprachgemeinschaft großenteils unbewusst funktioniert, so auch die Moral. Bewusst wird sie uns eher in Konfliktsituationen, wenn verschiedene moralischer Ansichten aufeinanderstoßen oder verletzt werden. Die moralische Selbstverständlichkeit, dass es gegen die moralischen Werte und Normen des Wohltuns ist, andere grundlos oder eigensüchtig zu verletzen, wird dann zum Problem, wenn wir oder andere davon betroffen sind. Wir reagieren mit moralischen Gefühlen von Empörung, Wut, Schuld oder Scham. Haben wir die Gelegenheit, diese Gefühle zu überdenken, dann kommen an deren Untergrund verborgene Ansichten, Erfahrungen, Wünsche oder Ängste zum Vorschein. Moralische Grenzen zu erfahren, spiegelt immer auch die eigene Biographie wider, insofern wir Einstellungen oder Handlungen jenseits dieser Grenzen nicht ohne weiteres in die eigenen Handlungsmuster integrieren können.
Moral ist nur eine Art von Orientierungen des sozialen Handelns neben anderen. Unser Empfinden und Handeln wird auch dadurch bestimmt, was für uns und unsere soziale Umwelt als üblich, ausgefallen, angesagt, nützlich, modern, schön, richtig, gerecht, rechtlich erlaubt oder geboten, anerkannt usw. gilt. Eine der wichtigsten Regularien, die für die Soziale Arbeit besonders relevant sind, ist das Recht. Die Soziale Arbeit bewegt sich in Deutschland heute auf der rechtlichen Grundlage des »Bürgerlichen Gesetzbuches« und insbesondere des »Sozialgesetzbuches«. Das Recht unterscheidet sich von Moral und Ethik vor allem dadurch, dass es mit ›harten‹ Sanktionen, also Strafen bewehrt ist. Seine Einhaltung kann notfalls durch die Staatsgewalt erzwungen werden. Ein Teil der moralischen Regeln der Rücksichtnahme auf die berechtigten Interessen Anderer ist zugleich rechtlich abgesichert, weil sie für besonders wichtig gelten. Andere Werte, zum Beispiel solche eines erfüllten und gelingenden Lebens, sind kaum rechtsfähig. Andererseits gibt es viele rechtliche Gesetze und Verordnungen, die keine moralische Bedeutung haben (außer der, dass gesetzkonformes Verhalten allgemein als moralisch wünschenswert gilt). So bilden Recht und Moral/Ethik zwei Bereiche mit einer gewissen Schnittmenge. Historisch haben sie sich erst in der Moderne ausdifferenziert. Der Richter des »Kreidekreises« fungiert noch zugleich als ethische Instanz.
Wie rechtliche Regeln und Gesetze können auch die moralischen Regeln zum eigenen Vorteil bewusst umgangen oder auch instrumentalisiert werden. Demgegenüber mag es erforderlich sein, die moralischen Vorannahmen ausdrücklich zur Sprache zu bringen. Damit aber wird sehr bald so etwas wie ein vermintes Gelände betreten. Denn Moral bei Anderen explizit einzufordern, stellt nur allzu rasch deren Selbstverständnis in Frage. Sobald eine Auseinandersetzung eine bestimmte Schärfe erreicht hat, erfolgt zumeist auch eine bewusste moralische Herabsetzung des Gegners. Persönliche Kritik wird dann zur Kritik der moralischen Persönlichkeit. Nichts bietet sich leichter zum Streit, aber auch zum Missbrauch an als Moral und Ethik.
Eine im Alltagsleben gängige Form dieses Missbrauchs ist das Moralisieren (die »Moralpredigt«), und es ist wichtig, ethisches Argumentieren nicht damit zu verwechseln. Wer Moral ›predigt‹, redet seinem Gegenüber ins Gewissen. Er will schlechtes Gewissen erzeugen und zu Reue und Umkehr bewegen. Dabei werden Werte und Normen beschworen, die als solche nicht in Frage gestellt werden. In der Erziehung ist die Wirkung von Moralpredigten, wie man weiß, sehr gering. Der »moralische Zeigefinger« ist zu Recht verrufen und fachlich-pädagogisch außer Kurs gesetzt. Auch in der Politik kann Moral allzu leicht missbraucht werden, indem sie politisches Argumentieren verdrängt. Kaum eine aggressive Übeltat kommt ohne den Versuch einer moralischen Verschleierung als »Notwehr« oder »gerechte Vergeltung« aus.
Auch in der beruflichen Sozialen Arbeit hat das Moralisieren keinen Platz. Das wird besonders deutlich in Praxisbereichen, in denen es die Fachkraft gelegentlich mit Menschen zu tun hat, deren Moralauffassung von der eigenen deutlich abweicht. So äußert sich der Sozialarbeiter Martin Klemke, der als Verfahrensbeistand an einem Amtsgericht die Aufgabe hat, die Interessen von Minderjährigen in kindschaftsrechtlichen Verfahren zu vertreten:
»Ich würde im Beruf niemals eigene Moralvorstellungen umsetzen wollen, weil die eigenen Moralvorstellungen längst nicht deckungsgleich sein müssen mit allgemeinen Ansichten. […] Höflichkeit zum Beispiel und Achtung vor den anderen Menschen haben für mich persönlich einen ganz hohen Wert. Aber ich könnte niemals jemanden urteilsmäßig in irgendeiner Form benachteiligen, nur weil er unhöflich ist.«
Der Sozialarbeiter unterscheidet hier genau genommen drei Ebenen des Moralischen, nämlich
a. die »allgemeinen Ansichten«, d. h. die einer bestimmten Kultur und einer bestimmten Epoche vorherrschenden Wert- und Normvorstellungen,
b. diejenigen Anteile davon, die ihm ›persönlich‹ in seinem Lebensumfeld besonders wichtig sind und
c. diejenigen Anteile, die seinem Berufsethos entsprechen.
Stattdessen würde Moralisieren hier bedeuten, die Unterschiede zwischen persönlichen Erwartungen und beruflichen Anforderungen derart zu verwischen, dass die spezifisch berufsethischen Ansprüche der Betroffenen auf Recht und Gerechtigkeit davon beeinträchtigt werden.
Auch die Klientinnen der Sozialen Arbeit neigen immer wieder zu einem fragwürdigen Moralisieren, nicht zuletzt, um so die Verantwortung für Schwierigkeiten von sich selbst auf andere abzuwälzen. Die Sozialarbeiterin Else Wickert, die in der Suchtberatung tätig ist, berichtet:
»Insgesamt stellt man hier in der Beratung immer wieder fest, dass Moral in den einzelnen Lebenszusammenhängen eine sehr große Rolle spielt […]. Also jetzt hatte ich eine Situation, wo die Tochter einer Klientin schwanger ist und der Vater von dem Kind sich jetzt entschieden hat: Ich möchte das Kind, aber die Frau nicht mehr. […] Im Grunde geht es um das Problem: Die Mutter hat die Tochter schon nicht losgelassen, die Tochter will das Kind jetzt bekommen, damit sie was hat, woran sie sich festhalten kann. […] Es geht ums Loslassen, darum, dass jeder Verantwortung für sein Leben übernimmt, und es geht auch um Aushalten und zu ertragen, wenn die Tochter sich dafür entscheidet, mit so einem Mann zu leben. […] Die Mutter schwingt die große Moralkeule mit der Frage: Wie kann sich ein Mann so verhalten, da macht er ihr das Kind und jetzt will er nix mehr von ihr wissen. Das sind moralische Aspekte, das ist ein Beispiel dafür, wo man einfach auch daran mit den Klienten arbeiten muss, eine Einstellung zu verändern oder zu hinterfragen oder mal zu gucken, was hat sie davon, wenn sie diesen Mann jetzt verantwortlich macht und nicht fragt: Was ist eigentlich mein Anteil, oder wie sieht eigentlich die Beziehung zu meiner Tochter aus, warum kann ich eigentlich meine Tochter nicht loslassen? Es ist ja viel einfacher, die moralische Keule zu schwingen und jemand anderes verantwortlich zu machen.«
Im Unterschied zum Moralisieren oder zur machtinteressierten Instrumentalisierung der Moral heißt ethisch über moralische Normen und Werte zu reden, diese nicht als etwas Unbestreitbares schon vorauszusetzen und auf ihre Durchsetzung zu dringen, sondern sie auf ihre Berechtigung und Wirkung hin zu befragen und ihre Geltung argumentativ zu begründen. Ethik kann und soll nicht moralisieren, sondern Moral analysieren, erklären, begründen und auch ihre dunklen Seiten kritisieren.
1.3 Suspendierung und Umdeutung von Moralfragen
Oft genug sind es Klagen über die Verletzung moralischer Erwartungen an Andere, die Klienten in Beratungssituationen vorbringen. Sie suchen Hilfe gegenüber den Zumutungen Anderer. Beratung als Hilfe zur Selbsthilfe wird aber in erster Linie die Klientinnen zur Selbstaufklärung zu bringen versuchen, auch weil ihnen dies am ehesten helfen wird, ihre Interessen mit dem richtigen Maß und auf die richtige Weise vertreten zu können. Die vorangegangene Schilderung der Suchtberaterin Else Wickert zeigt nicht nur die berechtigte Ablehnung des Moralisierens, sondern auch einen offenbar mit guten Gründen vorgenommenen psychologischen Umgang mit Moralfragen, den man als deren Umdeutung bezeichnen könnte. Sie beantwortet die selbst gestellte Frage nach dem psychischen Gewinn der moralisierenden Anklage mit einem dadurch aufrechterhaltenen Sicherheitsgefühl:
»Die Mutter hat die Tochter schon nicht losgelassen, die Tochter will das Kind jetzt bekommen, damit sie was hat, wodran sie sich festhalten kann, ne, unter anderem. Im Grunde genommen geht es ums Loslassen, darum, dass jeder Verantwortung für sein Leben übernimmt.«
Die Sozialarbeiterin versteht die moralischen Anklagen nicht als Bezeichnung der Ursache der zu bearbeitenden Problematik, sondern als deren Symptom: Was hat die Mutter davon, wenn sie den zukünftigen Vater ihres Enkelkindes moralisch beschuldigt? Die Antwort ist, dass sie die eigene Verantwortung verleugnet, wobei diese Verantwortung in sublimer Weise darin besteht, die Tochter in die Eigenverantwortung zu entlassen. Weiterhin wird damit aber auch deutlich, dass eine beratungstechnisch offenbar sinnvolle Suspendierung von Moralfragen nicht den generellen und langfristigen Verzicht auf diese oder gar das Außerkraftsetzen der Professionsethik bedeutet. Denn es geht sowohl bei der Mutter als auch bei der Tochter mit der (Eigen-)Verantwortungsübernahme um ein Stück moralischen Lernens.
Die entsprechende fachliche Intervention ist jedoch nicht ohne Risiko. Denn sie beruht auf einer psychosozialen Diagnose, die das Selbstverständnis der Beteiligten im Sinn einer wissenschaftlichen Verhaltenserklärung überschreitet. Die Sozialarbeiterin muss sich zutrauen, psychische Zusammenhänge zu erkennen, die den Beteiligten mindestens teilweise verborgen zu sein scheinen. Aus ihrem Expertentum leitet sie die Berechtigung ihrer Annahme über deren eigentliche Motive ab. Was aber bürgt für die Richtigkeit dieser Sichtweise? Dies kann letztlich nur die Bestätigung seitens der Beteiligten sein. Das bedeutet, dass deren Rolle nicht die von Objekten, sondern von (Co-)Subjekten einer Diagnose und der erfolgreichen Suche nach einer Problemlösung ist. Ein solcher Ansatz wird in dem folgenden Beispiel deutlich. Auch in ihm wendet die Beraterin die moralischen Klagen konsequent in Richtung einer Selbstreflexion um:
»So kann es fruchtbar sein, die geschiedene Mutter, die verzweifelt gegen die Umgangsregelung mit dem Vater ihres Kindes kämpft, zu fragen, warum dieser Umgang sie verzweifeln lässt, und umgekehrt kann es genauso fruchtbar sein, den geschiedenen Vater, der verzweifelt für ein Umgangsrecht mit seinem Kind kämpft, zu fragen, warum er eigentlich sein Kind so dringend zu sehen wünscht.« (Finger-Trescher 2006, 145)
Aber so wichtig der Schritt der Richtungsumkehr von der moralischen Anklage zur Selbstbefragung auch ist, so wird sich die Beraterin nicht notwendig mit den Auskünften der Klienten zufriedengeben. Ihre berufliche Erfahrung und ihre wissenschaftlich gestützte Expertise geben ihr Anhaltspunkte an die Hand, um die Selbstauskünfte zusammen mit den Klientinnen zu vertiefen. Expertentum, dialogische Offenheit und ethisches Taktgefühl ergänzen und korrigieren einander.
So gibt es Handlungsweisen, die an sich ethisch-normativ klar einzuordnen sind und dennoch eine flexible, kontextsensible Umgangsweise bis hin zur Toleranz des Unmoralischen erfordern. Typisch dafür ist das Lügen, das einerseits moralisch als verletzend angesehen wird und andererseits schon in der Alltagskommunikation verbreitet ist und stillschweigend toleriert wird, weil es die Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen oft erleichtert, indem andere mögliche Verletzungen konventionell verschleiert oder vermieden werden. Auch in der Sozialen Arbeit empfiehlt sich manchmal, um längerfristiger Ziele willen, ein Verzicht auf strikte Moral, wie am folgenden Beispiel des bereits zitierten Verfahrensbeistands Martin Klemke deutlich wird:
»Man kann die moralischen Dinge thematisieren, aber die Frage ist, ob das angebracht ist. […] Ein Beispiel ist, wenn Eltern lügen, das kommt ja sehr häufig vor. […] Wenn ich die Kinder frage: ›Hat die Mama es gern, wenn du zum Papa gehst?‹, kommt von den Kindern immer die Spontanantwort: ›Nein‹. Kinder denken ja nicht um zehn Ecken. Und die Mütter sagen dann meistens: ›Ich habe nichts dagegen, wenn er zu seinem Vater geht.‹ Daraufhin sage ich: ›Das Kind hat aber gesagt, dass Sie es auch nicht gernhaben.‹ Und dann ist Stille. Da sage ich dann auch nicht: ›Sie haben aber gelogen.‹ Unter Erwachsenen gehört sich das nicht. Das kann ich mit meinem Beruf nicht vereinbaren. Es ist ja auch so, dass das Gesetz manchmal sogar das Lügen erlaubt. Nehmen Sie als Beispiel doch einmal den Angeklagten. Der Angeklagte braucht nicht die Wahrheit zu sagen, der darf lügen, und es wird akzeptiert.«
Hier scheint sich der Unterschied zwischen lebensweltlicher Moral und Berufsethik ein Stück weit aufzulösen, in denen beiderseits das Lügen, obwohl es manifest negativ sanktioniert wird, latent dennoch kontextabhängig toleriert wird. Aber die Gründe dafür sind doch unterschiedlich. Während es im ersten Fall vor allem um ›Gesichtswahrung‹ geht, kommen im zweiten Fall Grundsätze des professionellen Auftrags mit ins Spiel. So muss der Verfahrensbeistand in hinreichend umfassender Weise sich über die Lebensumstände und Interessen des Kindes informieren können.
Moral ist eine Gesamtheit von Werten, Normen und Tugenden, die für Einzelne, Gruppen, oder Kulturen orientierende und handlungsanweisende Funktionen haben. Insofern spielt sie in jeder Lebensäußerung und jeder Interaktion eine manchmal offene, meist jedoch eher versteckte Rolle. Mit der dem Faktischen in gewisser Weise übergeordneten Funktion der Anleitung und Rechtfertigung ist sie auch in extremer Weise missbrauchsanfällig. Indem sie Allgemeines beansprucht, Pflichten einfordert, höhere Ideale beschwört, lenkt sie vom praktisch sich Aufdrängenden und Erforderlichen allzu leicht ab und erlaubt es, dass wir uns Andere oder sogar uns selbst über Wünsche, Ängste und andere verschwiegene Regungen hinwegtäuschen können. Diese Erkenntnis liefert für die meisten Formen von Psychotherapie und Beratung heute ausreichend Gründe, die Moral sozusagen nur mit spitzen Fingern anzufassen, obwohl sie die Moral weder als Problemgebiet leugnen noch selbst auf professionsethische Grundsätze verzichten können oder wollen. Zur professionellen moralischen ›Abstinenz‹ hier beispielhaft nur ein methodologisches Zitat aus Carl Rogers’ Grundsätzen der nicht-direktiven Beratung:
»Moralische Werte gehen in diese Art der Therapie nicht ein. Die positiven Gefühle werden ebenso als Teil der Persönlichkeit akzeptiert wie die negativen. Dieses Akzeptieren sowohl der reifen wie der unreifen Impulse, der aggressiven wie der sozialen Einstellungen, der Schuldgefühle wie der positiven Äußerungen bietet dem Individuum zum ersten Mal in seinem Leben Gelegenheit, sich so zu verstehen, wie es ist.« (Rogers 1972, 46)
1.4 Soziale und ethische Antinomien
Die Ethik bringt die möglichen Unterschiede und Widersprüche zwischen den moralischen Werten und Normen zur Sprache, die auf der Ebene der Moral selbst eher unmittelbar ausgefochten oder verdrängt werden. Sie verfolgt damit die Absicht der Klärung, Schlichtung und begründeten Orientierung. Moralische Werte und Normen sind immer auch Ausdruck einer Lebenswirklichkeit und der darin verankerten Ansichten, Bedürfnisse und Erwartungen. Da diese je nach individuellen und sozialen Bedingungen unterschiedlich, ja gegensätzlich sein können, kommt es auch zu entsprechend unterschiedlichen Werten und Normen.
Zur Zeit der Industrialisierung in der Mitte des 19. Jahrhunderts gab es noch keine Sozialgesetzgebung, diese kam in Deutschland erst in den 1880er Jahren unter dem damaligen Reichskanzler Otto von Bismarck auf, während bis dahin sich vor allem die Kirchen um die Fürsorge von Armen und Kranken gekümmert hatten. Mit dem neuen Reichtum der Produzenten, Händler und Finanziers entstand um die industriellen Zentren herum auch massenhaft neue Armut. Bismarck wolle damit vor allem sozialen Unruhen, vielleicht gar einer Revolution des von Armut und Elend bedrohten Proletariats vorbeugen. Nach und nach wurden Nothilfen eingerichtet und die Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter gegenüber den Fabrikanten reguliert. Noch einige Jahre zuvor hatte Karl Marx in seinem Hauptwerk Das Kapital (1867) über die Auseinandersetzungen um die Länge des Arbeitstages geschrieben:
»Der Kapitalist behauptet sein Recht als Käufer [der Arbeitskraft], wenn er den Arbeitstag so lang als möglich und womöglich aus einem Arbeitstag zwei zu machen sucht. […] der Arbeiter behauptet sein Recht als Verkäufer, wenn er den Arbeitstag auf eine bestimmte Normalgröße beschränken will. Es findet hier also eine Antinomie statt, Recht wider Recht, beide gleichmäßig durch das Gesetz des Warentausches besiegelt. Zwischen gleichen Rechten entscheidet die Gewalt.« (Marx [1867] 1968, 249)
Marx spricht von einer »Antinomie« (Unvereinbarkeit von Gesetzen), wobei er sich auf das ökonomische »Gesetz des Warentausches« bezieht, bei dem zwei Partner Waren tauschen, indem sie jeweils so viel wie möglich zu erlangen suchen, wofür sie so wenig wie nötig geben müssen. Unter Bedingungen der beiderseitigen Freiheit von Angebot und Nachfrage der Ware Arbeitskraft wird der Tausch bei einem einigermaßen gerechten Mittelwert erfolgen oder, wenn die Erwartungen zu weit auseinanderliegen, nicht zustande kommen. Nur gab es in der Realität der ungleichen Ausgangslagen diese Freiheit kaum. Deshalb spricht Marx hier von Gewalt als Mittel der Entscheidung über ökonomische Antinomien im Kampf der sozialen Klassen.
Der frühe Kapitalismus konnte sozialstaatlich ein Stück weit gebändigt, die Verelendung der Massen zurückgedrängt werden. Damit verschwanden freilich nicht die praktischen Antinomien. Die Interessengegensätze, Widersprüche in den Ansichten, Unterschiede in den sozialen Lagen blieben bestehen. Durch die Einbindung der arbeitenden Bevölkerung in die Industrie wurden die traditionellen Familien- und Verwandtschaftsstrukturen aufgelöst, und damit zerfielen auch die überkommenen Hilfestrukturen. An ihre Stelle trat nun die Soziale Arbeit, als Teil des Sozialstaatsregimes. Infolgedessen hatte auch sie es immer wieder mit der Bewältigung von praktischen Antinomien zu tun. Der ihr innewohnenden Ethik entsprechend, ersetzte sie reale oder drohende Gewaltverhältnisse durch Vereinbarungen.
Von dieser Herkunft zeugt die sie bis heute bestimmende Grund-Ambivalenz von Hilfe und Kontrolle. War ihr herrschaftlich vorwiegender Zweck die Kontrolle der aus den Kreisläufen der Normalität Herausgefallenen oder Ausgeschlossenen, so war doch dieses Ziel nachhaltig allenfalls dadurch zu erreichen, dass man ihnen Hilfe zuteilwerden ließ: Hilfe zur Versorgung der Grundbedürfnisse und zur Arbeitsfähigkeit. Unbedachte, naive Hilfe konnte aber auch zur Verstärkung der Abhängigkeit führen, wie beispielhaft im Falle eines Alkoholikers, der sich mit dem ihm zugesteckten Almosen wiederum Alkoholisches kauft. In der Abwehr solchen absehbaren Scheiterns von Hilfe konzipierte man Hilfe sozialpädagogisch als Hilfe zur Selbsthilfe. Hilfe sollte sich selbst überflüssig machen. Schon der Pädagoge Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1824) hatte mittels einer ganzheitlichen Bildung in Familie und Schule das Volk zu einem selbständigen und kooperativen Wirken in einem demokratischen Gemeinwesen befähigen wollen. Dieser Gedanke wurde in der Reformpädagogik wie auch in der Sozialen Arbeit weiterentwickelt. Aber auch er war nicht unberührt vom Aspekt der Kontrolle, unterschied man doch schon früh zwischen würdigen und unwürdigen Hilfsbedürftigen, wobei die ersteren sich als arbeitswillig, die letzteren als arbeitsunwillig zeigten.
Soziale Arbeit als Profession soll ihre Adressatinnen bei der Lösung von Problemen ihrer Lebensführung unterstützen. Ein »Beruf«, d. h. ein durch Ausbildung institutionalisiertes Wissen und Können, das gegen Bezahlung der Gesellschaft zur Verfügung steht, wird dadurch zu einer »Profession«, dass sich dieses Wissen und Können auf einen gesellschaftlich zentralen Wert bezieht und dass dies mithilfe von Institutionen wie Wissenschaft, Lehre, Prüfungen abgesichert wird. Im Fall der Sozialen Arbeit ist der entsprechende Terminalwert der der »Wohlfahrt«. Er kann auf zweierlei Wegen verwirklicht werden, einerseits negativ, durch Verhinderung derjenigen Umstände, die ihn gefährden, andererseits positiv, durch Verstärkung anderer Bedingungen, die ihn begünstigen. Kontrolle und Zwang gehören damit ebenso grundlegend zur Sozialen Arbeit wie Hilfe und Förderung, wenn auch ihr jeweiliges Mischungsverhältnis in den verschiedenen Arbeitsfeldern sehr unterschiedlich ist.
Die Lösung von Problemen der Lebensführung zielt darauf, das sonst als ›normal‹ geforderte Maß an Eigenverantwortung und Selbständigkeit zu erreichen. Dieses Ziel steht in einem unauflösbaren Spannungsverhältnis mit den gesellschaftlichen und natürlichen Bedingungen, die zu den Schwierigkeiten der Einzelnen wesentlich beitragen. Globale Veränderungen von Produktion, Handel und Finanzwirtschaft sowie die von Naturkatastrophen, Kriegen oder Flüchtlingsströmen ausgehenden kulturellen Verwerfungen lassen sich von den Individuen nicht oder kaum beeinflussen und schlagen doch auf ihre Lebensbedingungen durch. Betroffen sind diese allerdings in sehr unterschiedlichem Maße, je nachdem, über welche Ressourcen sie an ökonomischem, sozialem und kulturellem Kapital verfügen. Der Sozialen Arbeit wird dabei die Aufgabe zugewiesen, im individuellen Maßstab Probleme zu bearbeiten, die im gesellschaftlichen, ja globalen Maßstab verursacht wurden. Soziale Arbeit, die dies erkennt, intendiert sowohl Verhaltensänderung als auch (im beschränkten Maßstab) Verhältnisänderung, und kann doch nicht beides zugleich tun. In ihrer Praxis hat dies zur Folge, dass sie immer wieder Zielkonflikte bewältigen muss.
Die generelle praktische Zielvorstellung der Sozialen Arbeit besteht im Empowerment ihrer Klientel. Deren Selbstbestimmung wird vielfach durch physische und psychische Lebensbedingungen der Individuen verhindert. Das Leben unter materiell schwierigen Bedingungen, in gewaltaffinen Verhältnissen, mit Arbeits- oder Wohnungslosigkeit, mit körperlichen, psychischen oder mentalen Einschränkungen, mit Belastungen durch Krankheit und Alter, all dies verursacht bei den Betroffenen strukturelle Fremdbestimmungen. Sie sind deshalb auf besondere Rücksichten und Unterstützungen seitens der Sozialen Arbeit angewiesen, die aber nun ihrerseits allzu leicht in Fremdbestimmung umschlagen kann. Diese Fremdbestimmung muss nicht unbedingt durch fragwürdige Machtgelüste der Fachkräfte bedingt sein, sie kann auch dem Schutz der Klienten geschuldet sein. Jedenfalls stellen Selbst- und Fremdbestimmung ein zentrales Spannungsverhältnis der Sozialen Arbeit dar.
Auch in den beruflichen Ethikkodizes der Sozialen Arbeit wird regelmäßig auf derartige Spannungsverhältnisse hingewiesen. So wird zum Beispiel im Vorwort der Proklamation »Ethics in Social Work, Statement of Principles« (2005) der Berufsverbände »International Federation of Social Workers« und »International Association of Schools of Social Work« darauf hingewiesen, dass die Problembereiche, mit denen es die Soziale Arbeit zu tun hat, folgendes beinhaltet: