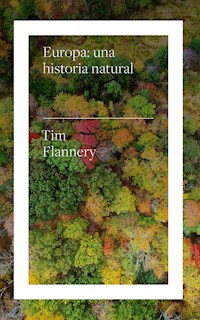13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Von der Entstehung der ersten Korallenriffe über die Ära, als noch riesige Elefanten durch die Wälder zogen, führt uns Flannery durch die Jahrtausende bis ins moderne Zeitalter, in dem der Mensch seine Umwelt mindestens ebenso sehr prägt wie diese ihn. Er erzählt von den oft exzentrischen Forschern, denen wir unser heutiges Wissen verdanken, von ihren abenteuerlichen Erkundungen und spektakulären Entdeckungen. Dabei verwebt er Natur- und Kulturgeschichte zu einer Erzählung darüber, wer wir sind und woher wir kommen – eine Erzählung, die so einzigartig ist wie Europa selbst.
Die Fragen, was Europa, wer Europäer und was europäisch ist, sind heute so umstritten wie selten zuvor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 585
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Tim Flannery
mit Luigi Boitani
Europa
Die ersten 100 Millionen Jahre
Aus dem Englischen von Frank Lachmann
Insel Verlag
Für Colin Groves und Ken Aplin, lebenslange Kollegen und Helden der Zoologie
Inhalt
Eine geologische Zeittafel
Einleitung
I Der tropische Archipel. Von vor 100 Millionen bis vor 34 Millionen Jahren
Kapitel 1 Ziel: Europa
Kapitel 2 Haţegs erster Erforscher
Kapitel 3 Zwergenhafte, degenerierte Dinosaurier
Kapitel 4 Inseln an den Knotenpunkten der Welt
Kapitel 5 Ursprünge und Ureuropäer
Kapitel 6 Die Geburtshelferkröte
Kapitel 7 Die große Katastrophe
Kapitel 8 Eine postapokalyptische Welt
Kapitel 9 Neue Morgenröte, neue Invasionen
Kapitel 10 Messel – ein Fenster in die Vergangenheit
Kapitel 11 Das große europäische Korallenriff
Kapitel 12 Geschichten aus der Pariser Kanalisation
II Ein Kontinent entsteht. Von vor 34 Millionen bis vor 2,6 Millionen Jahren
Kapitel 13 La Grande Coupure
Kapitel 14 Katzen, Vögel und Grottenolme
Kapitel 15 Das malerische Miozän
Kapitel 16 Ein miozänes Bestiarium
Kapitel 17 Europas exzeptionelle Affen
Kapitel 18 Die ersten aufrecht gehenden Affen
Eine Zusammenfassung der Evolution der Affen im Oligozän bis zum Miozän
Kapitel 19 Seen und Inseln
Kapitel 20 Die Messinische Salinitätskrise
Kapitel 21 Das Pliozän – die Zeit des Laokoons
III Das Eiszeitalter. Von vor 2,6 Millionen bis vor 38 000 Jahren
Kapitel 22 Das Pleistozän – Tor zur modernen Welt
Kapitel 23 Hybride – Europa, die Mutter der métissage
Kapitel 24 Die Rückkehr der aufrecht gehenden Affen
Kapitel 25 Neandertaler
Kapitel 26 Bastarde
Kapitel 27 Die kulturelle Revolution
Kapitel 28 Von Gemeinschaften und Elefanten
Kapitel 29 Weitere gemäßigte Riesen
Kapitel 30 Eisbestien
Kapitel 31 Was die Alten malten
IV Das Europa des Menschen. Von vor 38 000 Jahren bis in die Zukunft
Kapitel 32 Das Gleichgewicht kippt
Aussterbedaten der europäischen Megafauna
Kapitel 33 Die Domestizierer
Kapitel 34 Vom Pferd bis zum Scheitern der Römer
Kapitel 35 Die Inseln leeren
Kapitel 36 Die Ruhe und der Sturm
Kapitel 37 Überlebende
Kapitel 38 Europas globale Expansion
Menschliche Zu- und Abwanderung nach und aus Europa
Kapitel 39 Neue Europäer
Kapitel 40 Tiere des Imperiums
Kapitel 41 Europas Bewolfung
Kapitel 42 Europas stummer Frühling
Kapitel 43 Ein neues Zuhause
Kapitel 44 Die Riesen wiederbeleben
Envoi
Dank
Bildnachweise
Tafelteil
Register
Anmerkungen
Eine geologische Zeittafel
Zeitabschnitte
Wichtige Fossillagerstätten
Vor … Jahren
Kreide
Haţeg
66 Millionen
Paläozän
Hainin
56 Millionen
Eozän
Messel
Monte Bolca
34 Millionen
Oligozän
23 Millionen
Miozän
Fußspuren auf Kreta
Ungarische Eisenmine
5,3 Millionen
Pliozän
2,6 Millionen
Pleistozän
Dmanissi
11 764
Holozän
Einleitung
Naturgeschichten umfassen sowohl die natürlichen als auch die menschlichen Welten. Diese hier möchte drei große Fragen beantworten: Wie ist Europa entstanden? Wie wurde seine außergewöhnliche Geschichte erforscht? Und warum wurde Europa in der Welt so wichtig? Denjenigen, die wie ich nach Antworten suchen, kommt der Umstand zugute, dass Europa eine Unmenge von Knochen besitzt – Schicht um Schicht, begraben in Gestein und Sedimenten, die bis auf die Anfänge der Wirbeltiere zurückdatieren. Die Europäer haben zudem einen außerordentlich reichhaltigen Schatz an naturkundlichen Beobachtungen hervorgebracht, angefangen bei den Werken Herodots und Plinius’ bis hin zu denen der englischen Naturforscher Robert Plot und Gilbert White. Außerdem ist Europa derjenige Ort, an dem die Untersuchung der tiefen Vergangenheit begonnen hat. Die erste geologische Karte, die ersten paläobiologischen Studien und die ersten Dinosaurierrekonstruktionen wurden allesamt dort angefertigt. Und in den letzten Jahren hat eine von einflussreichen neuen DNA-Untersuchungen befeuerte Revolution der Forschung im Zusammenspiel mit erstaunlichen Entdeckungen in der Paläontologie eine grundlegende Neuinterpretation der Geschichte des Kontinents möglich gemacht.
Diese Geschichte beginnt vor ungefähr 100 Millionen Jahren, und zwar mit dem Augenblick der Zeugung Europas – also dann, als die ersten spezifisch europäischen Organismen entstanden sind. Die Erdkruste setzt sich aus tektonischen Platten zusammen, die sich unmerklich langsam über den Globus bewegen und auf denen die Kontinente aufsitzen. Die meisten Kontinente haben sich im Zuge des Zerfalls von Superkontinenten geformt. Europa aber fing als ein Archipel an, dessen Zeugung das geologische Zusammenwirken dreier kontinentaler »Eltern« umfasste – Asien, Nordamerika und Afrika. Diese machen zusammengenommen ungefähr zwei Drittel der Landfläche der Erde aus, und da Europa als eine Brücke zwischen diesen Landmassen fungierte, war es der wichtigste Ort des Austauschs in der Geschichte unseres Planeten.1
Europa ist ein Ort, an dem die Evolution schnell voranschreitet – ein Ort an der vordersten Front des globalen Wandels. Doch schon inmitten des tiefsten Dinosaurierzeitalters hatte es ein paar Besonderheiten, die die Evolution seiner Bewohner geprägt haben. Einige dieser Besonderheiten wirken bis heute fort. Tatsächlich resultieren sogar einige der aktuellen Dilemmata der Menschen in Europa aus diesen Eigentümlichkeiten.
Europa zu definieren ist ein heikles Unterfangen. Seine Vielfalt, seine Evolutionsgeschichte und seine sich wandelnden Grenzen machen es nahezu proteisch. Doch paradoxerweise ist es trotzdem immer sofort wiederzuerkennen, mit seinen ganz eigenen Kulturlandschaften, seinen ehemals riesigen Wäldern, den Mittelmeerküsten und dem Antlitz der Alpen – wir alle erkennen Europa, wenn wir es sehen. Und die Europäer selbst, mit ihren Schlössern, Städten und ihrer unverwechselbaren Musik, erkennt man ebenso schnell. Es ist zudem wichtig zu bedenken, dass die Europäer durch die antiken Welten Griechenlands und Roms miteinander vereint sind. Selbst diejenigen unter ihnen, deren Vorfahren nie Anteil an dieser klassischen Welt hatten, beanspruchen sie als die ihre und suchen in ihr nach Erkenntnis und Inspiration.
Was also ist Europa, und was bedeutet es, Europäer zu sein? Das Europa der Gegenwart ist kein Kontinent im eigentlichen geografischen Sinne.2 Vielmehr ist es ein Anhängsel – eine von Inseln umgebene Halbinsel, die vom westlichen Rand Eurasiens aus in den Atlantik ragt. In einer Naturgeschichte definiert man Europa am besten über die Geschichte seines Gesteins. Aus dieser Perspektive betrachtet, erstreckt es sich von Irland im Westen bis zum Kaukasus im Osten und von Spitzbergen im Norden bis Gibraltar und Syrien im Süden. Nach dieser Definition ist die Türkei ein Teil Europas, Israel aber nicht: Das Gestein der Türkei hat eine gemeinsame Geschichte mit dem Rest Europas, während das Israels seinen Ursprung in Afrika hat.
Ich bin kein Europäer – jedenfalls nicht in einem politischen Sinne. Ich wurde in den Antipoden geboren, wie die Europäer Australien einmal genannt haben – in Europas Gegenüber. Physisch aber bin ich so europäisch wie die Queen (die übrigens in ethnischer Hinsicht deutsch ist). Als Kind wurde mir die Geschichte der Kriege und Monarchen Europas eingetrichtert, während ich über die Bäume und Landschaften Australiens so gut wie nichts erfahren habe. Vielleicht hat dieser Umstand meine Neugier geweckt. Meine Suche nach Europa war jedenfalls schon längst im Gange, ehe ich überhaupt jemals einen Fuß auf europäischen Boden gesetzt hatte.
Als ich 1983 als Student zum ersten Mal nach Europa reiste, war ich ganz aufregt und mir sicher, bald den Mittelpunkt der Welt zu betreten. Doch als wir im Anflug auf Heathrow waren, machte der Pilot unserer British-Airways-Maschine eine Durchsage, die ich nie vergessen werde: »Wir nähern uns jetzt einer ziemlich kleinen nebligen Insel in der Nordsee.« Nie zuvor in meinem Leben hatte ich mir Großbritannien auf diese Weise vorgestellt. Als wir gelandet waren, war ich erstaunt über die milde Luft. Selbst der Geruch des Windes schien beruhigend zu sein, da ihm jener bestimmte Hauch von Eukalyptus fehlte, der mir kaum jemals aufgefallen war, bis er eben nicht mehr da war. Und die Sonne. Wo war die Sonne? Was ihre Stärke und Strahlkraft anging, ähnelte sie eher einem australischen Mond als jenem großen Feuerball, der meine Heimat versengte.
Die Natur Europas konnte noch mit weiteren Überraschungen aufwarten. Ich war erstaunt über die gewaltige Größe seiner Ringeltauben und das Ausmaß des Wildbestands in den Randgebieten des städtischen Englands. Die Vegetation in dieser feuchten und milden Luft war so zart und grün, dass ihre brillante Färbung mir fast unwirklich erschien. Sie wies nur wenige Dornen oder harte Zweige auf – ganz anders als das staubige und kratzige Buschland zu Hause. Nachdem ich einige Tage in den nebligen Himmel geblickt und weich auslaufende Horizonte betrachtet hatte, fühlte ich mich wie in Watte gepackt.
Diesen ersten Besuch unternahm ich, um die Sammlungen des Naturhistorischen Museums in London zu studieren. Kurz darauf wurde ich Kurator für die Säugetierausstellung im Australischen Museum in Sydney, wo man von mir erwartete, dass ich umfassende Expertise in Mammalogie erwarb. Als mich dann Redmond O’Hanlon, der Redakteur für Naturgeschichte bei der Times Literary Supplement, darum bat, ein Buch über die Säugetiere Großbritanniens zu besprechen, willigte ich daher auch mit einigem Zögern ein, diese Herausforderung anzunehmen. Das Werk verwunderte mich, denn es vergaß, jene beiden Spezies – Kühe und Menschen – zu erwähnen, die über eine lange Tradition auf der Insel verfügten und die ich dort in Hülle und Fülle zu Gesicht bekommen hatte.
Nachdem er meine Rezension erhalten hatte, lud Redmond mich in sein Haus in Oxfordshire ein. Ich befürchtete, das sei seine Art, mir mitzuteilen, dass meine Arbeit nicht den Anforderungen entsprach; doch wurde ich im Gegenteil sehr herzlich empfangen, und wir redeten mit großer Begeisterung über Naturgeschichte. Am späten Abend, nach einem ausgiebigen Essen, zu dem es viele Gläser Bordeaux gab, lotste er mich auf konspirative Weise in den Garten, wo er auf einen Teich deutete. Während Redmond mir zur verstehen gab, dass ich mich ruhig verhalten sollte, schlichen wir uns an den Rand. Dort reichte er mir eine Fackel, und inmitten der Wasserpflanzen erspähte ich eine blasse Gestalt.
Ein Molch! Und mein erster. Wie Redmond nämlich wusste, gab es in Australien keine geschwänzten Amphibien. Ich war ebenso von Ehrfurcht ergriffen wie P. G. Wodehouse’ wundervolle Schöpfung in den Jeeves-Romanen, nämlich der fischgesichtige Gussie Fink-Nottle, der »sich auf dem Land vergraben [hat], und seither beschäftigte er sich nur noch mit Molchen, die er in Glasbehältern züchtete und tagein, tagaus hingebungsvoll beobachtete«.3Molche sind so dermaßen primitive Kreaturen, dass sie zu beobachten wie ein Blick in die Zeit selbst ist.
Von dem Augenblick, als ich meinen ersten Molch zu Gesicht bekam, bis zur Entdeckung der Ursprünge der Europäer selbst war meine 30 Jahre währende Forschungsreise in die europäische Naturgeschichte voller Erkenntnisse. Was mich als Bewohner der Heimat des Schnabeltiers vielleicht am meisten überrascht hat, war die Tatsache, dass es in Europa ebenso alte wie primitive Geschöpfe gibt, die trotz ihrer Vertrautheit unterschätzt werden. Eine weitere für mich erstaunliche Entdeckung war die Summe der global bedeutsamen Ökosysteme und Arten, die aus Europa hervorgegangen sind und sich aber längst von diesem Kontinent verabschiedet haben. Wer hätte gedacht, dass die urzeitlichen europäischen Meere eine wichtige Rolle in der Evolution der modernen Korallenriffe gespielt haben? Oder dass sich unsere ersten aufrecht gehenden Urahnen in Europa und nicht in Afrika entwickelt haben? Und wer würde vermuten, dass viel von der eiszeitlichen Megafauna Europas fortlebt, in abgelegenen, verwunschenen Wäldern und Ebenen, verborgen wie die Elfen und Feen aus der Volkssage, oder in Form von Genen, die auf ewig im Permafrost schlummern?
So vieles von dem, was unsere moderne Welt geprägt hat, hat seinen Anfang in Europa genommen: die Griechen und die Römer, die Aufklärung, die industrielle Revolution und die Imperien, die den Planeten im 19. Jahrhundert unter sich aufgeteilt haben. Und auch heute noch regiert Europa in so vielen Hinsichten die Welt, vom demografischen Übergang über die Erschaffung neuer Politikformen bis hin zur Wiederbelebung der Natur. Wer weiß denn schon, dass es in Europa mit seinen fast 750 Millionen Einwohnern mehr Wölfe gibt als in den USA, inklusive Alaska?
Am erstaunlichsten aber dürfte sein, dass einige der für den Kontinent typischsten Arten, darunter seine größten wilden Säugetiere, Hybride sind. Denjenigen, die in Begriffen von »Reinblütern« und »Mischlingen« zu denken gewohnt sind, erscheinen Hybride oft als Irrtümer der Natur – als Gefahr für die genetische Reinheit. Neue Studien haben allerdings gezeigt, dass Hybridisierung für den evolutionären Erfolg von essenzieller Bedeutung ist. Vom Elefanten bis zur Zwiebel hat Hybridisierung die Weitergabe günstiger Gene ermöglicht, die es Organismen erlauben, in neuen und schwierigen Umgebungen zu überleben.
Einige Hybride weisen eine Vitalität und Tüchtigkeit auf, die bei keinem ihrer Elternteile vorzufinden ist, und einige Bastardarten (wie Hybride manchmal genannt werden) haben noch lange über das Aussterben ihrer Elternspezies hinaus überdauert. Die Europäer selbst sind Hybride, entstanden vor ungefähr 38 000 Jahren, als dunkelhäutige Menschen aus Afrika sich mit den hellhäutigen und blauäugigen Neandertalern zu vermischen begannen. Praktisch genau in dem Moment, in dem diese ersten Hybriden auftauchen, entsteht eine dynamische Kultur in Europa, zu deren Errungenschaften die erste bildende Kunst, die ältesten Menschenfiguren, die ersten Musikinstrumente sowie die früheste Domestizierung von Haustieren gehören. Allem Anschein nach waren die ersten Europäer sehr spezielle Bastarde. Lange davor war der europäische Artenreichtum allerdings dreimal durch Himmelskörper und tektonische Kräfte vernichtet worden.
Machen wir uns also daran, diesen Ort zu entdecken, der die Welt so sehr geprägt hat. Dafür werden wir auf diverse europäische Neuerungen zurückgreifen müssen – auf James Huttons Entdeckung der geologischen Zeitskala, auf Charles Lyells Grundprinzipien der Geologie, auf Charles Darwins Erläuterung des Prozesses der Evolution und auf H. G. Wells’ großartige imaginäre Erfindung, die Zeitmaschine. Bereiten Sie sich darauf vor, zu jenem Zeitpunkt in der Vergangenheit zurückzukehren, an dem Europa seine ersten zaghaften Eigenheiten zu entwickeln begann.
I
Der tropische Archipel
Von vor 100 Millionen bis vor 34 Millionen Jahren
Kapitel 1
Ziel: Europa
Wenn man eine Zeitmaschine steuert, muss man zwei Koordinaten festlegen: Zeit und Raum. Einige Teile Europas sind unvorstellbar alt, deshalb gibt es hier viele Möglichkeiten. Das Gestein des Baltischen Schildes ist über drei Milliarden Jahre alt und gehört damit zum ältesten der Welt. Das Leben bestand damals aus einfachen einzelligen Organismen, und in der Atmosphäre war noch kein freier Sauerstoff vorhanden. Zweieinhalb Milliarden Jahre später sind wir inmitten einer Welt mit komplexen Lebensformen, doch die Erdoberfläche liegt nach wie vor brach. Vor ungefähr 300 Millionen Jahren ist das Land dann zwar von Pflanzen und Tieren besiedelt, aber noch hat sich keiner der Kontinente aus der großen Landmasse namens Pangaea herausgelöst. Und auch noch nachdem Pangaea auseinandergebrochen war und fortan den südlichen Superkontinent Gondwana und sein nördliches Gegenstück Eurasien bildete, musste Europa erst noch zu einer selbständigen Entität werden. Tatsächlich entsteht eine zoogeografische Region Europa erst vor ungefähr 100 Millionen Jahren, in der letzten Phase des Zeitalters der Dinosaurier (der Kreidezeit).
Vor 100 Millionen Jahren war der Meeresspiegel viel höher als heute, und ein großer Ozean, bekannt als die Tethys (die entstand, als sich die Superkontinente Eurasien und Gondwana voneinander abspalteten), erstreckte sich von Europa bis nach Australien. Ein Seitenarm des Tethysmeers, die sogenannte Turgai-Straße, war eine wichtige zoogeografische Barriere, die Asien von Europa abschnitt. Der Atlantische Ozean war dort, wo es ihn überhaupt schon gab, nur sehr schmal. Im Norden wurde er von einer Landbrücke begrenzt, die Nordamerika und Grönland mit Europa verband. Diese Verbindung, die De-Geer-Landbrücke genannt wird, führte dicht am Nordpol vorbei, so dass die Kälte und die saisonale Dunkelheit die Anzahl der Arten begrenzte, die sie überqueren konnten. Im Süden war die Tethys von Afrika begrenzt, und ein Flachmeer bedeckte einen Großteil der heutigen Zentralsahara. Die geologischen Kräfte, die Arabien allmählich vom Ostrand Afrikas abspalten und den Großen Afrikanischen Grabenbruch hervorrufen sollten (wodurch sich der afrikanische Kontinent verbreitert hat), fingen gerade erst an, ihr Werk zu verrichten.
Der europäische Archipel von vor 100 Millionen Jahren befand sich ungefähr dort, wo heute Europa ist – östlich von Grönland, westlich von Asien und im Zentrum einer Region zwischen dem 30. und dem 50. Breitengrad nördlich des Äquators. Der naheliegendste Zielort für unsere Zeitmaschine wäre die Insel Baltica (die heute Teil des Ostseeraums ist). Als bei Weitem größte und älteste Insel des europäischen Archipels muss Baltica die urzeitliche Fauna und Flora Europas entscheidend geprägt haben. Doch bedauerlicherweise ist in der ganzen Landmasse niemals auch nur ein einziges Fossil aus der späten Phase des Dinosaurierzeitalters gefunden worden, so dass alles, was wir über das Leben auf Baltica wissen, von ein paar wenigen Überresten von Pflanzen und Tieren herrührt, die ins Meer gespült und dort in jenem Meeressediment überdauert haben, das jetzt in Schweden und im südwestlichen Russland an die Oberfläche tritt. Es wäre sinnlos, unsere Zeitmaschine in diese gespenstische Leere zu lenken.1
Wichtig zu wissen ist allerdings, dass gähnende Leerstellen in der Paläontologie der Regelfall sind. Um deren fundamentalen Einfluss zu erläutern, muss ich Signor-Lipps vorstellen – wobei es sich nicht um einen redseligen Italiener, sondern um zwei fachkundige Professoren handelt. Die US-Amerikaner Philip Signor und Jere Lipps taten sich 1982 zusammen, um einen bedeutenden Grundsatz der Paläontologie zu formulieren: »Da der Fossilbericht niemals vollständig ist, wird weder der erste noch der letzte Organismus in einem gegebenen Taxon als Fossil verzeichnet.«2 So wie die Alten den Mantel des Anstands über den entscheidenden Moment in der Geschichte von Europa und dem Stier legten, so hat, wie uns Signor-Lipps mitteilen, auch die Geologie den Augenblick der zoogeografischen Empfängnis Europas verschleiert – was für uns bedeutet, dass wir die Wählscheibe unserer Zeitmaschine auf einen Zeitpunkt zwischen 86 und 65 Millionen Jahren in der Vergangenheit einstellen müssen, als eine ausgesprochen vielfältige Reihe von Fossillagerstätten die Belege für ein vor Kraft strotzendes frühes Europa in sich aufgenommen haben. Diese Lagerstätten bildeten sich auf der Inselkette Modac, die sich südlich von Baltica erstreckte. Modac war lange in eine Region eingebettet, die Teile von fast einem Dutzend osteuropäischer Länder umfasst – von Mazedonien im Westen bis zur Ukraine im Osten. Zu Zeiten des Römischen Reichs befand sich diese große Fläche Land in den beiden weitläufigen Provinzen Mösien (moesia) und Dakien (dacia), von denen sich ihr Name ableitet.
Zum Zeitpunkt unserer Ankunft werden große Teile Modacs gerade von den ersten Regungen jener tektonischen Kräfte, die später die europäischen Alpen formen sollten, über die Wellen des Ozeans geschoben, während andere unter das Meer rutschen. Inmitten dieses Mahlstroms tektonischer Aktivität liegt die Insel Haţeg, ein Ort umgeben von unterseeischen Vulkanen, die periodisch die Erdoberfläche durchstoßen und Asche über das Land speien. Zum Zeitpunkt unseres Besuchs hat diese Insel bereits Millionen Jahre überdauert, wodurch dort eine einzigartige Fauna und Flora entstanden ist. Haţeg mit seinen ungefähr 80 000 Quadratkilometern, was in etwa der Größe der Karibikinsel Hispaniola entspricht, ist isoliert, liegt 27 Breitengrade nördlich des Äquators und ist von seinem nächsten Nachbarn, Bomas (der Böhmischen Masse), durch ungefähr 200 bis 300 Kilometer Tiefsee getrennt. Heute ist Haţeg ein Teil des in Rumänien gelegenen Transsilvaniens, und die dortigen Fossilienfunde zählen europaweit zu den umfangreichsten und vielfältigsten aus der letzten Phase des Dinosaurierzeitalters.
Öffnen wir nun die Tür unserer Zeitmaschine und betreten wir Haţeg, das Land der Drachen. Wir sind dort am Ende eines goldenen Herbstes angekommen. Die Sonne scheint zwar kräftig, steht in diesen Breiten allerdings ziemlich tief. Die Luft ist tropisch warm, und der feine weiße Sand eines hellen Strandes knirscht unter unseren Füßen. Die Vegetation in unserer Nähe ist eine Mischung aus niedrigen blühenden Sträuchern, während anderenorts Palmen- und Farnhaine von Ginkgo-Bäumen überragt werden, deren üppiges goldenes Laub bereits so reif ist, dass es von den ersten Windböen des nahenden milden Winters fortgeweht werden wird.3 Die großen, ausgewaschenen Flusstäler, die ihren Ursprung in den sich in der Ferne auftürmenden Gebirgen haben, weisen uns zudem darauf hin, dass es hier zumeist nur in bestimmten Jahreszeiten regnet.
Von einem trockenen Gebirgskamm aus erspähen wir Urwaldriesen, die den Zedern im Libanon ähneln. Diese Bäume aus der mittlerweile ausgestorbenen Gattung Cunninghamites sind tatsächlich Vertreter einer schon längst verschwundenen Zypressenart. In größerer Nähe zu uns liegt ein von Farnen umsäumtes Wasserloch, das mit Wasserlilien prangt und von Bäumen umgeben ist, die der bekannten Ahornblättrigen Platane (aus der Gattung Platanus) auffallend ähnlich sehen. Wasserlilien und Platanen sind Überlebende aus der Urzeit, und in Europa hat sich eine erstaunliche Anzahl solcher »pflanzlichen Dinosaurier« erhalten.4
Unser Blick wird nun vom Land auf das azurne Meer gelenkt, wo der Strand bedeckt ist mit etwas, was zunächst wie schillernde Lkw-Reifen aussieht, komplett mit Wellenprofil. Mit einer eigenartigen Schönheit erstrahlen sie in der tropischen Sonne. Irgendwo weit draußen auf dem Meer hat ein Sturm einen Schwarm Ammoniten getötet – meeresschneckenartige Geschöpfe aus der Teilgruppe der Kopffüßer, deren Gehäuse bis zu einem Meter Durchmesser aufweisen können –, und Wellen, Wind und Strömung haben ihre Schalen an Haţegs Küste getrieben.
Während wir über den glitzernden Sand wandern, bemerken wir einen Gestank. Vor uns liegt ein großer, mit Muscheln überzogener Klumpen, den die ablaufende Flut an Land gespült hat. Es ist ein Ungeheuer, ganz anders als alles, was heute lebt – ein Plesiosaurier. Die vier Flossen, die es einst kraftvoll fortbewegt haben, liegen jetzt flach und bewegungslos auf dem Sand. Aus dem fassartigen Körper ragt ein übermäßig langer Hals heraus, an dessen Ende sich ein winziger Kopf befindet, der immer noch in den Wellen baumelt.
Drei gigantische, vampirartige Gestalten mit ledriger Außenhaut, jede so groß wie eine Giraffe, watscheln aus dem Wald heraus. Das Trio, bösartig anmutend und enorm muskulös, umringt den Kadaver, den der größte der drei mit seinem drei Meter langen Schnabel mühelos enthauptet. Die Aasfresser umkreisen den toten Körper und verspeisen ihn mit wilden Hieben. Ernüchtert von diesem Schauspiel kehren wir in das sichere Innere unserer Zeitmaschine zurück.
Was wir gesehen haben, lässt uns erahnen, was für ein seltsamer Ort Haţeg ist. Die vampirartigen Ungetüme sind eine Art Flugsaurier, die unter der Bezeichnung Hatzegopteryx bekannt ist. Diese – und nicht irgendein mit vielen scharfen Zähnen bewaffneter Dinosaurier – waren die mächtigsten Raubtiere auf der Insel. Wären wir weiter ins Inland vorgedrungen, hätten wir möglicherweise ihre übliche Beute angetroffen – eine Reihe von Zwergsauriern. Haţeg war in doppelter Hinsicht ein seltsamer Ort: Seltsam für uns, weil er einer Zeit angehört, in der die Dinosaurier die Erde beherrschten, seltsam aber auch für das Dinosaurierzeitalter selbst, denn die Insel ist – wie der Rest des europäischen Archipels auch – eine isolierte Landfläche mit einer höchst ungewöhnlichen Ökologie und Fauna.
Kapitel 2
Haţegs erster Erforscher
Wie wir von Haţeg und ihren Geschöpfen erfahren haben, ist fast genauso erstaunlich wie dieses Land selbst. 1895 saß, während der irische Schriftsteller Bram Stoker seinen Roman Dracula schrieb, ein realer transsilvanischer Adliger namens Franz Baron Nopcsa von Felső-Szilvás auf seinem Schloss und war besessen, nicht von Blut allerdings, sondern von Knochen. Die Knochen, um die es hier geht, waren ein Geschenk seiner Schwester Ilona, die sie bei einem Spaziergang an einem Flussufer auf den Ländereien der Nopcsa-Familie gefunden hatte. Fraglos waren sie sehr, sehr alt. Heute ist das Schloss der Familie Nopcsa in Szacsal eine Ruine; 1895 jedoch war es ein elegantes zweistöckiges Anwesen mit Möbeln aus Walnussholz, einer großen Bibliothek und einem geräumigen Vergnügungssaal, auf dessen edle Ausstattung man auch heute noch durch die zerbrochenen Fensterscheiben einen Blick erhaschen kann. Obgleich er für gehobene europäische Standards bescheiden war, warf der Familienbesitz doch genügend Einnahmen ab, damit sich der junge Nopcsa seiner Leidenschaft für alte Knochen widmen konnte.
Nopcsa sollte einer der außergewöhnlichsten Paläontologen aller Zeiten werden, ist heute allerdings vollkommen in Vergessenheit geraten. Seine intellektuelle Reise begann, als er, die geschenkten Knochen in Händen, sein Schloss verließ und sich für ein wissenschaftliches Studium an der Wiener Universität einschrieb. Dort arbeitete er zumeist allein und stellte bald schon fest, dass die Knochen, die seine Schwester gefunden hatte, zum Schädel einer kleinen primitiven Art der Entenschnabelsaurier gehörten.1 Fasziniert machte sich der Baron an sein Lebenswerk: die Toten von Haţeg wieder zum Leben zu erwecken.
Der Universalgelehrte, Einzelgänger und Exzentriker sah viele Dinge klarer als andere, beschrieb sich aber dennoch als unter »zerrütteten Nerven« leidend. 1992 bemerkte Dr. Eugene Gaffney, eine unübertroffene Autorität in Sachen fossile Schildkröten, über Nopcsa, dass »er in seinen klaren Episoden seine geistige Aktivität auf die Erforschung von Dinosauriern und anderen fossilen Reptilien gerichtet hat«, es in den Phasen zwischen diesen brillanten Momenten aber durchaus auch zu von Dunkelheit und Überspanntheit geprägten Zeiten kam.2 Heute würde man bei ihm vermutlich eine bipolare Störung diagnostizieren. Doch worin auch immer sein Leiden bestand, es sorgte dafür, dass ihm jeder Sinn für Etikette abging. Tatsächlich legte er nur allzu oft »ein kolossales Talent zur Unhöflichkeit« an den Tag.3
Ein vielsagendes Beispiel dafür wird von Dr. Tilly Edinger berichtet, jener Pionierin der Erforschung fossiler Gehirne, die in den fünfziger Jahren eine Studie über Nopcsa anfertigte. In seinem ersten Jahr an der Universität hatte dieser eine Beschreibung seines Dinosaurierschädels publiziert – eine beachtliche Leistung. Und als er Louis Dollo traf, den renommiertesten Paläontologen seiner Zeit und ebenfalls Aristokrat, krähte der junge Baron: »Ist es nicht wundervoll, dass ich, ein so junger Mann, so eine exzellente Denkschrift verfasst habe?«4Dollo sollte ihm später ein zweifelhaftes Lob widmen, indem er sich an Nopcsa als einen »Kometen« erinnerte, »der über unsere paläontologischen Himmel saust und dabei nur ein diffuses Licht abstrahlt«.5
An der Wiener Universität blieb Nopcsa anscheinend weithin ohne akademische Betreuung. Isoliert von seinen Kollegen, ging seine Unabhängigkeit sogar so weit, dass er einen Klebstoff für die Reparatur seiner Fossilien erfand. Einen Kollegen hatte er allerdings, nämlich Professor Othenio Abel, mit dem er sein Interesse an der Paläobiologie teilte. Abel war ein Faschist, der eine aus 18 Professoren bestehende geheime Gruppe ins Leben rief, die auf die Zerstörung der Forscherkarrieren von »Kommunisten, Sozialdemokraten und mit den beiden verbündeten Juden und wieder Juden« hinarbeitete, und kam fast ums Leben, als ein Kollege, Professor K. C. Schneider, ihn zu erschießen versuchte. Als die Nazis an die Macht kamen, wanderte Abel nach Deutschland aus. Als er Wien 1939 nach dem sogenannten Anschluss einen Besuch abstattete, sah er die Nazifahne auf der Universität flattern und erklärte diesen Tag zum glücklichsten seines Lebens. Nopcsa hatte seine eigene Weise, mit Abel umzugehen. Als er erkrankte, rief er Abel in seine Wohnung und befahl einem der größten Paläontologen Europas (der gleichwohl ein recht gewöhnlicher Mensch war), seinem Geliebten ein abgetragenes Paar Handschuhe und einen Mantel zu bringen.6
Während Nopcsa seine Dinosaurier studierte, entflammte eine zweite große Leidenschaft in seinem Herzen. Bei seinen Reisen durch die transsilvanische Provinz hatte er nämlich Graf Draŝković kennen- und lieben gelernt. Dieser, zwei Jahre älter als Nopcsa, war als Abenteurer durch Albanien gezogen, einen Ort, der auch noch ein Jahrhundert nach Byrons Stippvisite exotisch, dunkel und tribal anmutete. Unter dem Eindruck der Geschichten, die ihm sein Liebhaber erzählte, unternahm Nopcsa einige privat finanzierte Reisen in das Land, wo er unter den Stämmen lebte, sich mit ihren Sprachen und Traditionen vertraut machte und sogar in ihre Auseinandersetzungen hineingeriet. Ein Foto zeigt ihn in seinem Pomp, bewaffnet und gekleidet im speziellen Ornat eines Shqiptarenkriegers. Auch wenn er also unbändig romantisch war, so war Nopcsa doch zugleich auch höchst wissbegierig und ein gewissenhafter Berichterstatter, der bald als der führende europäische Experte für die Geschichte, Sprache und Kultur Albaniens galt.
Als er 1906 in Albanien unterwegs war, stieß Nopcsa auf Bajazid Elmaz Doda, einen Schäfer, der hoch in den Verwunschenen Bergen des Landes lebte. Ihn stellte er als seinen Sekretär ein und vertraute seinem Tagebuch an, dass Doda »der einzige Mensch seit Graf Draŝković ist, der mich wirklich geliebt hat«.7 Seine Beziehung mit Doda sollte fast 30 Jahre dauern, und 1923 ehrte Nopcsa ihn, indem er eine eigenartige fossile Schildkröte nach ihm benannte: Kallokibotion bajazidi – die »schöne und runde Bajazid«.
Die Knochen dieser Schildkröte sind neben denen von Dinosauriern auf den Ländereien der Familie gefunden worden. Mit einem halben Meter Länge war Kallokibotion eine mittelgroße amphibische Kreatur, die von ihrem Erscheinungsbild her eine gewisse Ähnlichkeit zu den heutigen Sumpfschildkröten aufweist. Die Knochenanatomie von Kallokibotion zeigte allerdings, dass sie sehr anders war als jede lebende Spezies und zu einer urzeitlichen und mittlerweile ausgestorbenen Gruppe primitiver Schildkröten gehörte, deren letzte Vertreter aus der wundersamen Gattung der Meiolania kamen.
Die Meiolaniiden überlebten in Australien bis zum Auftreten der ersten Aborigines vor ungefähr 45 000 Jahren. Die Vertreter dieser Gattung waren riesige Landtiere von der Größe eines Kleinwagens, deren Schwänze sich in knöcherne Keulen verwandelt hatten, während ihre Köpfe große, zurückgebogene Hörner trugen, ähnlich wie die von Rindern. Es ist wahrscheinlich, dass die ersten Australier beinahe die allerletzten Nachfahren von Bajazids »schöner und runder« Schildkröte erledigt haben. Doch ein paar von ihnen gelangten über das Meer auf die warmen, feuchten und tektonisch aktiven Inseln von Vanuatu. In der Abgeschiedenheit ihres Einsiedlerkönigreichs überdauerten die Meiolaniiden – bis ihr Land zum zweiten Mal entdeckt wurde, dieses Mal von den Vorfahren der Ni-Vanuatu, den heutigen Bewohnern dieser Inseln. Eine kompakte Schicht aus zerlegten und gekochten Meiolaniidenknochen, ungefähr 3000 Jahre alt, markiert die Ankunft von Menschen. Und so verschwand eine der letzten Spuren des Landes Modac – ja fast der letzte Nachhall jenes versunkenen Archipels überhaupt.
Bajazid, Albanien und Fossilien waren die wesentlichen Konstanten in Nopcsas Leben, und nur zu einem dieser drei sollte seine Liebe vergehen. Seine Beschäftigung mit Albanien erreichte ihren Höhepunkt kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, als er den verwegenen, von vornherein zum Scheitern verurteilten Plan verfolgte, in das Land einzufallen und dessen erster König zu werden.8 Diesen Ablenkungen zum Trotz steckte Nopcsa auch weiterhin bis über beide Ohren in seiner Paläontologie und verfasste 1914 eine Arbeit über die Lebensweise der transsilvanischen Dinosaurier, die das Bild des frühen Europas revolutioniert hat.9 Sein wissenschaftlicher Ansatz zeichnete sich dadurch aus, dass er seine Fossilien als Überreste lebender Wesen analysierte, die in spezifischen Habitaten lebten und auf die Bedingungen ihrer Umwelt reagierten. Er war faktisch der erste Paläobiologe der Welt.
Nopcsa bewies, dass Haţeg nur von zehn Arten großer Lebewesen bevölkert war. Zu diesen zählte ein kleiner fleischfressender Dinosaurier, von dem wir durch zwei seiner Zähne wissen (die beide nacheinander verloren gingen) und den der Baron Megalosaurus hungaricus taufte. Megalosaurus ist ein fleischfressender Dinosaurier, dessen Fossilien tatsächlich überall in Europa zu finden sind, allerdings in älterem Gestein. Seine Präsenz auf Haţeg erschien anomal, und bald schon wurde nachgewiesen, dass Megalosaurus hungaricus einer der seltenen Irrtümer des jungen Forschers war.
Es ist eine eigenartige wissenschaftliche Tatsache – die an dieser Stelle einen kleinen Exkurs wert ist –, dass der früheste wissenschaftliche Name für Megalosaurus tatsächlich Scrotum lautete. Diese Geschichte beginnt mit dem ersten Dinosaurierfossil überhaupt, das beschrieben und gezeichnet worden ist, und zwar vom ehrwürdigen Robert Plot im Jahr 1677.10 Seine Natural History of Oxfordshire (»Naturgeschichte von Oxfordshire«) war wohl die erste moderne englischsprachige Naturgeschichte und behandelte ganz im Stile der Zeit alles von den Pflanzen, Tieren und Gesteinen der Grafschaft bis hin zu den markanten Gebäuden und sogar einigen berühmten Predigten, die in ihren Kirchen gehalten wurden. Plot identifiziert das Fossil korrekt als das Ende eines Oberschenkelknochens. Vielleicht, so spekulierte der Autor, stammte es ursprünglich von einem der Elefanten, die im Zuge des vermeintlichen Besuchs des römischen Kaisers Claudius in Gloucester nach Großbritannien verschifft worden waren, als dieser (Plot zufolge) die Stadt wiederaufbauen ließ »im Gedenken an die Eheschließung seiner schönen Tochter Gennissa mit dem damaligen britischen König Arvirargus, wobei er möglicherweise einige seiner Elefanten mit sich führte«. Dummerweise konnte Plot allerdings keine Aufzeichnungen über Elefanten nachweisen, die näher an Gloucester herangekommen wären als bis nach Marseille.11
Nach einer langen und profunden Untersuchung kam Plot zu der Schlussfolgerung, dass der Knochen, der in der Nähe eines Friedhofs gefunden worden war, von einem Riesen stammen könnte. Wie viele seiner Zeitgenossen war nämlich auch er der Überzeugung, dass das von Geoffrey von Monmouth im 12. Jahrhundert verfasste Werk The History of the Kings of Britain (»Die Geschichte der Könige Britanniens«) auf soliden Tatsachen beruhe. Und die Anziehungskraft der klassischen europäischen Antike ist so stark, dass Geoffrey von Monmouth seine historische Darstellung mit einer Anspielung auf Vergil beginnen lässt, in der Brutus, ein Abkömmling des Trojaners Aeneas, an Albions Küsten landet, um sich mit den ursprünglichen Bewohnern der Insel, den »Riesen von Albion«, zu versippen, und auf diese Weise die britische Rasse begründet.
Plot gab dem Relikt keinen wissenschaftlichen Namen, und so blieb es bis 1763, als ein gewisser Richard Brookes Plots bildliche Darstellung in seinem eigenen Buch namens A New and Accurate System of Natural History (»Ein neues und genaues System der Naturgeschichte«) wiederabdruckte.12Brookes, der anscheinend ebenfalls Geoffrey von Monmouth Glauben schenkte,13 war nicht der Auffassung, dass der von Plot abgebildete Klumpen Teil eines Knochens war. Er identifizierte ihn vielmehr als ein Paar gewaltige menschliche Testikeln. Mit den Riesen von Albion im Kopf und vielleicht von der Vorstellung verzückt, er könnte auf ebenjene Hoden gestoßen sein, die die erste Königin Britanniens begattet hatten, bezeichnete Brookes das Fossil als Scrotum humanum. Da er dem Linné’schen System folgte, blieb dieser Name der wissenschaftlich korrekte. Und Brookes’ Bestimmung war ganz offensichtlich überzeugend; so behauptete der französische Philosoph Jean-Baptiste Robinet, er könne in der versteinerten Masse die Muskulatur der Hoden und sogar die Überreste einer Harnröhre ausmachen.
Im 19. Jahrhundert war der Glaube an die Korrektheit von Geoffrey de Monmouth’ Auffassungen abgeflaut und die wissenschaftliche Erforschung der Dinosaurier weiter vorangeschritten. 1842 prägte der Anatom Sir Richard Owen, ein auf die wissenschaftlichen Leistungen anderer eifersüchtiger Mensch, der auch nicht davor zurückschreckte, die frühere Namensvergabe für interessante Fossilien zu ignorieren, den Begriff »Dinosauria«. Ob er vom Scrotum wusste, ist unklar; der Wirbel rund um Owens »Entdeckung« war aber so groß, dass Brookes’ Beschreibung mehr als ein Jahrhundert lang verloren war. Sogar der Knochen selbst verschwand. Plots Zeichnung machte es allerdings möglich, diesen zweifelsfrei als vom fleischfressenden Dinosaurier Megalosaurus stammend zu identifizieren, dessen Überreste in den Sedimenten des Jura in Großbritannien keine Seltenheit sind.
Die Wissenschaft der Taxonomie schreibt ihre eigene Geschichte, so dass der Verlust einer realen Probe mit Blick auf gültige wissenschaftliche Namen ohne Bedeutung ist. Im Zentrum dieser Wissenschaft steht ein kleines grünes Buch mit dem Titel The International Code of Zoological Nomenclature (»Die Internationalen Regeln für die Zoologische Nomenklatur«).14 Die Taxonomie folgt – wie das Erbrecht – einem Grundsatz des Erstgeburtsrechts, der besagt, dass der erste ordnungsgemäß festgelegte wissenschaftliche Name Vorrang vor allen anderen hat.15 Zum Bedauern all derer, denen die Vorstellung, Dinosaurier als Hodensäcke zu bezeichnen, nicht zusagt, verbietet es der Code nicht, Namen von Köperteilen zu verwenden. Tatsächlich nannte sogar der große Linné selbst eine tropische Pflanze Clitorea, nämlich aufgrund der Form ihrer leuchtend blauen Blüten. Eine Klausel in den Statuten des Codes besagt jedoch, dass, wenn ein Name seit 1899 nicht mehr verwendet worden ist, er als nomen oblitum oder vergessener Name betrachtet und damit verworfen werden kann. Eine solche Festlegung ist allerdings willkürlich.16
Als der britische Paläontologe Lambert Beverly Halstead im Jahr 1970 darauf aufmerksam machte, dass Scrotum ein wissenschaftlich gültiger und zudem der erste jemals für einen Dinosaurier vorgeschlagene Name war, ging ein Schaudern durch die ansonsten so behäbige Gemeinschaft der Taxonomen. Dass Halstead im Übrigen offenbar besessen war von Dinosauriersex, trug ebenfalls nicht zur Entspannung der Lage bei. Sein bemerkenswertestes Werk ist ein illustriertes Handbuch über die Paarungspositionen von Dinosauriern – eine Art reptilisches Kamasutra –, das unter anderem für die Sauropoden, die größten Dinosaurier überhaupt, ein »Bein-drüber«-Manöver beschreibt, das viele für höchst zweifelhaft halten. Bei mindestens zwei Gelegenheiten begab sich Halstead auch auf eine Bühne, um gemeinsam mit seiner Ehefrau einige der obskureren Stellungen vorzuführen.17
Transsilvanien wurde am Ende des Ersten Weltkriegs von Österreich-Ungarn an Rumänien abgetreten, und Baron Nopcsa verlor sein Schloss, seine Ländereien und sein Vermögen. Zur Wiedergutmachung wurde ihm die Position des Direktors am großartigen Geologischen Institut in Bukarest angeboten. Doch der Verlust war zu groß, so dass er den Großteil seiner Zeit damit verbrachte, Einfluss auf die Regierung zu nehmen, damit diese ihm sein Lehen zurückgab. 1919 stimmte sie seinem Begehren zu, doch als der Baron nach Szacsal zurückkehrte, verprügelten ihn seine ehemaligen Leibeigenen heftig und zwangen ihn dazu, seinen Erbbesitz zum zweiten Mal aufzugeben.
Eine Zeit lang war Nopcsa an den Rollstuhl gefesselt, und als er spürte, wie seine Kräfte nachließen, ließ er sich »steinachisieren«. Diese Operation, die in einer extremen Variante einer einseitigen Vasektomie bestand, war von Dr. Eugen Steinach als Mittel gegen Erschöpfung und nachlassende männliche Potenz erfunden worden.18Nopcsa schwärmte zwar von deren wunderbaren Auswirkungen auf seine sexuelle Leistungsfähigkeit, doch den Rest seines Körpers verjüngte dieses Mittel nicht, wie sich 1928 bei einer Zusammenkunft der deutschen Paläontologischen Gesellschaft zeigte, in deren Rahmen Nopcsa einen »brillanten Vortrag« über die Schilddrüse diverser ausgestorbener Lebewesen hielt. Tilly Edinger, die an diesem Treffen teilnahm, erinnerte sich später: »Er wurde zwischen uns geschoben, zurückgelehnt in einem Rollstuhl und gelähmt von Kopf bis Fuß […] und schloss mit den Worten: ›Heute habe ich mit schwacher Hand versucht, einen schweren Vorhang zur Seite zu ziehen, um Ihnen einen neuen Tagesanbruch zu zeigen. Zieht kräftig, vor allem ihr Jüngeren; ihr werdet sehen, wie das Morgenlicht stärker wird, und ihr werdet Zeugen eines neuen Sonnenaufgangs sein.‹«19
Unfähig dazu, sein Institut zu reformieren, trat Nopcsa vom Amt des Direktors zurück und verarmte weiter. Er verkaufte seine Fossiliensammlung an das British Museum und fing an, Europa auf seinem Motorrad zu bereisen, Bajazid dabei immer auf dem Sozius. Das Ende kam, als er gerade mit der Erforschung von Erdbeben befasst war und mit Bajazid in einer Wohnung in der Singerstraße 12 in Wien lebte. Der große US-amerikanische Dinosaurierexperte Edwin H. Colbert beschreibt die Szene so: »Am 25. April 1933 zerbrach etwas in Nopcsa. Er reichte seinem Freund Bajazid eine Tasse Tee mit Schlafmittel. Daraufhin ermordete er den schlafenden Bajazid, indem er ihm mit einer Pistole in den Kopf schoss.«20
Nopcsa schrieb einen Abschiedsbrief und erschoss sich dann selbst, womit er seinem Adelsgeschlecht den Garaus machte. In diesem Brief erklärte er, dass er unter »einem totalen Zusammenbruch meines Nervensystems« leide. Idiosynkratisch bis zum Schluss, hinterließ er der Polizei noch die Anweisung, dass es »ungarischen Akademikern« strikt verboten werden sollte, um ihn zu trauern. Seine Kremierung – bei der er in seine lederne Motorradkluft gekleidet war – hätte einem Wikingerhäuptling alle Ehre gemacht.21 Bajazid wurde dagegen im muslimischen Bereich des örtlichen Friedhofs beigesetzt.
Kapitel 3
Zwergenhafte, degenerierte Dinosaurier
Unter den Knochen, die Nopcsa auf seinem Gut gesammelt hat, befanden sich auch die Überreste eines Sauropoden – eines schwerfälligen, langhalsigen Dinosauriers vom Typ Brontosaurus. Verglichen mit seinen Verwandten war er, der nur die Größe eines Pferdes hatte, allerdings winzig. Zu den am häufigsten vertretenen Arten zählten ein kleiner gepanzerter Dinosaurier (Struthiosaurus) und der kleine Entenschnabelsaurier Telmatosaurus, der nur fünf Meter lang war und 500 Kilogramm wog. Die Insel Haţeg war außerdem die Heimat eines ausgestorbenen drei Meter langen Krokodils und natürlich die von Bajazids schöner, runder Schildkröte.
Nopcsas Dinosaurier waren nicht nur klein von Wuchs, sondern auch primitiv. Um sie zu beschreiben, verwendete er Ausdrücke wie »armselig« und »degeneriert«.1 Eine solche Redeweise war zu Beginn des 20. Jahrhunderts ungewöhnlich. Andere europäische Wissenschaftler behaupteten, dass die Fossilien aus ihrem Land die größten, besten oder ältesten ihrer Art seien (und dies manchmal, wie im Falle des britischen Piltdown-Menschen, in betrügerischer Absicht). So entdeckte man zum Beispiel kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs in den deutschen Kolonien in Ostafrika ein riesiges Sauropodenskelett. Dieses wurde im Berliner Museum für Naturkunde aufgestellt, wo es der alte Klaus Zimmermann, Leiter der Säugetierabteilung, noch in den sechziger Jahren amerikanischen Besuchern genüsslich vorführte, »to show zem zat zey haven’t got a bigger one« (»um ihnen zu zeigen, dass sie kein größeres haben«).2
Tatsächlich war es im Zeitalter des Imperialismus nichts Ungewöhnliches, eine andere Nation dadurch herabzusetzen, dass man behauptete, ihre Geschöpfe seien klein oder primitiv. Als der Franzose Comte de Buffon, der Vater der modernen Naturgeschichtsschreibung, 1781 in Paris mit Thomas Jefferson zusammentraf, behauptete er, der amerikanische Hirsch und andere Tiere des Landes seien zu klein, kümmerlich und degeneriert ebenso wie die männlichen menschlichen Bewohner Amerikas, über die er schrieb: »[D]ie Zeugungsorgane sind klein und schwächlich. Er hat keine Haare, keinen Bart und keinen Eifer für das Weib.«3Jefferson war erzürnt. Stärker denn je dazu entschlossen, die Überlegenheit alles Amerikanischen zu demonstrieren, schickte er nach Vermont um ein Elchfell und ein Geweih von maximaler Größe und war beschämt, als nur ein verschimmelter Kadaver geliefert wurde, bei dem sich das Fell schon von der Haut löste, und dazu das Geweih eines nur kleinen Tieres.
Nopcsa scheint von einem solchen zweifelhaften Nationalismus unbeleckt geblieben zu sein. Er arbeitete mit großer Umsicht an seinen Proben und wollte verstehen, warum sie kleiner waren als anderenorts entdeckte Dinosaurier, und er war der erste Forscher, der von fossilisierten Knochen dünne Scheiben abschnitt, wodurch gezeigt werden konnte, dass die Saurier Transsilvaniens nur sehr langsam gewachsen sind. Die Wissenschaft der Zoogeografie steckte zwar noch in ihren Kinderschuhen, doch es war bereits bekannt, dass Inseln als Rückzugsorte für alte, langsam wachsende Kreaturen dienen konnten und begrenzte Ressourcen gegebenenfalls dafür sorgten, dass die Inselbewohner über die Generationen hinweg immer kleiner wurden. So gelangte Nopcsa zu der Feststellung, dass die spezifischen Eigenarten seiner Fossilien durch eine einzige Tatsache erklärt werden konnten: Sie waren die Überreste von Lebewesen, die auf einer Insel gelebt hatten. Im Folgenden sollte er sich daranmachen, die Saurierfauna in ganz Europa zu untersuchen, und stieß dabei überall auf die Merkmale von »Verarmung und Degeneration«. Auf dieser Grundlage argumentierte er, dass ganz Europa zur Zeit der Dinosaurier ein Archipel gewesen sein musste. Diese grundlegende Erkenntnis ist das Fundament, auf dem die gesamte Erforschung der europäischen Fossilien vom Ende des Dinosaurierzeitalters an basiert. Und trotzdem wurde Nopcsa ignoriert. Sein fehlender europäischer Chauvinismus, seine offen ausgelebte Homosexualität und seine erratische Persönlichkeit haben zweifellos zu seinen Akzeptanzproblemen beigetragen.
Nicht alle Dinosaurier Europas sind Pygmäen. Die, die während der Jurazeit (also vor Nopcsas Sauriern) gelebt haben, konnten tatsächlich sehr groß werden. Allerdings bewohnten diese ein Europa, das Teil eines Superkontinents war. Auch jene, die die europäischen Inseln über das Meer erreichten, konnten groß sein, obgleich deren Nachfahren im Zuge ihrer Anpassung an ihre insulare Heimat über Tausende Generationen hinweg immer kleiner wurden.
Ein wunderbares Beispiel für einen europäischen Dinosaurier in voller Größe ist der zweifüßige Pflanzenfresser Iguanodon bernissartensis. Dutzende artikulierte Skelette dieser schwerfälligen Kreatur, jedes davon bis zu zehn Meter lang, fand man im Jahr 1878 in 322 Metern Tiefe in einer belgischen Kohlengrube. Die Knochen, die von Louis Dollo (dem gegenüber Nopcsa mit seiner ersten Veröffentlichung geprahlt hatte) montiert wurden, stellte man zuerst in der aus dem 15. Jahrhundert stammenden St.-Georgs-Kapelle in Brüssel aus, einem prunkvollen Oratorium, das sich einst im Besitz des Prinzen von Nassau befunden hatte. Diese Präsentation war so beeindruckend, dass die Deutschen, als sie Belgien im Ersten Weltkrieg besetzten, die Ausgrabungen in der Kohlengrube fortsetzten und kurz davorstanden, auf die knochenhaltige Schicht zu stoßen, als die Alliierten Bernissart zurückeroberten. Die Arbeiten wurden eingestellt, und trotz weiterer Bemühungen, zu den Fossilien vorzustoßen, wurde die Mine 1921 geflutet, und alle Hoffnung war verloren.
Durch die Entwicklung neuer Technologien ist es den Paläontologen möglich geworden, mehr über das Leben auf Haţeg herauszufinden, als es Nopcsa jemals möglich gewesen war. Eine der wichtigsten davon war die Verwendung feiner Siebe zum Aufspüren der Knochen winziger Lebewesen, darunter die primitiver Säugetiere. Manche von ihnen, so etwa die Kogaioniden, legten wahrscheinlich Eier und hüpften wie Frösche. Man stieß auf die Knochen seltsamer Amphibien namens Albanerpetontiden, der Urahnen der Geburtshelferkröten, die zu den ältesten Lebewesen Europas gehören, ebenso auf die von als Madtsoiiden bezeichneten pythonähnlichen Schlangen, terrestrisch lebender Krokodile mit gezackten Zähnen, beinloser Echsen, urtümlicher skinkartiger Geschöpfe sowie auf die Knochen von Rennechsen. Sowohl die Schlangen aus der Gruppe der Madtsoiiden als auch die zackenzahnigen Krokodile überlebten in Australien bis zum Auftreten des Menschen auf dem Inselkontinent. Dies ist ein vertrautes Phänomen – das alte Europa, das bis in die Gegenwart in Australasien fortlebt.
2002 gaben Forscher die Entdeckung von Hatzegopteryx bekannt, des Spitzenprädators der Insel – jener Geschöpfe also, die wir erblickt haben, als wir aus unserer Zeitmaschine gestiegen sind.4 Im Unterschied zu den Dinosauriern passte sich der Hatzegopteryx an das Inselleben an, indem er riesengroß wurde. Vermutlich war er der größte Kurzschwanzflugsaurier, den es je gab. Dieses Wesen ist uns zwar nur durch einen Teil des Schädelknochens, des Oberarmknochens (Humerus) und einen Halswirbel bekannt, doch das reicht aus dafür, dass Paläontologen seine Flügelspannweite auf zehn bis zwölf Meter und seinen Schädel auf eine Länge von über drei Meter schätzen konnten. Hatzegopteryx war groß genug, um die Dinosaurier Haţegs zu töten, und sein massiver, dolchartiger Schnabel lässt vermuten, dass er seine Beute nach Art eines Storches gefangen hat.5 Vielleicht war er flugfähig, höchstwahrscheinlich verbrachte er seine Zeit auf der Insel aber auf seinen Handgelenken kriechend, während sich seine großen ledernen Flügel wie ein Leichentuch um seinen Körper legten. Ein gigantischer Nosferatu kommt einem hier in den Sinn. Wie Nopcsa – und bestimmt auch Bram Stoker – diese bizarre Kreatur gefallen hätte!
Kapitel 4
Inseln an den Knotenpunkten der Welt
Die Fauna des Dinosaurierzeitalters auf der Insel Haţeg ist die am eindeutigsten charakterisierbare, die wir kennen. Doch Haţeg ist nur ein Teil der Geschichte Europas zu jener Zeit. Um das ganze Bild zusammenfügen zu können, müssen wir noch weiterreisen. Nachdem wir Haţegs Küsten Richtung Süden verlassen haben, überqueren wir die riesigen tropischen Weiten des Tethysmeers. In seinem flachen Wasser bilden heute ausgestorbene Muscheln, Rudisten genannt, ausgedehnte Betten. Zudem wuselt es nur so vor Meeresschnecken, die Actaeonelliden heißen und deren größte Exemplare, geformt wie Artilleriegeschosse, die ganze Hand ausfüllen würden. Die Gehäuse dieser Raubschnecken waren außerordentlich dick. Sie gediehen prächtig auf den von den Rudisten gebildeten Riffs und gruben im Boden, wo immer es die Sedimente erlaubten. Sie waren in solchen Massen vorhanden, dass im heutigen Rumänien ganze Hanglagen – Schneckenhügel genannt – aus ihren Fossilien bestehen. Neben den Ammoniten und den großen Meeresreptilien wie etwa den Plesiosauriern gab es in der Tethys auch zahlreiche Meeresschildkröten und Haie.
Nördlich des Archipels existierte ein Ozean ganz anderer Art. Es gab praktisch keine Spezies, die dort ebenso vorkam wie in der warmen Tethys – seine Ammoniten zum Beispiel waren von vollkommen anderer Art. Das Borealmeer war weder tropisch, noch war sein Wasser klar und einladend. Vielmehr war es angefüllt mit einer goldbraunen Alge namens Coccolithophorida, deren Skelette später jenen Kalkstein bilden sollten, der heute Teile Großbritanniens, Belgiens und Frankreichs unterlagert. Die meisten Überreste der Coccolithophoriden, aus denen der Kalkstein besteht, sind zerbröselt – sie müssen von einem bis heute unbekannten Räuber gefressen und ausgeschieden worden sein.1
Wenn die Coccolithophoriden, die im Borealmeer so reichlich vorhanden waren, auch nur ungefähre Ähnlichkeiten mit Emiliania huxleyi (Ehux), ihrer heute am weitesten verbreiteten Vertreterin, aufweisen, dann können wir eine Menge über das Erscheinungsbild dieses Ozeans in Erfahrung bringen. Wo Auftrieb oder andere Nährstoffquellen es Ehux ermöglichen, sich stark zu vermehren, da kann sie als Algenblüte so stark wuchern, dass der Ozean milchig wird. Zudem reflektiert Ehux Licht, staut die Wärme in den oberen Wasserschichten des Ozeans und produziert Dimethylsulfid, eine chemische Verbindung, die an der Wolkenbildung beteiligt ist. Das Borealmeer dürfte mit seinem milchigen Oberflächenwasser voller Organismen, die sich am Plankton labten, während ein wolkenverhangener Himmel alles vor Überhitzung und schädlicher ultravioletter Strahlung abschirmte, ein unglaublich produktiver Ort gewesen sein.
Wie seltsam Europa gegen Ende des Zeitalters der Dinosaurier tatsächlich war, lässt sich kaum übertreiben. Es war ein geologisch komplexer und dynamischer Inselbogen, dessen einzelne Landflächen sich aus urzeitlichen Kontinentalfragmenten, aufgestiegenen Segmenten ozeanischer Erdkruste sowie aus von vulkanischer Aktivität neu erzeugtem Land zusammensetzten. Selbst in diesem frühen Stadium übte Europa bereits einen überproportional großen Einfluss auf den Rest der Welt aus, der zum Teil von der sich ausdünnenden Erdkruste unter ihm herrührte. Als Hitze an die Oberfläche drang, warf sie den Meeresboden zu Gebirgskämmen zwischen den Inseln auf. Und diese Verflachung, die durch die Entstehung von Mittelozeanischen Rücken im Zuge des Auseinanderbrechens der Superkontinente noch verstärkt wurde, führte dazu, dass die Weltmeere über die Ufer traten, wodurch sich die Konturen der Kontinente veränderten und fast alle der europäischen Inseln in den Fluten versanken.2 Der langfristige Trend hingegen wies in die Richtung der Entstehung von mehr Landfläche dort, wo später Europa liegen sollte.
Wie Caesars Gallien kann auch der europäische Archipel im ausklingenden Dinosaurierzeitalter in drei Teile geteilt werden. Das große, im Norden gelegene Land Baltica und sein südlicher Nachbar Modac bildeten den Hauptteil. Südlich davon lag eine äußerst vielgestaltige und sich rasch wandelnde Region, die wir die Seelande nennen wollen und die die fernen Inselgruppen von Pontus, Pelagonien und Taurus umfasste. Mehr als 50 Millionen Jahre später sollten sie in jene Landflächen eingehen, die heute das östliche Mittelmeer säumen.
Westlich dieser beiden großen Reiche befand sich noch ein dritter Teil. Verstreut auf dem Längengrad zwischen Grönland und Baltica lag ein Gefüge von Landflächen. Mangels eines allgemein anerkannten Namens wollen wir diese Region Gaelien (nach den Gälischen Inseln und Iberien) nennen. Diese gallo-iberischen Inseln, die aus den Gälischen Inseln (Proto-Irland, Schottland, Cornwall und Wales) bestanden und sich bis zum afrikanischen Bereich Gondwanas erstreckten (und dabei Teile des heutigen Frankreichs, Spaniens und Portugals umfassten), bildeten eine Region mit vielen Gesichtern. Wir wollen an zwei Orten in Gaelien landen, wo es überaus reichhaltige Fossilienfunde gibt.
Unsere Zeitmaschine platscht in ein flaches Meer nahe der Stelle, wo heute die westfranzösische Landschaft der Charente liegt. Wir finden uns an der Mündung eines schmalen Flusses wieder, dessen Strömung durch die Trockenzeit zum Erliegen gekommen ist. Eine skinkähnliche Echse (eine der frühesten Skinke überhaupt) trippelt über das Seegras hinweg, das den Strand säumt, und in einem Wasserloch beginnt sich das ruhige, grüne Wasser plötzlich zu kräuseln. Eine kleine, schweineähnliche Schnauze stößt durch die Wasseroberfläche, bevor sie wieder in die Tiefe sinkt. Es ist eine Papua-Weichschildkröte; von ihr existiert heute nur noch eine einzige Art, die in den Flüssen des südlichen Neuguineas und im australischen Arnhemland lebt.
Als wir unseren Blick über die gälische Küste schweifen lassen, entdecken wir große Halswender-Schildkröten beim Sonnenbaden. Diese eigentümlichen Kreaturen sind nach ihrer Gewohnheit benannt, ihre Köpfe beim Einziehen in ihren Panzer zur Seite zu klappen. Heute sind die Halswender nur noch in der südlichen Hemisphäre anzutreffen, wo sie Flüsse und Tümpel in Australien, Südamerika und Madagaskar bevölkern. Ihre europäischen Fossilien stammen hingegen von einem höchst ungewöhnlichen Zweig ihrer Familie, nämlich von den Bothremydiden. Sie sind die einzigen Halswender, die jemals im Salzwasser gelebt haben, und waren fast ausschließlich auf Europa beschränkt. In den Wäldern, die den Fluss säumen, erspähen wir primitive, verzwergte Dinosaurier, die denen ähneln, die auf Haţeg gefunden worden sind, allerdings eine andere Spezies repräsentieren. Eine Bewegung in der Vegetation verrät die Anwesenheit eines Beuteltiers von der Größe einer Ratte, das von seiner Gestalt her den kleineren Opossums in den heutigen südamerikanischen Wäldern sehr ähnlich ist. Dies ist das erste moderne Säugetier, das Europa erreicht hat.
In der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur im Südosten Frankreichs stieß man 1995 auf die Überreste eines noch faszinierenderen Lebewesens – eines gigantischen, flugunfähigen Vogels. Er wurde Gargantuavis philoinos getauft, »riesiger weinliebender Vogel«, weil seine fossilisierten Knochen inmitten von Weinbergen nahe der Gemeinde Fox-Amphoux ausgegraben wurden (die man sonst allenfalls als den Geburtsort des führenden französischen Revolutionärs Paul de Barras kennt).
Zu der Zeit, als jene Kreaturen lebten, erhob sich die Insel, aus der später einmal Südfrankreich werden sollte, allmählich aus den Fluten. Die südlich von ihr gelegene Insel Meseta (die den Großteil der Iberischen Halbinsel umfasste) war allerdings gleichzeitig im Sinken begriffen. Spanien würde sich natürlich erneut aus dem Meer erheben, und zwar in einem Prozess, der sowohl die majestätischen Pyrenäen als auch den Anschluss Iberiens an das übrige Europa hervorbringen sollte. Doch vor 70 Millionen Jahren gab es in der Nähe der heutigen nordspanischen Region Asturien eine Lagune, und als das Land unterging, wurde sie bei Flut vom Meer überspült, so dass die Knochen von Alligatoren, Flugsauriern und verzwergten Titanosauriern (langhalsigen Sauropoden) im Sediment begraben wurden. Von anderswo auf Meseta stammende Fossilien berichten uns davon, dass sich in den Wäldern jener versinkenden Insel Salamander verborgen hielten.
Kapitel 5
Ursprünge und Ureuropäer
Was war in jenen unvordenklichen Zeiten spezifisch europäisch? Und was davon hat bis heute überdauert? Wissenschaftler sprechen von einer europäischen »Hauptfauna«1, womit sie solche Tiere bezeichnen, deren Abstammungslinien im Dinosaurierzeitalter überall im Archipel vorhanden waren. Die Vorfahren eines Großteils dieser Hauptfauna – die Amphibien, Schildkröten, Krokodile und Dinosaurier umfasst hat – kamen schon sehr früh über das Meer aus Nordamerika, Afrika und Asien. Man könnte annehmen, dass Asien ein bestimmender Einflussfaktor gewesen wäre, doch die Turgai-Straße (ein Teil des Tethysmeers) fungierte als starke Barriere, so dass die Möglichkeiten zur Einwanderung von dort begrenzt waren. Gelegentlich erhoben sich allerdings vulkanische Inseln inmitten dieser Straße, die als Sprungbretter fungierten, und über Millionen von Jahren hinweg gelang diversen Lebewesen die erfolgreiche Überquerung, entweder als Passagiere von Vegetationsflößen oder von einer Vulkaninsel zur nächsten schwimmend, treibend oder fliegend.
Die aus Asien eintreffenden Dinosaurier stellten sich dabei als die robustesten Einwanderer heraus, obwohl es auch die Zhelestiden (primitive, insektenfressende Säugetiere, die den Rüsselspringern ähnlich waren) irgendwie geschafft haben. Zweifüßige Entenschnabelsaurier, große, schwerfällige Lambeosaurier, bestimmte nilpferdähnliche Ceratopsia und Verwandte der Velociraptoren – allesamt groß und wahrscheinlich gute Schwimmer – hatten den größten Erfolg. Für jeden Einzelnen von ihnen, der sich lebend an die Küste einer der europäischen Inseln schleppte, dürften 10 000 ertrunken sein. Etwa eine Million Jahre später sollten ihre Nachfahren dann schon zu den verzwergten Dinosauriern der europäischen Inselwelt gehören.
Die Migrationsroute von Asien nach Europa war eher ein Filter denn eine Schnellstraße, da nur einige wenige die Größe, die Stärke oder das schlichte Glück hatten, sie zu bewältigen. Dennoch bleiben wichtige Fragen ungeklärt. Warum zum Beispiel schafften weder die Weich- beziehungsweise Spaltenschildkröte noch die Landschildkröte, die beide in Asien lebten und gute Wasserreisende sind, den Sprung herüber? Kleinere Lebewesen müssen bei Stürmen oder Überflutungen doch massenhaft ins Meer gespült worden sein. Doch was auch immer der Grund dafür gewesen sein mag, es gibt jedenfalls keinen Beleg dafür, dass irgendeines von ihnen dies überlebt hätte und auf einer europäischen Insel heimisch geworden wäre.
Über die gesamte Existenz Europas hinweg hat Afrika seinen nördlichen Nachbarn wiederholt in die Arme geschlossen, bevor es sich wieder hinter einen salzigen Vorhang zurückzog. Gegen Ende des Dinosaurierzeitalters führten große Flüsse von Afrika nach Europa, und afrikanische Süßwasserfische strömten in Massen herein. Unter diesen waren urzeitliche Verwandte der Piranhas und jener berühmten Aquarienfische, der Salmler, daneben Hornhechte und Süßwasser-Quastenflosser, die Mawsoniidae genannt werden. Der Quastenflosser ist ein großer Fisch, der mit den Landwirbeltieren verwandt ist und dessen Entdeckung vor der Ostküste Südafrikas im Jahr 1938 weltweites Erstaunen hervorrief, nahm man doch an, er sei schon seit 66 Millionen Jahren ausgestorben.
Neben diesen Fischen kamen auch die ersten modernen Frösche nach Europa. Diese Gruppe mit dem Namen Neobatrachia umfasst auch die Ochsenfrösche und die Echten Kröten, die heute überall in Europa anzutreffen sind. Diese afrikanischen Einwanderer fanden dort, wo sich heute Ungarn befindet, ein einladendes Zuhause, und an dieser Stelle stieß man denn auch in Bauxitminen auf ihre Überreste. Einige Halswender-Schildkröten, die pythonartigen Schlangen aus der Familie der Madtsoiiden mit ihren rudimentären Gliedmaßen, die terrestrisch lebenden zackenzahnigen Krokodile und verschiedene Dinosaurier kamen ebenfalls von Afrika aus nach Europa. Ein karnivorer Dinosaurier, Arcovenator, scheint sogar von Indien her über Afrika nach Europa gekommen zu sein. Vor 66 Millionen Jahren ist die Landbrücke mit Afrika dann allerdings wieder in den Fluten versunken.
Als die Verbindungen nach Afrika abgeschnitten waren, nahmen die Migrationsbewegungen aus Nordamerika über die De-Geer-Landbrücke an Fahrt auf. Die Welt war damals zwar viel wärmer als heute, aber dennoch bedurfte es zu deren Überquerung einer langen Wanderung durch die Polarregionen, in denen es (wie zu allen Zeiten) drei Monate im Jahr dunkel war. Unter den ersten Einwanderern waren die Rennechsen, wobei der europäische Zweig dieser Familie schon lange abgestorben ist. Es ist auch möglich, dass das frühe Beuteltier, dessen Zähne in der französischen Charente gefunden worden sind, ebenfalls die De-Geer-Landbrücke benutzt hat.
Diverse Angehörige der Abstammungslinie der Krokodile sowie mit dem seltsamen trompetenden Lambeosaurus verwandte Dinosaurier kamen ganz am Ende dieses Zeitalters über die De-Geer-Landbrücke, in einer Phase, als ein sich erwärmendes Klima diese Route vielleicht etwas erträglicher machte. Alles in allem aber war die Landbrücke für den Großteil der nordamerikanischen Fauna zu polar und von zu extremen Bedingungen geprägt. Mit Sicherheit haben weder der furchterregende Tyrannosaurus noch der dreihornige Triceratops, die zu den bekanntesten Dinosauriern Amerikas zählen, jemals ihren borealen Boden betreten. Und selbst für jene wenigen glücklichen Arten, die es erfolgreich nach Europa geschafft haben, galt, dass ihr Bewegungsradius durch komplexe Barrieren eingeschränkt war. Der europäische Archipel war von Meeren durchzogen, und jede Insel hatte ihre typischen Eigenheiten; einige waren zu klein oder vielleicht zu trocken oder aus anderen Gründen ungeeignet dafür, den Populationen mancher Arten als Lebensraum zu dienen. Es ist zwar richtig, dass einige Spezies eine europaweite Verbreitung gefunden haben, doch viele blieben auf nur eine Insel oder eine Gruppe von Inseln beschränkt.2 Europa war zu jener Zeit also Einwanderungsnehmerland, doch hatte es der Welt auch etwas zu geben? Die Antwort lautet nein. Es gibt keine Hinweise auf irgendeine europäische Gruppe, die sich in den späteren Phasen des Dinosaurierzeitalters auf andere Landflächen ausgedehnt hätte. Für manche Kreaturen hat Europa allerdings wie eine Fernstraße fungiert, da es von primitiven Säugetieren und einigen Dinosauriern dazu genutzt wurde, von Asien nach Amerika und umgekehrt zu gelangen. Eine Erklärung für dieses Ungleichgewicht könnte in einer von Charles Darwin auf den Punkt gebrachten biologischen Tendenz bestehen, der zufolge solche Arten, die von größeren Landflächen herstammen, konkurrenzmäßig überlegen sind, weshalb eine erfolgreiche Migration normalerweise von größeren zu kleineren Landflächen erfolgt. Darwin bemerkt im Zuge seiner Untersuchung einer rezenteren Migration:
Ich vermuthe, daß diese überwiegende Wanderung von Norden nach Süden der grösseren Ausdehnung des Landes im Norden und dem Umstande, daß die nordischen Formen in ihrer Heimath in grösserer Anzahl existirten, zuzuschreiben ist, in deren Folge sie durch natürliche Zuchtwahl und Concurrenz bereits zu höherer Vollkommenheit und Herrschaftsfähigkeit als die südlicheren Formen gelangt waren.3
Der größte Teil der Hauptfauna Europas ist heute längst ausgestorben, und doch gibt es noch ein paar wenige unerwartete Überlebende. Die wichtigsten davon sind die Alytiden (jene Familie, zu der auch die Geburtshelferkröte gehört) und die Echten Salamander und Molche (die Familie der Salamandriden). Diese Relikte aus der Zeit des heraufdämmernden Europas verdienen besondere Beachtung, denn sie sind faktisch die lebenden Fossilien des Kontinents, so kostbar wie das Schnabeltier und der Lungenfisch.
Im März 2017 besuchte ich Voltaires Schloss in Ferney-Voltaire in der Nähe von Genf. Auf den südlich gelegenen Hängen zeigten sich bereits die ersten Frühlingsblumen, doch das Waldland war noch feucht und winterkalt. Ich drehte einen Holzscheit um und sah darunter eine braune Kreatur, die kaum zehn Zentimeter lang war und deren einzige Färbung zu jener Nicht-Brutzeit ein kaum wahrnehmbarer Hauch von Orange war, der sich in Form einer Linie über ihren Rücken zog. Es war ein Italienischer Kammmolch (Triturus carnifex), der sich in wenigen Wochen in einen Teich begeben und, sofern er männlich war, einen extravaganten, drachenartigen Rückenkamm sowie helle Punkte und eine kräftige schwarz-weiße Gesichtszeichnung aufweisen würde.
Dieses Geschöpf gehört zur Familie der Salamandriden, deren knapp 80 Arten über Nordamerika, Europa und Asien verstreut leben. Diese große Verbreitung hat den Ursprungsort der Tiere lange Zeit verschleiert, doch eine Untersuchung der mitochondrialen DNA von 42 dieser Arten hat gezeigt, dass sich die Salamandriden zuerst vor über 90 Millionen Jahren auf einer Insel im europäischen Archipel entwickelt haben.4 Vielleicht handelte es sich dabei um Meseta, wo die ältesten Salamandridenfossilien der Welt gefunden worden sind. Jene Untersuchung hat zudem nachgewiesen, dass sich die farbenprächtigen italienischen Brillensalamander bereits vom Rest der Salamandriden-Familie abgesondert haben, als die Dinosaurier noch lebten. Gleich nach deren Aussterben erreichten die Tiere Nordamerika und legten den Ursprung für die nordamerikanischen und pazifischen Molche. Noch etwas später, vor ungefähr 29 Millionen Jahren, wanderten einige Salamandriden nach Asien und bildeten ihrerseits die Urahnen der Feuerbauchmolche, der Chinesischen Lippenmolche und anderer asiatischer Arten.5
Tatsächlich ist die Feststellung ehrfurchterweckend, dass die Vorfahren dieses winzigen, empfindlichen Geschöpfs, das ich in den Tiefen von Redmond O’Hanlons Teich in Oxfordshire kauern sah, Teil einer Gruppe waren, die Amerika schon lange vor Kolumbus und Ostasien lange vor Marco Polo von Europa aus kolonisiert hat. Für mich sind diese Tiere – und nicht irgendein Imperien aus dem Boden stampfender menschlicher Kolonisator – die eigentliche Verkörperung des europäischen Erfolges.
Kapitel 6
Die Geburtshelferkröte
Dass eine Kröte im Zentrum des urzeitlichen Europas steht, ist eine Wahrheit, die eher wie ein Märchen klingt.1 Die Geburtshelferkröte ist heute vom Süden der Niederlande und dem Osten Belgiens bis zu den sandigen Wüsten Spaniens anzutreffen, was sie zum erfolgreichsten und am weitesten verbreiteten Angehörigen der ältesten überlebenden Wirbeltierfamilie Europas macht, nämlich der Alytiden, einer Gruppe, die die Geburtshelferkröten, die Eigentlichen Scheibenzüngler, die Unken und die Gemalten Scheibenzüngler umfasst.2 Schaut man einer Geburtshelferkröte in die Augen, dann sieht man eine Europäerin, deren Urahnen noch den schrecklichen Hatzegopteryx