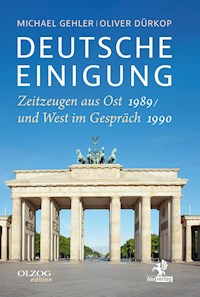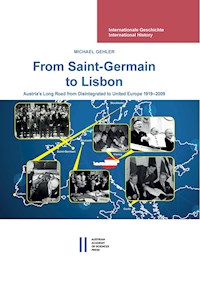Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: StudienVerlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
KOMPAKT UND ANSCHAULICH ERZÄHLT: VON DEN ANFÄNGEN EUROPAS BIS ZUR EU IN AKTUELLEN KRISENZEITEN Die Zukunft der EU und der gegenwärtige Zustand Europas beherrschen die politischen Diskussionen unserer Tage. MICHAEL GEHLER liefert einen umfassenden Überblick über die lange Geschichte Europas – von den Anfängen bis zur Gegenwart der Europäischen Union in stürmischen Krisenzeiten. Entstehung, Aufbau und Funktionen der Institutionen sowie die Entwicklung von der Montanunion bis zur EU werden allgemein verständlich dargestellt. Chronologie, Glossar, Literatur sowie zahlreiche Bilder und Karten veranschaulichen die Entwicklung der europäischen Integration.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 675
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Gehler
Europas Weg
Michael Gehler
Europas Weg
Von der Utopie zur Zukunft der EU
Grundriss
I. Europa-Mythos und Ideen: Vom Karlskult bis Coudenhove-Kalergi
1. Grundlagen und Voraussetzungen
2. Dante Alighieri als „Propagandist des Reichs“
3. Pierre Dubois und die „Wiedereroberung des Heiligen Landes“
4. Georg Podiebrad und der europäische „Fürstenbund“
5. Sebastian Münster und die Individualisierung der „monarchia universalis“
6. Althusius und die Schweiz als konföderiertes Europa
7. Sullys „Grand Dessin“ mit Stoßrichtung gegen die Habsburger Hegemonie
8. William Penn und der „Europäische Reichstag“ als karitative „balance of power“
9. Saint-Pierre, Leibniz, Rousseau und der Machiavellismus der Fürsten
10. Immanuel Kant und der „Föderalismus freier Staaten“ als ethische Maxime
11. Die Französische Revolution mit ihren direkten Folgen und Fernwirkungen
12. Kant versus Novalis – konkurrierende Verfasstheiten Europas
13. Der Wiener Kongress als Gegenmodell zur Französischen Revolution
14. Giuseppe Mazzini, Victor Hugo und das europäische Revolutionsjahr 1848 – Ursachen und Folgen
15. Constantin Frantz und sein gegenmoderner „Bund der Völker“
16. Friedrich Naumann und das deutsche „Mitteleuropa“-Konzept
17. Das Ende der europäischen Großreiche 1918
18. Richard N. Coudenhove-Kalergi und sein Appell an die europäische Vernunft
19. Nationalsozialismus und Kommunismus: Weder europäische Ideologien noch supranationale Politikkonzepte
20. Fluchtpunkt London: Europa im Exil 1939–1945
II. Der Weg zum Europa der Institutionen
1. Vom Marshall-Plan zur EWG 1947–1957
2. Spaltung Westeuropas, Aufbau und Krise der EWG/EG 1958–1968
3. Die Norderweiterung, Vertiefungsversuche und „Eurosklerose“ 1969–1978
4. Erste Direktwahlen zum Europäischen Parlament und Süderweiterung 1979–1986
5. Die Einheitliche Europäische Akte, Vertrag von Maastricht und der Beitritt der Neutralen 1987–1995
6. Die Verträge von Amsterdam und Nizza 1997–2000
7. Der Euro und der „Konvent zur Zukunft der EU“ 1999–2004
8. Die größte Erweiterung der europäischen Integrationsgeschichte und das Scheitern der „EU-Verfassung“ 2004–2005
9. Das Ringen um einen neuen Vertrag 2005–2009
10. Von der Finanzmarktkrise zur Bankenunion 2010–2013
11. Von der Überwindung der „Eurokrise“ und der „Flüchtlingskrise“ zu den Europaparlamentswahlen 2013–2019
12. Die Bildung und Ziele der neuen EU-Kommission von der Leyen
III. Vertiefungen
1. Das Spannungsfeld zwischen Nationalstaat und Supranationalität: Integrationstheoretische Zugänge
2. Militarisierung und Teilung Europas nach 1945
3. Dreifache Eindämmung: Sicherheitsgarantie durch die USA als europäische Präsenzmacht
4. Liberalisierung des Handels- und Zahlungsverkehrs: Die USA als externer Förderer und ökonomischer Impulsgeber
5. Der Schuman-Plan oder sektoriale Integration
6. Der Pleven-Plan oder das Scheitern einer europäischen Armee
7. „Tauwetter“ und Integrationsverlust: Der Ost-West-Konflikt als Hintergrund der Integration
8. Die Römischen Verträge oder die horizontale Integration
9. Fortschritte und Rückschläge
10. Verspätete Demokratisierung im Nachvollzug und integrationspolitischer Neuanlauf
11. Die Revolutionen in Mittelosteuropa 1989/90 und die Folgen
12. Die Kriege am Balkan: Eine humanitäre und politische Katastrophe für Europa
13. Im Zeichen militärischer Schwäche der EU: Befriedung und Stabilisierung des Balkans durch die NATO und die USA
14. Im Zeichen fragwürdiger US-Interventionspolitik: „Out-of-area“-Einsätze und europäische Gefolgschaftsverweigerung
15. Der Unionsvertrag von Maastricht: Ein verstärkter Integrationsrahmen für das geeinte Deutschland
16. Vertiefung vor Erweiterung: Intensivierte Westintegration und verzögerte Ostintegration Europas
17. Die komplizierte und komplikationsreiche Einführung des Euro
18. Erweiterung vor Vertiefung: Die politische Vereinigung des Kontinents
19. Die Chancen, Defizite und Grenzen der Erweiterungen: Aus- und Überdehnung oder die Europäische Nachbarschaftspolitik (ENP)
20. Der Unionsvertrag von Lissabon: Zwischen Anspruch und Wirklichkeit
21. Scheitert der Euro – scheitert die EU? Die Bändigung der größten Krise in der Geschichte der europäischen Integration
22. EU-USA – Ende einer Partnerschaft angesichts des NATO-Verbunds?
23. Ein Pyrrhussieg für Putin oder nur Verlierer? Deutschland, die EU, Russland, die Krim-Annexion und der Krieg in der Ostukraine
24. Grenzenloses Europa? Die „Flüchtlingskrise“ und der schwierige bis unmögliche Partner Türkei
25. Geburtsfehler, Stärken und Schwächen: Die EU als Krisenprodukt angeschlagener Nationalstaaten und postmodernes Imperium
26. Deutschland, Frankreich und die EU: Vom Krisenmanager zur lahmen Ente Europas und Aachen als Neustart für Europa?
27. Vom „Brexit“ zum Exodus des Vereinigten Königreichs?
28. Die EU in der globalen Unordnung und ihr innerer Zusammenhalt
29. Die EU als grund- und menschenrechtlicher Hoffnungsträger in der Weltgesellschaft
30. Ein ambitioniertes Unternehmen: Aufgaben und Aussichten der EU-Kommission von der Leyen im Vorfeld und durch Corona
Nachwort zur Neuauflage
Anhang
Europa und seine Einigung nach 1945 – eine Chronologie
Glossar
Abkürzungsverzeichnis
Quellen- und Literaturhinweise (Auswahl)
Linkverzeichnis
I. Europa-Mythos und Ideen: Vom Karlskult bis Coudenhove-Kalergi
1. Grundlagen und Voraussetzungen
60 Jahre nach Inkrafttreten der Römischen Verträge, die eine Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und eine Atomgemeinschaft (EURATOM) begründeten, erhielt der französische Staatspräsident Emmanuel Macron den Karlspreis zu Aachen. Die Begründung des Kuratoriums lautete: Er sei ein „mutiger Vordenker für die Erneuerung des europäischen Traums“. Es zeichnete ihn für „seine kraftvolle Vision von einem neuen Europa und seinen Kampf gegen Nationalismus und Isolationismus“ aus. Die Laudatio hielt Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie führte aus, dass die „Freiheitswerte ein zerbrechliches Gut“ seien. Europa brauche einen neuen Aufbruch und Begeisterungsfähigkeit, wofür Macron stehe, um das Schicksal des Kontinents selbst in die Hand zu nehmen. Merkel war 2008 ausgezeichnet worden. Deutschland hatte 2007 die Ratspräsidentschaft erfolgreich geleitet, die zu einem neuen Unionsvertrag führte. Macron sollte zehn Jahre später im September 2017 mit einer Rede an der Pariser Sorbonne-Universität eine „Neugründung“ der EU nach dem „Brexit“ fordern. Er hatte Merkel aufgefordert, ihn zu unterstützen, Neues zu wagen und zu handeln. Er plädierte für eine stärkere Eurozone mit einem eigenen Haushalt, was Merkel jedoch reserviert aufnahm.
Die Aachener Auszeichnung wurde nicht immer nur an Persönlichkeiten vergeben. Stellvertretend für den Euro wurde Wim Duisenberg am 9. Mai 2002 der Karlspreis verliehen. Die Wahl seitens des Direktoriums der Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen war wohlbegründet: „Der Euro ist ab Januar 2002 weit mehr als das einheitliche Zahlungsmittel in Europa. Er trägt darüber hinaus zu einer gemeinsamen europäischen Identität bei, stabilisiert die Gemeinschaft und hat damit eine friedensstiftende Wirkung. Er unterstützt die zukünftige gemeinsame Sicherheits- sowie Außenpolitik und bildet die Basis für eine europäische Arbeits-, Sozial- und Gesundheitspolitik.“ Der Euro leiste somit einen „entscheidenden, Epoche machenden Beitrag zum Zusammenwachsen der Völker Europas“, denn Währungen seien in der Geschichte „schon immer mehr als ein Zahlungsmittel“ gewesen: „Sie waren und sind immer auch ein Stück Identität und ein Gradmesser politischer, wirtschaftlicher und sozialer Stabilität.“
Vor der Bankenkrise in den USA und der durch sie mitverursachten Finanzund Wirtschaftskrise in der EU war dieser optimistische Ausblick auf die Zukunft nicht unbegründet. So nahm Wim Duisenberg als Präsident der Europäischen Zentralbank (1998–2003) repräsentativ für die seit 1. Juli 1998 tätige Wächterin der Geldwertstabilität die Auszeichnung in Aachen entgegen. Dort werden seit 1950 die Karlspreisträger geehrt, die sich in führender Position um die europäische Einigung verdient machten. Namensgeber ist Kaiser Karl der Große. Unter den Geehrten befinden sich u. a. als Erster Richard N. Coudenhove-Kalergi (für die „Paneuropa-Union“ mit ihrem Ziel der Verwirklichung eines europäischen Staatenbundes), Alcide De Gasperi 1952 (für den italienischen Einsatz zur Gründung der NATO und bei der Integration Europas), Paul Henri Spaak 1957 (für die Zusammenarbeit der Benelux-Staaten und die europäische Einigung), Robert Schuman 1958 (für die Schaffung der Montanunion), Edward Heath 1963 (für die britischen EWG-Beitrittsverhandlungen), Salvador de Madariaga 1973 (als Exponent westeuropäischer Kultur und Liberalität), François Mitterrand und Helmut Kohl 1988 (für ihre besonderen Verdienste um die europäische Einigung), Václav Havel 1991 (als Mitbegründer der Bürgerrechtsbewegung in seinem Land und einer der Initiatoren der „sanften Revolution“ in Mitteleuropa), Franz Vranitzky 1995 (für den EU-Beitritt Österreichs), Bill Clinton 2000 (für seine Bemühungen um Irlands Friedensgespräche), György Konrád 2001 (als Brückenbauer für Gerechtigkeit und Versöhnung in Europa), Valéry Giscard d’Estaing 2003 (für den Entwurf einer europäischen Verfassung als Präsident des entsprechenden Konvents), Papst Johannes Paul II. 2002 (für sein Wirken für die Einheit Europas, die Wahrung seiner Werte und die Botschaft des Friedens), Donald Tusk 2014 (für ein demokratisches und weltoffenes Polen im Kreise der europäischen Völkerfamilie), Jean-Claude Trichet 2011 (für den Zusammenhalt der Währungsunion und den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Binnenmarktes als Grundstein des Wohlstands und sozialer Sicherheit Europas), Herman Van Rompuy 2014 (als Mittler und Konsensbildner sowie Impulsgeber der europäischen Einigung) oder demnächst Klaus Johannis 2020 (für Rumänien als eines der europäischsten Länder in Südosteuropa).
Dass der Karlskult nicht der Vergangenheit angehört, sondern sich seine Ausstrahlungskraft noch beibehalten hat, vital ist und ungebrochen fortlebt, kann bei den alljährlichen Preisverleihungen in Aachen beobachtet werden. Immer wieder werden die Geehrten mit den Leistungen Karls des Großen in Verbindung gebracht. Der Mythos schöpft aus verschiedenen historischen Quellen: dem Christen- und Kaisertum, der Einigungsidee für Europa und europäischer Kunst und Kultur. Die Wurzeln der Entstehungsgeschichte der Strukturen und Werte Europas reichen jedoch noch viel weiter zurück als in das frühe Mittelalter.
„Europa“ als Idee spielte im Altertum praktisch keine Rolle. Das bedeutet aber nicht, dass die Antike für seine weitere Entwicklung zu vernachlässigen wäre. Europa verdankt ihr den kunst- und geistesgeschichtlichen Hintergrund sowie ihren kultur- und rechtsgeschichtlichen Unterbau: Architektur, Philosophie, Kunst-, Rechts-, Herrschafts- und Lebensformen. Die eigenen antiken griechischen Kulturleistungen wie auch ihre Kulturübertragungen aus dem Orient nach Europa verdienten laut dem Innsbrucker Rechtswissenschaftler Heinz Barta mehr Beachtung: die Erfindung der Politik und ihre Humanisierung, das Gesetz als Steuerungsmittel der Gesellschaft, der Gedanke der Demokratie, eine Proto-Rechtsstaatlichkeit sowie das Konzept unabhängiger Gerichtsbarkeit, Richtertums und Rechtssprechung, aber auch Verfassungsideen, die Entwicklung der zentralen Verschuldenshaftung und insbesondere der personale rechtliche Schutz bis hin zur Menschenwürde. Solon schuf einen ersten, gleichwohl noch kleinen Grundwerte-Katalog, der die unverlierbare Freiheit, eine bereits sehr weitgehende gesellschaftliche Gleichheit und – laut Barta relevanter als in der amerikanischen Verfassung von 1774 und in der Französischen Revolutionsverfassung von 1789 – die politische Teilhabe aller Bürger umfasste. Eine Eigenart griechischen kulturellen Denkens bestand darin, dass es vernetzt war und sich nicht unterteilt nach Disziplinen artikuliert hat. Griechische Dichter äußerten sich juristisch, politisch, philosophisch wie auch Philosophen und Historiker. Sie leisteten damit eine immense Vorarbeit für die römische und die spätere europäische Kultur.
Europa bis 750
Hinzu trat erst später das Christentum als Medium, Träger und Vermittler des Einigungsgedankens. Es war nicht nur verbreitungsstark, sondern auch aufnahmefähig und die Botschaft der Christen universal.
Die „große religiöse und ideologische Neuheit des westlichen Europa“ (Jacques Le Goff) hatte sich gegenüber orientalisch-mystischen Religionen und dem römischen Kaiserkult behauptet und der griechisch-römischen Welt selbst als identitätsstiftende Weltanschauung für die Erhaltung der Einheit des Imperium Romanum angeboten. Der Aufstieg des Bischofs von Rom zum Papst, die Taufe des Merowingers Chlodwig (~ 498) und die erste bei einem mittelalterlichen Herrscher erfolgte Krönung Karls des Großen zum Kaiser durch Papst Leo III. am Weihnachtstag des Jahres 800 in Rom waren Stationen auf dem Weg des Zusammenwachsens von römisch-lateinischen und romanisch-germanischen Traditionen. Die römischkatholische Kirche war dabei der Kern des neuen Reiches, das sich als Erbe des Imperium Romanum verstand.
Wiederkehrend blieb das Ringen um Europas Einheit eine Idee, die besonders mit Karl assoziiert, aber auch und v. a. mit seinen Nachfolgern verknüpft werden konnte. Sie wurde immer dann notwendig, wenn es äußere, als existentiell empfundene Gefährdungen gab: So als Karl Martell die Araber 732 bei Tours und Poitiers abwehrte, Karl der Große (747–814) einen Feldzug gegen das islamische Spanien (778) führte und in mehreren Kriegszügen (791–796) das Awarenreich zerschlug, daran anknüpfend Otto der Große (912–973) die Ungarn auf dem Lechfeld (955) besiegte, Papst Urban II. die Verteidigung der Christenheit beschwor und den Kreuzzug gegen die Ungläubigen forderte (1095), Kaiser Friedrich Barbarossa (~ 1123–1190) die Tataren an den Ostgrenzen des Stauferreiches fürchtete, als Wien von der Türkengefahr (1529, 1683) bedroht war oder in der Seeschlacht bei Lepanto im Golf von Korinth (1571) der Sohn Karls V., Juan d’Austria, über die Osmanen triumphieren konnte.
Mit dem römischen Recht als umfassende Einrichtung ist das Kaiser- und Königtum Roms als Epoche der „europäischen Einheit“ begriffen worden, mit „Charlemagne“, Karl dem Großen, wurde die Geburt des „Abendlandes“ identifiziert, wobei trotz der von seinem Hofhistoriographen Einhard überragend gezeichneten Herrscherfigur „Caroli Magni“ die Verschiedenartigkeit seines „Reichs“ dessen Aspekte der Einheitlichkeit überwog. Von europäischem Bewusstsein war allerdings in der karolingischen Epoche noch kaum etwas zu spüren. Das kontinuierliche Muster des Mittelalters hieß „christianitas“ und „ecclesia“ (Christlichkeit und Kirche). Um die Jahrtausendwende war das Wort „Europa“ in der lateinischen Christenheit nicht unbekannt, sein Inhalt aber noch unbestimmt. Klar war nur, dass man dazugehörte, was schon einiges bedeutete.
Die semantischen Wurzeln sind in der Antike zu finden. Dem semitischen Wort „ereb“ zufolge bezeichnete es das Dunkle, die Gegend, wo die Sonne untergeht, das „Abendland“. So nannten es die an der kleinasiatischen Küste lebenden Phöniker. Die Griechen gebrauchten das Wort für das gestaltlose nördliche Land der „Barbaren“. Der Begriff blieb aber vage und wurde nur selten verwendet.
Die griechische Sage aus Homers Zeiten erzählt von „Europe“, der lieblichen und noch jungfräulichen Tochter des Agenor, des Stammvaters der Phönizier, und Schwester des Kadmos, die ein schöner Stier entführt hatte. Eine einprägsame Erzählung rührt vom Dichter Moschos von Syrakus auf Sizilien, der um 150 v. Chr. lebte. Als die verzweifelte Europe Zwiegespräche mit dem Tier führte und fragte, wer es sei und wohin es sie bringe, antwortete das schöngehörnte Wesen: „Sei getrost, Jungfrau; fürchte dich nicht vor dem Meeresgewoge. Ich bin Zeus selbst; denn ich kann in jeder Gestalt, in der ich will, erscheinen. Sehnsucht zu dir hat mich getrieben. Kreta wird dich nunmehr aufnehmen, das auch mich selbst aufzog; dort wird deine Hochzeit sein. Von mir wirst du berühmte Söhne gebären, die alle Herrscher über die Menschen sein werden.“ Der Sohn des Kronos hielt Wort: Kreta erschien, Zeus nahm seine Gestalt an, löste Europe den Gürtel, und die Horen bereiteten das Lager. Das Mädchen wurde seine Braut und schenkte ihm die Söhne Rhadamanthys, Minos und Sarpedon. Die europäische Kunst gestaltete als Motiv die Entführung seit dem 7. Jahrhundert v. Chr. bis heute. In den Meisterwerken von Veronese, Tizian und Tintoretto fand die Jungfrau künstlerische Darstellung.
Die Chronisten Karls des Großen priesen ihn zwar schon um 799 als „Pater Europae“. England blieb jedoch außerhalb seines Herrschaftsbereichs. Es gehörte nie zu Karls Reich, dass sich im Wesentlichen auf den Kontinent konzentrierte, alles andere als homogen war und bald in verschiedene Teile zerfallen sollte. Sein Erbe, welches unter den Nachfahren in ein West-, Mittel- und Ostfrankenreich aufgeteilt wurde, verbreitete sich von Norden nach Süden mit der Legitimation durch das geistliche Oberhaupt und die Gefolgschaft der Herrscher, also mit kirchlichem Segen, dynastischer Tradition und den Heil bringenden Insignien. Es dehnte sich auch von Meer zu Meer in Kontinentaleuropa durch Kulturtransfers über Rom, Byzanz nach Kiew aus und führte zu neuen Reichsgründungen bis nach Dänemark und Südskandinavien. Das Karolingische Reich wirkte mit seinen Anstößen zur Herrschaftsbildung von den Ostfranken über Baiern nach Böhmen, Polen und Ungarn.
Der Karlskult hat aber auch mit pseudohistorischen und scheinlegitimatorischen Analogien gearbeitet und dabei bis in die jüngste Zeit unreflektierte Europaideologien produziert und einen unkritischen Gemeinschaftskonformismus genährt. Die Karl zugeschriebene „renovatio imperii“ war mehr Wunschdenken späterer Rezipienten als geschichtliche Realität, seine Politik „kaum ein durchdachtes Programm“, sondern vielmehr „fortgesetzte Improvisation“ (Rudolf Schieffer). Europäisch war weder sein Herrschaftsstil noch seine Politik, wenn man an die Zwangsmissionierungen und -umsiedlungen der Sachsen oder die gewaltsame Unterwerfung des Baiern-Herzogs Tassilo denkt.
Römische Straßenzüge in der Zeit um 850. Dieses Verkehrsnetz erstreckte sich westlich des Limes im Wesentlichen auf Westeuropa und nur eingeschränkt auf Südosteuropa.
Europäisch an Karl waren sein persönliches Umfeld, das aus Italien, Irland, England und Spanien kam, seine erstaunliche Offenheit und die Auffassung, dass man Schrift, Kunst und Kultur nur durch namhafte nichtfränkische Gelehrte fördern könne, die er auch als Berater an seine Hofschule zog und die dort in relativer Freiheit arbeiten konnten. Karl hatte damit eine der Grundlagen für die geistige Entwicklung Europas geschaffen.
Auch für die Baukunst und Kultur schuf Karl eine Basis, die bereits europäische Züge aufwies. Für seinen Aachener Prunkbau ließ er nicht nur die Marmorsäulen aus Italien über die Alpen schleppen, sondern auch lombardische Handwerker herbeiholen, da lokale Kräfte vom Fach noch nicht die Fertigkeiten besaßen. Das von den Römern aufgebaute europaweite Straßensystem existierte weiter und beförderte den Kulturaustausch und Wissenstransfer.
Von Karls Hof gingen auch wesentliche Anstöße zu einer Bildungsreform aus, die für die Entwicklung der Schrift, die karolingische Minuskel, und die Kunst der karolingischen Renaissance entscheidend werden sollten, so bspw. für die Klöster Reichenau und St. Gallen, wo das Bild vom „Vater Europas“ besonders stark gepflegt worden ist. In St. Gallen wurde Karl als „bester aller Kaiser“ hoch geehrt. Notker der Stammler zeichnete auf Bitten von Karls Urenkel, Karl dem Dicken, in den „Gesta Karoli Magni“ das Bild eines christlichen Kaisers, das ganz entscheidend zur Idealisierung seiner Person und Herrschaft beitrug.
Die Ottonen übernahmen die Tradition der Karolinger, was in der Krönung im Dom zu Aachen seinen Ausdruck fand, das Karl der Große selbst schon symbolisch als das „Neue Rom“ tituliert hatte. Die Herrschaft Ottos I. (936–973) war dauerhaft und wirkte nachhaltig. Mit dem Sieg am Lechfeld, der Slawen-Missionierung und der Übernahme der Königsmacht in Oberitalien bekam sein Königtum europäische und imperiale Züge. Nach Hilferufen des Papstes folgte seine Kaiserkrönung 962 in Rom zum Imperator Romanorum, dem „Kaiser der Römer“. Der „Rom-Gedanke“ war aber keine Fortsetzung der römischen Politik im Sinne eines Reiches, sondern diente lediglich als Herrschaftsgrundlage über das westliche Mitteleuropa.
Im Dezember 1165, also zur Hochblüte der Stauferherrschaft und während des Schismas, erfolgte Karls Heiligsprechung. In Aachen schrieb Gegenpapst Paschalis III. Karl den Großen in Anwesenheit von Friedrich Barbarossa in das Buch des Heiligen ein, worauf dort und später auch in Frankfurt eine Verstärkung des Kults um seine Person einsetzte. Durch Bildnisse und Statuen verbreitete sich die Verehrung Karls und wurde fester Bestandteil historischer Rückbesinnung.
Der Karlskult und „Europa“ dienten schon sehr früh als ideologisches Vehikel und politisches Identifikationsmittel sowie auch als sinnstiftender Abwehrbegriff gegen äußere Gefahren. Der Gegner wurde dabei oftmals als bedrohlich empfunden, seine Kultur als fremd, zumindest anders als die eigene. Dabei wurde der Gegensatz zwischen „Freiheit“ und „Despotie“ betont. Das Wort „Europa“ verschwand, wenn die äußeren Bedrohungen nachließen. Es tauchte aber wieder auf, wenn es um die Bewahrung oder Wiederherstellung der Einheit der Christenheit (Westrom-Ostrom; später Protestantismus-Katholizismus), die Schaffung des „ewigen Friedens“ und machtpolitischen Egoismus mit universalistischem Herrschaftsanspruch und imperialem Hegemoniestreben ging, aber auch für die Legitimation von Expansionsversuchen und Aggressionsakten nach außen bis hin zur „Befreiung des Heiligen Landes“ wurden „Europa“-Ideen instrumentalisiert.
Europa, ein geografischer Raum, den Paul Valéry einmal als „Halbinsel Asiens“ bezeichnete, umfasst 10,5 Millionen Quadratkilometer. Einschließlich der Inseln und Binnenmeere ist es der viertgrößte Kontinent und mit einer Bevölkerung von rund 700 Millionen Menschen einer der am dichtesten besiedelten Erdteile. Vom Größenumfang zweitkleinster Kontinent, liegt Europa vom Bevölkerungsausmaß im Spitzenfeld. Die Frage des Raums berührt die der Grenzen, die für Geographen besonders schwierig ist: Wo fängt es an, wo hört es auf? Eine natürliche geographische Trennlinie zu Asien gibt es nicht, wie auch eine bloße Addition seiner politischen Bestandteile ungenügend bleibt.
Europa ist in ständiger Veränderung. Dies gilt für Gestalt wie Gehalt. Es war weder in sich geschlossen noch einheitlich, zu allen Zeiten ungleich und entzog sich sowohl einer genauen Begriffsbestimmung als auch einer „objektiven“ Festlegung. Hat man „Europa“ im Kopf, so tauchen verschiedene Bilder, Klischees und Konflikte auf. Es ist daher mehr als nur ein geographischer und bevölkerungsspezifischer Begriff: Es entspringt einem gemeinsamen historisch-kulturellen Bewusstsein. Gesprochen wird von einem sich wandelnden kollektiv-imaginären Entwurf (Hagen Schulze). Das „gemeinsame“ Europa beinhaltet große Vielfalt, es ist in geistes-, ideen-, mentalitäts- und kulturgeschichtlichen Dimensionen zu denken, um seine Eigenheiten zu ergründen, was Fremdwahrnehmungen und Selbsteinschätzungen einschließt.
Die Machtausübung war in der vorindustriellen Zeit religiös („von Gottes Gnaden“) legitimiert und durch den Heiligen Vater als irdischem Repräsentanten des Herrn repräsentiert. Die Lage des geistlichen Zentrums südlich der Alpen schuf den weltlichen Herrschaftsformen im Norden Handlungsspielräume und geistige Distanz zur römisch-katholischen Autorität in Rom. Das Legitimitätsprinzip blieb jedoch für jede Autokratie gültig. Die Ottonen übernahmen es von den Karolingern, was in der Krönung im Dom zu Aachen zum Ausdruck kam, das Karl symbolisch als das „Neue Rom“ tituliert hatte. Der ottonische Herrschaftsraum umfasste einen großen Teil des ehemaligen fränkischen Mittelreiches von den Niederlanden bis zur Riviera. Die Ottonen setzten die Befestigungs- und Klosterpolitik der Karolinger fort, eroberten und sicherten das Land an Elbe und Oder mit Marken und Burgen.
Während Frankreich und England unter den Wikinger- bzw. Normannen-Invasionen zu leiden hatten, festigte der Sieg am Lechfeld von 955 über die Ungarn dauerhaft die Herrschaft Ottos des Großen. Durch die Slawen-Missionierung und Übernahme der Königsmacht in Oberitalien bekam das Königtum Ottos europäische, ja imperiale Züge. Nach Hilferufen des Papstes folgte seine Kaiserkrönung 962 in Rom zum „Imperator Romanorum“, dem „Kaiser der Römer“. Der „Rom-Gedanke“ war noch keine Fortsetzung der römischen Politik im Sinne eines Imperiums, sondern diente lediglich als Herrschaftsgrundlage für das westliche Mitteleuropa. In diesem Personenverbandsstaat zwischen Atlantik, Riviera und Oberitalien kam Ottos persönliche Herrschaft zum Ausdruck. Erst mit dem „Sacrum Imperium“, dem heiligen Reich des 12. Jahrhunderts, wurde ein Raumbezug hergestellt. Vorher bezogen sich Salbung und Krönung allein auf die Person des römischen Königs bzw. Kaisers.
Die Ausdehnung kaiserlicher Machtansprüche im südlichen Mittelmeerraum sah sich mit der Herrschaftslegitimation der römischen Päpste im Widerstreit. Das nordalpine Europa fügte sich sakral dem Heiligen Vater, gründete klösterliche Kulturzentren und trieb deren Ausbreitung nach Mittel- und Osteuropa voran. Für kirchliche Würdenträger und Vertreter des Adels galt die Heidenmissionierung als Expansionslegitimation. Salbung und Krönung durch den Papst verbürgten die Verbindung zwischen Gefolgsmännern und Lehnsherren. Schon seit dem 12. Jahrhundert fand das französische Königtum zu einer sakral-eigenständigen Legitimation. Die polnischen Jagiellonen wurden um die Wende zum 14. Jahrhundert christianisiert, während die kirchliche Königskrönung in Litauen erst nach seiner Verbindung mit Polen um 1400 üblich wurde.
Unter der Familie der europäischen Könige behielt der Papst als geistliches Oberhaupt das ideelle Prius, das sich in ihrer Machtpolitik nicht mäßigend auswirkte. Die Päpste verlangten den Vorrang des geistlichen Lebensbereichs („auctoritas“) vor dem weltlichen („potestas“) nicht nur innerhalb der Kirche und Theologie. Das kanonische Recht sollte die Rechtsgrundlage zwischen Kirche und Staat bilden.
Verschiedene Formen des Dualismus prägten Europa: zwischen Grundherren und Knechten, Lehnsherren und Vasallen, Königen und Ständen oder Regierung und Opposition. Die Geistlichen emanzipierten sich von der Herrschaft der Könige und des Adels, betonten ihre spezifischen Aufgaben, erhielten Freiräume (Immunitäten), eigene Gerichtsbarkeiten und Abgabenfreiheiten. Der Investiturstreit (1075–1122) entschied zwar nicht die politische Machtfrage zwischen Kaiser und Papst. Die Einführung in das geistliche Amt wurde jedoch durch das Wormser Konkordat (1122) von den weltlichen Rechten getrennt. Damit wurde eine Ausdifferenzierung der Machtausübung erreicht.
Könige und Fürsten trafen im Verbund mit den ihnen unmittelbar Untertänigen, der hochadeligen Gefolgschaft, Entscheidungen. Dem „Großen Rat der Barone“ in England oder Frankreich entsprachen im deutschen Königtum die Hoftage der Fürsten. Geistliche und hohe Adelige hatten einen eigenen Gerichtsstand, wie der Klerus waren sie grundsätzlich frei von regelmäßiger Besteuerung. Ausnahmen bestanden nur in Landesnot, im Verteidigungsfall oder bei Überschuldung der Herrscher.
Fachkundige Administratoren und spezialisierte Ratsgremien verdrängten die hochadeligen Vasallen-Räte, so in England und Frankreich im 13. Jahrhundert und in Deutschland im 14. Jahrhundert. Erste große Widerstandshandlungen erfolgten durch die englischen Barone gegen die Eigenmächtigkeiten von König Johann „Ohneland“. In der Magna Charta (1215) erstritten sie für ihre Anerkennung des Königs die Bestätigung eigener Rechte: u. a. ordentliche Gerichtsverfahren, Schutz vor willkürlichen Verhaftungen und Mitentscheidung bei Steuererhebungen. Der Herrscher unterlag dem Zwang zum Konsens aufgrund steigender Finanzprobleme, aber auch aufgrund der nicht kalkulierbaren Erbfolgen und Dynastiewechsel.
Der feudalherrschaftliche Hochadel blieb an der Herrschaft beteiligt. Neue Verwaltungsstrukturen, Hofhaltungen und unzählige militärische Konflikte verschlangen Unsummen. Es sei nur an den längsten aller europäischen Kämpfe erinnert, der sich im „Hundertjährigen Krieg“ (1339–1453) zwischen England und Frankreich abspielte, so dass der Steuerkonsens auf den niederen Adel (Ritter), auf Städte und Klöster ausgeweitet werden musste. Mit der Verbreitung des Rechts auf Konsens entstanden politisch berechtigte Stände, die sich in Reichs- und Landtagen oder den „Generalständen“ formierten. Dem König trat nicht mehr der Adelsstand, sondern die „Gemeinschaft des Reiches“ (Winfried Eberhard) gegenüber. Dies führte zu einer Korporatisierung des Staates, d. h. die Einzelpersönlichkeit des Herrschers trat in den Hintergrund. Im englisch-französischen Krieg setzte sich die Auffassung durch, dass nicht der König, sondern die Krone das Reich besitze. Der Herrscher sei nur dessen Verwalter und Verwahrer der Krone.
Im 14./15. Jahrhundert entwickelten sich in den Königreichen Europas und den deutschen Fürstenterritorien Ständeverfassungen – frühmoderne Staatsformen, in denen bisher gültiges oder neues Recht verankert wurde, welches Machtausübung nur im wechselseitigen Zusammenspiel sicherte. Die römisch-deutschen Könige wurden bereits im 14. Jahrhundert von den sieben Kurfürsten, den drei geistlichen (Köln, Mainz und Trier) und vier weltlichen (dem König von Böhmen, dem Herzog von Sachsen, dem Markgraf von Brandenburg und dem Pfalzgrafen bei Rhein) gewählt, was Kaiser Karl IV. ihnen in der Goldenen Bulle (1356) verbriefte. Das deutsche Königreich hatte aufgrund der Reformbeschlüsse von Worms (1495) einen Reichstag, der aus den Kurfürsten, Fürsten, Grafen und Städtevertretern sowie einem Reichskammergericht mit Beteiligung der Reichsstände bestand. Die europäischen Monarchien hatten sich zu „ständischen Konsens-Systemen“ im Spätmittelalter entwickelt.
Die Macht der Stände erfuhr zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert ihren politischen Höhepunkt und wirkte noch während des „Absolutismus“ im 18. Jahrhundert weiter, ein von der Geschichtsschreibung hinterfragter Begriff, weil er wohl auch selbst nie den Anspruch des Absoluten einlösen konnte. Es handelte sich durch den Einfluss des Adels, des Klerus, der Provinzialstände und anderer höfischer Gruppierungen nur um eine relative monarchische Herrschaftsmacht.
Die Institutionalisierung ihrer Korporationen mit ausgeprägtem Verlangen nach Partizipation und dem Bewusstsein für Repräsentation war kein west-, sondern ein gesamteuropäisches Phänomen, das auch in den als „rückständig“ geltenden ostmitteleuropäischen Kernregionen mit ihren sehr dominanten machtvollen Adelsgruppen anzutreffen war, so im weitgehenden polnischen „liberum veto“, das die Staatsmacht aufzulösen drohte. Nur in Europa und auf keinem anderen Kontinent prägten sich derart weitgehende Partizipationsrechte der Untertanen aus. In manchen Ländern etablierte sich ihre Mitwirkungspraxis als permanente Einrichtung, so in den Wahlmonarchien Polen, Böhmen oder Ungarn, wo sie auch noch bei der Nationsbildung im 19. und 20. Jahrhundert beträchtlichen Einfluss hatten.
Neben den Territorialherrschaften entwickelten sich mit Genua, Venedig und der Hanse europäische Seemächte. Im 12. Jahrhundert nahm Genua einen gigantischen wirtschaftlichen Aufschwung. Seine Einwohnerzahl stieg auf 90.000 und wurde so eine der größten Städte auf der Apenninen-Halbinsel. Seine Spitzenstellung im Asienhandel für die kommenden eineinhalb Jahrhunderte erlaubte die Ausdehnung eines Netzes von Filialen und Kontoren bis ins Schwarze Meer, wo sie auf der Krim oder am Don mit venezianischen Niederlassungen konkurrierten. Durch den Pesttod des Normannenkönigs Robert Guiscard (1085) konnte Venedig seine Präsenz an der Ostküste und in Byzanz verstärken und mit den römischdeutschen Kaisern koalieren. Papsttreue war nie ein Anliegen der Lagunenstadt. Der Aufstieg zur europäischen Großmacht gelang mit der Wahl von Enrico Dandolo zum Dogen (1192), der die Thronwirren in Byzanz und den Tod des Staufers Heinrich VI. nutzte, um die Führung des vierten Kreuzzuges mit dem Vorwand zu übernehmen, in Byzanz die rechtmäßige Erbfolge wieder herzustellen. Der offene Krieg mit Genua brach 1257 aus. Ein Kompromiss durch Aufteilung der Interessengebiete kam nicht zustande. Am Ende behielt Venedig im Landkrieg durch „Condottieri“ (Söldnerheere) die Oberhand. Die Kaiser, die sich mit Päpsten und Genuesern in Konflikt befanden, waren die Helfer eines Seestädte-Bundes, der ebenfalls zur europäischen Großmacht avancierte.
Kaiser Friedrich II. erhob Lübeck 1226 zur freien Reichsstadt und entzog sie dadurch dem Anspruch von Territorialherren. Während Genua und Venedig im Süden Europas von den Kreuzzügen profitierten, zogen Lübeck und Hamburg Handelsvorteile aus der Missionierung der heidnischen Slawen. Die Nachfrage nach Holz, Asche, Pelzwerk und Erzen aus dem Osten und Norden war groß, Tuche und Fertigwaren konnten im Osten abgesetzt werden. Mit ihren Kontoren auf Gotland, in Bergen, London, Brügge und Nowgorod formte die Hanse um den Nukleus Hamburg und Lübeck ein gemein-europäisches Fernhandelssystem, das in einem langwierigen Prozess aus genossenschaftlichen Zusammenschlüssen nord-, west- und ostdeutscher Kaufleute während ihrer regelmäßigen Gruppenreisen und Handelsaufenthalte erwachsen war (Ahasver von Brandt).
Hanse bedeutete mittelhochdeutsch „Kaufmannsgilde“ und althochdeutsch „Kriegsschar“ („Hansa“). Neben Lübeck, Bremen, Hamburg, Lüneburg, Riga, Rostock, Stralsund oder Wismar, die als klassische Hansestädte gelten, waren solche Städte auch Hildesheim, Frankfurt/Main, Mainz oder Nürnberg. Mit der Hanse wird der Netzwerkcharakter von Städten deutlich, wobei sie über ihre regionale Bedeutung hinaus auch europäische Relevanz hatten. Sie stellte eine europäische Großmacht dar, die sogar Könige absetzen konnte und Kriege führte. An sich ein „schwer fassbarer Organismus, der keinen wirklich dauerhaften oder übergreifenden institutionellen Charakter besaß“ (Jan Lokers), wird die Dauer der klassischen Geschichte der Hanse auf rund 500 Jahre von 1159 bis 1669 angesetzt. Eine juristische Einordnung fällt schwer. Die Geschichte dieses Städtebundes ist wohl nur vor dem Hintergrund der demografischen, ökonomischen und politischen Entwicklung zu sehen. Zwischen 1000 und 1300 wuchs die Bevölkerung im Heiligen Römischen Reich von 3,5 Millionen auf 14 Millionen Einwohner an, was eine enorme Nachfrage an Gütern und Produkten hervorrief. Städte wurden Transithandelsplätze und Zentralmärkte.
Die Hanse entstand nicht mit einem einzigen Gründungsakt, sondern in einer langwierigen Entwicklung in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Gemeinsames Interesse waren der Aufbau, die Aufrechterhaltung und die Intensivierung von Handelsbeziehungen. 1358 tritt der Verbund als „Dudesche Hanse“ ans Licht der Öffentlichkeit. Der Ost-West-Handel verlief sehr einseitig: Die auf der Fahrt nach Westen voll beladenen Schiffe verkehrten auf der Rückfahrt nur teilweise beladen oder gar leer. Der Handel von West nach Ost blieb hinter dem Handel von Ost nach West zurück. Der Aufstieg zur Macht der Hanse war begünstigt durch den Verlust der königlichen Zentralgewalt ab Mitte des 13. Jahrhunderts, der auch im Norden des Heiligen Römischen Reichs zu einem Machtvakuum geführt hatte. Die Städte schlossen sich zu regionalen, aber nie lang anhaltenden Bünden zusammen, um Frieden und Recht zu wahren. Die Anarchie auf den Verkehrswegen galt es zu beseitigen und das Seeräuberunwesen zu bekämpfen. Blockaden waren ein Mittel. Hansestädte konnten auch eigene Armeen und Flotten aufstellen. Die militärischen Erfolge waren aber nicht durchschlagend. Mangelnde Geschlossenheit, Nicht-Beteiligung an Gemeinschaftsaktionen, die Sonderrolle einiger Städte, wie Köln und Bremen, sowie die Verfolgung von Eigeninteressen deuteten schon den Niedergang der Hanse an. Die eigentlichen Zielsetzungen, die Beibehaltung der Handelsprivilegien, der Schutz der Kaufleute im Ausland und die Wahrung des Nord- und des Ost-West-Handelsmonopols, blieben verbindend und wurden über lange Zeit erreicht.
Die Hanse entwickelte einen grenzenlosen Wirkungsbereich von norddeutschen und nordeuropäischen Städten bis hin nach Venedig, dem Fondaco dei Tedeschi an der Rialto-Brücke, eingeschränkt aber auch vom Mittelmeer über Spanien und Portugal, ja sporadisch sogar bis nach Lateinamerika. Sie kontrollierte nicht nur die Seewege über die Ostsee, sondern besaß auch ein Vetorecht bei der Wahl des Königs von Dänemark. Das erste bekannte Privileg, die Urkunde einer Kaufmannshanse, stammt aus dem Jahr 1157, während 1669 der letzte Hansetag stattfand. Für den Niedergang werden weitere Gründe angeführt: einmal der Mangel an einheitlichen Gewichten und Maßen. Die Hansekaufleute sperrten sich gegen Neuerungen auf dem Bankensektor und veränderte Formen der Kreditgewährung. In der geballten, wachsenden und immer übermächtiger werdenden Konkurrenz oberdeutscher, niederländischer und englischer Kaufleute ist ein weiterer Grund zu sehen. Letztere konnte die Hanse im 15. Jahrhundert noch im Zaum halten, doch die Holländer liefen ihr vom 15. bis zum 17. Jahrhundert zunehmend den Rang ab. Seit rund 1450 gab es auf der See in Nordeuropa kein Handelsmonopol der Hanse mehr. Die wiederkehrende Uneinigkeit in Abwehr- und Verteidigungsfragen machte sich im Zeichen des Wettbewerbs nun besonders gravierend bemerkbar. Der Deutsche Ordensstaat und der preußische Adel verlangten für sich selbst das Recht des Fernhandels. Die Entstehung des frühneuzeitlichen Staates seit dem 16. Jahrhundert war ein weiterer wesentlicher Faktor, der zur Einbuße an Autonomie und Eigenständigkeit, also zu einem Machtverlust der Städte, führte. Von diesem Vorgang waren auch die Hansestädte betroffen. Die Landesherren engten deren Spielraum immer mehr ein. So erklärte die Stadt Berlin nach ihrer Unterordnung unter den brandenburgischen Kurfürsten 1452 ihren Austritt aus der Hanse. War sie schon in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts bedeutungslos geworden, so lebten ihre Einrichtungen bis ins 19. Jahrhundert weiter. Mit dem Verkauf der Kontore in London (1852) und Antwerpen (1862) erlosch sie definitiv.
Die zögerliche Mitwirkung britischer Kaufleute an dem einträglichen Tausch und Handel lag an der eingeschränkten Städtepolitik des Hauses Plantagenet, das die Geldströme nicht in bürgerliche, sondern in die eigenen Kassen lenken wollte. Bis zum 14. Jahrhundert blieb das englische Bürgertum handelspolitisch zurückhaltend. Anders als England war Flandern ein florierendes Handelsgebiet. Brügges Aufstieg zum Weltmarkt des europäischen Westens erfolgte gleichzeitig mit den Aktivitäten deutscher Kaufleute im Osten. Die Stadt wurde Umschlagplatz für englische Wolle, friesisches Vieh, französischen Wein, portugiesische oder spanische Früchte. Italienische Kaufleute führten mit dem Wechsel ein neues Finanzierungssystem ein, während die Deutschen mit ihrem Großschiff, der Kogge, das wirtschaftlichste Transportmittel besaßen.
Die Kirche besaß jahrhundertelang den alleinigen geistigen Führungsanspruch, bedingt durch ihr Wissensmonopol, die weitverzweigte Organisation und die auf Dauer angelegte machtvolle Gestaltungskraft gegenüber herrschaftlichen und staatlichen Gemeinwesen. Romanische Kirchen, gotische Dome und barocke Prachtbauten zeugen von ihrer glanzvollen irdischen Präsenz. Ordensgründer, wie der Schöpfer der Klosterregel des westlichen Mönchtums, der Heilige Benedikt von Nursia (~ 480–547) – Papst Paul VI. ernannte ihn zum „Patron Europas“ –, namhafte Theologen wie Albertus Magnus (~ 1200–1280), dem der Brückenschlag zwischen Christentum und der Philosophie Aristoteles’ gelang, Thomas von Aquin (1224–1274) oder Nikolaus von Kues (1401–1464), der die Aussöhnung zwischen Reichspolitik und päpstlichem Machtstreben versuchte, prägten die geistesgeschichtliche Entwicklung Europas.
Daneben wirkten die lateinischen Slawenapostel Kyrillos/Cyrill (827–869) und Methodios/Method (826–885), die die theologisch-kulturelle Expansion des Christentums, v. a. die „Missionierung“ der Ostgermanen, Ungarn und kleinerer Teile der slawischen Völker (9.–11. Jahrhundert) vorantrieben. Für ihre Arbeit der Bekehrung im Großmährischen Reich schufen sie das „kyrillische“ Alphabet. Das Gros der Slawen, die Balkan-Völker und Russen ließen sich jedoch von der griechisch-christlichen Konfession inspirieren und bekannten sich zur orthodoxen Kirche, während der Westen des Kontinents zur Zeit der Merowinger, Karolinger und Ottonen durch die katholische Kirche christianisiert wurde. Hierbei spielten irische Mönche wie bspw. Columban der Jüngere von Luxeuil (~ 542/3–615), der „Glaubensbote in Alemannien“ und Gründungsabt des Klosters Bobbio, oder der angelsächsische Mönch (Wynfrith) Bonifatius (672–754) eine große Rolle.
Seit dem späten Mittelalter sind die hohen Schulen als Einrichtungen mit europäischer Dimension zu verstehen. Die Erziehung zu Akademikern war bis dato in Kloster- und Domschulen erfolgt, die für den eigenen Bedarf ausbildeten und eher selten auswärtige Kleriker aufnahmen. Diese Schulen standen unter der direkten Aufsicht eines Abtes oder Bischofs. Es entstanden Universitäten. Eine Gründung erfolgte 1224 durch den Stauferkaiser Friedrich II. in Neapel. Salerno (1050), Bologna (1088) und Paris (~ 1100) waren vorausgegangen und spielten für weitere Gründungen eine Vorreiterrolle. Oxford (1163), Cambridge (1200), Montpellier (1289), Prag (1348), Krakau (1364), Wien (1365), Ofen (1389), Leipzig (1409), Rostock (1419), Löwen (1425) und Uppsala (1477) folgten. Dabei bildeten sich eigenständige universitäre Einheiten, Personenverbände, die für die akademische Lehre zuständig waren. Neu waren an diesen Stätten die weitreichende, überregionale Ausstrahlungskraft sowie die Freizügigkeit der Magister und Scholaren. Sie bedurften als Ortsfremde eines spezifischen Rechtsschutzes, die Universität selbst einer besonderen Bestandsgarantie. Nicht nur die Herren „professores“, sondern auch die „fahrenden Scholaren“ und Vaganten frequentierten verschiedene Städte des Kontinents.
Kaiser Friedrich Barbarossa gewährte mit der „Authentica Habita“, dem Scholaren-Privileg, erlassen am Reichstag auf den Roncalischen Feldern 1158, den Bologneser Studenten Bewegungsfreiheit und Immunität. Damit wurde der Grundstein zur universitären Selbstverwaltung gelegt und die rechtliche Zuständigkeit der Kommunen beschränkt. Das Dokument untersagte, die Hochschüler für Schulden ihrer Landsleute haftbar zu machen. Berühmt wurde der Passus, wonach allen, die aus Liebe zur Wissenschaft die Heimat verlassen und in der Fremde leben mussten, Schutz zugesagt sei. Das Hochschulwesen wurde damit stark befördert. Innerhalb zahlreicher Universitäten schlossen sich die Studenten zu „nationes“ in der Art von Schutzgilden und „Bursen“ (Wohnheimen) zu organisierten Gemeinwesen zusammen. Die fahrenden „scholares“ trugen durch ihre gemeinsame Sprache Latein zusammen mit Magistern und Professoren zur Europäisierung der Universitäten bei und können als erste Repräsentanten europäischer Identität bezeichnet werden. Festzuhalten ist allerdings auch, dass aus den europäischen Universitätsstädten die landsmannschaftlich organisierten studentischen „Nationen“ hervorgingen, d. h. die Städte mit den Universitäten bei aller Europäizität und Internationalität über die Studenten auch den Anfang der Territorialisierung machten und dabei den geistigen Nukleus für das Denken in Kategorien der vormodernen Nationalstaatsbildung bildeten. Dabei ging es auch immer wieder um die Freiheit der „Nationen“.
Schon seit dem Mittelalter war es Brauch, dass vor allem Gelehrte, Künstler, später auch Handwerker zum Zwecke ihrer Ausbildung oder um Neues kennen zu lernen, längere Reisen, eine so genannte „Grand Tour“, unternahmen. So zog es Maler besonders nach Italien oder Wissenschaftler nach Frankreich. Legendär wurden Bildungsreisen, auf die sich junge Adelige und Begüterte begaben, auf denen bekannte Persönlichkeiten und Stätten aufgesucht wurden. So fand auf diese Weise ein relativ regelmäßiger Austausch von Erkenntnissen, Sitten und Gebräuchen statt.
Schon früh erfolgte neben der Ausbildung an den Universitäten ein reger Gedankenaustausch über Erfindungen und Neuerungen via Akademien und wissenschaftlichen Gesellschaften. Zwischen den Gelehrten des gesamten Europas wurden dabei durch Fahrten, vor allem aber durch Briefwechsel dauerhafte und enge Kontakte geknüpft. In diesen Akademien waren zum Teil auch Vertreter von Fürstenhöfen und frühmodernen Staaten oder auch (wie in England) der Wirtschaft vertreten, die dafür sorgten, dass neue Erkenntnisse und Fragestellungen schneller und weiter verbreitet werden konnten. Ein Beispiel dafür liefert Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), einer der letzten großen Universalgelehrten (Mathematiker, Philosoph, Jurist und Historiker), der mit nahezu allen Wissensgebieten befasst war. Er war Mitglied der Royal Society und der Académie des Sciences sowie Präsident der Sozietät der Wissenschaften in Preußen. Seine Leistung wird im Transfer der antiken Wertewelt in die Neuzeit gesehen, ohne diese zu verstellen oder zu verfälschen.
Politik- und kulturgeschichtlicher Hintergrund sowie gesellschaftlicher Kontext des Denkens und Wirkens von Leibniz war die konfessionelle Spaltung, die das Europa der Mitte des 17. Jahrhunderts charakterisierte. Dieser Gegensatz ist mit der ideologischen Auseinandersetzung des 20. Jahrhunderts vergleichbar. Als Sohn eines Juristen und Moralphilosophen war Leibniz Nachkriegskind, das die Folgen des Dreißigjährigen Krieges (1618–1648) zu begreifen versuchte, einer Zeit, in der sich für Gebildete und Gelehrte die Vereinbarkeit der Güte Gottes mit dem Leid der Welt als ernsthafte Frage stellte. Leibniz wandte sich religionsphilosophischen Fragen zu, so jener von der „Theodizee“, der Rechtfertigung Gottes und einer Welt, die er im Weg der Lehre von den „Monaden“ zu erklären versuchte. Danach habe Gott aus der Vielzahl von möglichen Welten die beste „aller möglichen Welten“ auf der Basis einer „prästabilierten Harmonie“ (also einem von vornherein eingerichteten Zusammenwirken des Gemeinwohls) geschaffen. Leibniz’ Denken und Wirken kreiste wiederholt um die Wiederherstellung der Einheit des Christentums. Dabei entwickelte er sich zu einem herausragenden Vertreter grenzüberschreitenden Denkens, der ausgehend von seinen Welterkundungen für die Schaffung einer europäischen Friedensordnung eintrat. Mit seiner Monadenlehre nahm Leibniz die vielfach propagierte Formel „Einheit in der Vielheit“ („unitas in multitudine“) vorweg, die dem heutigen Leitbild der EU entspricht. Es erstaunt umso mehr, als er zeitgleich auf verschiedensten Ebenen wirkte, europäisch und global orientiert war, einem moderaten Patriotismus „wie Griechen und Römer“ verpflichtet war und Verbindendes vor Trennendes stellte.
Europa-Pläne sind damit keine Erfindungen des 20. Jahrhunderts. Es gab sie bereits im hohen Mittelalter und der Neuzeit. Die Scholaren erlebten den Kontinent während ihrer Studienaufenthalte. Die Ritterorden, Konzilien und Universitäten waren für die mittelalterlichen Eliten von großer Bedeutung. Daraus erwuchsen auch Vorstellungen zur politischen Gestaltung Europas. Die Autoren dachten nicht nur an eine bessere Zukunft für den Kontinent, sondern boten Herrschern auch Rezepte zur Machterhaltung an. In der Debatte wurde v. a. der westliche Teil des Kontinents bzw. die lateinische Christenheit als Einheit verstanden, die es wiederholt gegen äußere Feinde, wie z. B. die so empfundenen Türken, zu verteidigen galt. Universalistisch angelegte Herrschaftskonzeptionen vom hohen Mittelalter bis in die Neuzeit wurden zwar realpolitisch wenig bedeutsam, sind aber in ihrer ideengeschichtlichen, herrschaftslegitimierenden und motivierenden Dimension von historischem Interesse. Sie stammten von Beratern, Schriftstellern, Gelehrten, Juristen, Philosophen oder politischen Außenseitern (Derek Heater). Sie sind auch als nicht zu unterschätzende Beiträge für die „Entstehung einer europapolitischen Philosophie“ (Wolfgang Schmale) und als Elemente der langen „Geschichte des Völkerrechts“ (Harald Kleinschmidt), in diesem Falle des „Ius Publicum Europaeum“, zu verstehen. Wenn sie aufgegriffen und propagiert wurden, waren sie nur selten ein Ziel für sich, sondern dienten der Verschleierung machtpolitischer Egoismen, hegemonialer Intentionen oder imperialistischer Zielsetzungen. Die Konzepte spiegeln zeitgenössisches Denken im Umfeld von Eliten mit Blick auf Konfliktmanagement, Kompromisslösungen und praktische Machtausübung wider. Sie waren sowohl Ausdruck regional begrenzten Denkens als auch (gesamt-) europäischer Selbstwahrnehmung und bewegten sich zwischen souveräner Herrschaftslegitimation und supranationaler Föderation.
2. Dante Alighieri als „Propagandist des Reichs“
Der Florentiner Dante Alighieri (1265–1321) war der erste abendländische Denker, der als Anhänger des Kaisers („Ghibelline“) für die Unabhängigkeit der Stadt am Arno gegen die Ansprüche der Papsttreuen (der „Guelfen“) eintrat. Dem Weltherrschaftsanspruch von Papst Bonifatius VIII. – „Bulla Unam Sanctam“ (1302) – widersprach er: Weder das Alte noch das Neue Testament habe einem Priester anvertraut, sich um weltliche Dinge zu kümmern. Derlei sei gegen die Natur der Kirche. Der Papst habe die Aufgabe, der Offenbarung folgend das Menschengeschlecht zum ewigen Leben hinzuführen und der Kaiser dafür Sorge zu tragen, nach den Lehren der Philosophie den Erdenbewohnern zum irdischen Glück zu verhelfen, d. h. für Freiheit und Frieden zu sorgen. Erwartungsvoll war Dante dem römisch-deutschen König, dem Luxemburger Heinrich VII., „dem Erben Roms“ und „Ordner Italiens“, auf dessen Zug nach Rom (1312) entgegengeeilt. Der in universalen Kategorien denkende Schöpfer der enzyklopädisch angelegten „Divina Comedia“ (Göttliche Komödie), ein in toskanischer Mundart verfasstes und in allegorisch-lehrhafte Gedichte eingekleidetes Werk, erwartete sich von Heinrich die „renovatio imperii“ (Erneuerung des Reichs). Die historisch begründete Sehnsucht nach Wiederherstellung des (römischen) Kaiserreiches und der Wunsch nach Unterwerfung der Fürsten und Monarchen unter seiner Autorität waren angesichts der Fremdherrschaft der Franzosen und Spanier im unteritalischen Raum, der aufstrebenden lokalen und regionalen Gewalten der lombardischen Republiken sowie der wachsenden Macht der Reichsfürsten als rückwärtsgewandte politischideologische Utopie zu verstehen, die an den Gegebenheiten des 14. Jahrhunderts in Mittel- und Südeuropa scheiterte. Der „Propagandist des Reichs“ sah in einer „monarchia totius europae“ (den ganzen Kontinent umfassenden Monarchie) mit globaler Dimension das Ziel und als Feind dieser Idee neben dem Papst vor allem in Frankreich, dessen König die Universalität des Heiligen Römischen Reichs nicht anerkannte. Dante zufolge konnte aber nur eine Universalherrschaft Frieden sichern und die verschiedenen einzelnen Gemeinwesen zu einer geregelten Ordnung zusammenfassen. Seiner Auffassung nach wäre hierzu die Herrschaft eines Einzelnen erforderlich. Wie das gesamte Universum seinen Oberherrn in Gott habe, so sollte die Menschheit einen obersten Herrscher, einen „Weltmonarchen“, haben. Auf diese Weise gleiche sich die Ordnung der Menschheit der von Gott gelenkten Schöpfung an. Nur so wäre Dantes Vorstellungen gemäß auch eine Instanz vorhanden, die Fürstenzwist schlichten und der Welt Gerechtigkeit bringen könne. Nur unter der Herrschaft des Augustus („Pax Romana“) sei die „gesamte Welt ruhig“ gewesen. Die Autorität des Kaisers stamme wie beim Papst unmittelbar von Gottes Gnaden. In seiner Schrift „Monarchia“ wandte sich Dante nicht gegen den Papst, sondern versuchte, die Gegensätze zwischen ihm und dem Kaiser auszugleichen. Die herbeigesehnte Weltherrschaft sollte aber die Eigenheiten der Völker durch unterschiedliche Gesetze berücksichtigen. Der Kaiser, dessen Macht nur so weit reichen sollte wie der Einfluss des Christentums, sollte Teilherrschern lediglich allgemeine Anweisungen geben und die Menschheit, zu der Dante nur die christliche rechnete, so zum Frieden führen. Erstmals seit der Antike wurde damit indirekt der Gedanke einer Föderation formuliert. Im Sinne der Zwei-Schwerter-Lehre sprach er sich gegen den Vorrang der Kirche aus. Beide Schwerter seien ihren Trägern unmittelbar von Gott übergeben, so dass sich keiner in die Sphäre des anderen einzumischen habe. Die guelfische Partei veranlasste Dantes Verbannung aus Florenz. Mit seiner „Göttlichen Komödie“ wurde er jedoch unsterblich.
Im Dom Santa Maria del Fiore, dem Ort der Lesungen seiner Göttlichen Komödie, hält Dante auf dem 1465 anlässlich seines 200. Geburtstages bei Domenico di Michelino in Auftrag gegebenen Gemälde ebendieses Buch in der Hand. Der Bildhintergrund entspricht den Abschnitten Hölle (links), Läuterungsberg (Mitte) und Paradies (rechts).Foto: Jastrow
3. Pierre Dubois und die „Wiedereroberung des Heiligen Landes“
Mit dem Ende der Stauferherrschaft in Unter- und Mittelitalien schwand der universale Herrschaftsanspruch des Kaisers. Der Amtsanwalt und Propagandist des französischen Königs Philipp des Schönen, Pierre Dubois (auch Petrus de Bosco, ~ 1255–1321), entwickelte eine neuartige universalistische Herrschaftskonzeption auf föderativer Grundlage. Die Einnahme Akkons durch die Mamelucken (1291), wodurch den Christen das „Heilige Land“ endgültig verloren ging, veranlasste ihn zu der Flugschrift „De recuperatione Terre Sancte“ („Über die Wiedereroberung des Heiligen Landes“, 1306), die er als Vorbedingung für einen neuen Kreuzzug, die Schaffung eines weltweiten Friedens innerhalb der gesamten Christenheit und ein vom Papst geleitetes Konzil aller geistlichen und weltlichen christlichen Fürsten forderte. Die Ablenkung der militanten Kräfte nach außen sollte Frieden unter allen Mitgliedern schaffen. Verbleibende Konflikte wurden durch jeweils drei Prälaten und drei weltliche Fürsten für jede Partei beigelegt, die vom Konzil zu bestimmen waren. Gegen die Entscheidung der Schiedsrichter war nur die Anrufung der päpstlichen Instanz möglich. Ein Friedensbrecher konnte durch Güterentzug und „Frontbewährung“ gemaßregelt werden, was an moderne Kriegszeiten erinnert. Seine kriegerische Eignung konnte er gegen die „Ungläubigen“ beweisen. Vorrechte des römischen Kaisers fehlten gänzlich. Dubois ging von der hegemonialen Stellung des französischen Königs aus, der einer Delegiertenversammlung europäischer Monarchien vorstehen sollte. Der Gedanke vom „bellum iustum“ war mit der konziliaren Idee und dem Papst als letzter Anrufungsinstanz eng verknüpft. Philipp folgte den komplexen Ratschlägen seines Juristen nicht. Er war ein pragmatischer Staatsmann, der für Experimente nichts übrig hatte.
Mit dem Konzept war jedoch die Idee einer europäischen Föderation geboren. In der Geschichte des Völkerrechts gilt Dubois als Schöpfer der obligatorischen und permanenten Schiedsgerichtsbarkeit, die als solche punktuell freilich schon vor seiner Zeit praktiziert worden war. Sie sollte sich auf einer politischen Organisation der gesamten zivilisierten Welt gründen, war also global gedacht. Ohne entsprechenden politischen Willen war das aber nicht durchsetzbar. Dieser fehlte Philipp. Weiterhin wurden Föderationen oder Koalitionen christlicher Staaten, z. B. zum Kampf gegen die Türken, vorgeschlagen.
Die Entwürfe des böhmischen Königs Georg Podiebrad (1420–1471) zu einer Allianz mit dem französischen König Ludwig XI. (1462–1464), dem König von Ungarn und dem Hohen Rat Venedigs sowie die Anregung von Kardinal Wolsey zur Bildung einer Liga zwischen König Heinrich VIII. von England und Franz I. von Frankreich, in beiden Fällen gegen die Türken und jeden Verletzer des universalen Friedens (1518), blieben unverwirklicht. Als Europa mit der „Türkengefahr“ konfrontiert war (1529, 1683), gab es nicht immer Zusammenarbeit zur Abwehr des „äußeren Feindes“. Die Franzosen taten sich mit den Osmanen zusammen. Franz I. verbündete sich 1535 mit Suleiman gegen die Habsburger. Zum ersten Mal hatte sich ein offizielles Bündnis zwischen einem europäischen und nichteuropäischen Partner gebildet. Polens König Johann Sobieski eilte bei der zweiten türkischen Belagerung Wiens 1683 zu Hilfe. Dubois’ Gedanken finden sich bei Podiebrad wieder, der die Vorstellungen des Franzosen verfeinern und ausbauen ließ.
4. Georg Podiebrad und der europäische „Fürstenbund“
Der letzte nationaltschechische König schlug, stimuliert durch seinen französischen Berater und Dolmetscher Antonio Marini, einen Beistands- und Nichtangriffspakt christlicher Herrscher vor: Wiedergutmachung in Streitfällen zwischen Vertragspartnern, Bestrafung von Rechtsbrechern, Schiedsgerichte, Interventionsrecht im Falle eines Friedensbruchs, Isolation und Ächtung des Aggressors, eine den Zeitumständen angepasste Rechtsordnung mit einem „allgemeinen Generalkonsistorium“ (Gerichtshof), Unverzüglichkeit des Verfahrens mit richterlicher Gewalt, Neuaufnahme von Gleichgesinnten, Einstimmigkeits- bzw. verbindliche Mehrheitsbeschlüsse bei Angriffen eines „Feindes“, einheitliches Münzwesen zur Erleichterung der Organisation der Verteidigung, Quartier-Bestellung und Rückkehr der Krieger etc. sowie ein abgestuftes Gremialsystem. Dieses wies ein permanentes Ratskollegium (Deputierte mit Vollmachten) unter Berücksichtigung wechselnder Tagungsorte („Rotationsprinzip“) und einen speziellen Rat mit weitgehenden Kompetenzen in der Frage der Aufnahme sowie der Gerichtsbarkeit auf. Auch der Gedanke der Stimmengewichtung (bei Gleichheit sollten „Ansehen“ und „Verdienste“ den Ausschlag geben) war bereits vorhanden. Höchste Autorität blieb noch der Papst, der durch Sanktionierung und Eintreibung des „Zehents“ (Mitgliedsbeiträge und Steuern) Eingriffsmöglichkeiten, aber auch eine Art Schlichtungsfunktion hatte. Ziele waren die Abwehr der Türken (die 1453 Konstantinopel erobert hatten), wobei die Kreuzzugsidee wohl Pius II. beschwichtigen und Podiebrad vor Bannflüchen des Heiligen Vaters schützen sollte, die Friedenssicherung auf föderativer Grundlage und langfristig die Ausschaltung von Kaiser und Papst. Denn der hatte den selbstbewussten Herrscher als „Ketzer“ verurteilt, zumal er sich mit moderaten Hussiten, einer religiösen und sozialen Protestbewegung, liiert hatte.
Der Plan eines säkularisierten europäischen Staatenbundes diente besonders Georgs politischer Legitimität in Böhmen. Die Rezeption seiner Ideen reicht bis zur jüngeren Zeit. Während des „Prager Frühlings“ 1968 wurde Podiebrad von den Aufständischen in ihrem Kampf gegen die Breschnew-Doktrin als Beleg für die Tradition des tschechischen Europabewusstseins reklamiert. Waren Dante und Dubois noch der universalistischen Einheit des Mittelalters verpflichtet, so wird diese durch Podiebrad aufgegeben. Sein Bund verlangte Verzicht auf selbständige Kriegführung, Finanzhoheit und Außenpolitik, garantierte aber Existenz und Unabhängigkeit der Gliedstaaten. Mit diesen Ideen war der Weg für Europa als weltlichem Bundesstaat gebahnt. Die Verteidigung des Glaubens sollte dem Bund anheimfallen, d. h. der weltliche Fürst sollte auch in religiösen Fragen keine Autorität mehr über sich dulden.
5. Sebastian Münster und die Individualisierung der „monarchia universalis“
Die Idee der Universalmonarchie war gesamteuropäisch angelegt und nicht auf eine Dynastie beschränkt, da das Kaisertum keine Erb-, sondern eine Wahlmonarchie war. Karl V. (1500–1558) verkörperte den letzten Versuch einer europäischen Hegemonie-Bildung vor der Französischen Revolution und ist durch sein Selbstverständnis als ein weiterer „Ahnherr der europäischen Einigung“ betrachtet worden, dessen Herrschaft globale Ausmaße erreichte. Er gebot durch die kluge Heiratspolitik seiner Vorfahren über Burgund, die Niederlande, die spanischen Königreiche, den Süden Italiens, die Kolonien, die österreichischen Erblande und das Reich. Karl V. erwog übernationale Herrschaftspläne zur Ausschaltung des französischen Königtums als permanenten Rivalen, indem er dieses auflösen und in kleinere Einheiten aufteilen wollte. Der Ehrgeiz Frankreichs auf das römischdeutsche Kaisertum blieb ungestillt. Alle Monarchen Frankreichs bis hin zu Ludwig XIV. empfahlen sich als Gegenkandidaten des Hauses Österreich.
„Körperlichkeit“ Europas: Der Kopf ist Spanien, der Nabel Böhmen, die Brust Frankreich und Deutschland, Arme und Hände sind Italien und Dänemark, von denen die eine den Reichsapfel, die andere das Zepter trägt. Russland und die Balkanländer bilden hingegen die Falten ihres weiten Kleides.
Foto: aus Sebastian Münsters Cosmographia
Das Europa Karls V. wurde in der zeitgenössischen Kunst durch eine gekrönte Jungfrau dargestellt, womit seine Körperlichkeit (Wolfgang Schmale) ihren spezifischen Ausdruck fand.
Die Allegorie ist von dem Hebraisten Sebastian Münster (1489–1552) – nach Johannes Reuchlin (1455–1522) der Bedeutendste seines Fachs in Deutschland, der 1534/35 die erste christliche Ausgabe der hebräischen Bibel herausbrachte. Sein Ruhm gründet sich vor allem auf die „Cosmographia“ (1544), aus der dieses Europabildnis stammt, einer Weltbeschreibung in sechs Büchern mit zahlreichen Karten und Abbildungen. Ihr Konzept verband die Kompilation von aktuellen Daten, von zeitgenössischen Mitarbeitern vor Ort gesammelt, mit der Auswertung schriftlicher Quellen von der Antike bis ins 16. Jahrhundert. Das erste Buch beinhaltete „physische Geographie“, das zweite und dritte bestanden aus einer Übersicht über Lage und Grenzen Europas und eingehender Beschreibung der einzelnen Länder. 1536 bringt er in deutscher Sprache die „Mappa Europae“ heraus. Die Informationen für die Landkarten erbat er sich von zeitgenössischen Gelehrten und Fürsten, für deren Hilfe er sich in seinen Werken bedankte.
Mit der Herrschaft Karls V. war kulturell das Zeitalter von Humanismus und Renaissance verbunden. Seine Funktion lag in der Öffnung des Tors zur Neuzeit „durch ihr neues, auf antikem Boden stehendes Menschenbild“ (Clemens Zintzen), das die Individualität des Künstlers hervorkehrte, wie das Beispiel Münster deutlich macht.
Europa zur Zeit Karls V. (Anfang 16. Jahrhundert)
Die Humanisten Europas, geleitet vom wachsenden Selbstinteresse, Bedürfnis nach Eigenverantwortung und versucht, sich von kirchlicher Bevormundung zu emanzipieren, waren allerdings nicht immer kosmopolitisch orientiert. Sie befassten sich mit Rekonstruktionen von Genealogien, nationalen Charakterisierungen und setzten dabei auch andere Nationen herab. Der weltbürgerliche Erasmus von Rotterdam (1465/69–1536), Gegenspieler von Martin Luther, der als einer der ersten über sich selbst erzählte, von seinen Interessen, Freuden, Neigungen und Leiden berichtete, war eher eine Ausnahme, indem er sich der Relativität seiner Aussagen bewusst war, jede Parteilichkeit ablehnte und „besser noch Nichtbürger bei allen zu sein“ wünschte. Seine in lateinischer Sprache gehaltenen Appelle zur Einheit des Christentums, Aussöhnung zwischen Frankreich und dem Hause Österreich und zum Frieden in Europa blieben ohne Resonanz.
Kaiser Karl V. prägte diese Epoche entscheidend mit. Er gebot theoretisch über ein Weltreich, von dem gesagt wurde, dass darin „die Sonne nicht untergeht“. „Plus ultra“ lautete sein Leitspruch, womit die Absicht zur Eroberung, Kolonisierung und Christianisierung der Länder Nord-, Mittel- und Südamerikas zum Ausdruck kam (Karl Brandi, Alfred Kohler). Ererbt hatte Karl sein Reich von Kuba bis Ungarn. Lateinamerika, die Philippinen und die Molukken verdankte er allerdings der Eigeninitiative der Konquistadoren.
Betrachtet man das Universalreich von einer machtpolitischen Perspektive, so stimmt sein Herrschaftsanspruch nur zu Hälfte: Karl hätte sein Erbe ohne die Edelmetalle aus Mexiko und Peru schon 1520 nicht mehr behaupten können. Der ständige Geldzufluss aus Übersee versetzte ihn erst in die Lage, Weltmachtpolitik zu betreiben. Karl V. war nach seiner Wahl und durch die Kriege gegen Franz I., König von Frankreich, bereits zu Anfang seiner Regentschaft nahezu bankrott. „Es waren ganz zweifellos lediglich die Schätze, die die Conquistadoren anfangs an Karl schickten, ohne etwas für sich selbst zu behalten, die den Monarchen letztlich gnädig stimmten“. Karl schrieb Hernán Cortés im Dezember 1523, indem er diesen nicht nur anwies, sondern geradezu bat, alles zu unternehmen, was ihm möglich sei, um „die [...] größtmögliche Summe Goldes zu schicken“ (Felix Hinz).
„Europa“ spielte im Denken von Karl V. jedoch keine herausragende Rolle. Er war zuerst Katholik, dann Oberhaupt der Habsburger und nicht zuletzt auch Aristokrat im Sinne des Ordens vom „Goldenen Vlies“, wahrscheinlich sogar mehr Kosmopolit als Europäer. Er besaß kein Sprachtalent und beherrschte kaum eine Sprache gut. Für das Erlernen des Spanischen brauchte er sehr lange. Er war selten länger an einem Ort in seinem Reich – zumal „alle Welt“ sich gegen ihn zu erheben versuchte. Zuerst Franz I., den er 1525 bei Pavia besiegte und in Gefangenschaft setzte, dann Papst Clemens VII., der sich ihm 1527 unterwerfen musste. Schließlich folgten die aufständischen Fürsten im Reich, die sich dem Protestantismus angeschlossen hatten. Dieser erwies sich als widerspenstig. Die durch Einfluss von Jean Calvin (1509–1564), Martin Luther (1483–1546) und Ulrich Huldreich Zwingli (1481–1531) zwischen 1525 und 1535 auch politisch außer Kontrolle geratene gesamteuropäische Reformationsbewegung mit langer Vorgeschichte und weitgehenden Auswirkungen (~ 1400–1650) führte zu Gewaltausbrüchen, Bildersturm und den Bauernkriegen, konnte durch die mit großer Härte gegen „ketzerische“ Umtriebe reagierende kirchliche Autorität aber nicht mehr gebändigt werden. „Die Entfesselung der Frömmigkeit“ (Gábor Klaniczay) hatte bereits eingesetzt und war voll im Gange.
Der Anspruch eines europäischen Universalreiches spanischer Prägung unter Karl V. und seinem Nachfolger Philipp II. ließ sich nicht mehr aufrechterhalten. Im Augsburger Religionsfrieden (1555) war mit dem Grundsatz „cuius regio, eius religio“ die konfessionelle Spaltung beschlossene Sache. Karl V. dankte 1556 in Brüssel frustriert ab. Testamentarisch verfügte er die Ausrottung des Protestantismus.
Es gab nun kein gemeinsames religiöses Fundament mehr, auf dem eine einheitliche Kultur hätte entstehen können. Die Kirchen und das Christentum konnten den sich formierenden Staaten keine entscheidenden Impulse mehr geben, sie blieben in den jeweiligen Gesellschaften aber wertbestimmende Instanzen und normierten den Alltag weiterhin. Seither dominierte der Souveränitätsgedanke der frühen Nationen England, Frankreich, Holland, Spanien und Portugal. Die modernen Staaten forderten eine Trennung von Kirche und Staat, d. h. mehr Souveränität für sich.
6. Althusius und die Schweiz als konföderiertes Europa
Der deutsche Rechts- und Staatsphilosoph Johannes Althaus („Althusius“, 1557–1638) ging in seiner „Politica methodice digesta“ (Aufzählung von Methoden in der Politik, 1614) aufgrund seiner eidgenössischen Erfahrungswelt von der Überlegung aus, dass die staatliche Gewalt beim Volk und den Ständen liegen müsse. Die Regierenden besäßen nur anvertraute Macht, wobei sie die Bürgerfreiheiten und religiösen Gewissensüberzeugungen zu achten hätten. Für ihre Verwirklichung dachte Althusius an „Ephoren“ (griechisch: Gesetzesaufseher), womit die Gewaltenkontrolle gefordert wurde. Seine Vorstellung kam aus der Erkenntnis, dass ein Staat nicht als homogene Masse von Einzelindividuen, sondern als „symbiotische Universalgesellschaft“ aus Gemeinden, Provinzen und Regionen anzusehen sei, die sich ihrerseits aus Familien, kirchlichen und weltlichen Gemeinschaften zusammensetzten. Darin erblickte Althusius die Chance, zu größeren Verbänden über die Staatsgrenzen hinaus zu übergeordneten Strukturen zu gelangen und die Einzelstaaten im Verbund auf einer mittleren Größe zu halten, die für sie am besten sei.
Mit dem Augsburger Religionsfrieden und der Abdankung Karls V. schien der Pluralismus der Konfessionen rechtlich gesichert und der Protestantismus sich behauptet zu haben. Er war die bisher größte Herausforderung für die katholische Kirche. Das Konzil von Trient (1546–1563) eröffnete dann den Weg zur Gegenreformation (16.–19. Jahrhundert). Die katholische Kirche basierte nun auf Reformdekreten, aber auch gefestigten dogmatischen Grundsätzen und gewann durch die Pracht der barocken Kunst ein neues, eindrucksvolles Profil. Das Augsburg von 1555 war durch diese Gegenbewegung und auch aufgrund unklarer Vertragsbestimmungen lediglich ein „gläserner Friede“ (Winfried Schulze), der nur über ein halbes Jahrhundert währte und Europa im Kleinen mit seiner kulturellen Vielfalt verkörperte.
Das habsburgische Spanien, die „Supermacht der Epoche“, war „mächtigstes Bollwerk des katholischen Glaubens“ (Bernd Roeck), der sich zu einem zentralen Element der staatlichen und vornationalen Identität entwickelt hatte. Frankreich, das eine spanisch-habsburgische Umklammerung verhindern wollte, blieb Hauptgegner – ein politisches Leitmotiv der Geschichte Europas bis ins 18. Jahrhundert. Die Machtstellung der Halbinsel Spanien wurzelte nicht nur in ihren eigenen Ressourcen, sondern auch in Schätzen ihres Kolonialreiches, v. a. dem Silberreichtum in Amerika. Sie war auch Folge der inneren Schwäche Frankreichs, das durch die Hugenottenkriege paralysiert worden war. Noch um 1600 war offen, ob dieses Land sich zum zentralistischen oder polyzentrischen Staat entwickeln würde. Die innere Befriedungspolitik Heinrichs IV., die mit dem Toleranzedikt von Nantes (1598) ihren konkreten Ausdruck fand, bildete die Basis für den französischen Aufstieg. Spanien betrieb auch gegen das protestantische England, das unter der letzten Tudor-Regentin Elizabeth I. eine wirtschaftliche und kulturelle Blüte erlebte, eine scharf umrissene Außenpolitik. Philipp II. scheiterte jedoch damit, die britische Insel mit seiner auf allen Weltmeeren bis dato unbesiegbaren „Armada“ zu blockieren (1588). Ihre Niederlage leitete den Niedergang der spanischen Vorherrschaft in Europa und den Aufstieg Englands zur führenden Seemacht der Welt ein.
7. Sullys „Grand Dessin“ mit Stoßrichtung gegen die Habsburger Hegemonie
Maximilien de Béthune Herzog von Sully (1560–1641), Berater und Minister des französischen Königs Heinrich IV., entwickelte um 1640 einen Entwurf zur Reorganisation Europas. Er hatte seit 1576 in den Hugenotten-Heeren gekämpft. Aufgrund militärischen und politischen Geschicks sowie religiöser Prinzipientreue gewann er das Vertrauen Heinrichs IV. von Navarra, der ihn nach Thronbesteigung in seine Regierung berief. Nach der Ermordung Heinrichs (1610) schied er aus. In seinen „Mémoires ou Oeconomies royales d’Estat“, die 1662 in Paris erschienen, breitete er einen Plan zur Bildung einer Föderation der christlichen Staatenwelt aus, dessen Urheberschaft er Heinrich zuschrieb. 15 gleich starke Staaten sollten einen europäischen Bund bilden. Ihre Vertreter würden mit bewaffneter Macht gemeinsam über den Frieden wachen. Um dem „Großen Entwurf“ ein höheres Prestige zu verleihen, ordnete Sully dieser Struktur sechs große Erbmonarchien (Frankreich, Spanien, England, Dänemark, Schweden und die Lombardei), fünf Wahlmonarchien (Papst, Kaiser, die Könige von Ungarn, Böhmen und Polen) und vier Republiken (die Schweiz, Niederlande, Venedig und eine neu zu schaffende Republik in Italien, das sich bereits mit Venedig, Mailand, Florenz, Neapel-Sizilien und dem Kirchenstaat zu einer inneren Pentarchie formiert hatte) zu. Dieser Verbund sollte mit einem Generalrat ausgestattet sein, in dem die höchsten politischen und richterlichen Funktionen vereinigt werden sollten, sowie mit sechs regionalen Räten. Die Habsburger hätten damit nicht nur ihre Hegemonialstellung auf dem Kontinent, sondern auch wichtige Gebiete und ihren Einfluss auf den Weltmeeren verloren. Die spanischen südlichen Niederlande, das spätere Belgien, sollten zum Beispiel an die Vereinigten Niederländischen Provinzen, Tirol an die Schweiz usw. fallen. Das so neu gestaltete Europa sollte in der Lage sein, Türken und Russen, die als nichtchristlich galten, in die Schranken zu weisen, wobei Sully auch Überlegungen über das Ausmaß der europäischen Kontingente für einen Krieg gegen die Muselmanen und Orthodoxen anstellte. Der Verweis Spaniens auf die außereuropäische Welt deutete auf die globale Dimension des Konzepts hin. Konfessionen sollten unangetastet bleiben. Der Bund war gegen den türkischen Sultan gerichtet, während der Zar berechtigt war, dem Bündnis beizutreten. Der Präliminarartikel mit der Beschränkung der Hausmacht der Habsburger war Kernstück des Plans, während der Kaiser ausgehend von der „Goldenen Bulle“ 1356 als Oberhaupt weiter von den Kurfürsten gewählt werden sollte. Die Bevollmächtigten aller Staaten der christlichen Republik sollten an wechselnden Orten (Metz, Luxemburg, Nancy, Köln, Mainz, Trier, Frankfurt, Würzburg, Heidelberg, Speyer, Worms, Straßburg, Basel oder Byzanz) tagen.
Der „Grand Dessin“ Heinrichs IV. war eine Mystifikation und reflektierte die Auffassung des französischen Königshofs. Der Wunsch, die spanisch-österreichische Vorherrschaft in Europa einzuschränken, fand hierin Ausdruck.
Der Dreißigjährige Krieg (1618–1648) war ein europäischer Krieg bis dato schlimmsten Ausmaßes. Er wurde zum Krieg aller Kriege der frühen Neuzeit. Keine militärische Auseinandersetzung hatte bisher, und noch weit danach, so viele Opfer gefordert. Internationale Konflikte, strittige Verfassungsprobleme und konfessionelle Streitfragen hatten sich vermengt. Neben der Religion war die Habsburger Hegemonie in Frage gestellt. Ohne spanisches Geld und Militärs, wie den ausgezeichneten Heerführer Albrecht von Wallenstein (1583–1634), hätte die Dynastie den Konflikt nicht durchhalten können. Mitentscheidend für seinen Ausgang waren Aufstieg und Intervention Gustav Adolfs II. von Schweden (1594–1632), der die Machtposition des Kaisers schwächte, der Abstieg Spaniens, das wirtschaftlich ausgezehrt und mit inneren Aufständen konfrontiert war, sowie die Konsolidierung Frankreichs unter den Kardinälen Armand-Jean du Plessis Richelieu (1585–1642) und Jules Mazarin (1602–1661).