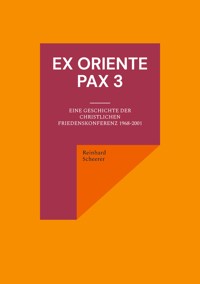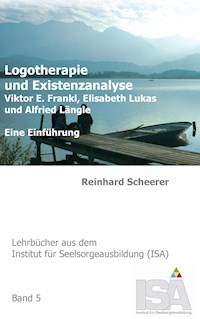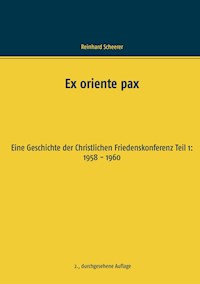9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Gegenstand dieser Arbeit sind die Christliche Friedenskonferenz (CFK) und der Prager Systematiker Josef L. Hromádka, der als der geistige und geistliche Vater der CFK zu gelten hat. Vor allem ihm (aber auch Männern und Frauen wie Hans-Joachim Iwand, Erich Müller-Gangloff, Renate Riemeck, Werner Schmauch und Wolfgang Schweitzer) ist es zu danken, dass in der Christlichen Friedenskonferenz stets klar war, dass diese Welt nicht aus Engeln und Teufeln, sondern aus Menschen besteht; dass wir, wo es um Gut und Böse, um Recht und Unrecht, um Leben und Tod geht, alle auf derselben Seite stehen; und dass wir nicht in Sicherheit voreinander, sondern nur im Frieden miteinander eine Zukunft haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 597
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Für Esther
Inhaltsverzeichnis
Teil 3 – Einladung zum Dialog
Einleitung
Das Ende des Experiments
Die I. Allchristliche Friedensversammlung 1961
Friede und Israel
Friede und die Volksrepublik China
Friede und der politische Katholizismus
Der orthodoxe Beitrag
Regionalkonferenzen und -ausschüsse
in der Bundesrepublik Deutschland
in der Deutschen Demokratischen Republik
in West-Berlin
in der Schweiz
in den Niederlanden und Belgien
in Frankreich
in Großbritannien
in Italien
in der Volksrepublik Polen
in Japan
Das Komitee für die Christliche Friedenskonferenz in den Vereinigten Staaten
Die II. Allchristliche Friedensversammlung1964 oder: Friede und die Deutschlandfrage
„Mein Bund ist Leben und Friede“ (Mal 2, 5)
Rettet den Menschen - Friede ist möglich oder: Der „Sumpf der Theologie“
Literaturverzeichnis
Einleitung
Man kann die Geschichte der CFK auch so beschreiben, wie ihr erster Generalsekretär, Jaroslav N. Ondra, das verschiedentlich getan hat1 - als eine Erfolgsgeschichte, die ihrer eigenen Logik folgt. An der Tagung des Beratenden Ausschusses für die Fortsetzung der Arbeit (BAFA) der Christlichen Friedenskonferenz vom 13. - 17. Oktober 1965 in Budapest führte er aus: Am Anfang stand der Kampf gegen die Atombombe. Das war das Thema der ersten Konferenz. Dann der Kampf gegen den Kalten Krieg: die zweite Konferenz. Dann kamen die positiven Aufgaben, die Vorbereitung der Ersten Allchristlichen Friedensversammlung (ACFV): die dritte Konferenz. Die konkrete Formulierung ihrer Stellung zur Abrüstung: die I. ACFV. Das Streben nach friedlicher Koexistenz in einer Zeit, in der allein die Erwähnung der Worte „friedliche Koexistenz“ als kommunistische Propaganda galt: die II. ACFV. Dann der Kampf gegen Kolonialismus und Neokolonialismus und für Solidarität und Zusammenarbeit für Gerechtigkeit und Frieden. So habe die CFK immer ihre Linie gehabt und sich als eine Avantgarde in der Friedensarbeit der Christenheit erwiesen, wurde das alles doch eins nach dem anderen im Weltkirchenrat, ja sogar in der UNO aufgegriffen. Denn auch diese Beschreibung hatte und hat ihren Wert.
Statt dessen erzähle ich hier die Geschichte der Auseinandersetzungen innerhalb der CFK und hebe die kontroversen Themen hervor, die die CFK oft genug auf eine Zerreißprobe stellten. Solche Themen gab es mehr als genug. Das konnte aber auch gar nicht anders sein; zu unterschiedlich war die Motivation ihrer Mitarbeiter: Einige kamen, weil sie dachten, dass es wichtig sei, dass Christen etwas für den Frieden tun; andere dachten, die Beschäftigung mit der Friedensfrage sei der Preis, den die Christen im Osten den Kommunisten zahlen müssten, um die Möglichkeit ökumenischer Kontakte zu erhalten. Die westlichen Mitarbeiter schätzten die CFK vor allem als Ort west-östlicher Kontakte; manche von ihnen kamen auch als die Reichen, um die armen Verwandten zu besuchen. Ebenso unterschiedlich war ihre theologische Prägung; sie reichte von den Quäkern über die klassischen protestantischen Kirchen bis hin zu den orthodoxen Kirchen und dem römischen Katholizismus. Und dann trafen sich in Prag Menschen aus Moskau und Washington, aus BRD und DDR, aus Afrika, Asien und Lateinamerika. Wenig überraschend ist die Geschichte der CFK deshalb auch die Geschichte einer beschwerlichen, mitunter als zu beschwerlich empfundenen Suche nach dem Verbindenden, die ihre Mitarbeiter trotz aller Unterschiede das Gemeinsame des christlichen Glaubens, die Nachfolge Jesu im Dienst an der Menschheit, immer wieder neu entdecken ließ.
Nicht die Verlautbarungen der CFK, nicht ihre Botschaften, Resolutionen2 oder Briefe an die verantwortlichen Staatsmänner sind deshalb von besonderem Interesse, sondern die Diskussionen, die sich in ihnen spiegelten. Schon Ondra betonte, es genüge nicht, nur zur Kenntnis zu nehmen, was beschlossen wurde. Viel wichtiger sei, die gesamte Atmosphäre und vor allem die schwierigen Situationen zu erfassen, die die Konferenzen bestimmten. Erst dadurch werde deutlich, wie auf den Konferenzen etwas wachse, unter Schmerzen wachse, und dass die Menschen nicht kämen, um über etwas abzustimmen, das vorher schon vorbereitet war.
In diesem Sinne wies der Präsident der CFK, Josef Lukl Hromádka, immer wieder darauf hin, dass jeder Mitarbeiter der CFK von seiner Umwelt gezeichnet sei, dass seine Ansichten einseitig seien und dass deshalb alle zu Vorurteilen und Verdächtigungen neigten. Es gehe auch gar nicht anders. Die Gefahr liege deshalb nicht in ihrer Einseitigkeit, sondern darin, dass sie ihre Einseitigkeit nicht zugeben wollten und ihre Ansichten für den alleinigen Maßstab für die Beurteilung anderer Menschen hielten. Hromádka folgerte: „In dem Augenblick, da sich jeder von uns der Tatsache seiner Einseitigkeit bewusst wird, haben wir schon einen entscheidenden Schritt vorwärts getan.“3 Denn diese Einsicht sei die Voraussetzung für jeden Dialog. Dialog heiße Aufgeschlossenheit für den anderen Menschen, der andere Ansichten habe, heiße Bereitschaft von ihm zu lernen und auch dort eine gemeinsame Basis zu suchen, wo man auf den ersten Blick fast unmöglich von einer solchen Basis sprechen könne. Und genau darin liege der eigentliche Sinn der Christlichen Friedenskonferenz. Denn diese Bewegung sei eine Gemeinschaft, deren Glieder zwar durch den gemeinsamen Glauben an das Evangelium Jesu von Nazareth miteinander verbunden seien, die aber verschiedenen politischen, sozialen, nationalen und kulturellen Bereichen entstammten. So müsse die Bewegung immer wieder neu geschaffen und geläutert werden - durch das Evangelium. Denn
„Das Evangelium spricht einen jeden von uns in seinen persönlichen Schmerzen und Nöten an, bringt ihm die Botschaft von der Vergebung und Versöhnung und schafft ein Band, das uns umschließt, aus welcher Welt wir auch kommen mögen, durch welche politische oder kulturelle Gebilde wir geformt sind und welche Ansichten von der Welt, der Geschichte, der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft und der Zukunft wir auch immer haben mögen. Und das wird gerade ein Beweis auch für die Lebendigkeit unseres Friedensstrebens, unserer Christlichen Friedenskonferenz sein, wenn wir uns die Wirklichkeit des Kommens Gottes in unser Leben in Jesus von Nazareth lebendig zu Bewusstsein bringen und wenn wir einander in Seinem Licht sehen werden.“4
Schon während der Tagung des Beratenden Ausschusses vom 4. - 9. Juni 1963 in Prag hatte die Theologische Kommission der internationalen CFK diese nicht eben leicht zu ertragende Spannung reflektiert und daraus - voreilig, wie sich nach der Militärintervention der Warschauer-Pakt-Staaten in der Tschechoslowakei im August 1968 zeigte - den Schluss gezogen: „Weil wir zur Jüngerschaft des Herrn Jesus Christus gehören, vertrauen wir auch dann einander, wenn jeder an seinem Ort Entscheidungen fällt, die der Bruder nicht versteht.“5
Die Orte, an denen sich diese Unterschiede am klarsten zeigten, waren die Regionalkonferenzen und -ausschüsse der CFK. Entsprechend breiten Raum nehmen sie hier ein; skizziert werden die ältesten der seinerzeit mehr als 40 Freundeskreise und Regionalkonferenzen der CFK weltweit. Mehrheitlich waren dies (west)europäische Kreise. Darin spiegelt sich, dass die CFK noch in den 1960er Jahren eine vordringlich von dem Ost-West-Gegensatz bewegte und auf Europa fokussierte Bewegung war. Zwar hatte sie von Anfang an auch ein weiteres, auf den Nord-Süd-Gegensatz gerichtetes Interesse - so sprachen an der 2. CFK André Trocmé über Französische Christen und das Problem der unentwickelten Völker, an der 1. ACFV Jacob S. A. Stephens über Friede und die neuen Staaten, und an der 2. ACFV Emilio Castro und Richard Adriamanjato über Hunger und wirtschaftliche Unabhängigkeit beziehungsweise Freiheit und Einheit. Und sie nahm immer wieder auch Stellung zu ausgewählten, den europäischen Horizont übersteigenden Themen und Ereignissen.
Das galt zunächst für den Nahostkonflikt, den ihr Präsident Josef L. Hromádka in seinem Hauptvortrag an der I. ACFV 1961 einführte. Er nahm damit nicht nur das seit dem Deutschen Evangelischen Kirchentag 1958 in München allmählich in Gang kommende christlich-jüdische Gespräch auf; er reagierte damit auch auf das Elend der palästinensischen Flüchtlinge. Und er hörte die Stimme arabischer Christen, die die bedingungslose Unterstützung der Gründung des Staates Israel durch Europäer und Nordamerikaner auf deren Schuldgefühl den Juden gegenüber zurückführten und klagten, im Zuge ihrer Wiedergutmachung des an Juden geschehenen Unrechts täten Europäer und Nordamerikaner Buße nicht auf eigene, sondern auf fremde Kosten. Darüber müsse gearbeitet werden, mahnte einer der Vizepräsidenten der internationalen CFK, der Franzose Georges Casalis, nach dem Sechs-Tage-Krieg 1967. Statt dessen kam es zum Bruch mit Helmut Gollwitzer und einer Reihe weiterer westdeutscher Theologen - vordergründig aus politischen Gründen, wegen einer vermeintlich pro-palästinensischen, anti-israelischen Parteinahme der CFK im Nahost-Konflikt, im letzten aber über die theologische Frage, ob der Staat Israel für Christen ein säkularer Staat ist wie jeder andere auch.
Als ebenso spannungsgeladen erwies sich die Besinnung auf den Themenkreis Friede und die Volksrepublik China. Zwar hatte die CFK seit ihrer Gründung immer wieder deren Aufnahme in die UNO gefordert. Als volkschinesische Christen 1961 an der I. ACFV teilnahmen, war das jedoch nicht nur ihr erster, sondern auch ihr letzter Besuch in Prag. Die westlichen Tagungsteilnehmer waren der Konfrontation mit ihren volkschinesischen Brüdern und der von ihnen vertretenen Sicht der US-Außenpolitik nicht gewachsen, so dass sie, statt in eine sachliche Auseinandersetzung über die angeschnittenen Fragen einzutreten, einen persönlichen Angriff auf die Brüder führten. Auf besondere Resonanz stieß in der CFK dagegen das Interesse Volkschinas an dem neuen sozialistischen Menschen, das dort anders als in der Sowjetunion ungebrochen war; ebenso zurückhaltend reagierte sie auf die ökumenische Chinabegeisterung im Zeichen der Großen Sozialistischen Kulturrevolution.
Über den Themenkreis Friede und die Deutschlandfrage kam es während der II. ACFV 1964 zu heftigen Auseinandersetzungen. Nicht nur die östlichen, sondern auch die westlichen Nachbarn Deutschlands bestanden in ihrer Angst vor den Deutschen sowohl auf der Oder-Neiße-Linie als auch auf der deutschen Zweistaatlichkeit. Und das Miteinander der Brüder aus den beiden deutschen Staaten war eher ein Neben- oder gar ein Gegeneinander voller bewusster Vorbehalte und direkter politischer Abhängigkeiten, so nicht nur der italienische Waldenser Giorgio Girardet; unstrittig war allein die Bitte an den Deutschen Bundestag, die Verjährung der NS-Verbrechen auszusetzen. Erst als die westdeutsche Delegation während der III. ACFV 1968 die Forderung ihrer Nachbarn nach völkerrechtlicher Anerkennung der DDR nicht mehr mit der Drohung beantwortete, abzureisen, entspannte sich die Situation.
Bereits seit der 2. CFK 1959 verhandelte die CFK das Problem Friede und politischer Katholizismus. Eine Stellungnahme dazu hatten die westlichen Teilnehmer zunächst verhindert, weil sie fürchteten, das könne der Glaubwürdigkeit der CFK in ihren Ländern schaden. Ausgelöst durch den Eucharistischen Weltkongress 1960 in München wurde der politische Katholizismus an der I. ACFV jedoch erneut zum Thema; das traditionell gespannte Verhältnis zwischen Rom und Moskau (die Orthodoxie hatte das Thema auf die Tagesordnung gesetzt) und die Bedrängung von protestantischen Minderheitskirchen durch die römisch-katholische Kirche (die osteuropäischen Minderheitskirchen hatten die ROK darin unterstützt) wirkten dabei mit. Für ihre vermeintlich antikatholische Stellungnahme 1961 wurde die CFK viel gescholten. Das hinderte sie jedoch nicht, das Pontifikat Johannes XXIII und das 2. Vaticanum dankbar zu begrüßen und einzugestehen, sie habe der erneuernden Kraft des Heiligen Geistes in der römisch-katholischen Kirche zu wenig zugetraut. Zu einer stärkeren Mitarbeit von Katholiken in der CFK kam es trotzdem nicht; die zwischenzeitlich von katholischen Funktionären der DDR-CDU initiierte Gründung der Berliner Konferenz Europäischer Katholiken stand dem entgegen.
Dass in alledem der orthodoxe Beitrag nicht zu übersehen war, und dass ich ihm deshalb ein eigenes Kapitel gewidmet habe, versteht sich von selbst.
Wenig überraschend bedeutete die Militärintervention der fünf Warschauer-Pakt-Staaten in der Tschechoslowakei 1968 einen tiefen Einschnitt auch in der Geschichte der Christlichen Friedenskonferenz, war sie doch nicht nur ein Kind, sondern auch eine engagierte Wegbegleiterin des Prager Frühlings. Die westeuropäischen Regionalkonferenzen und -ausschüsse lösten sich auf, spalteten oder distanzierten sich, ebenso die US-amerikanische und die japanische. Die französischen Freunde der CFK wurden aus der internationalen CFK ausgeschlossen. Die CFK-Arbeit in Europa kam weithin zum Erliegen.
Weder die Cuba-Krise noch der Vietnamkrieg figurieren hier. Die Problematik der sogenannten Dritten Welt, die Fragen von Dekolonialisierung, Neokolonialismus und Antiimperialismus und die damit zusammenhängenden Überlegungen zu einer Theologie der Revolution fehlen ebenfalls; ich werde sie in dem dritten Band (m)einer CFKGeschichte behandeln. Anderes habe ich immerhin ansprechen können - in der Hoffnung, Mut zu machen, sich der angerissenen Themenkomplexe monographisch zu nähern und die vielen Lücken zu füllen, die diese Darstellung notwendigerweise lässt. Sie behilft sich damit, dass sie sich auf die theologische Diskussion konzentriert, die CFK insofern beim Wort nimmt als eine christliche Friedenskonferenz und sie an diesem Anspruch misst.
Mein besonderer Dank gilt einmal mehr den Mitarbeitern der Stadtbücherei Kaltenkirchen, ohne deren Hilfe ich dieses Buch nicht hätte schreiben können.
1 So zum Beispiel anlässlich der Tagung des Beratenden Ausschusses für die Fortsetzung der Arbeit der Christlichen Friedenskonferenz vom 13. - 17. Oktober 1965 in Budapest: Jaroslav N. Ondra, Weg und Aufgaben der Christlichen Friedenskonferenz, in: Stimme der Gemeinde 17 (1965), Sp. 647-650
2 Vergleiche dazu etwa: Resolution des Beratenden Ausschusses der Christlichen Friedenskonferenz, in: Stimme der Gemeinde 17 (1965), Sp. 651-654
3 Josef L. Hromádka, Solidarität und Zusammenarbeit für Gerechtigkeit und Frieden, in: Stimme der Gemeinde 17 (1965), Sp. 655
4 a.a.O., Sp. 654f.
5 Gerd W. Theyssen, „Mein Bund ist Leben und Frieden“. Tagung des Beratenden Ausschusses der Christlichen Friedenskonferenz vom 4. bis 9. Juni in Prag, in: JK 24 (1963), S. 385
Das Ende des Experiments
Mit der vom 13. - 18. Juni 1961 in Prag zusammentretenden I. Allchristlichen Friedensversammlung (ACFV) endete das „Experiment“ CFK: Mit ihr wurde die Christliche Friedenskonferenz zu einer ständigen, kontinuierlich arbeitenden Institution. Das erhellt schon aus dem Selbstverständnis dieser Versammlung als der ersten in einer ganzen Reihe solcher Veranstaltungen; folgerichtig schlossen sich in dem hier interessierenden Zeitraum vom 28.6. - 3.7.1964 eine zweite und vom 31.3. - 5.4.1968 eine dritte ACFV an.
Diese Versammlung galt als das oberste Organ der CFK. Sie legte die Grundlinien der Arbeit der Konferenz fest und fand alle drei bis vier Jahre statt. Zugleich wählte sie die leitenden Organe der Konferenz - den Präsidenten, den Generalsekretär, die Mitglieder des Arbeitsausschusses (AA) und die Mitglieder des Beratenden Ausschusses für die Fortsetzung der Arbeit (Fortsetzungsausschuss, BAFA).
Zum Präsidenten der CFK wählte die I. ACFV Prof. Josef L. Hromádka; er trat damit die Nachfolge von Synodalsenior Dr. Viktor Hájek an. Und sie bestätigte den bereits von der 3. CFK gewählten Sekretär des Ökumenischen Rates in der Tschechoslowakei, Pfarrer Jaroslav N. Ondra, in seinem Amt als Generalsekretär der Christlichen Friedenskonferenz. Der Präsident vertrat die Bewegung nach außen, der Generalsekretär unterstützte ihn darin. Zusammen mit dem Generalsekretär nahm der Präsident Stellung zu allen aktuellen Fragen, wenn nicht eines der anderen leitenden Organe der Bewegung tagte.
Der Arbeitsausschuss umfasste zunächst 16, seit der II. ACFV 24 und seit der III. ACFV 28 Mitglieder, darunter den Präsidenten und den Generalsekretär der CFK. Er ernannte die Vizepräsidenten der Bewegung, berief die Mitglieder des Internationalen Sekretariats (IS) und bestellte Studienkommissionen, die anstehende Fragen klären und vertiefen sollten. Wenn weder die Allchristliche Friedensversammlung noch der Fortsetzungsausschuss tagten, nahm der Arbeitsausschuss die Aufgaben der CFK wahr. In dem hier interessierenden Zeitraum trat der Arbeitsausschuss 19 mal zusammen, und das nicht allein in den sozialistischen Ländern, etwa in Prag, Budapest, Moskau, Dresden, Bukarest und Sofia, sondern unter anderem auch in Driebergen (Niederlande), Agape (Italien), Haywards Heath (Großbritannien) und Radevormwald (BRD). Diese Treffen gaben oftmals den Anstoß zur Gründung von Regionalausschüssen oder Regionalkonferenzen.
Von der I. ACFV in den Arbeitsausschuss gewählt6 wurden aus der ČSSR Prof. Josef L. Hromádka, Pfarrer Jaroslav N. Ondra und Prof. Andrej Žiak, aus der BRD Oberkirchenrat Dr. Heinz Kloppenburg, aus Westberlin Prof. Heinrich Vogel, und aus der DDR Prof. Werner Schmauch, aus Frankreich Pastor Paul Conord, aus Großbritannien Prof. Richard Ullmann, aus den Niederlanden Prof. Albert Rasker, aus der UdSSR der Generalsekretär des Baptistenbundes Pastor Alexander Karev, Erzbischof Jan Kiivit und Erzbischof Nikodim, aus Rumänien Prof. Milan Seşan, aus Ungarn Bischof Dr. Tibor Bartha, aus Liberia Moderator J. J. Mendscole und aus dem Libanon Metropolit Niphon von der Antiochenischen Kirche.
Die Erweiterung des Arbeitsausschusses spiegelte die Ausweitung der Arbeit der CFK insbesondere in den Ländern der sog. Dritten Welt wider. Von der II. ACFV neu in den Arbeitsausschuss gewählt7 wurden aus Bulgarien Metropolit Maxim, aus Polen Bischof Dr. Andrzej Wantula, aus der UdSSR Archmandrit Juvenalij, aus den USA Rev. John C. Heidbrink, aus Indien Abraham K. Thampy, aus Japan Prof. Keiji Ogawa, aus Lateinamerika Rev. Emilio Castro, aus Madagaskar Rev. Richard Adriamanjato, und aus Sierra Leone Rev. Fergusson. An die Stelle des verstorbenen Prof. Werner Schmauch aus der DDR trat Prof. Hellmuth Bandt, an die Stelle des verstorbenen Prof. Richard Ullmann aus Großbritannien trat Rev. Paul Oestreicher. Weiterhin wurden gewählt für Pastor Paul Conord aus Frankreich Prof. Georges Casalis, für Prof. Albert Rasker aus die Niederlanden Prof. J. de Graaf, für Prof. Milan Seşan aus Rumänien Metropolit Nicolai Corneanu, und für Alexander Karev aus der UdSSR Pastor Ilya Ivanov. In ihrem Amt bestätigt wurden aus der ČSSR Prof. Josef L. Hromádka, Pfarrer Dr. Jaroslav N. Ondra und Prof. Andrej Žiak, aus der BRD Oberkirchenrat Dr. Heinz Kloppenburg, aus Westberlin Prof. Heinrich Vogel, aus der UdSSR Metropolit Nikodim und Erzbischof Dr. Jan Kiivit, aus Ungarn Bischof Dr. Tibor Bartha und aus dem Libanon Metropolit Niphon.
Von der III. ACFV neu in den Arbeitsausschuss gewählt wurden ein zweiter (katholischer) Vertreter aus Polen, Dr. Janusz Makowski, Ross Terrill aus Australien, Prof. Sergio Arce-Martinez aus Cuba und ein zweiter Vertreter aus Indien, Rev. Paul T. Verghese. Weiterhin wurden gewählt für Rev. Paul Oestreicher aus Großbritannien Canon David M. Paton, für Bischof Dr. Andrzey Wantula aus Polen Dr. Witold Benedyktowicz, für Erzbischof Dr. Jan Kiivit aus der UdSSR Erzbischof Alfred Tooming, für Pastor Ilya Ivanov wiederum Pastor Alexander Karev, und für Archimandrit Juvenalij Metropolit Filaret, für Rev. John C. Heidbrink aus den USA Dr. Harold W. Row, für Prof. Keiji Ogawa aus Japan Prof. Akira Satake, für Metropolit Niphon aus dem Libanon Metropolit Ignatios Hazim und für Rev. Fergusson aus Sierra Leone Esther Coker. In ihrem Amt bestätigt8 wurden aus Bulgarien Metropolit Maxim, aus der ČSSR Prof. Josef L. Hromádka, Pfarrer Dr. Jaroslav N. Ondra und Prof. Andrej Žiak, aus der BRD Oberkirchenrat Dr. Heinz Kloppenburg, aus Westberlin Prof. Heinrich Vogel Vogel und aus der DDR Prof. Hellmuth Bandt, aus Frankreich Prof. Georges Casalis, aus den Niederlanden Prof. J. de Graaf, aus Rumänien Metropolit Nicolai Corneanu, aus der UdSSR Metropolit Dr. Nikodim, aus Ungarn Bischof Dr. Tibor Bartha, aus Indien Abraham K. Thampy, aus Madagaskar Rev. Richard Adriamanjato und aus Uruguay Rev. Emilio Castro.
Vom Arbeitsausschuss zu Vizepräsidenten der CFK ernannt wurden - im Anschluss an die II. ACFV Rev. Richard Adriamanjato (Madagaskar), Bischof Dr. Tibor Bartha (Ungarn), Prof. Georges Casalis (Frankreich), Rev. Emilio Castro (Uruguay), Oberkirchenrat Dr. Heinz Kloppenburg (BRD), Metropolit Dr. Nikodim (UdSSR) und Abraham K. Thampy (Indien).
- im Anschluss an die III. ACFV für Rev. Emilio Castro (Uruguay) Prof. Sergio Arce-Martinez (Cuba). Die übrigen Vizepräsidenten wurden in ihren Ämtern bestätigt.
Unter der Leitung des Generalsekretärs setzte das Internationale Sekretariat (IS) die Entscheidungen der Leitungsorgane der CFK um und bereitete die Sitzungen dieser Organe bzw. der Studienkommissionen vor; es umfasste den Generalsekretär und 11 Sekretäre, die verschiedene Tätigkeitsbereiche der CFK und verschiedene Regionen vertraten.
Als Internationale Sekretäre wurden von der II. ACFV in ihrem Amt bestätigt9 aus der BRD Pastor Herbert Mochalski, aus der DDR Pastor Gerhard Bassarak, aus Großbritannien Rev. Alan Keighley, aus Polen Rev. Zdislaw Pawlik, aus der Schweiz Pastor Martin Schwarz, aus der UdSSR Rev. Alexej Bujewskij und Rev. Alexej Stoyan, und aus Ungarn Pastor Karoly Tóth.
Neben dem Arbeitsausschuss wurde auch das internationale Sekretariat vergrößert. Als internationale Sekretäre wurden von der III. ACFV die bereits Genannten (mit der Ausnahme von Rev. Alan Keighley, an dessen Stelle Irene Jacoby trat) in ihrem Amt bestätigt10 und noch dazu aus Bulgarien Prof. Todor Sabev, aus Rumänien Pastor Ilie Georgescu, aus Indien V. E. Mathew, aus Kamerun Dr. Aaron Tolen und aus Uruguay Dr. Julio de Santa Ana gewählt.
Die Studienkommissionen entstanden aus den zehn Arbeitsgruppen der I. ACFV; die nachstehende Aufstellung11 benennt zugleich deren Vorsitzende, stellvertretende Vorsitzende und Schriftführer (Sekretäre). Es waren dies die Kommissionen
Friede und Gerechtigkeit: Metropolit Justin (Rumänien), Prof. Ernst Wolf (BRD), Bischof Dr. Miroslav Novák (ČSSR)
Friede und Freiheit: A. Th. Van Leuwen (Niederlande), Metropolit Niphon (Libanon), Prof. Zigmond Varga (Ungarn)
Friede und Kalter Krieg: Prof. Wolfgang Schweitzer (BRD), Prof. Miklos Pálfy (Ungarn), Prof. Jan M. Lochman (ČSSR)
Friede und die neuen Staaten: Rev. Alan Keighley (Großbritannien), Rev. Jacob S. A. Stephens (Ghana), Dr. Luděk Brož (ČSSR)
Friede und die Deutschlandfrage: Prof. Albert J. Rasker (Niederlande), Pfarrer Wolfgang Scherffig (BRD), Oberkirchenrat Dr. Gerhard Lotz (DDR), Dr. Witold Benediktowicz (Polen)
Friede und Missbrauch des Christentums: Giorgio Girardet (Italien), Prof. Lászlo M. Pákozdy (Ungarn), Nikolaj Afinogenow (UdSSR)
Friede und Abrüstung: Prof. Milton Mayer (USA), Exarch Ioann (Berlin), Prof. George Casalis (Frankreich)
Friedensdienst der Jugend: Reinhard Tietz (BRD), Rev. Akira Satake (Japan), Milan Opočensky (ČSSR)
Friede und Ökumene: Erzbischof Nikodim (UdSSR), John Lawrence (Großbritannien), Dr. Jiří Novák (ČSSR)
Friede und die atomaren Waffen: Prof. Yoshio Inoue (Japan), Alexander Karev (UdSSR), Prof. Paul van Buren (USA)
Welche Bedeutung das Ende des Experiments gerade auch für die inhaltliche Arbeit hatte, zeigt ein Vergleich der I. ACFV mit der 3. CFK. Letztere arbeitete in nur vier Arbeitsgruppen zu den Themen Auf dem Weg zur Friedensepoche der Menschheit: Richard K. Ullmann (Großbritannien), Prof. Milan Seşan (Rumänien), Herbert Mochalski (BRD)
Vorbereitung der Allchristlichen Friedensversammlung: Bischof Nikodim (UdSSR), Bischof Dr. Tibor Bartha (Ungarn), Oberkirchenrat Dr. Heinz Kloppenburg (BRD)
Probleme des Kalten Krieges: Prof. Wolfgang Schweitzer (BRD), Prof. Albert J. Rasker (Niederlande), Prof. Miklos Pálfy (Ungarn)
Friede und Gerechtigkeit: Bischof Dr. Miroslav Novák (ČSSR), Prof. Milton Mayer (USA), Prof. Werner Schmauch (DDR)
Diese Kommissionen hatten zwischen 20 und 45 Mitglieder, die entsprechend ihrer fachlichen Qualifikation bestellt wurden, und sollten mindestens einmal im Jahr zu einer Tagung zusammenkommen. Diese Tagungen fanden in der Regel in Verbindung mit einer Allchristlichen Friedensversammlung bzw. mit einer Tagung des Fortsetzungsausschusses statt. Allerdings wurde der Zuschnitt der Studienarbeit schon bald verändert. Bereits die II. ACFV ersetzte die zehnte Kommission, Friede und die atomaren Waffen, durch eine Friede und Katholizismus überschriebene Arbeitsgruppe. Doch auch diese Neuordnung hatte keinen Bestand. Die III. ACFV ging gänzlich neue Wege und arbeitete nur noch in sieben Arbeitsgruppen zu theologischen, internationalen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fragen sowie in einer Jugendkommission und in einer ökumenischen, die Gemeinsame christliche Verantwortung trotz verschiedener Bekenntnisse diskutierenden Arbeitsgruppe.
Der Fortsetzungsausschuss umfasste zunächst an die 120, seit der II. ACFV dann an die 160 Mitglieder, darunter den Präsidenten der CFK und ihren Generalsekretär sowie die Mitglieder des Arbeitsausschusses. Zu seinem Vorsitzenden wählte die I. ACFV den ersten Präsidenten der CFK, Synodalsenior Dr. Viktor Hájek. Dieser Fortsetzungsausschuss tagte vom 15. - 18.5.1962 in Karlsbad, vom 4. - 8.6.1963 in Prag, vom 13. - 17.10.1965 in Budapest und vom 17. - 22.10.1966 in Sofia, und nahm zwischen den Tagungen der Allchristlichen Friedensversammlung deren Aufgaben wahr.
Dem von der I. ACFV gewählten Fortsetzungsausschuss gehörten 24 deutsche Mitglieder an; sechs von ihnen kamen aus der DDR. Dies waren Pastor Gerhard Bassarak, Prof. Emil Fuchs, Prof. Carl J. Heckmann, Oberkirchenrat Dr. Gerhard Lotz, Dr. Hanfried Müller und Prof. Werner Schmauch. Fünf von ihnen kamen aus Westberlin, namentlich Prof. Helmut Gollwitzer, Pfarrer Joachim (Jochen) Kanitz, Dr. Erich Müller-Gangloff, Prof. Heinrich Vogel und Studentenpfarrer Rudolf Weckerling. Die größte Gruppe kam aus der Bundesrepublik; ihr gehörten 13 Mitglieder an: Oberkirchenrat Dr. Heinz Kloppenburg, Pastor Herbert Mochalski, Kirchenpräsident Dr. Martin Niemöller, Vikarin Anneliese Neumärker, Pastor Martin Rohkrämer, Studentenpfarrer Martin Schröter, Prof. Wolfgang Schweitzer, cand. theol. Reinhard Tietz, Dr. Hartmut Weber, Pfarrer Dr. Herbert Werner, Präses D. Ernst Wilm, Prof. Ernst Wolf und Bischof Dr. Friedrich Wunderlich.12
Dem von der II. ACFV gewählten Fortsetzungsausschuss gehörten 26 deutsche Mitglieder an; zehn von ihnen kamen aus der DDR. Dies waren Prof. Hellmuth Bandt, Pastor Gerhard Bassarak, Prof. Karl-Heinz Bernhardt, Pastor Dr. Dieter Frielinghaus, Magdalene Hager, Prof. Erich Hertzsch, Bischof Dr. Moritz Mitzenheim, Prof. Hanfried Müller, Carl Ordnung und Generalsuperintendent Dr. Albrecht Schönherr. Drei von ihnen kamen aus Westberlin, namentlich Prof. Helmut Gollwitzer, Pastor Joachim (Jochen) Kanitz und Prof. Heinrich Vogel. Die größte Gruppe kam unverändert aus der Bundesrepublik; ihr gehörten wieder 13 Mitglieder an: Superintendent Dr. Heinrich Engler, Oberkirchenrat Dr. Heinz Kloppenburg, Pastor Herbert Mochalski (oder Prof. Renate Riemeck), Pastorin Anneliese Neumärker, Kirchenpräsident Dr. Martin Niemöller, Pfarrer Martin Rohkrämer, Pastor Hans Rücker, Pastor Martin E. Schröter, Prof. Wolfgang Schweitzer, Pastor Martin Stöhr, Pastor Reinhard Tietz, Präses D. Ernst Wilm und Bischof Dr. Friedrich Wunderlich.
Dem von der III. ACFV gewählten Fortsetzungsausschuss gehörten nur noch 21 deutsche Mitglieder an: neun aus der DDR: Prof. Hellmuth Bandt, Pastor Gerhard Bassarak, Prof. Karl-Heinz Bernhardt, Pastor Wolf-D. Gutsch, Bischof Dr. Moritz Mitzenheim, Carl Ordnung, Pastor Helmut Orphal, Superintendent Dr. Albrecht Schönherr und Günter Wirth; zwei aus Westberlin: Pastor Joachim (Jochen) Kanitz und Prof. Heinrich Vogel, sowie neun aus der BRD: Frank Crüsemann, Superintendent Dr. Heinrich Engler, Hannelore Hansch, Oberkirchenrat Dr. Heinz Kloppenburg, Pastor Herbert Mochalski, Pastorin Anneliese Neumärker, Kirchenpräsident Dr. Martin Niemöller, Prof. Renate Riemeck und Bischof Dr. Friedrich Wunderlich.
Jedem dieser Fortsetzungsausschüsse gehörten damit an: ein Mitglied aus der DDR: Gerhard Bassarak, zwei Mitglieder aus Westberlin: Joachim (Jochen) Kanitz und Heinrich Vogel, und fünf Mitglieder aus der BRD: Heinz Kloppenburg, Herbert Mochalski, Anneliese Neumärker, Martin Niemöller und Friedrich Wunderlich.
Ein Statut, das diese Ordnung abbildete, konnte erst nach erfolgter Genehmigung durch das tschechoslowakische Staatsamt für Kirchenfragen vom Fortsetzungsausschuss der CFK an seiner Karlsbader Tagung im Mai 1962 förmlich angenommen werden13. Kritik daran äußerte als einer der ersten Roland Gerhardson. Er erhob im Kern den gegen jede vermeintliche Frontorganisation gerichteten Vorwurf, die leitenden Gremien, hier die Allchristliche Friedensversammlung und der Fortsetzungsausschuss, seien nichts als Fassade, die lediglich die Steuerung der Prager Friedenskonferenz durch Moskau verdecken solle. Denn im Gegensatz zu anderen kirchlichen Konferenzen, die von Kirchen beschickt werden und deren Arbeit von Kirchen getragen wird, obliege die Arbeit der CFK hauptsächlich dem Sekretariat und den Ausschüssen. Der Präsident der CFK oder der Generalsekretär gäben jederzeit zu politischen Fragen im Namen der CFK Erklärungen ab, die nachträglich vom Arbeitsausschuss gebilligt würden. „Die alle drei Jahre zusammentretende 'Generalversammlung' der CFK, die 'Allchristliche Friedensversammlung', hat so gut wie keinen Einfluss auf die Tagespolitik der Organisation.“14 Und das Internationale Comité zur Verteidigung der christlichen Kultur - Deutsche Sektion ergänzte, der Beratende Ausschuss für die Fortsetzung der Arbeit trete nur einmal jährlich zusammen. „Er hat für die CFK nur untergeordnete Bedeutung; er soll den Eindruck eines möglichst umfassenden internationalen Gremiums erwecken.“15
Ebenso kritisch äußerte sich das Comité im Blick auf die Studienkommissionen: Sie ließen erkennen, dass die CFK sich berufen fühle, an der Lösung so ziemlich aller wichtigen politisch-sozialen Probleme mitzuwirken, die die Welt beunruhigten; sie kenne keine Grenzen, weder für die eigene Aufgabenstellung noch für den eigenen Anspruch, Lösungsvorschläge auf allen Gebieten der Weltpolitik zu bieten. „Auf keinem Gebiet ist aber eine ernsthafte Anstrengung sichtbar, die Vielschichtigkeit der zu bewältigenden Probleme erschöpfend und kritisch zu erkennen und aufzuzeigen und damit zunächst einmal die unabdingbaren Voraussetzungen für den Versuch von Lösungsvorschlägen zu schaffen“16.
Diese Kritik überging nicht nur, dass die CFK von Anfang an - genauer: seit der ihre Gründung vorbereitenden Tagung zum Kampf gegen thermonukleare Waffen als Aufgabe der Kirche 1957 in Prag - immer wieder sachkundige Referenten (wie zum Beispiel Atomphysiker) zu ihren Tagungen einlud. Diese Kritik übersah auch, dass die Aufgabe der CFK im Kern nicht in der Erarbeitung politischer Erklärungen bestand, sondern „im gemeinschaftlichen Aufeinanderhören, Reden, Sicherkennen und im persönlichen Weitertragen dieser als möglich erfahrenen Gemeinschaft“17 - darin, dass Christenmenschen aus Ost und West, dass lateinische und orthodoxe Theologen und Kirchenmänner unter Gebet zu Gott zu brüderlichem Gespräch zusammenkamen und einander wirklich und wahrhaftig anhörten und eben darin christlich handelten. Das konnte auch gar nicht anders sein. Denn die CFK unterschied sich dadurch von anderen ökumenischen Organisationen, die von Mitgliedskirchen getragen werden, dass auch christliche Gruppen und Einzelpersönlichkeiten Mitglied sein konnten18. Ihr Einfluss reichte deshalb nur so weit wie die Überzeugungskraft, mit der ihre Mitglieder und Freunde sich in die öffentliche Diskussion einbrachten. Und dies wiederum war abhängig davon, dass die CFK ihre theologisch und politisch intendierten Appelle im brüderlichen Gespräch klärte. In seinem Kommentar zu den Statuten der Christlichen Friedenskonferenz sagte Ingo Roer dazu:
„Der Struktur nach ist die CFK eine Versammlung von Christen, die nichts mehr repräsentieren als sich selbst. Darin kann gerade Christliches getroffen sein, ohne Ansehen der Person dem sachlichen Wort Raum zu geben. Jede Allchristliche Friedensversammlung soll selbst ein Stück Friedensarbeit sein, die Christliche Friedenskonferenz eine Bewegung zur Befreiung der Christen von historischen, politischen, konfessionellen, organisatorischen Schranken, die die Christen hindern, wirksam für die Gewinnung von Frieden einzutreten.“19
Ausschlaggebend dafür war zunächst die Tatsache, dass sich die in der Christlichen Friedenskonferenz Mitarbeitenden immer wieder auf das Evangelium als den Ausgangspunkt ihrer Arbeit verständigten. Dieses Evangelium, wie sie es verstanden, war der lebendige Christus, der in die tiefsten Tiefen der menschlichen Ohnmacht und Sünde herabstieg, und dessen Tod und Auferstehung den Sieg über die menschliche Oberflächlichkeit und Untreue, Unwahrhaftigkeit und Scheinheiligkeit, Selbstgerechtigkeit und Stolz, Unverträglichkeit und Hass bedeutete. Wem aber Jesus Christus in der tiefsten Tiefe seiner eigenen Existenz begegnet war, der konnte gar nicht anders, als sich ständig zu fragen, nicht etwa ob, sondern wodurch er selbst die Situation der heutigen Welt mitverschuldet hat, und bußfertig die Folgen all dessen auf sich zu nehmen, was er selbst getan hatte, und was seine Väter ihm als Erbe und Last hinterlassen hatten. Ausgangspunkt all ihrer Überlegungen war deshalb das Erschrecken darüber, dass es die sich selbst als christlich verstehenden Völker waren, die nicht nur das Zeitalter der Weltkriege heraufführten, sondern auch die Atombombe bauten, sie einsetzten und seither damit drohten, sie auch in neuerlichen kriegerischen Auseinandersetzungen als erste einzusetzen.
Hinzu kam, dass sie sich in ihrer Arbeit in und mit der CFK als Glieder ihrer Kirchen verstanden und darum nicht nur die eigene Verantwortung, sondern auch die Verantwortung ihrer Kirchen für den Unfrieden in der Welt erlebten. „Denn der Kalte Krieg zwischen den Kirchen und in den Kirchen dauert an und gibt dem kalten Krieg in der Welt eine gefährliche Dimension religiöser Weihe.“20 Miteinander begriffen sie ihre Tätigkeit deshalb als einen großen Kampf um die Freiheit der Kirche auf dem Boden des Evangeliums. So mühten sie sich nicht nur, jedes Misstrauen, jede Verdächtigung untereinander auszuschließen und die Wurzeln des Kalten Krieges aus ihren eigenen Herzen zu reißen. Sondern sie suchten auch dem Kalten Krieg in und zwischen den Kirchen entgegenzuwirken. Immer wieder wandten sie sich nicht nur gegen alle Bestrebungen, die christlichen Kirchen in die gegen die sozialistischen Länder gerichtete Front einzugliedern und sie zu Trägerinnen und Heiligsprecherinnen antikommunistischer Pläne zu machen. Sondern sie fragten sich auch, ob die Atmosphäre des Kalten Krieges nicht ausgerechnet unter den Kirchen und in den Gemeinden am schwülsten sei. So weit sie aus dem Osten kamen, klagten sie mit dem Präsidenten der CFK, Josef L. Hromádka:
„Wir sind verantwortlich für den Aufbau der Kirche und für die Verkündigung des Evangeliums in unseren Ländern. Unsere Kirchen im Ostgebiet sind Opfer eines unheimlichen Kalten Krieges, der gerade von einigen kirchlichen Kreisen religiös geheiligt wird. Man muss es klar sagen, dass wir in unserem Ringen um das Evangelium von unseren Brüdern im Westen wenig Hilfe bekommen. Fast jeden Tag stoßen wir auf neue und immer neue uns in den Weg geschleuderte Steine und müssen viel Kraft aufwenden, um diese Steine wegzuwälzen und den Weg freizumachen.“21
Und so weit sie aus dem Westen kamen, waren sie zumindest bereit, diese Klage ihrer Brüder aus dem Osten zu hören. In diesem Sinne verstanden sie sich nicht nur als eine ökumenische Bewegung; sie waren überzeugt, dass die CFK eine Bereicherung der großen ökumenischen Familie darstellte - organisatorisch, weil ihr Kirchen angehörten, die, abgesehen von ihrer Mitgliedschaft in der CFK, außerhalb jeder ökumenischen Arbeit standen (und die ihren Weg nach Genf schließlich über Prag nehmen sollten); strukturell, weil sie, anders als der Weltrat der Kirchen, Bruderschaften, kirchlichen Friedensausschüssen und Vereinigungen wie zum Beispiel dem Versöhnungsbund die Chance boten, sich in die ökumenische Bewegung einzubringen; und inhaltlich, weil der Ruf nach Frieden und Abrüstung, nach Versöhnung und friedlicher Gemeinschaft der Völker im Mittelpunkt ihrer Bemühungen stand und von keiner anderen Frage in den Hintergrund gedrängt wurde.
Eben darin waren sie sich ihrer Einseitigkeit bewusst. Sie nahmen nicht nur für sich in Anspruch, dass ihre Ansichten aus ihrer Erkenntnis des Evangeliums und aus ihrer Auffassung von der Sendung der Kirche erwuchsen. Ohne Umschweife gaben sie auch zu, dass sie von der Atmosphäre, in der sie lebten, von den Ansichten der Staatsmänner ihrer Länder, ihrer geschichtlichen Situation usw. beeinflusst seien. Das sei gar nicht anders möglich. „Unsere Beziehung zu den sozialen und politischen Fragen wird nie mit hundertprozentiger Reinheit nur vom Evangelium geformt... Die Tatsache, dass wir mitten in einer bestimmten Welt und einer bestimmten Gesellschaft leben, spiegelt sich unausweichlich in unserer Schau öffentlicher Fragen und in unseren kulturellen und politischen Zielen wider.“22 Und mit Nachdruck betonten sie, dies gelte nicht nur für die Brüder aus dem Osten, sondern auch für die Brüder aus dem Westen. Zugleich räumten sie ein, sie seien in ihren ökumenischen Gesprächen noch nicht so weit gekommen, einander gegenseitig ernst zu nehmen und sich gemeinsam unter den höheren Maßstab des Evangeliums zu stellen und dem Richter zu unterwerfen, der Anspruch darauf hat, mit letzter Gültigkeit zu entscheiden. Wie weit sie davon entfernt waren, wurde aber auch ihnen erst im Ergebnis der I. Allchristlichen Friedensversammlung deutlich. Denn, so ihr Präsident Josef L. Hromádka im Blick zurück nach vorn:
„Erst während der Versammlung haben wir die unersetzbare Sendung unserer Arbeit erfasst: Menschen, die seit zehn, fünfzehn Jahren voneinander getrennt waren, in gegenseitiger Isolierung lebten, zusammenzuführen und sie aneinander zu gewöhnen. Die Entfremdung der Völker, der einzelnen Menschen und Kirchen ist tiefer, als wir voraussahen. Es ist nicht leicht, das richtige Wort zu finden, den uns entfremdeten Menschen wirklich anzusprechen und sich selbst verständlich zu machen. In dieser Hinsicht war diese Versammlung eine große Belehrung für uns alle. Wir müssen Geduld haben miteinander auch dort, wo die Ansichten der Gesprächspartner uns befremdlich, ja anstößig erscheinen. Wir dürfen uns selbst nicht für einen Maßstab (oder für den Maßstab) der Wahrheit und Richtigkeit halten. Und wir müssen immer wieder neu versuchen, den anderen noch besser und tiefer zu verstehen und unsere eigenen Ansichten verständlicher zu machen.“23
Diese Einschätzung wirkt nach vier Jahren Vorbereitung einigermaßen ernüchternd. Sie relativiert sich, bedenkt man, dass die Gesamtzahl der Teilnehmer 632 betrug, „dass 88 Teilnehmer aus den Kirchen der Bundesrepublik und 72 aus der DDR, zusammen 160 deutsche Teilnehmer, nach Prag kamen, während aus den Kirchen der Tschechoslowakei nur 86 Vertreter die Konferenz besuchten. 51 Vertreter kamen aus den Kirchen der Sowjetunion.“24 Doch nicht genug damit: Sowohl der Ökumenische Rat der Kirchen als auch der Lutherische Weltbund waren durch offizielle Beobachter in Prag vertreten. Der British Council of Churches entsandte eine Gruppe von Delegierten und Beobachtern der ihm angeschlossenen Kirchen. Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland entsandte zwei, der Ökumenische Rat der Kirchen von Schweden drei, der Ökumenische Rat von Finnland einen Beobachter, ebenso die Kirche von Schottland. Von der bischöflichen Methodistenkirche kamen Bischof Sigg aus Zürich und Bischof Wunderlich aus Frankfurt/M., für die Waldenser P. Girardet aus Italien25.
Während aus den sozialistischen Ländern Vertreter aller kirchlichen Gruppen teilnahmen, „wie man sie noch auf keiner ökumenischen Tagung traf“26 - so jedenfalls der schweizerische evangelische Pressedienst in einer Meldung vom 21. Juni 1961 -, kam die Mehrheit der Teilnehmer doch aus dem Westen. Entsprechend groß fiel das Echo im Westen aus. Nicht ohne Stolz bemerkte Károly Tóth in seiner Auswertung der I. ACFV: „Es gibt kein einziges bedeutendes Presseorgan der protestantischen Kirchen, das sich nicht mit diesem hochbedeutenden ökumenischen Ereignis befasst hätte.“27 Noch wichtiger war allerdings die Teilnahme der von der desinteressierten Öffentlichkeit weithin als tot abgetanen Kirchen: „Als die orthodoxe Kirche von Äthiopien, der Patriarch von Antiochien, der Katholikos von Grusinien und das Haupt der armenischen Kirche bei der Eröffnung die Teilnehmer begrüßten, wurde es spürbar, dass so etwas wie ein kirchengeschichtliches Ereignis begann.“28 Denn ihr Erscheinen könne nicht einfach politisch erklärt werden. Wer wisse, was es brauche, bis sich die Würdenträger dieser alten orthodoxen Kirchen zu einer Reise entschlössen, der müsse feststellen, dass die Prager Konferenz und ihr Thema vom Frieden diesen Kirchen offenkundig von besonderer Wichtigkeit seien. Walter Bredendiek nahm diese Beobachtung zum Anlass einer grundsätzlichen Bemerkung. In seiner Würdigung der I. ACFV in der Zeitschrift Glaube und Gewissen im September 1961 urteilte er: „Die Allchristliche Friedensversammlung hat gezeigt, dass die Sache des Friedens jene dynamische Kraft darstellt, die die konfessionellen und nationalen Unterschiede an die zweite und dritte Stelle rückt und diese Differenzen so überbrückt, dass sie nicht mehr spaltend wirken, sondern eine Mannigfaltigkeit konstituieren“29.
6 Und Friede auf Erden. Dokumente der Ersten Allchristlichen Friedensversammlung, Praha, 13.-18. Juni 1961. Herausgegeben vom Sekretariat der Christlichen Friedenskonferenz. Redigiert von V. D. Schneeberger. Prag 1961, S. 182
7 Verzeichnis der auf der II. Allchristlichen Friedensversammlung gewählten Repräsentanten der Christlichen Friedenskonferenz, in: Mein Bund ist Leben und Friede. Dokumente und Nachrichten der II. Allchristlichen Friedensversammlung in Prag, 28. Juni bis 3. Juli 1964. Herausgegeben vom Internationalen Sekretariat der Christlichen Friedenskonferenz, Prag 1965, Anhang, S. 17f.
8 List of Representatives of the CPC chosen at the Third ACPA, in: Seek Peace and Pursue it. Save Man - Peace is Possible. Documents of the Third All-Christian Peace Assembly, Prague, March 31 - April 5, 1968. Published by the Christian Peace Conference, Prag 1968
9 Verzeichnis der auf der II. Allchristlichen Friedensversammlung gewählten Repräsentanten der Christlichen Friedenskonferenz, a.a.O., S. 22
10 List of Representatives of the CPC chosen at the Third ACPA, a.a.O.
11 The First All-Christian Peace Assembly, in: Communio viatorum IV (1961), S. 213
12 Eine Aufstellung der von der I. ACFV in den Fortsetzungsausschuss Gewählten findet sich in: Und Friede auf Erden, a.a.O., S. 183f. Eine separate Aufstellung der deutschen Mitglieder des Beratenden Ausschusses der Christlichen Friedenskonferenz findet sich in: Junge Kirche 22 (1961), S. 696
13 Den Auftrag zur Ausarbeitung eines Organisationsstatuts der Bewegung hatte der Arbeitsausschuss der CFK auf seiner Sitzung im Februar 1962 in Budapest dem Internationalen Sekretariat erteilt; dazu stellte der Generalsekretär der CFK, Jaroslav N. Ondra, klar: „Wir haben kein Interesse daran, eine Institution zu werden, wir sind und gedenken eine Bewegung zu bleiben, deren Mitglieder Kirchen, kirchliche Gruppen, einzelne Gemeinden und Einzelpersonen sein können... aber auch eine Bewegung kann die Organisation nicht unterschätzen.“ (J. N. Ondra, Bisherige Arbeit und Perspektiven, in: Christliche Friedenskonferenz, H. 1 (November 1962), S. 21) Ausschlaggebend dafür war nicht zuletzt die Beobachtung Tibor Barthas: „Wir sind leider gezwungen, in der gegenwärtigen Periode der Entfaltung des ökumenischen Gedankens festzustellen, dass die sich pilzartig vermehrenden Konferenzen, Begegnungen und Beratungen auf das Formen des Bewusstseins der Gemeinden und der einzelnen Christen keinen großen Einfluss haben. Die Ergebnisse dieser Beratungen bleiben meistens auf den Kreis jener Personen beschränkt, die sozusagen berufsmäßig an solchen Tagungen teilnehmen und für die jemand die Bezeichnung 'ökumenische Techniker' prägte.“ (Tibor Bartha, Aufgaben und Ziele der Christlichen Friedenskonferenz, in: Christliche Friedenskonferenz, H. 2 (Januar 1963), S. 40)
14 Roland Gerhardson, Christen und Kommunisten (Schriftenreihe des Studienkollegs für zeitgeschichtliche Fragen, 11). Köln: Wissenschaft und Politik 1966, S. 21f.
15 Um den rechten Dienst am Frieden. Die Prager „Christliche Friedenskonferenz“. Bonn: Internationales Comité zur Verteidigung der christlichen Kultur - Deutsche Sektion, o. J., S. 9
16 a.a.O., S. 16
17 Ingo Roer, Die Christliche Friedenskonferenz, ein Ort ökumenischer Friedensarbeit. Entwicklung, Struktur, Personen, Aufgabe, Tätigkeit, Daten. Herausgegeben von der Informationsabteilung der Christlichen Friedenskonferenz. Prag 1974, S. 18f.
18 Diese Feststellung gilt nicht nur für die internationale CFK, sondern auch für ihre Regionalkonferenzen und -ausschüsse. Sie reichten von verfassten Kirchen über eingetragene Vereine bis hin zu losen Zusammenschlüssen. Solche Regionalausschüsse gab es in mehr als 15 Ländern. Hinzu kamen Freundeskreise der CFK in mehr als 25 Ländern, die die CFK zwar unterstützten, eine Mitgliedschaft in der internationalen CFK aber nicht anstrebten.
19 a.a.O., S. 95
20 Josef L. Hromádka, Fragen und Ziele der Allchristlichen Friedensversammlung, in: Junge Kirche 22 (1961), S. 250
21 ders., Und Friede auf Erden, in: Und Friede auf Erden, a.a.O., S. 10
22 a.a.O., S. 36
23 ders., Vorwort, in: Und Frieden auf Erden, a.a.O., S. 7
24 Adalbert Hudak, Die Prager Friedenskonferenz. Kirche und kommunistischer Totalstaat in der Begegnung. Mit einem Nachwort des Herausgebers Werner Petersmann: Die Prager Allchristliche Friedenskonferenz und der gerechte und (darin) dauerhafte Friede (Jedermann. Eine Schriftenreihe des Johann-Heermann-Kreises für gesamtdeutsche Verantwortung, 4). München: Bergstadtverlag Joh. Gottl. Korn 1964, S. 14f.
25 Amtliche Beobachter auf der Allchristlichen Friedenskonferenz in Prag, in: Junge Kirche 22 (1961), S. 369f.
26 Die Allchristliche Friedenskonferenz in Prag. Ein Pressebericht als Vorwort, in: Junge Kirche 22 (1961), S. 389
27 Károly Tóth, Die Bedeutung der Ersten Allchristlichen Friedensversammlung vom Juni 1961 in Prag (Hefte aus Burgscheidungen, 74). Berlin 1962, S. 11
28 a.a.O., S. 5
29 Walter Bredendiek, zit. n. Károly Tóth, a.a.O., S. 22
Die I. Allchristliche Friedensversammlung 1961
Inhaltlich stand die 1. Allchristliche Friedensversammlung (ACFV) wesentlich in Kontinuität mit den drei Christlichen Friedenskonferenzen 1958 - 1960. In seiner Eröffnungsansprache an der I. ACFV erinnerte ihr Präsident Viktor Hajek einmal mehr daran, dass die dort Versammelten durch zwei Gedanken miteinander verbunden waren: durch die Sehnsucht nach Frieden und durch den festen Glauben, dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Dass er Gott ist, der in dieser Welt im Fleisch erschienen ist. Dass er „um unserer Sünde willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt“ ist (Röm 4, 25). Dass „in keinem andern das Heil, auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben ist, durch den wir sollen selig werden“ (Apg 4, 12). Dass er das Licht der Welt, das Brot des Lebens und der gute Hirte ist, der sein Leben für die Schafe gelassen hat. Hajek fuhr fort:
„Unter diesen Voraussetzungen unseres Glaubens erscheint uns die Frage des Friedens in einem ganz besonderen Licht. Wir wollen nicht den Frieden um des Friedens willen, sondern wir wollen den Frieden um Christi willen. Weil er der Welt Versöhnung gebracht hat, wollen auch wir der Welt zur Versöhnung dienen. Weil er den Menschen vergeben hat, wollen auch wir vergeben und die Menschen zur Vergebung führen. Weil er die Menschen geliebt hat, wollen auch wir die Menschen lieben und sie von Hass, Argwohn und Verleumdung befreien. Weil er den Menschen das Leben geschenkt hat, wollen auch wir gegen den Tod und die Vernichtung kämpfen.“30
Ganz ähnlich äußerte sich Heinrich Vogel. In seiner Eröffnungspredigt an der 1. ACFV stellte er klar:
„Weil wir glauben, dass Gott mit uns Frieden macht, und weil wir in der Hoffnung gewiss sind, dass er das Reich des ewigen Friedens in einer neuen Welt, unter einem neuen Himmel durch ihn, Jesus Christus, den Fürsten des Friedens, heraufführen wird, - gerade darum wissen wir uns gerufen, in Sachen des zeitlichen Friedens in die Bresche zu treten. Dabei sind wir tief beschämt durch die Tatsache, dass so viele andere es vor uns taten, auch solche, die den Namen Gottes nicht kennen und gar meinen, Gott leugnen zu sollen und zu dürfen.“31
Denn die Christen seien allzu lange und allzu oft an den unter die Räuber gefallenen Mitmenschen vorübergegangen in der Richtung auf das himmlische Jerusalem eines ewigen Friedens, den jeder für sich erhoffte, vielleicht in einer Gesinnungsgemeinschaft der Gläubigen, aber blind und taub für den Notschrei des Menschen, den Gott so geliebt hat, dem er doch gehört.
Auch Josef L. Hromádka begann seinen Hauptvortrag an der 1. ACFV zum Thema „Friede auf Erden“ mit dem Bekenntnis zu dem Evangelium Jesu von Nazareth, „von dem wir glauben und bekennen, dass in ihm das Wort Fleisch geworden ist und dass sein Kreuz und seine Auferstehung den Sieg über die menschliche Ohnmacht und Sünde, über den Tod und das Übel bedeutet.“32 Hromádka entfaltete dieses Bekenntnis nach zwei Seiten. Einerseits erfasse dies Evangelium seine Hörer in den tiefsten Tiefen der menschlichen Existenz. In dieser Hinsicht sei es eine Kritik ihrer Oberflächlichkeit und Untreue, Unwahrhaftigkeit und Scheinheiligkeit, es decke unbarmherzig auf, wer sie seien, wo sie stünden und wo sie ihrer Sendung untreu geworden seien. So warne es vor Selbstgerechtigkeit und Überhebung. Und es decke den Zusammenhang auf zwischen dem, was für ein Erbe und welche Last ihre Väter ihnen hinterlassen hätten, und dem, was ihnen an Aufgaben auferlegt sei. Zugleich öffne das Evangelium den Christen die Augen für die tiefe Solidarität mit dem heutigen Menschen, mit seinen Schwierigkeiten und Krankheiten, aber auch mit seinen Hoffnungen und seiner Sehnsucht. „In der Nachfolge Jesu sehen wir, wie eng wir mit der Not und den Ängsten unserer Zeit verbunden sind, wie wir an allen großen und kleinen Verwirrungen und Fragen des heutigen Menschen teilhaben.“33
„Je tiefer der Mensch die Botschaft von der heiligen und verzeihenden Liebe Gottes in Jesus von Nazareth in den Tiefen und auf den Höhen der menschlichen Kämpfe begreift, um so klarer, schmerzvoller, aber auch aufmunternder wird ihm seine Zugehörigkeit zu den Menschen (bewusst), die um ihn herum leben, mögen sie in der Kirche oder außerhalb der Kirche, im Westen oder im Osten sein, mögen sie seinen Glauben annehmen oder nicht... Je mehr der Mensch zu den Wurzeln des Evangeliums durchdringt, je näher er Jesus von Nazareth, dem Sohn des lebendigen Gottes und dem Menschensohn steht, um so feiner, beteiligter und verantwortungsbewusster hört er den Puls der anderen Menschen, auch derer, die außerhalb der Kirche stehen und in dieser Welt mit Krankheit und Not, mit Unkenntnis und Hunger, mit Hass und Bosheit, mit allen Gefahren der Feindschaft und der Zerstörung, des Krieges und der Vernichtung kämpfen.“34
Deshalb wäre die ACFV fruchtlos und nutzlos, wenn sie nicht die ganze Zeit in der Gegenwart dessen bliebe, der Knechtsgestalt angenommen hat. Der in diese Welt gekommen ist, um den Menschen zu dienen. „Er ist unter die Menschen getreten, in ihre Sünde und Bosheit, in ihren Tod und in ihr Grab, um sie von all dem zu befreien, was sie fesselt, versklavt und in der Tiefe ihrer menschlichen Existenz und im Kern der menschlichen Gemeinschaft lähmt.“35 Zu eben diesen Menschen gehörten auch die zur ACFV Zusammengekommenen. Als solche sammelten sie sich um den, der ihnen das Evangelium verkündige, der mit ihnen zusammen gegen ihre Ausschließlichkeit, Erstarrtheit und traditionelle Unbeweglichkeit kämpfe und alle Mauern des Misstrauens, kühler Zurückhaltung und falscher gegenseitiger Vorstellungen niederreißen wolle. Um jedes Missverständnis zu vermeiden, stellte Hromádka klar: Die dogmatischen, organisatorischen und traditionellen Unterschiede zwischen den in Prag Versammelten sollten nicht nivelliert, sondern die Mannigfaltigkeit des Erbes gehoben werden, mit denen die einzelnen Kirchen und ihre Glieder nach Prag kamen. Denn
„gerade hier, unter uns, gewinnt unsere Vielgestaltigkeit einen tiefen Sinn. Ein jeder von uns versucht seinen Bruder aus der anderen kirchlichen Gemeinschaft besser, tiefer und positiver zu verstehen. Ein jeder von uns sehnt sich danach, das Zeugnis seiner eigenen Kirche voll ausdrücken und aussprechen zu können. Die Bruderschaft und das Bewusstsein der Einheit der Christen führt nicht zur Uniformität, zur Einförmigkeit. Auch hier stehen wir inmitten der Gemeinschaft, in die Jesus von Nazareth selbst mit seiner Fülle, mit seinem Reichtum des Evangeliums kommt und gerade dadurch mit jedem von uns gegen unsere falsche Unverträglichkeit, Exklusivität und unser Misstrauen kämpft.“36
Das gelte nicht nur im Blick auf die konfessionellen Unterschiede, das gelte auch in politischer Hinsicht. Denn natürlich habe jeder nicht nur eigene Ansichten etwa in Bezug auf die internationale Situation, auf die Volksrepublik China, auf die Vereinigung Deutschlands, auf den Kalten Krieg und die Abrüstung. Jeder sei ebenso selbstverständlich davon überzeugt, dass seine Ansichten aus seiner Erkenntnis des Evangeliums und aus seiner Auffassung von der Sendung der Kirche erwüchsen. Zugleich sei jeder aber auch von der Atmosphäre, in der er lebe, von den Ansichten der Staatsmänner seines Landes, seiner geschichtlichen Situation usw. beeinflusst. Seine Beziehung zu den sozialen und politischen Fragen werde deshalb nie nur vom Evangelium allein geformt. Die Tatsache, dass jeder inmitten einer bestimmten Welt und einer bestimmten Gesellschaft lebe, spiegele sich unausweichlich in seiner Schau öffentlicher Fragen und in seinen kulturellen und politischen Zielen. Von daher stellte Hromádka als Spezifikum der Allchristlichen Friedensversammlung heraus:
„Wir sind uns dessen bewusst, wie weit der Ort und die Zeit, in denen wir stehen, unsere Denkweise und unsere Entscheidungen bestimmen. Wir bestreiten jedoch, dass der letzte Schiedsrichter unserer Einseitigkeit und Objektivität die mit der sog. 'westlichen' Welt verbundene Christenheit sein könnte. Dabei ist 'westlich' kein geographischer, sondern ein gesellschaftspolitischer, vielleicht auch ein geschichtsphilosophischer Begriff.“37
Zugleich war Hromádka der erste, der einräumte, dass seine Darlegungen den Stempel seines Landes, wohl der ganzen osteuropäischen Zone, aber auch den Stempel seiner Kirche und seiner geistigen Tradition trugen - mit all ihren Vorteilen und Mängeln. Das hinderte ihn jedoch nicht, seine Ansichten offen zur Diskussion zu stellen, ohne deren Tendenz zu verschleiern. Dieselbe Offenheit erwartete er allerdings auch von seinen Brüdern und Schwestern. Denn eine andere Möglichkeit der Verständigung gebe es nicht in einer Versammlung, deren Glieder von unterschiedlichen politischen und sozialen Ansichten geprägt und mit ihren Kirchen und Völkern in deren Verlangen und Hoffnungen solidarisch seien. Eine weitere Voraussetzung dafür, dass während der I. ACFV Verständigung gelingen könne, sah Hromádka in dem Bewusstsein der Konferenzteilnehmer,
„dass wir selber die Schuld und die Verantwortung tragen für die Leiden des Menschen von heute, für die Spannung, das Misstrauen, die Verdächtigungen, ja, für den Hass und die Feindschaft zwischen den Völkern. Und in diesem Bewusstsein wollen wir einander zuhören und erforschen, worin die Widersprüche und Unterschiede zwischen unseren Ansichten bestehen... Wir wollen nicht mit brüderlicher Sentimentalität und offizieller christlicher Frömmigkeit Unterschiede und Meinungsverschiedenheiten künstlich zudecken. Dadurch würden die wahren Zwistigkeiten in der Menschheit und Christenheit von heute nur vertieft“38.
Das falle um so leichter, als der normale Christ von kleingläubiger Mittelmäßigkeit sei - und jeder Teilnehmer an der 1. ACFV ein Stück dieser Mittelmäßigkeit in sich trage. Viel zu lange schon drehten sie sich nur um sich selbst, um ihre Gewohnheiten und Traditionen, ihre persönlichen und lokalen Interessen. Darum zögen so viele Kirchen, Gemeinden und Einzelchristen zwischen sich und die neu entstehende Welt einen eisernen oder goldenen oder Bambusvorhang und rechtfertigten dies auch noch mit vermeintlich christlichen Argumenten. So lebten gerade diejenigen unter ihnen hinter diesen Vorhängen, die sicher seien, vor ihnen zu leben und freie Luft zu atmen, und liefen so Gefahr, zu Instrumenten des Kalten Krieges zu werden. Demgegenüber erinnerte Hromádka immer wieder an die jüngste Geschichte.
„Im letzten halben Jahrhundert sind wir in gewaltige Umstürze in der Welt hineingestellt worden, und wir leben immer noch unter dem Eindruck der Katastrophe, die vor zwanzig Jahren die Welt erschüttert hat. Immer noch hören wir den Jammer und das Stöhnen der Millionen, die auf den Schlachtfeldern gefallen sind, die in den Trümmern der ausgebombten Häuser, die in den Konzentrationslagern und Gaskammern ums Leben gekommen sind. Wir sind Zeugen dessen, dass die sogenannten christlichen Völker aufgehört haben, nicht nur politische, sondern auch moralische und geistliche Lehrer der heutigen Menschheit zu sein.“39 - „Seit 1914 leben wir in Unruhe, wie auf vulkanischem Boden. Wir erleben auf allen Seiten einen Erdrutsch und sehen heute, dass durch den Weltkrieg 1939-1945 nicht nur alle internationalen Hauptfragen nicht gelöst wurden, sondern dass gerade durch diesen Krieg die Entwicklungen auf allen Kontinenten in Fluss geraten sind und dass es bis heute, sechzehn Jahre nach Kriegsende, nicht gelungen ist, auch nur eine einzige große und wesentliche Frage der internationalen Beziehungen zu lösen.“40 - „Vierzig Jahre hindurch steht die Menschheit in einem Prozess geschichtlicher Katastrophen und Änderungen, für die es in der Weltgeschichte keine Analogie gibt. Die alte internationale Ordnung, die bis zum zweiten Weltkrieg von den sog. christlichen westlichen Völkern aufrecht erhalten wurde, ist heute zertrümmert... Der ganze Bau der sog. christlichen Zivilisation ist erschüttert und das Ziel von Angriffen nicht nur von innen - d. h. von Zweifeln des Unglaubens, von der skeptischen Stimmung des modernen Menschen - sondern auch von den neu erwachenden religiösen Gruppen besonders in Asien, aber auch in Afrika, und von der neuen sozialistischen Gesellschaft.“41
Und doch sähen sich die sogenannten christlichen und demokratischen Völker Westeuropas und Nordamerikas noch immer als letzte Schiedsrichter und entscheidende Faktoren in dem Aufbau der neuen internationalen Ordnung. Das führe zu großer Verunsicherung nicht zuletzt in den christlichen Kirchen, denn auch die Kirchen „hielten und halten die gebührende Rolle der westlichen Demokratien für eine Garantie ihrer Existenz und Entwicklung“42, so dass es für den Großteil des traditionellen Christentums nicht einfach sei, „mutig und hoffnungsvoll auf die neue Situation zu blicken und sowohl die Entstehung der sozialistischen Staaten als auch die Selbständigkeit der Kolonialvölker für eine kostbare Gelegenheit zu einem Neuanfang der christlichen Verkündigung und einem Neuaufbau der Kirche zu halten.“43
Unter diesen Umständen verwahrte sich Hromádka gegen alle Bestrebungen, die aus den christlichen Kirchen Heiligsprecherinnen antikommunistischer Pläne machen wollten, legte aber auch Wert auf die Feststellung, dass die Kirchen genauso wenig zu Trägerinnen eines antiwestlichen Kreuzzugs werden dürften. Und er tat das eine wie das andere in dem Bewusstsein, in dieser Hinsicht einen großen Kampf um die Freiheit der Kirche auf dem Boden des Evangeliums zu führen und damit im Dienst des Kampfes um die Kirche Christi zu stehen. Um so wichtiger war ihm, dass die Brüder im Westen darin keinen Opportunismus, Kollaboration oder gar Feigheit erblickten. Zwar sei die Atmosphäre im Osten in der Tat durch großes Misstrauen den Kirchen gegenüber, durch Widerwillen gegen die sogenannte religiöse Weltanschauung als einen Überrest des Aberglaubens, des unkritischen Denkens und der Reaktion gekennzeichnet. Das sei jedoch gerade kein Grund, deswegen in eine Auseinandersetzung über Glauben und Unglauben, über Evangelium und Atheismus einzutreten. Vielmehr gelte es, darüber nachzudenken, worin die christlichen Kirchen und ihre Glieder mitverantwortlich seien für die Gebrechen der alten Gesellschaft, für die tiefen Gegensätze zwischen Armen und Reichen, zwischen Mächtigen und Unterdrückten und für all das, was zu den Katastrophen der letzten Jahrzehnte geführt hat. Denn die Menschen im Osten suchten nach zweckmäßi-
geren Gesellschaftsordnungen und nach tragfähigeren Grundlagen des Rechts und der Gerechtigkeit; sie wollten die menschliche Freiheit und Würde durch eine adäquatere gesellschaftliche Struktur sichern, als es die alte feudale und liberale Gesellschaft tun konnte. In diesem Zusammenhang machte Hromádka einerseits darauf aufmerksam:
„Jede Revolution ist hart und manchmal unbarmherzig. Es ist heute aber kein revolutionäres Experiment mehr, sondern ein durchdachtes, geplantes und verwirklichtes Programm neuer Ordnungen in Stadt und Land, in den traditionell christlichen sowie in den nichtchristlichen, in den kulturell entwickelten sowie in den unentwickelten Ländern. Es ist ein gewaltiger Kampf darum, den Menschen eine neue Sicherheit und gesellschaftliche Gleichheit zu gewähren und ihnen nicht nur politische, sondern auch soziale und wirtschaftliche Freiheit zu sichern. Das geschieht auf den Trümmern alter Ordnungen, nach erschütternden materiellen und geistlichen Katastrophen. Neue Menschen kommen zur Verantwortung und werden mit der Leitung und Verwaltung betraut. Es sind oft Menschen ohne Erfahrungen, die erst Schritt für Schritt das Leiten und Führen, das Organisieren des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens lernen müssen. Dabei gibt es auf der Welt sehr viel sittliche Erschöpfung infolge so langer internationaler Spannungen und so schrecklicher Eingriffe in das Leben der Menschen während des letzten Krieges und der Revolution.“44
Andererseits beharrte er darauf, im Licht des Evangeliums eben diesen Menschen von heute zu verstehen, der vergeblich auf die Hilfe für die Armen und Ärmsten, die Hungernden und Verworfenen gewartet habe.
„Ihn besonders müssen wir in seiner positiven Sehnsucht nach einer neuen Gesellschaft verstehen. Auch seinen Unglauben, ja, seinen Kampf gegen die Kirchen und die sog. Religionen! Erst nachdem wir seine Pläne, Hoffnungen und seinen Kampf um eine neue Gesellschaft ohne Klassen- und Rassenunterschiede verstanden haben, werden wir eventuell auch seine Fehler, Irrtümer, die Mängel und Lücken in seinem Werk begreifen. Dann werden wir auch besser und klarer einsehen können, dass keine antiatheistische Front den Unglauben überwinden kann, sondern allein die Sehnsucht, dem Menschen nachzugehen, und echterer Glaube an das Evangelium, in dem wir bereit sind, die Ohnmacht, ja den Unglauben unseres Mitmenschen auf uns zu nehmen und ihm zu helfen, so wie auch Jesus von Nazareth dem Menschen geholfen hat.“45 - „Die Staatsmänner und Politiker, Wissenschaftler und Schriftsteller, Erzieher und Techniker, die in den Fabriken und auf dem Lande arbeiten, brauchen Licht und besonders die innige Glut derjenigen Menschen, die vom Evangelium erfasst sind, das in die Tiefen der menschlichen Not, der menschlichen Angst, der Sünde und des menschlichen Leides hinabsteigt. Und sie haben es nötig, dass inmitten der schwersten und scheinbar hoffnungslosesten Situation, wenn es scheint, dass wir in eine Sackgasse ohne Ausblick und ohne Hilfe geraten sind, jemand auf das Licht über dem Horizont hinweist. Auf der Welt ist genügend Traurigkeit und Schmerz, Verdruss und Ungeduld, es gibt unter uns genug Zynismus und gefühllose Gleichgültigkeit, aber auch Schlamperei und Unverantwortlichkeit... Aber gerade in unserem Glauben an das Evangelium gehen wir durch diese Welt ohne Angst und werden von neuem von der freudigen Hoffnung und sehnsüchtigen Erwartung bewegt, dass der, der über Grab, Sünde und Tod gesiegt hat, auch heute Sieger sein wird.“46
Darum sei Friede auf Erden die Losung, unter der die CFK zusammengekommen sei. Sie verstehe den Frieden so, wie ihn die Propheten und Apostel verstanden haben und wie er den Inhalt des Evangeliums bilde. Schalom im alttestamentlichen Sinn sei weit mehr als äußerer Friede, als eine Situation ohne Krieg und ohne Kampf: es sei die Fülle der Gaben Gottes, seiner Liebe und Gnade, seiner Vergebung und Identifizierung mit den Menschen. Friede, wie ihn die Weihnachtsbotschaft verkünde, sei die Erfüllung dieses Friedens, den die Propheten als Angeld erfahren hätten, der in Jesus von Nazareth in die verborgensten Winkel des menschlichen Wesens und der menschlichen Beziehungen eingekehrt sei. Darum folge die CFK den Menschen überall dorthin, wo um Frieden gerungen werde, um friedliches Zusammenleben, um Vertrauen von Mensch zu Mensch, um die Bereitschaft, voneinander zu lernen und durch Wettbewerb die Vorzüge oder Mängel dieser oder jener Gesellschaftsordnung zu erweisen. Schon das sei schwierig genug. Denn friedliches Zusammenleben sei schwer. Es erfordere weit größere Spannkraft und verantwortliches Suchen immer besserer Wege und Lebensbedingungen. Ja, in bestimmtem Sinne sei Frieden schwerer als Krieg. Aber es sei eine Last, die dem menschlichen Leben Würde verleihe. Hauptanliegen der Arbeit der CFK bleibe jedoch der Kampf gegen Atom- und Wasserstoffbomben, gegen die Gefahr des atomaren Krieges und gegen die Gefahr des Massenselbstmordes der Menschheit.
Es überrascht deshalb nicht, wenn es auch 1961 in Prag, eingeführt durch einen Vortrag von Prof. Yoshio Inoue, im Kern um die Massenvernichtungsmittel ging. Inoue war Mitglied der christlichen Friedensbewegung in Japan und kam nur deshalb nach Prag, weil „wir Japaner das einzige Volk in der Welt sind, das den Greuel der Kernwaffe erlebt hat“47 und sich deshalb, anders als andere, voll bewusst sei, was eine Kernwaffe ist. Deutlicher noch, er kam nur deshalb nach Prag, weil er ein Foto eines Luftschutzmanövers in den USA gesehen hatte, das zeigte, wie Schulkinder sich unter den Tischen in ihren Klassenräumen versteckten. Denn „Wenn wir Japaner so ein Foto sehen, können wir nicht umhin zu lachen, weil ein solches Bild in Anbetracht der Wirkung einer Kernwaffe lächerlich ist.“48
In Prag berichtete Inoue von dem Wasserstoffbombenversuch der amerikanischen Regierung im März 1954 im südlichen Pazifik. In seiner Folge sei die „Asche des Todes“ auf japanische Fischer gefallen und habe einen von ihnen um sein Leben gebracht. Deshalb hätten einige Hausfrauen in Tokio Unterschriften gegen solche Versuche gesammelt - am Ende des Jahres seien es etwa 20 Millionen Unterschriften gewesen - und damit zugleich die japanische Bewegung gegen Kernwaffen initiiert. Inoue schöpfte daraus die Hoffnung, dass die Japaner Hiroshima und Nagasaki niemals vergessen würden - auch wenn die Regierung immer wieder versuche, dem japanischen Volk die Erinnerung daran auszutreiben. Das habe sich schon ein Jahr zuvor, 1953, gezeigt, als sie den von ihr mit der amerikanischen Regierung abgeschlossenen Sicherheitsvertrag in Kraft setzte, obwohl täglich 300.000 von der Angst vor einem neuen Krieg bewegte Demonstranten vor dem Parlamentsgebäude in Tokio dagegen demonstrierten. Speziell für die japanischen Christen gehe es dabei auch um ein ethisches Problem, weil die japanische Armee während des Krieges in den chinesischen Städten und Dörfern Verbrechen begangen habe, und weil die japanische Regierung nicht nur keine Entschädigung dafür angeboten, sondern China in diesem Sicherheitsvertrag neuerlich als hypothetischen Feind ins Visier genommen habe. Inoue entsetzte sich: „Ist das nicht eine sonderbare und entehrende Erscheinung? Für uns japanische Christen ist das ein Problem, das unser Gewissen angeht, dass zwischen dem chinesischen Volk und uns wieder eine gerechte Gemeinschaft hergestellt wird.“49