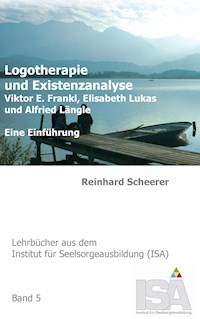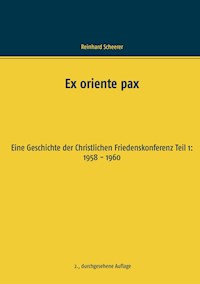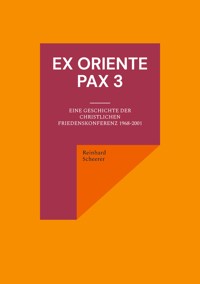
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die Invasion der CSSR durch Truppen der Warschauer Vertragsorganisation 1968 bedeutete einen tiefen Einschnitt auch für die Christliche Friedenskonferenz. Sie wurde sowohl personell als auch inhaltlich neu aufgestellt. An die Stelle von Josef L. Hromadka und Jaroslav N. Ondra traten Metropolit Nikodim und Janusz Makowski als Präsident bzw. Generalsekretär der Bewegung. Und anstelle der tschechischen wurde die ostdeutsche Theologie tonangebend, wie sie insbesondere von Gerhard Bassarak und Carl Ordnung vertreten wurde. In der schärfer werdenden Systemauseinandersetzung wurde die CFK von einer eurozentrischen zu einer weltweiten Bewegung - 1984 war sie in 86 Ländern aktiv - und spielte eine beachtliche Rolle sowohl als Nichtregierungsorganisation im Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen als auch im Gegenüber zum Weltrat der Kirchen. Als Kind des Kalten Krieges kam sie mit dem Ende des "real existierenden Sozialismus" auch an ihr Ende.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Esther
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Die Krise der Bewegung 1968 - 1971
Die Neukonstituierung der CFK
Auf dem Weg zur IV. Allchristlichen Friedensversammlung
Anknüpfungspunkte
Erneutes Wachstum
Von Antikommunismus und friedlicher Koexistenz
Durch Rüstungskontrolle und Rüstungsbegrenzung zu gemeinsamer Sicherheit?
Zu neuen Ufern
Vom Neuen Denken
Von Glasnost und Perestroika oder: Die Wiederkehr des Albtraums
Giselher Hickel
Ein persönlicher Rückblick auf das Ende der CFK
Personenregister
Literaturverzeichnis
Einleitung
Mit dem dritten Band komme ich an das Ende (m)einer Geschichte der Christlichen Friedenskonferenz. Seit 1976 war ich in der Westberliner Regionalkonferenz der CFK aktiv. Mitgearbeitet habe ich dort vor allem theologisch - so in der Vorbereitung auf unseren Stand auf dem Markt der Möglichkeiten des Deutschen Evangelischen Kirchentags 19831. Erst fünf Jahre später, 1988, kam ich anlässlich der 30 Jahr Feier der Bewegung in Kontakt mit der internationalen CFK. Während all der Jahre war von den Ereignissen des Jahres 1968 und davon, was sie für die CFK bedeuteten, nicht die Rede. Ich habe das deshalb an dieser Stelle gewissermaßen nachgeholt - beginnend mit der militärischen Intervention der Warschauer-Pakt-Staaten in der ČSSR und der daran anschließenden Krise der CFK. Das war der überschaubarere Teil dieser Arbeit. Was dann kam, war so komplex, so umfangreich - 1984 war die CFK in 86 Ländern aktiv - dass hier erst recht gilt, was ich schon in den ersten beiden Bänden dieser Geschichte gesagt habe: Ich tippe vieles nur an, noch mehr übergehe ich ganz, denn das Geschehen auf fünf Kontinenten ließ sich einfach nicht abbilden. Kurze Einführungen in die Arbeit der asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanisch-karibischen Kontinentalvereinigung der CFK vermitteln kaum einen ersten Eindruck. Einen Blick auf die Arbeit der Regionalkonferenzen habe ich gar nicht erst gewagt, auch wenn sie Beachtliches geleistet haben; ich erinnere nur an die ökumenischen Symposien zu Friedensfragen, die der Regionalausschuss in der DDR zusammen mit der Sektion Theologie der Humboldt-Universität seit 1982 jedes Jahr veranstaltete, und an die seit April 1985 jährlich stattfindenden Torgau-Treffen; hier sollte in Erinnerung an die Begegnung amerikanischer und sowjetischer Truppen 1945 an der Elbe bei Torgau die Möglichkeit des gemeinsamen Kampfes gegensätzlicher Gesellschaftssysteme gegen eine Gefahr bedacht werden, die die Existenz der gesamten Menschheit bedroht.
Doch nicht um im engeren Sinne politische Aktionen der Bewegung ging es mir, sondern um die sie vorbereitenden Diskussionen; auch nicht um die Vielzahl der Erklärungen, mit denen zumal die Leitung der CFK an die Öffentlichkeit trat, sondern um die Studienarbeit, die ihnen vorausging und die substantieller ausfiel als jene. In der grundlegenden Einschätzung folge ich Paul Verghese, für den nach 1968 nach der tschechischen die (ost-)deutsche Theologie in der CFK den Ton angab; immer wieder habe ich deshalb vor allem DDR-Theologen, allen voran Gerhard Bassarak und Carl Ordnung, aber auch Carl-Jürgen Kaltenborn, Werner Wittenberger und andere zu Wort kommen lassen. Mich interessierten dabei die Anknüpfungspunkte: Wo gab es Kontinuitäten, wo Diskontinuitäten, als die CFK nach 1968 neu konstituiert wurde? Wie bezog sich diese „neue“ CFK auf die Friedensbewegung in der nicht-sozialistischen Welt? Und wie ging es nach der Tabuisierung des christlich-marxistischen Dialogs in der CFK nach 1968 damit weiter? Das alles erwies sich in Europa als deutlich schwieriger als anderswo, denn selbst die Diskussion um die lateinamerikanische Theologie der Befreiung - um nur ein Beispiel zu nennen - hatte ihre Auswirkungen auf die sozialistischen Länder. Die Wortführer der in der CFK aktiven Theologen aus der ersten und aus der zweiten Welt betonten deshalb immer wieder: Wer in dem christlichen Glauben mehr als eine Motivation für ein Bündnis mit der Friedenspolitik der sozialistischen Länder erblicke, wer daraus gar die Hoffnung auf einen besseren Frieden schöpfe als ihn die Politik der friedlichen Koexistenz meine, der gehe fehl.
Und mich interessierten die Aufbrüche - die leider viel zu späte und selbst dann noch viel zu zögerliche Einbeziehung von Frauen in die Arbeit der Bewegung, der Entwurf eines Friedenskatechismus und die Ansätze Neuen Denkens, die nicht nur das Ende des real existierenden Sozialismus, sondern auch der CFK einläuteten. Denn die CFK war ein Kind der Systemauseinandersetzung, und sie kam mit dem Ende dieser Auseinandersetzung auch an ihr Ende.
So verdankte sich die Christliche Friedenskonferenz zunächst einer Initiative tschechoslowakischer Theologen, die an der Vollversammlung des Weltkirchenrates 1954 in Evanston als Delegierte aus einem sozialistischen Land nicht als Brüder in Christo angenommen, sondern als Marionetten der Kommunisten ausgegrenzt wurden. Bereits auf dem Rückweg in die ČSSR überlegten Josef L. Hromádka und Jan Michalko deshalb, wie sie die Glaubwürdigkeit ihres ökumenischen Zeugnisses stärken könnten. Zuhause angekommen zogen sie den Sekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen in der ČSSR, Bohuslav Pospíšil, hinzu. Dieser erinnerte daran, dass in Amsterdam nur zwei der drei ökumenischen Bewegungen im Weltkirchenrat aufgingen, die den ökumenischen Gedanken in den Jahren zwischen dem ersten und dem zweiten Weltkrieg hochgehalten hatten. Das waren die Bewegungen für Glaube und Kirchenverfassung und für Praktisches Christentum. Dagegen wurde die Arbeit des Weltbundes für Freundschaftsarbeit der Kirchen nicht fortgeführt - mit gutem Grund. Denn wenn in der westlichen Christenheit die Auseinandersetzung zwischen West und Ost weithin als eine Auseinandersetzung zwischen Erzengel Michael und Satan galt, dann war klar, dass es eine Freundschaftsarbeit der Kirchen über den eisernen Vorhang hinweg nicht geben konnte und auch nicht geben durfte. Um so nachdrücklicher erinnerte Pospíšil an die Weltkonferenz des Weltbundes für Freundschaftsarbeit der Kirchen 1928 in Prag und an den Appell Dietrich Bonhoeffers, des Jugendsekretärs des Weltbundes, von 1934, ein ökumenisches Konzil abzuhalten, um der Welt die Waffen aus der Hand zu schlagen. In dieser Tradition konstituierte sich die CFK.
Und weil es um Frieden ging, begegneten sich die Gründer der Christlichen Friedenskonferenz zunächst als Interpreten je ihres Lagers. Damit kamen zugleich der real existierende Sozialismus und mit ihm der Marxismus-Leninismus in den Blick. Die Interpretationen, die von den Teilnehmern aus den sozialistischen Ländern gegeben wurden, entstammten natürlich dem Bezugsrahmen der Interpreten; sie mündeten deshalb insbesondere bei Hromádka in den Anspruch, die Marxisten besser zu verstehen als sie sich selbst verstanden. Dieses Interesse am Marxismus-Leninismus war - vor aller Arbeit in und mit der CFK - auf Seiten der Theologen und Kirchenmänner aus den sozialistischen Ländern dadurch gegeben, dass sie in einem sozialistischen Land lebten und mit der Kirchenpolitik der kommunistischen Parteien konfrontiert waren. In der ČSSR reagierten sie darauf mit einer Rückbesinnung auf die böhmische Reformation mit ihrer Verbundenheit mit den unteren Gesellschaftsschichten und mit einer Bejahung des Endes des konstantinischen Zeitalters. Dabei blieben sich Hromádka und seine Mitstreiter in der CFK stets bewusst, dass sie mit der Gründung der Christlichen Friedenskonferenz auch auf eine Einladung der Kommunisten zur Zusammenarbeit mit Atheisten reagierten. Um so wichtiger war es ihnen, deutlich zu machen, dass hinter dem Einsatz von Christen und Kirchen für den Frieden kein allgemein menschliches Interesse am Überleben stehe, sondern eine sie in besonderer Weise in die Pflicht nehmende Hoffnung. Ein weiteres Moment, das zur Gründung der CFK führte, war deshalb der Versuch eines „Erweises der Kraft“ (Emil Fuchs), die allein den Kommunisten die Augen dafür öffnen könne, dass Religion mehr ist als falsches Bewusstsein und Kirche mehr als eine Agentur der Bourgeoisie.
Hinzu kamen einerseits das kirchliche Interesse an einem Ort, an dem sich die Kirchen der sozialistischen Länder treffen und miteinander reden konnten - so wie die für Kirchenfragen politisch verantwortlichen staatlichen Organe das immer wieder taten, und andererseits das Interesse dieser Ämter, „ihre“ Friedenspfarrer länderübergreifend zu vereinigen, „ihren“ Kirchen im Gegenüber zum ÖRK einen repräsentativen Rahmen zu bieten und die einen wie die anderen in ihren Friedenskampf einzubeziehen.
So protestierten die Gründerväter der CFK gegen die Atom-“waffe“. Denn bei den Massenvernichtungsmitteln handele es sich nicht mehr um Waffen, die auf ein begrenztes Ziel gegenüber einem erkennbaren Feind in Abwehr des Bösen angewandt werden könnten, sondern um Gewaltmittel, durch die eine Masse von Lebewesen unterschiedslos ausgerottet werden solle. Sie protestierten zugleich gegen die Drohung mit der Atom“waffe“. Denn die Drohung mit der Atomrüstung sei eine Drohung mit dem Selbstmord. Und sie protestierten gegen die Abschreckung. Denn die Meinung, dass die Massenvernichtungsmittel wegen ihrer mörderischselbstmörderischen Furchtbarkeit nie angewandt werden würden, basiere auf dem Wahn, dass der Mensch vernünftig und gut sei. Christen müssten deshalb absolutes Vertrauen auf Menschen setzen, wenn sie die Atomrüstung als Sicherheitspolitik verstehen wollten. Doch absolutes Vertrauen auf Menschen sei Abgötterei. So warnte Heinrich Vogel an der ersten Christlichen Friedenskonferenz 1958 in Prag, es stehe bei der Majestät Gottes des Richters, den Menschen, der sich als Schöpfer und Zerstörer der von Gott geschaffenen und erhaltenen Welt gebärde, im Vollzug des Gerichtes Gottes zum Henkersknecht an sich selbst zu machen. Diese Warnung richtete Vogel an Ost und West. Beiden Seiten hielt er vor Augen: Ein christliches Abendland, das die Atombombe zu seinem Heiland und Retter vor der Gefahr des Weltbolschewismus mache, überantworte sich selbst dem Gericht. Und ein Sozialismus, der durch die Bereitstellung der Massenvernichtungsmittel seine Zukunft zu sichern versuche, verrate seine Idee und werde dem Herrn der Geschichte nicht entrinnen, auch wenn er ihn leugne.
Wenn sich die Gründerväter der CFK betont an Ost und West wandten, dann deshalb, weil es ihnen in ihrer ökumenischen Arbeit um Frieden, nicht um Sicherheit ging. Weil Sicherheit in letzter Konsequenz immer Sicherheit vor dem anderen meint und deshalb nur durch Überlegenheit zu erlangen ist, dadurch, dass der andere nach dem eigenen Bild geformt und den eigenen Interessen dienstbar gemacht wird. Sicherheit ist deshalb eine Fiktion und Frieden demzufolge nicht zu sichern. Darauf hatte nicht erst Hans Joachim Iwand in seinem Vortrag an der ersten Christlichen Friedenskonferenz 1958 in Prag hingewiesen. Schon der Psalmist erinnerte daran, als er aufforderte: Suche Frieden und jage ihm nach. Weil Frieden ein Beziehungsbegriff ist - und deshalb nur im Frieden mit dem anderen gelebt werden kann. Frieden suchen, das heißt deshalb zu überlegen, ob man dem anderen zu nahe getreten ist, ihn verletzt hat. Frieden suchen, das heißt deshalb, sich von dem Unrecht des anderen an das eigene Unrecht - und von dem eigenen Recht an das Recht des anderen erinnern zu lassen. Frieden suchen, das heißt deshalb, sich nicht für einen Engel und den anderen nicht für einen Teufel zu halten. Frieden suchen, das heißt deshalb, den anderen zu entschuldigen und alles zum besten zu kehren. Es lag auf der Hand: Der Kalte Krieg war das ganze Gegenteil von alledem. Und ein deutliches Zeichen dafür, dass beide Seiten sich immer wieder schwer taten mit dem Frieden - und statt des Friedens mit dem anderen immer wieder auf die teuflische Aftergestalt des Friedens, auf die Sicherheit vor dem anderen setzten. Folgerichtig stritten die kirchlichen Vertreter beider Seiten schon an der I. Allchristlichen Friedensversammlung 1961 in der Arbeitsgruppe Kalter Krieg darüber, wer vor wem mit dem größeren Recht Angst habe: Viele Vertreter aus dem Osten meinten, dass die Bedrohung des Friedens vom Westen ausgehe, während viele Vertreter aus dem Westen die Ausbreitung der kommunistischen Weltrevolution als Bedrohung empfanden. Wenn es trotzdem immer wieder gelang, miteinander im Gespräch zu bleiben, dann deshalb, weil diese Gegensätze eingebettet waren in das gemeinsame Hören auf das Zeugnis der Heiligen Schrift.
Dieser Streit wurde 1968 mit militärischen Mitteln entschieden. Und dieser Entscheid wurde von der IV. ACFV 1971 zementiert, als sie explizit Vertreter der sozialistischen Länder, der Zweidrittel-Welt und der kapitalistischen Länder in ihre Gremien wählte. Seither galt es als ausgemacht, dass der Frieden in Europa nicht mehr gewonnen, sondern gesichert werden müsse - und dass die Okkupation der ČSSR ein Akt solcher Friedenssicherung war. Um so engagierter begleitete die CFK die vermeintlichen Abrüstungs- und Rüstungskontrollverhandlungen (SALT, START, MBFR) zwischen USA und UdSSR, Warschauer Vertrag und NATO und rechtfertigte gleichzeitig die Nachrüstung - auch die atomare Nachrüstung - des Ostens als im Interesse der Sicherheit der sozialistischen Länder bedauerlicherweise noch erforderliche Maßnahme. Das bedeutete einen Bruch nicht nur mit dem Atompazifismus Heinrich Vogels, sondern auch mit der Absage an jenes Sicherheitsdenken, das friedensunfähig macht. Noch schwerer wog freilich, dass zeitgleich der christlich-marxistische Dialog in der CFK tabuisiert wurde. An seine Stelle trat die Übernahme zentraler Behauptungen des Marxismus-Leninismus als wissenschaftlich erwiesener Tatsachen. Das galt für den Satz,
- dass das gegenwärtige Zeitalter das Zeitalter des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus im Weltmaßstab sei;
- dass die Hauptkampflinie in der Systemauseinandersetzung quer durch Europa verlaufe; und
- dass die friedliche Koexistenz einzig die Beziehungen zwischen Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung regele.
Das hatte zur Konsequenz,
- dass es - anders als in Afrika, Asien und Lateinamerika - keine europäische CFK gab und auch nicht geben durfte, da es hier an „politischer Reife“ (Gerhard Bassarak) fehlte.
- dass die internationale CFK mit Fragen der europäischen Sicherheit präokkupiert blieb, und
- dass insbesondere die asiatische und die lateinamerikanisch-karibische CFK selbst innerhalb der CFK nicht die Resonanz fanden, die sie verdient hatten.
Begünstigt wurde diese Entwicklung dadurch, dass im Zuge der Marxismus-Renaissance im Westen mit der Studentenbewegung Theologengruppen entstanden, die vom Standpunkt einer marxistischen Rechtgläubigkeit aus kritische Anfragen an marxistische Lehrsätze, aber auch jede „linke“ Kritik osteuropäischer Gesellschaften, als antikommunistisch abwiesen.
Mit Glasnost und Perestroika wendete sich das Blatt dann noch einmal; der christlich-marxistische Dialog wurde enttabuisiert - mit durchaus ermutigenden Ergebnissen
- bei marxistischen Gesprächspartner in der Überwindung der Fixierung auf Religion als auf ein Bewusstseinsphänomen und in der Entdeckung, dass es sich dabei auch um eine soziale Daseinsweise handeln kann, von der Verantwortung für die Welt übernommen werden kann; und
- bei christlichen Gesprächspartner in der Überwindung der Fixierung auf das Evangelium der Armen und in der Entdeckung von Jesu Guter Botschaft für die Reichen.
Mit dem Ende des real existierenden Sozialismus traten die Kirchen in den sozialistischen Ländern, die korporativ Mitglieder der CFK waren, mit Ausnahme der Russischen Orthodoxen Kirche (ROK) aus der CFK aus; sie brauchten die Bewegung nicht mehr, um sich miteinander zu treffen. Die CFK verlor dadurch entscheidend an Gewicht. Hinzu kam, dass die finanziellen Mittel ausblieben, die vor allem die ROK aufbrachte, als sie die Flugtickets zur Verfügung stellte, die die internationale Arbeit der CFK erst ermöglichten. Seit die ROK selbst darüber entscheiden konnte, wofür sie ihr Geld ausgab, war anderes, darunter die Wiederinbetriebnahme von Kirchen, Klöstern und theologischen Ausbildungsstätten, die seit Jahrzehnten geschlossen oder zweckentfremdet waren, dringlicher. Differenzen innerhalb der CFK, insbesondere über die Frage, ob der reale Sozialismus gestürzt wurde, oder ob er stürzte, kamen hinzu.
An dieser Stelle endet meine Geschichte der Christlichen Friedenskonferenz; seit dem Ende der Systemauseinandersetzung hatte ich mich stärker in der Berliner Gesellschaft zur Förderung des christlich-marxistischen Dialogs engagiert als in der CFK, dann ging ich auf Bitten der Presbyterian Church of Sudan (PCOS) mit der Basler Mission an das Nile Theological College in Khartoum, um dort als Dozent für Theologie und Philosophie an der Ausbildung sudanesischer Pastoren mitzuarbeiten, und als ich 2004 nach Deutschland zurückkehrte, war die CFK bereits Geschichte. Diese Jahre sind deshalb nicht mehr Teil meiner Geschichte mit der CFK. Um so dankbarer bin ich, dass sich Giselher Hickel bereit erklärt hat, mit seinem persönlichen Rückblick auf das Ende der CFK diese Leerstelle zu füllen.
Mein Dank gilt zudem den Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei Kaltenkirchen, ohne deren Hilfe ich dieses Buch nicht hätte schreiben können.
1 Reinhard Scheerer, 500 Jahre Luther - 50 Jahre Hitler, in: Neue Stimme 1983, H. 6, S. 13-17
Die Krise der Bewegung 1968 - 1971
Auslöser der bislang schärfsten Krise der CFK und Anlass ihrer Neukonstituierung war die Militärintervention der Warschauer-Pakt-Staaten in der ČSSR im August 1968. „300 000 sowjetische, polnische, ungarische und bulgarische Soldaten und Offiziere drangen vom Gebiet der DDR, Polens und Ungarns in die Tschechoslowakei ein... In den ersten Wochen der Besetzung verloren 94 Tschechen und Slowaken ihr Leben, 345 waren schwer verletzt. Bis Ende August 1968 kamen 58 sowjetische Armeeangehörige um und 150 wurden verwundet. Es entstand ein Schaden von etwa 10 Mrd. Kronen.“2 Dieses Ereignis überraschte nicht wirklich. Schon in seinem Bericht von der III. Allchristlichen Friedensversammlung (ACFV) vom 31. März bis 5. April 1968 hatte Hans-Jürgen Benedict darauf hingewiesen, dass der „Prager Frühling“ nicht nur Freude, sondern auch Unbehagen ausgelöst hatte. Benedict erinnerte sich:
„Der Frühling war mit aller Macht in Prag ausgebrochen - meteorologisch wie politisch... Für die Mitglieder der CFK vor allem aus westlichen Ländern, die trotz des Antikommunismus in ihrer Heimat und trotz der Beibehaltung halbstalinistischer Regierungspraktiken im Ostblock mit der ja im Osten beheimateten Organisation zusammengearbeitet hatten, war diese Entwicklung natürlich eine nachträgliche Bestätigung ihres Vertrauens in den Sozialismus... Ungeteilt war diese Freude allerdings nicht: Östliche Delegierte befürchteten von dem tschechischen Beispiel eine ungesunde Akzeleration der entsprechenden Prozesse im eigenen Land... Waren die Tschechen, wie schon einmal vor 500 Jahren, zu weit vorgeprescht?“3
Benedict übersah, dass dieses Unbehagen auch westliche Delegierte, zumal aus der BRD, erfasste. Das zeigte das Interview Herbert Mochalskis mit Erika Kadlecova, der Leiterin des tschechoslowakischen Staatsamtes für Kirchenfragen, während der III. ACFV am 4. April 1968. Die Fragen, die Mochalski der Reformpolitikerin stellte, atmeten Unverständnis, wenn nicht Ablehnung der politischen Linie der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei (KPČ) unter der Führung Alexander Dubčeks - angefangen bei der Eingangsfrage: Warum soll der Sozialismus in der ČSSR demokratisiert werden? Sehen Sie nicht die Gefahr, dass sich antisozialistische Kräfte des Demokratisierungsprozesses bemächtigen könnten? Kennt diese Demokratisierung Grenzen? In ihrer Antwort erinnerte Kadlecova daran, dass der Sozialismus in der Tschechoslowakei auf den Prinzipien des humanistischen Marxismus aufgebaut werde. Zwar sei es im Laufe der Revolution nötig gewesen, die Tätigkeit der Kräfte zu begrenzen, die sich gegen den Sozialismus gestellt hätten. Doch sobald der Sozialismus stabilisiert sei, müssten die Kräfte, die die Revolution vorbereitet und durchgeführt hätten, die demokratischen Prinzipien und Freiheiten erneuern, die sie in der Zeit der Revolution begrenzen mussten.
Deshalb sei die führende Rolle der kommunistischen Partei in der Vergangenheit zwar sehr oft beschworen, aber erst im Laufe dieser Erneuerung wirklich mit Leben erfüllt worden. Zudem gelte es, eine sozialistische Gesellschaft aufzubauen, die den Notwendigkeiten und Traditionen der Tschechoslowakei entspreche. Sie dürfe nicht weniger demokratisch sein „als die Gesellschaft, die wir schon kennen“4. Eine Wiederherstellung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse sei und bleibe jedoch ausgeschlossen; sie werde auch von niemandem gefordert. Die einzigen, die von der Invasion wirklich überrascht waren, waren die tschechoslowakischen Reformkommunisten selbst5. So erklärte das tschechoslowakische Außenministerium am 21. August 1968:
„1. Zur Invasion und zur bewaffneten Intervention der fünf Staaten in die Tschechoslowakei ist es gegen den Willen der Regierung, des Präsidenten, der Nationalversammlung und anderer verfassungsmäßiger Organe gekommen. Kein legales Organ der tschechoslowakischen Staatsmacht hat diese Intervention bewilligt und auch nicht um sie ersucht.
2. Die Sowjetunion, Polen, die DDR, Ungarn und Bulgarien verletzten damit grob die Grundprinzipien des Völkerrechts. Sie traten die UN-Charta mit Füßen, welche die Gewaltanwendung oder Gewaltandrohung gegen die territoriale Integrität oder politische Unabhängigkeit jedes Staates untersagt... Zu der Besetzung kam es in einer Situation, wo die Tschechoslowakei als kleiner mitteleuropäischer Staat niemanden bedrohte. Bis zu der Invasion herrschte auf dem ganze Territorium des Staates absolute Ruhe, und auf keine Weise waren die Interessen anderer Staaten oder anderer Bürger bedroht...
3. Durch Invasion und gewaltsame Besetzung des souveränen tschechoslowakischen Staates sind nicht nur die für alle Staaten geltenden Grundprinzipien des Völkerrechts mit Füßen getreten worden, sondern auch der Warschauer Pakt und bilaterale Verträge, die die Tschechoslowakei mit den fünf angegebenen Staaten geschlossen hat und in denen eindeutig die Pflicht zur Respektierung der gegenseitigen Souveränität und Nichteinmischung verankert war.“6
Doch das Echo auf die Invasion blieb verhalten; in der Stimme der Gemeinde formulierte Karl Linke den realpolitischen Kommentar zu dieser Klage des tschechoslowakischen Außenministeriums: Der Truppeneinmarsch der fünf Warschauer Paktstaaten stelle sich nach dem geltenden Völkerrecht zwar als Verletzung der Souveränität der ČSSR dar. Aber man dürfe nie vergessen, dass die Politik die Kunst des Möglichen sei. Und das bedeute, „dass die Politik die grundlegenden menschlichen Ideen und die Sätze des Völkerrechts nur sehr annäherungsweise verwirklicht.“7 Linke fügte hinzu: „Die Politik der Sowjetunion kann unmenschlich hart sein, aber irrational und unberechenbar ist sie nicht.“8 Man mache sich etwas vor, wenn man in der krisenhaften Entwicklung des sowjetisch-tschechoslowakischen Verhältnisses einen Beweis für die Irrationalität und Unvorhersehbarkeit der sowjetischen politischen Aktionen und Reaktionen sehe. Und was ihre Unmenschlichkeit anlange, so liefere der Westen mindestens ebenso viele Beispiele der Unmenschlichkeit, so dass das gegenseitige übereinander zu Gericht Sitzen und Aburteilen auf einen vernünftigen Christenmenschen keinen großen Eindruck machen könne.
Um so größer war das Echo auf den Aufruf „An die kommunistischen und Arbeiterparteien der ganzen Welt“ des Prager Stadtkomitees der KPČ. Darin hieß es:
„Heute wurde die Tschechoslowakische Sozialistische Republik gegen den Willen der Regierung, der Nationalversammlung und der Führung der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei von den Armeen der fünf Länder des Warschauer Paktes besetzt. Damit ist zum ersten Mal in der Geschichte der internationalen kommunistischen Bewegung von verbündeten Gruppen ein Aggressionsakt gegen einen Staat unter Führung einer kommunistischen Partei verübt worden. Angesichts der Tatsache, dass sich das Gebäude des Zentralkomitees der Partei, wo gegenwärtig das Präsidium tagt, in den Händen der Besatzungstruppen befindet, appelliert das Stadtkomitee der Partei in Prag an alle kommunistischen und Arbeiterparteien. Genossen, protestiert gegen diese beispiellose Verletzung des sozialistischen Internationalismus. Fordert, dass die Zentralkomitees der kommunistischen Parteien der Sowjetunion, Polens, Bulgariens, Ungarns und der DDR die Tätigkeit der Regierung Černik und des Zentralkomitees unter Führung von Alexander Dubček trotz der vorübergehenden Anwesenheit von Truppen nicht lahmlegen. Fordert den unverzüglichen Abzug der Besatzungstruppen.“9
Daraufhin verurteilten die 90 in Moskau anerkannten kommunistischen Parteien in der nicht-sozialistischen Welt den Einmarsch fast ausnahmslos10. Auch die kommunistischen Parteien Rumäniens, Albaniens, Jugoslawiens und Chinas lehnten die Besetzung der ČSSR ab, am zurückhaltendsten noch Rumänien - „Nichts kann diese Einmischung in innere Angelegenheiten eines anderen Staates rechtfertigen. Diese Aktion ist ein schwerer Schlag für die kommunistische Bewegung und den Weltfrieden.“11 - und Jugoslawien - „Die Souveränität der sozialistischen Länder ist verletzt worden und die fortschrittlichen Kräfte in der Welt haben einen starken Schlag erlitten.“12
Nicht nur Partei und Staat, auch die Kirchen und das Sekretariat der CFK in der ČSSR protestierten. So hieß es in dem Aufruf des Synodalrats der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder vom 21. August 1968 an alle Kirchengemeinden unter anderem:
„Wir schreiben euch diesen Brief in den Mittagsstunden des Tages, an dem die Souveränität und Freiheit unserer Republik durch einen Angriff von außen verletzt worden sind... Wir bekannten uns alle gern zum Regenerationsstreben unseres Volkes, das den Präsidenten Ludvik Svoboda, den Ministerpräsidenten Oldrych Černik und den ersten Sekretär der KPČ, Alexander Dubček, an der Spitze hat. In diesem Streben sehen wir die Fortsetzung unserer besten nationalen und geistigen Traditionen. Im Namen unserer ganzen Kirche protestieren wir gegen die Bedrohung dieses Regenerationsprozesses, gegen die Verletzung unserer Staatssouveränität und gegen die Okkupation unseres Landes durch ausländische Armeen, und wir verlangen ihre Abberufung.“13
Ebenso deutlich äußerte sich in Abwesenheit von Präsident Hromádka und Generalsekretär Ondra das Sekretariat der CFK in Prag. Es erklärte ebenfalls am 21. August 1968: „Das Sekretariat der Christlichen Friedenskonferenz gibt ihrer Solidarität Ausdruck mit der legalen Regierung der ČSSR und erklärt, dass die widerrechtliche Besetzung der Tschechoslowakei durch fremde Truppen gegen alle Grundsätze des friedlichen internationalen Zusammenlebens verstößt und eine ernsthafte Bedrohung darstellt für den Frieden in der ganzen Welt.“14 Es folgten die bekannten Äußerungen Hromádkas zur Okkupation durch die sozialistischen Nachbarn und seine ebenso bekannte Forderung nach dem unverzüglichen Abzug der Okkupationsarmeen in seinem Brief an den sowjetischen Botschafter in Prag vom 22. August 196815 und in seinem daran anschließenden Memorandum zur Intervention16. Der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) nahm diese Stimmen auf und erklärte in Beantwortung einer Anfrage einer Mitgliedskirche des Ökumenischen Rates in der ČSSR am 27. August 1968:
„1. Wir bedauern die militärische Einmischung in innere Angelegenheiten der Tschechoslowakei, eines kleinen, benachbarten und verbündeten Landes, durch die Regierung der Sowjetunion, Polens, Ost-Deutschlands, Ungarns und Bulgariens.
2. Wir stellen fest, dass die Führung der Kommunistischen Partei in der ČSSR bestrebt war, Partei und Staat mit legalen Mitteln, die in keiner Weise als Unfreundlichkeit gegenüber den östlichen Nachbarn ausgelegt werden konnten, zu reformieren, und dass es das Ziel dieser Reformen war, mehr geistige und intellektuelle Freiheit zu gewähren. Diese Bemühungen wurden und werden von der überwältigenden Mehrheit des tschechoslowakischen Volkes unterstützt.
3. Wir befürchten, dass die unbedachte Aktion der Sowjetunion und ihrer Verbündeten das Vertrauen friedliebender Menschen in aller Welt erschüttern wird - ein Vertrauen, das allein die Basis des Weltfriedens sein kann.
4. Wir appellieren an die Regierung der Sowjetunion, ihre Politik zu überprüfen, die zu der militärischen Intervention geführt hat, alle ihre Truppen zum frühestmöglichen Zeitpunkt aus der ČSSR abzuziehen und auf den Gebrauch von Gewalt und die Drohung mit Gewalt gegenüber ihren Verbündeten zu verzichten sowie sich bewusst zu sein, dass jeder Gebrauch militärischer Gewalt, für welchen Zweck und durch welche Macht auch immer, anderen Mächten als Grund oder Entschuldigung dienen kann, ihrerseits solcher Gewalt mit Gewalt zu begegnen.
5. Wir fühlen uns eins mit den Kirchen und dem Volk der Tschechoslowakei und drücken ihnen unsere Anteilnahme in dieser schweren Prüfung aus. Wir unterstützen ihren gewaltlosen Widerstand gegen die erzwungene Wiedereinführung geistiger, intellektueller und sozialer Kontrollen, die für eine tapfere und mutige Nation unannehmbar sind.“17
Der Metropolitanrat der orthodoxen Kirche in der Tschechoslowakei dankte dem ÖRK in einem von Metropolit Dorotej unterzeichneten Brief für diese Stellungnahme; das rumänisch-orthodoxe Patriarchat gab die Erklärung des Ökumenischen Rates der Regierung und allen Kirchengemeinden bekannt und erließ eine eigene Botschaft an die Christen in Rumänien. Darin hieß es: „Zusammen mit der ganzen Nation geben wir unserer Solidarität mit denen Ausdruck, die die Wiederherstellung des heiligen Rechts auf freie Entwicklung und auf die Unabhängigkeit des tschechoslowakischen Volkes fordern.“18
Der französische Regionalausschuss machte sich die Erklärung des Sekretariats der CFK vom 22. August 1968 zu eigen, äußerte seine entschiedene Verurteilung der Besetzung der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und erklärte, „eine solche Intervention war und ist nicht zu rechtfertigen, sowohl im Blick auf das internationale Recht, als auch auf den Aufbau des Sozialismus. Sie hat der Sache des Sozialismus in der Welt einen schweren Schlag versetzt“19. Der Ausschuss für die Christliche Friedenskonferenz in den USA erklärte: „Wir wenden uns an die Sowjetunion und deren Verbündete wie wir uns so oft an unsere eigene Regierung gewandt haben, dass sie ihre militärischen Kräfte zurückzieht und dem Volk die Freiheit gibt, seinen eigenen Weg zu finden.“20 Das lateinamerikanische Komitee „Kirche und Gesellschaft“ (ISAL) verdammte
„jegliche Form von Unterdrückung und Imperialismus, seien sie kapitalistischer oder sowjetischer Art, und erklärt angesichts der Tatsache der Invasion der UdSSR in die Tschechoslowakische Sozialistische Republik folgendes:
1. Die Tat der UdSSR zeigt, dass sie versucht, die schwächeren Nationen in ihrem Wirkungs- und Einflussgebiet zu kontrollieren und zu beherrschen, auf diese Weise die Selbstbestimmung der Betroffenen zu unterbinden und somit selbst die einfachsten Prinzipien des internationalen Rechts zu verletzen.
2. ISAL glaubt, dass eine gerechtere Gesellschaft nur zustande kommen kann, wenn die Menschen ihre Zukunft selbst aufbauen können, verbunden mit Freiheit, Selbstbestimmung und Verantwortlichkeit, denn das ist die Grundvoraussetzung zur Verhinderung jedes Imperialismus.
3. Deshalb verachtet ISAL diesen Gewaltakt, der von den Armee-Einheiten der UdSSR, Polens, der DDR, Ungarns und Bulgariens gegen Menschen ausgeführt wurde, die versuchten, neue Alternativen für eine gerechtere Gesellschaft zu finden.“21
Das japanische Regionalkomitee der Christlichen Friedenskonferenz wandte sich am 25. August 1968 in einem Brief an die Regionalkomitees der CFK in der Sowjetunion, Bulgarien, der DDR, Polen und Ungarn. Darin hieß es:
„Wir halten es für bedauerlich, dass Truppen der UdSSR und der weiteren vier osteuropäischen Länder am 20. August des Jahres in das tschechoslowakische Territorium eingefallen sind und es seitdem besetzen. Wir sind der Auffassung, dass es auch mit der Begründung der Verteidigung des Sozialismus keinem Land erlaubt ist, sich in die Innenpolitik von anderen mit Gewalt einzumischen. Das jetzige Vorgehen der fünf Länder ist nicht nur für den Weltfrieden bedrohlich, sondern es wird sich für das internationale Ansehen der sozialistischen Länder negativ auswirken und vor allem unserem Bemühen für den Frieden in der Dritten Welt große Schwierigkeiten bereiten. Wir sehen ein, dass die Situation, in der Sie sich befinden, für Sie nicht sehr einfach ist, aber wir bitten Sie dringend für die Lösung des Problems das Beste zu tun.“22
Damit überforderten die japanischen Geschwister ihre Brüder im Osten. Sie sahen nicht, dass diese - anders als sie - in dem tschechoslowakischen Versuch, Sozialismus und Freiheit miteinander zu verbinden, nicht die Chance sahen, Millionen für den Sozialismus zu gewinnen, sondern haarsträubenden Revisionismus, wenn nicht Konterrevolution. Denn diese Geschwister teilten die Grundüberzeugungen des bürokratischen Sozialismus - bis in die von ihnen verantwortete Hierarchisierung und Zentralisierung des kirchlichen Lebens hinein23. Sie waren davon überzeugt, dass es in der klassenlosen Gesellschaft (nicht anders als in den von ihnen geführten Kirchen) ein leitendes Zentrum geben müsse, dass die erdrückende Mehrheit der Bevölkerung (nicht anders als die Mehrzahl der Gläubigen) außerhalb dieses Zentrums stehe, und dass diesem Sozialismus (dieser Kirche) die Zukunft gehöre. Sie glaubten, dass dies die Zeit des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus im Weltmaßstab sei, und dass es einzig darauf ankomme, diesen Übergang friedlich zu gestalten. Damit lebten die hier von ihren japanischen Brüdern angesprochenen Geschwister in einer ganz anderen Welt als diese und folgten darum auch einer ganz anderen Erzählung als die tschechoslowakischen Genossen und - in deren Folge - die japanischen CFK-Mitarbeiter.
Die Brüder im Osten folgten der TASS-Erklärung vom 21. August 1968, die den Einmarsch in die Tschechoslowakei damit rechtfertigte, dass sich Persönlichkeiten der Partei und des Staates der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik an die Sowjetunion und die anderen sozialistischen Staaten mit der Bitte gewandt hätten, dem tschechoslowakischen Brudervolk dringend Hilfe, einschließlich der Hilfe durch bewaffnete Kräfte, zu gewähren. „Dieser Appell wurde ausgelöst, weil die in der Verfassung festgelegte sozialistische Staatsordnung durch konterrevolutionäre Kräfte gefährdet wurde, die mit dem Sozialismus feindlichen äußeren Kräften in eine Verschwörung getreten sind.“24 Mehr noch, die Brüder im Osten beriefen sich auch dann noch auf diese Erklärung, als zunächst keiner der Unterzeichner dieses Hilfeersuchens namhaft gemacht werden konnte25; als im Laufe des 21. August fast alle wichtigen Regierungsmitglieder und Parteifunktionäre von den Besatzungstruppen verhaftet wurden; als am 22. August 1968 die Prawda Alexander Dubček als ein rechtsgerichtetes revisionistisches Element der KP und der Regierung der ČSSR und die Präsidiumsmitglieder Špaček und Kriegel, den stellvertretenden Ministerpräsidenten Šik, Außeminister Hájek und ZK-Sekretär Císař als Verräter namhaft machte, als die polnische Zycie Warszawy diese Liste um Smrkovský ergänzte. Die Brüder im Osten hielten selbst dann noch an dieser Erklärung fest, als es in Moskau zu „Verhandlungen“ mit diesen „Verrätern“ kam.
Damit überforderten nun auch die Brüder im Osten ihre japanischen Brüder. Denn was Karl-Heinz Gräfe ausweislich der nach 1989 bekannt gewordenen staatlichen und parteiamtlichen Dokumente festhielt, war aufmerksamen Zeitgenossen der Intervention längst aufgegangen: Der Versuch der Interventen, wie 1956 in Ungarn eine „Revolutionäre Arbeiter- und Bauernregierung“ einzusetzen, war am massenhaften gewaltfreien Widerstand der Bevölkerung und des tschechoslowakischen Staatspräsidenten Ludvik Svoboda gescheitert. „Daraufhin blieb der Breshnewführung nichts anderes übrig, als sich mit den am 21. August gewaltsam in die UdSSR entführten Vertretern der verfassungsmäßigen Machtorgane an den Verhandlungstisch zu setzen.“26 Hinzu kam, dass Svoboda bereits Anfang 1970 in einem Interview mit der Prawda darauf aufmerksam machte, dass sich die tschechoslowakische Seite bei diesen „Verhandlungen“ in einer Zwangslage befand: „Es habe schweres Blutvergießen gedroht... Daher habe man versuchen müssen, mit Moskau eine Lösung zu finden.“27 In seinen 1993 erschienenen Erinnerungen bemerkte Alexander Dubček dazu:
„In Anbetracht der realen Bedrohung zum damaligen Zeitpunkt wird klar, wie wenig man unsere Entscheidungen (Zustandekommen des Moskauer Protokolls vom 26. August 1968) als 'freiwillig' betrachten kann. Wir waren mit dem klassischen Beispiel eines ungleichen, durch Gewalt und Drohungen aufgezwungenen Vertrages konfrontiert. Für die Tschechoslowakei hatte ein solcher Vertrag den unheimlichen Charakter eines déjá-vu-Erlebnisses: Der Vertrag wirkte wie ein Durchschlag jenes früheren Vertrages über die Errichtung des Protektorats Böhmen und Mähren, den Hitler am 15. März 1939 dem letzten Vorkriegspräsidenten der Tschechoslowakei, Dr. Emil Hacha, aufgezwungen hatte.“28
Beide trafen sich darin mit dem Präsidenten der CFK, Josef L. Hromádka, der das Ergebnis dieser Verhandlungen als schlimmer als das Münchener Abkommen von 1939 empfand. Unter diesen Umständen gab der letzte Satz des Kommuniqués vom 27. August 1968 über die Verhandlungen in Moskau dieses Kommuniqué selbst der Lächerlichkeit preis. Er lautete: „Die Verhandlungen verliefen in einer Atmosphäre der Aufrichtigkeit, Kameradschaftlichkeit und Freundschaft.“29 Aber auch das hinderte die Geschwister im Osten nicht, sich positiv zur Okkupation der ČSSR zu stellen, äußerten sie sich doch nicht nur als Christen, sondern auch als Bürger ihres Staates wie als Sprecher ihrer nationalen Tradition und der sie umgebenden politischen und kulturellen Atmosphäre30. Josef Smolík machte ihnen darüber den Vorwurf, sie hätten sich von den östlichen Regierungen instrumentalisieren lassen31, allen voran der Patriarch der Russischen Orthodoxen Kirche (ROK) und weitere geistliche Würdenträger aus der UdSSR. In seiner Erklärung vom 28. September 1968 äußerte zunächst der Patriarch der ROK unter anderem,
„indem wir den Standpunkt, der in Bezug auf die tschechoslowakischen Ereignisse von den fünf sozialistischen Staaten eingenommen ist, teilen und die Notwendigkeit, alles Mögliche zu unternehmen, um die der Tschechoslowakei drohende Gefahr seitens der äußeren und inneren Kräfte, die die Einheit des tschechoslowakischen Volkes zerstören und ihm die in schwerem Kampf errungenen Eroberungen zu entziehen streben, verstehen, betrachten wir das Ereignis des 21. August als die Bekundung - wenn auch in einer außerordentlichen Form - der Solidarität seitens der Brudervölker... Sein Zweck war in keiner Weise eine 'Okkupation' der Tschechoslowakei... Wir sind überzeugt, dass die Stationierung der Truppen der brüderlichen Staaten in der Tschechoslowakei keine Gefahr für ihre Sicherheit, territoriale Integrität oder ihre nationale Souveränität bildet... Die führenden Persönlichkeiten der sozialistischen Staaten haben wiederholt erklärt, dass sie die Bestrebungen des Volkes der Tschechoslowakei, die auf die Stärkung und Entwicklung des Sozialismus und der sozialistischen Demokratie in der ČSSR gerichtet sind, unterstützen. Es ist bekannt, dass dieser Prozess in der Tschechoslowakei durch die Aktionen der fünf verbündeten Staaten nicht verletzt wurde, vielmehr haben diese Aktionen zu dessen ruhigerem Verlauf beigetragen... Wie es die Fakten bezeugen, vollzieht sich heute in der Tschechoslowakei eine Konsolidierung des öffentlichen Lebens, die, unterstützt durch die friedliebenden Kräfte, alle Aussicht hat, zu einer völligen und für alle annehmbaren Regulierung zu führen.“32
Diese für alle annehmbare Regulierung führte nicht nur zur Entmachtung der Reformer, dem Ausschluss und der sozialen und politischen Ausgrenzung einer halben Million Kommunisten, von denen die Hälfte über zwanzig Jahre der Partei angehörte, sondern auch zu einer Reihe politischer Prozesse, in denen über 3000 Personen verurteilt wurden. „Betroffen waren auch viele parteilose Bürger, die gleichfalls mit Berufsverboten und Benachteiligungen für sich und ihre Familien auf Jahrzehnte bestraft wurden.“33 Angesichts dieser Perspektive, die der Patriarch in Kenntnis der sowjetischen Geschichte voraussehen konnte und musste, hoffte Alexej, dass die christlichen Brüder in der ČSSR „ihre Treue den Geboten des Evangeliums tätig bewähren und in der Lage sein werden, die kränklichen Gemütsbewegungen und Stimmungen, die einige von ihnen empfinden, zu überwinden.“34 Und Hromádka gab er zu bedenken, „es wäre unbedacht und ungerecht, den Ablauf dieses Prozesses durch die Überbetonung der Widersprüche, durch das Unterstreichen der Beleidigungen oder durch die Schaffung irgendeiner zusätzlichen Schwierigkeit zu erschweren.“35Andere osteuropäische Kirchenführer traten dem Patriarchen bei. Katholikos Efrem II., Patriarch von Georgien, bedauerte „die 'übereilte' Stellungnahme des Ökumenischen Rates und meint, alle Fragen der tschechoslowakischsowjetischen Beziehungen seien im Moskauer Abkommen vom 27. August sowie mit den 'zur Normalisierung der Situation' ergriffenen Maßnahmen beantwortet worden.“36 Und der stellvertretende lutherische Erzbischof von Estland, Edgar Hark, vertrat „die Auffassung, dass 'faktisch keine militärische Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Tschechoslowakei' stattgefunden habe. Die Truppen des Warschauer Paktes seien 'einer Bitte um Beistand von seiten führender Persönlichkeiten in Partei und Staat (der ČSSR) gefolgt', und Moskau habe sich dem Prager Reformkurs, 'der dem Wohle des tschechoslowakischen Volke dienen solle', niemals widersetzt.“37 Dabei betonten sie ihre Verbundenheit mit dem tschechoslowakischen Volk - und machten gleichzeitig der Bevölkerung der ČSSR den Vorwurf, dass sie sich von ausländischen antisozialistischen Kräften habe benutzen lassen. Folgerichtig spielten die Äußerungen der tschechoslowakischen Menschen zu der Intervention wie zu ihrer Vorgeschichte und zu ihren Folgen für sie gerade keine Rolle; deren Hoffnungen und Wünsche wie auch deren Befürchtungen und Ängste übergingen sie schweigend38.
Dieses Schweigen war nicht nur in den Mitgliedskirchen der CFK im Osten zu beobachten, dasselbe galt auch für die Regionalkonferenzen im Westen. Anders als Hromádka äußerten sie sich nicht einmal zur Selbstverbrennung Ján Palachs. Dieser hatte während der Weltgebetswoche für die Einheit der Christenheit die schottische Kirche besucht und dort unter anderem über die Reaktion seines Volkes auf die Ereignisse am 21. August 1968 gesprochen. Die Art und Weise, wie die Okkupation gerechtfertigt wurde, sei eine größere Herausforderung gewesen als die Truppen selbst. „Die Rechtfertigung stützte sich auf Lügen und falsche Nachrichten. Man versuchte, unsere führenden Politiker als Verbrecher hinzustellen... Die Russen gaben vor, sie seien als Freunde, um uns zu helfen, gekommen.“39 Und zur Selbstverbrennung Palachs sagte Hromádka: „Ich als Theologe sehe in diesem sich selbst aufopfernden Tod einen Ausdruck der Situation, in der wir leben. Es geht etwas in den Herzen meiner Landsleute vor. Ich kann einen Selbstmord nicht gutheißen. Aber ich kann die psychologischen Gründe, die dazu führten, verstehen.“40 Ebenso still blieben die Gliederungen der CFK im Westen, als dem Pfarrer, der Palach beerdigt hatte, zusammen mit zwölf Pfarrern der Tschechoslowakischen Hussitischen Kirche, 11 Pfarrern der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder und mindestens 16 katholischen Priestern die staatliche Genehmigung zur Ausübung des seelsorgerlichen Amtes entzogen wurde, ohne die sie nicht von ihrer Kirche berufen werden konnten41. So blieb es dem Generalsekretär des Britischen Kirchenrates, Bischof Kenneth Sansbury, vorbehalten, den Patriarchen der ROK darauf hinzuweisen, dass sich die Solidarität zwischen verbündeten Nationen unmöglich auf eine Weise äußern könne, die dem Partner, dem man angeblich helfen wolle, widerstrebe. Deshalb müsse der Britische Kirchenrat zu den Brüdern in den Kirchen der Tschechoslowakei stehen, die sich mit der Nation im Gebet und in der Hoffnung auf die Fortentwicklung des „Sozialismus mit einem menschlichen Gesicht“ eins seien. Sansbury ergänzte, Metropolit Nikodim, der sich zur Zeit des Einmarsches sowjetischer Truppen in der Tschechoslowakei aufhielt, „sei vielleicht selbst in der Lage gewesen, zu beobachten, dass die tschechische kommunistische Partei, die Regierung und die große Mehrheit des Volkes ihrer Sicht von allem, was im sozialistischen System gut ist, treu blieben, und dass die Gegenrevolution keine wirkliche Gefahr für das Land darstellte.“42 Diese Entwicklung bleibe gefährdet, solange eine ausländische Armee auf tschechischem Boden stationiert sei. Es könne nicht glaubwürdig behauptet werden, dass dies keine Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik darstelle. Dies behaupten heiße, die Wahrheit entstellen.
Deutlich zurückhaltender äußerten sich die deutschen CFK-Mitarbeiter in Ost und West. „Ganz abgesehen von unserer persönlichen Verbundenheit mit den Brüdern in der ČSSR“ fragte Heinz Kloppenburg nach den Ursachen und Folgen der Okkupation. „Beides zu sehen ist wichtiger als alle noch so berechtigte Erregung der Herzen.“43 Deshalb erinnerte Kloppenburg zunächst daran, dass die in den Völkern des Ostens nicht überwundene Furcht vor deutscher Aggression zu starker Sorge angesichts restaurativer und neonazistischer Tendenzen in der Bundesrepublik geführt habe, die auch durch die Außenpolitik Willy Brandts nicht überwunden werde. So hätten konservative Kräfte im Kommunismus eine wirtschaftliche und politische Infiltration der Tschechoslowakei vom Westen her befürchtet, die zu einer Bedrohung des gegenwärtigen Kräftegleichgewichts und zu einer Gefährdung der sozialistischen Zukunft hätte führen können. Herbert Mochalski ging noch einen Schritt weiter. Er warnte seine christlichen Brüder in Prag und Bratislava vor den Kräften in der Bundesrepublik, die am 21. August ihre Sympathie für die ČSSR entdeckt hätten und sich seither als Herolde der Freiheit und Unabhängigkeit der Kommunistischen Partei der ČSSR gäben, deren Begeisterung jedoch nicht einem demokratischen Sozialismus in der Tschechoslowakei gelte, sondern der Möglichkeit, im Zuge der Demokratisierung das S als Chiffre für Sozialismus aus der Abkürzung ČSSR zu eliminieren. Ihnen erklärte er:
„Diese falschen Freunde mit ihren eiligen Besuchen in Prag... haben ihren nicht geringen Anteil an dem Misstrauen der anderen sozialistischen Staaten, ob es der Kommunistischen Partei und der Regierung der ČSSR gelingen werde, den vom Westen erhofften Prozess einer stillen, allmählichen Umwandlung der Sozialistischen Republik in eine bürgerlich-kapitalistische Demokratie aufzuhalten. Dieses Misstrauen und die Sorge vor den dann entstehenden politischen und strategischen Folgen für alle sozialistischen Staaten mag die Intervention erklären“44.
Und den Reaktionären und Kalten Kriegern, denen der Einmarsch in die Tschechoslowakei die Möglichkeit bot, jede Entspannungspolitik zu diskreditieren, gab Mochalski zu bedenken: Wer als Feind ein Land besetze, übernehme die Regierungsgewalt und setze die legalen Organe ab. Doch Svoboda, Dubček, Černik und Smrkovský verhandelten in Moskau, und in Prag und Bratislava tagten die gewählten Parteiorgane. Ganz ähnlich äußerte sich Gerhard Bassarak. Auch er meinte, die Ereignisse in der Tschechoslowakei bis zum 21. August und danach seien im Westen allzu emotional beurteilt worden. Denn „Gefühle können das Denken hindern, und das ist gefährlich.“45 Vielmehr sei zu fragen, warum so viele Menschen im Westen, die bislang keineswegs Freunde des Sozialismus gewesen seien, plötzlich ihre Sympathien für den Sozialismus und seine Entwicklung in der ČSSR entdeckt hätten. Und es sei daran zu erinnern, dass der Einmarsch der Streitkräfte der fünf Warschauer-Pakt-Staaten in die Tschechoslowakei nur deshalb erfolgt sei, „um den status quo in Europa als die beste Friedensgarantie nicht verändern zu lassen“. Damit wolle er die Invasion zwar nicht verteidigen, aber doch um Verständnis dafür werben, dass sich die Sowjetunion zu diesem Schritt entschloss.
Eine Differenz blieb. War Kloppenburg überzeugt, „Wer gegen die Intervention in Vietnam ist, muss auch gegen die Intervention in Prag sein; wer zu Vietnam geschwiegen hat und schweigt, hat kein Recht, jetzt zu schreien.“46, widersprach Bassarak: „Ich muss sagen..., dass die Vorgänge in der Tschechoslowakei am 21. August dieses Jahres und danach keinen Krieg darstellten, dass es auf beiden Seiten nur wenig Blutvergießen gab, dass es für beide Seiten unpopuläre Maßnahmen waren, und dass auf keiner Seite Siegesfanfaren ertönten. Wer jetzt im Westen enttäuscht ist, sollte sich prüfen, ob er sich nicht vorher getäuscht hat.“47 Und - Bassarak setzte sich durch. Hatte der Beratende Ausschuss für die Fortsetzung der Arbeit der Christlichen Friedenskonferenz in seiner Budapester Sitzung vom 13.-17. Oktober 1965 noch festgestellt, „Imperialismus ist das Unternehmen, fremde Menschen und Völker mit ökonomischen, politischen und militärischen Mitteln zu beherrschen oder unter Druck zu setzen im Dienst von Interessen, welche den eigenen Interesse der betreffenden Völker fremd oder mit ihnen in Widerspruch sind“48; hatte die Internationale Kommission der CFK auf ihrer Sitzung in Georgsmarienhütte im März 1966 noch verlautbart, „Jeder Versuch eines Volkes, ein anderes Volk durch politische oder ökonomische Mittel in Abhängigkeit zu bringen oder zu beherrschen oder mit Waffengewalt sich zu unterwerfen, ist Imperialismus“49; schränkte Herbert Mochalski in seiner Ansprache an der IV. ACFV ein: „Als Imperialismus bezeichnen wir den Versuch der international verflochtenen Kapitalgesellschaften und ihrer politischen Exponenten, mit der Hilfe und mit der Methode ökonomischer, politischer und militärischer Macht... ein anderes Volk und seinen Staat oder eine ganze Region von Völkern und Staaten gegen deren Interessen der eigenen Herrschaft zu unterwerfen und zum Zwecke der Ausbeutung abhängig und gefügig zu machen.“50
2Karl-Heinz Gräfe, Der „Prager Frühling“ 1968 - Götterdämmerung oder Morgenröte?, in: Das Jahr 68: Weichenstellung oder Betriebsunfall? Zwischen Prager Frühling und Pariser Mai. Herausgeber im Auftrag des PDS-Landesvorstandes Sachsen Karl-Heinz Gräfe, Bernd Rump, Horst Kreschnak, Peter Gärtner, Frank Tschimmel. Schkeuditz: GNN (1998), S. 62
3 Hans-Jürgen Benedict, Die III. Allchristliche Friedensversammlung (31.3.-5.4.1968), in: Junge Kirche 29 (1968), S. 264 - Dass diese Befürchtung nicht aus der Luft gegriffen war, zeigt das Kapitel Die Zerschlagung des Prager Frühlings in: Christopher Andrew / Wassili Mitrochin, Das Schwarzbuch des KGB. Moskaus Kampf gegen den Westen. Aus dem Englischen von Klaus-Dieter Schmidt und Kurt Baudisch. Berlin: Propyläen 1999, S. 346-364
4 Zum Prozess der Demokratisierung in der ČSSR. Interview mit Frau Dr. Erika Kadlecova, in: Stimme der Gemeinde 20 (1968), Sp. 286
5 Alexander Dubček erinnerte sich: „Ich glaubte bis zuletzt nicht, dass die Führer der Sowjets einen militärischen Angriff gegen uns eröffnen würden. Das war für mich einfach undenkbar. Es widersprach gänzlich meiner Vorstellung der Werte, die meiner Meinung nach die Beziehungen zwischen sozialistischen Ländern bestimmten... Jede Parallele zu Ungarn 1956 kam mir wirklich absurd vor... Seit ungefähr zehn Jahren waren die Sowjets sehr bemüht, als konsequente Gegner jeder Aggression zu erscheinen, und sie hatten heftig für eine internationale, friedliche Koexistenz geworben. Sollten sie jetzt beschließen, dieses sorgfältig aufgebaute Image durch eine so eklatante Aggression zu zerstören, die sich auch noch gegen ihren Verbündeten richtete?“ (Alexander Dubček, Leben für die Freiheit. Übertragen aus dem Amerikanischen von Andrea Galler, Birgit Kaiser und Ursel Schäfer. München: C. Bertelsmann 1993, S. 262)
6 Stellungnahme des Außenministeriums, in: Der Fall ČSSR. Strafaktion gegen einen Bruderstaat. Eine Dokumentation. Herausgegeben von der Redaktion der Fischer Bücherei unter Mitarbeit des Südwestfunks Baden-Baden. Redaktion Klaus Kamberger. Frankfurt/M.: Fischer Bücherei 1968, S. 29f.
7 Karl Linke, Unser Anteil an der Prager Tragödie, in: Stimme der Gemeinde 20 (1968), Sp. 547
8 ders., Irrationalität der Sowjetpolitik, in: Stimme der Gemeinde 20 (1968), Sp. 675
9 An die kommunistischen und Arbeiterparteien der ganzen Welt, in: Der Fall ČSSR, a.a.O., S. 28
10 Lediglich die kommunistischen Parteien der Mongolei, Syriens, Chiles, Kolumbiens, Luxemburgs und der USA billigten das sowjetische Vorgehen.
11 Rumänisches Kommuniqué, in: Der Fall ČSSR, a.a.O., S. 44
12 Jugoslawisches Kommuniqué, in: Der Fall ČSSR, a.a.O., S. 44
13 Der Aufruf des Synodalrats an die Gemeinden vom 21.8.1968, in: Junge Kirche 29 (1968), Beiheft 1, S. 4
14 Erklärung des Sekretariats in Prag, in: Junge Kirche 29 (1968), Beiheft 1, S. 4
15 Brief von Professor D. Hromádka an den Botschafter der UdSSR in Prag, geschrieben am 22. August 1968, in: Junge Kirche 29 (1968), Beiheft 1, Beilage
16 Memorandum zur Intervention am 21. August 1968, in: Josef L. Hromádka, Der Geschichte ins Gesicht sehen. Evangelische und politische Interpretationen der Wirklichkeit. Ausgewählt und herausgegeben von Martin Stöhr (Theologische Bücherei, 60). München: Chr. Kaiser 1977, S. 302-325
17 Ökumenischer Rat verurteilt Ostblock-Intervention, in: Junge Kirche 29 (1968), S. 665f.
18 Kirchen in Osteuropa bedauern ČSSR-Erklärung des Ökumenischen Rates, in: Junge Kirche 29 (1968), S. 667 - Vergleiche dazu auch die Botschaft der Häupter der religiösen Kulte in der Sozialistischen Republik Rumänien an die Geistlichen und Gläubigen im Zusammenhang mit der von der Großen Nationalversammlung den 22. August 1968 verabschiedeten Erklärung, in: Hoffnung lässt nicht zuschanden werden. Herausgegeben von Reinhard Scheerer. (Zur Geschichte der Christlichen Friedenskonferenz, 3) Frankfurt/M.: Haag + Herchen 1995, S. 185f.
19 Der französische Regionalausschuss, in: Hoffnung lässt nicht zuschanden werden, a.a.O., S. 188
20 Erklärung des US-Ausschusses für die Christliche Friedenskonferenz zur Besetzung der Tschechoslowakei, in: Hoffnung lässt nicht zuschanden werden, a.a.O., S. 190
21 Statement des lateinamerikanischen Komitees „Kirche und Gesellschaft“, Porto Allegre, vom 25. August 1968, in: Junge Kirche 29 (1968), S. 668
22 Regionalkomitee der Christlichen Friedenskonferenz in Japan, Dr. Akira Satake, Tokyo, Japan, in: Junge Kirche 29 (1968), S. 667
23 Vergleiche dazu Milan Salajka, Die ökumenische Lage in der ČSSR im Frühjahr 1968, in: Junge Kirche 29 (1968), S. 488-490
24 Mitteilung von TASS vom 21. August 1968 zum Einmarsch in die Tschechoslowakei, in: Der Fall CSSR, a.a.O., S. 13f.
25 „Wie die heute zugänglichen Quellen belegen, forderten ohne Wissen der Partei- und Staatsführung lediglich drei der elf Mitglieder des Präsidiums (Vasil Bilak, Drahomir Kolder, Oldrich Svestka) und zwei ZK-Mitglieder (Alois Indra, Antonin Kapek) am 16. August 1968 den militärischen Einmarsch über den sowjetischen Botschafter an. Am folgenden Tag entschied das Politbüro des ZK der KPdSU, in der Nacht vom 20. zum 21. August 1968 militärisch einzumarschieren. Auf dieser Grundlage erarbeitete und beschloss das Politbüro des ZK der KPdSU schließlich auch den ominösen Aufruf einer 'Gruppe des ZK der KPČ, der Regierung und der Nationalversammlung' an die Partei- und Staatsführungen der Warschauer Paktstaaten, den der sowjetische Botschafter in Prag Alois Indra und Vasil Bilak überreichte und der dann am 21. August 1968 veröffentlicht wurde.“ (Karl-Heinz Gräfe, a.a.O., S. 64) Vergleiche dazu auch Vasil Bilak, Wir riefen Moskau zu Hilfe. Der „Prager Frühling“ aus der Sicht eines Beteiligten. Herausgegeben und übersetzt von Klaus Kukuk. Berlin: Das neue Berlin 2006
26 a.a.O., S. 62f.
27 Ein Interview Svobodas (Basler Nationalzeitung, 2.2.1970), in: Junge Kirche 31 (1970), S. 185
28 Alexander Dubček, a.a.O., S. 302
29 Das Moskauer Kommuniqué (27.8.1968), in: Der Fall CSSR, a.a.O., S. 73
30 So Josef L Hromádka immer wieder, zuletzt in seinem Memorandum zur Intervention am 21. August 1968.
31 Josef Smolík, Ökumene aus der Perspektive von Prag, in: Der Ökumenische Rat der Kirchen in den Konflikten des Kalten Krieges. Kontexte - Kompromisse - Konkretionen. Herausgegeben von Heinz-Jürgen Joppin (Beiheft zur Ökumenischen Rundschau, 70). Frankfurt/M.: Otto Lembeck 2000, S. 201f.
32 Erklärung seiner Heiligkeit des Patriarchen von Moskau und ganz Russland Alexej zu den Ereignissen in der Tschechoslowakei, in: Junge Kirche 29 (1968), S. 664f.
33Karl-Heinz Gräfe, a.a.O., S. 63
34 Erklärung seiner Heiligkeit des Patriarchen von Moskau und ganz Russland Alexej, a.a.O., S. 664 - Vernichtender lässt sich eine Kritik an der Versammlung der Vertreter der christlichen Kirchen in der ČSSR am 2. September 1968 in Prag nicht formulieren, die in einer An alle Christen in unserer Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik gerichteten Kundgebung erklärt hatte: „Wir danken allen verfassungsmäßigen Vertretern mit dem Präsidenten der Republik L. Svoboda an der Spitze, die sich im Interesse des Lebens und der Ehre der Völker unseres sozialistischen Staates in der gegebenen Bedrängnis für den Weg der allmählichen Konsolidierung der Verhältnisse entschlossen haben, welche durch das Eindringen einiger Staaten des Warschauer Paktes auf das Gebiet unseres Staates entstanden ist. Wir würdigen die Tatsache, dass die Konsolidierung der Verhältnisse in unserer sozialistischen Republik durch das Bestreben unseres Volkes unter der Leitung des Präsidenten der Republik L. Svoboda, der Nationalversammlung, an deren Spitze mit J. Smrkovský, der Regierung des Ministerpräsidenten O. Černik und an der Spitze mit Alexander Dubček geschieht - und wie wir hoffen auch weiterhin geschehen wird - denen wir alle vertrauen.“ (Versammlung der Vertreter der Christlichen Kirchen am 2. September 1968 in Prag, An alle Christen in unserer Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik, in: Junge Kirche 29 (1968), S. 598
35 a.a.O., S. 665 - Dass es auch anders ging, bewies der Patriarch der Bulgarischen Orthodoxen Kirche Kyrill, der eine Stellungnahme zur ČSSR-Erklärung des ÖRK mit der Begründung ablehnte, er wolle sich nicht „in politische Fragen dieser Art“ einmischen.
36 Kirchen in Osteuropa bedauern ČSSR-Erklärung des Ökumenischen Rates, a.a.O., S. 666
37 ebd. - Die Erklärung der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Ungarn zu den Ereignissen in der Tschechoslowakei (in: Hoffnung lässt nicht zuschanden werden, a.a.O., S. 190-199) reagierte weniger auf die Ereignisse am 21. August 1968 als auf Hromádkas Bemerkungen zur Ungarischen Krise 1956 (s.o., Bd. 1, S. 114-118) - So auch: Ungarische Lutherische Kirchenzeitung bejaht Okkupation der CSSR, in: Junge Kirche 29 (1968), S. 599f. Darin hieß es unter anderem: „Die Erscheinungen der letzten Monate in der Tschechoslowakei hätten 'gespensterhaft an einzelne Ereignisse der ungarischen Konterrevolution von 1956 erinnert'... Die Errungenschaften des Sozialismus seien in Gefahr geraten... Während der 'Ausmerzung der Fehler in der Tschechoslowakei' seien - genau wie 1956 in Ungarn - 'die Gegner des Sozialismus vorgedrungen und gewisse Kreise westlicher Länder in Aktion getreten, die die Vernichtung des Sozialismus auf ihr Banner geschrieben haben. Über die nach dem Westen hin seit Monaten offenen Grenzen strömten Aufwiegler und Rebellen, in erster Linie aus westdeutschen revanchistischen Kreisen, zu Tausenden in die Tschechoslowakei, um eine Änderung des Regimes und den Austritt der Tschechoslowakei aus der Gemeinschaft der sozialistischen Länder zu ermöglichen'. Um diese Gefahren abzuwenden, heißt das Blatt die 'getroffenen Maßnahmen' gut und nennt sie ein 'gutes Zeichen dafür, dass die Bestrebungen nach einer Lösung nicht umsonst waren'.“
38 Vergleiche dazu: Prof. Hromádka warnt vor Zynismus und Indifferenz, in: Junge Kirche 29 (1968), S. 737: „Vor der 'ungeheuren Gefahr des Zynismus, der Enttäuschung und der Apathie', der das tschechoslowakische Volk erliegen könnte, sollte sich der Druck von seiten der Sowjetunion und anderer sozialistischer Länder verstärken, warnte der bekannte Prager Theologe Prof. Josef Hromádka... Genauso wenig wie ein Rückfall des Westens in eine 'anti-kommunistische, anti-sowjetische Hetze' den Kirchen und dem Volk der Tschechoslowakei in der gegenwärtigen schwierigen Lage helfen könne, genauso wenig lasse sich der Sozialismus auf 'Misstrauen, Zynismus und Gleichgültigkeit' aufbauen. Das Land brauche 'Hilfe, Vertrauen und Verständnis' der Christen in anderen Ländern. Den Kirchen der Tschechoslowakei biete sich nach dem 21. August die große Chance, 'Quelle der Hoffnung und der schöpferischen Vitalität' zu werden, die die Nation brauche... Die Geschlossenheit der Nation nach dem 21. August habe den Kommunisten die Loyalität der Christen vor Augen geführt und andererseits den Christen gezeigt, dass der Kommunismus nicht statisch, sondern wandelbar sei. Die Chancen der Kirchen, sich am Aufbau eines menschlichen Sozialismus zu beteiligen, seien heute 'größer denn je'.“
39 Hromádka besuchte Schottland, in: Junge Kirche 30 (1969), S. 171
40 a.a.O., S. 172 - Vergleiche dazu das Wort des Synodalrats „An alle Gemeinden der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder. Prag, den 22. Januar 1969“ in: Junge Kirche 30 (1969), S. 172f.: „Tief bewegt stehen wir vor der erschütternden Tat Ján Palachs, vor dem, was er erlebte, bevor er sich entschied, was er durchlitt, woran er glaubte. Sein Tod ist ein Aufschrei, wie er noch nie in unserer Geschichte zu hören war. Er ist ein Signal für die Gefahr, in der wir uns befinden... Wir dürfen uns nicht lähmen und niederschmettern lassen durch die Tatsachen, vor denen wir stehen. Sehen wir weiter nach vorn! Wir wollen uns mit all denen vereinen, die sich für die Durchsetzung neuer Beziehungen zwischen den Menschen in den Kampf begeben haben. Der Tod Ján Palachs ruft uns zum Leben... Er forderte uns auf, dass wir uns für eine Veränderung zum Besseren einsetzen, für Werte, die unserer Existenz das rechte Antlitz und die moralische Würde geben, für Ideale, die die Menschheit vereinen und nach vorn führen... Die ganze Welt ist krank, und unser Land ist einer der empfindlichsten Punkte. Gebt nicht preis, was das Rückgrat unserer Geschichte war. Wir wollen den Glauben an die Zukunft nicht verlieren. Wir wollen nicht an der Verzweiflung ersticken. Wir wollen die unterstützen, die an den führenden Stellen für eine menschliche, demokratische, sozialistische Gesellschaft kämpfen. Wir wollen ihnen nicht unser Vertrauen entziehen. Machen wir den Graben zwischen ihnen und dem Volk nicht breiter! Schaffen wir mit ihnen gemeinsam eine Atmosphäre, in der die gezwungen werden abzutreten, die ihre Arbeit zunichte machen, die Spannung erhöhen und die krisenhafte Reizbarkeit der Jugend auslösen. Der Weg ist schwer, voll von Hinterhalten und Hindernissen, aber auch von Hoffnung, wenn wir einig bleiben in Treue zur Wahrheit, die siegt.“
41 Rund 40 Geistlichen in der Tschechoslowakei Lizenz entzogen, in: Junge Kirche 35 (1974), S. 298f. - Vergleiche dazu das Wort der Mitgliedskirchen der CFK in der Tschechoslowakei an den Arbeitsausschuss der CFK, in der diese Kirchen ungeachtet dieses Lizenz-Entzugs erklärten: „Als Vertreter von Kirchen in der Tschechoslowakei, die ein sozialistischer Staat ist, bezeugen wir, dass wir im Rahmen der sozialistischen Gesellschaft unsere religiöse und kirchliche Arbeit ungestört fortführen und die Bemühungen unserer Völker um weitere Erfolge im Aufbau unseres konsolidierten friedliebenden Landes voll unterstützen werden.“ (Ein Wort an den Arbeitsausschuss der CFK, in: Neue Stimme, Mai-Heft 1974, S. 22f.) Ebenso bemerkenswert ist die redaktionelle Einführung dieses Wortes in der Neuen Stimme. Sie betonte: „Interessant ist diese Grußadresse für uns und die Kirchen in der BRD deshalb, weil die antikommunistischen Kampagnen hierzulande ja immer darauf abzielen, gewissermaßen die Interessen der Kirche für sich in Anspruch zu nehmen. Wichtigster Stützpfeiler für den Antikommunismus in den Kirchen ist die - in vielen Varianten wiederholte - Behauptung, die Kirchen seien in den sozialistischen Staaten einer ständigen Unterdrückung ausgesetzt... Vor diesem Hintergrund ist es von besonderer Eindringlichkeit, mit welchem Ernst die Kirchen in der ČSSR ihr Zeugnis für die Mitarbeit an der Friedenspolitik ihres Staates vortragen. Es ist eine Stimme die gehört werden muss...“
42 Tschechoslowakei: Briefwechsel zwischen russischen und britischen Kirchenführern veröffentlicht, in: Junge Kirche 30 (1969), S. 57
43 Heinz Kloppenburg, An die Mitglieder und Freunde der Christlichen Friedenskonferenz in der Bundesrepublik Deutschland, 29.8.1968, in: Junge Kirche 19 (1968), Beiheft 1, S. 1
44 Herbert Mochalski, Die Prager Tragödie, in: Stimme der Gemeinde 20 (1968), Sp. 515 - Vergleiche dazu: Die Regionalkonferenz in der Schweiz, in: Junge Kirche 30 (1969), S. 147. In einem Brief an die Mitgliedskirchen und Regionalausschüsse der CFK erklärte die Schweizerische Arbeitsgruppe: „Das tief verwurzelte Misstrauen derer, die in der Vergangenheit unermessliche Opfer an Blut und Gut bringen mussten, ist uns wohl verständlich. Der Geist, der Krieg will, um über die anderen zu herrschen, hat sich noch nicht von unserem Erdball vertreiben lassen. Seine freche Sprache wird bereits wieder laut. Wir übersehen auch nicht, wie schwer es alle jene Regierenden haben, die selber den Frieden wollen, jedoch an der ehrlichen Gesinnung des Nachbarn zweifeln müssen.“
45 Professor Dr. Bassarak: Besetzung der Tschechoslowakei - ein „schmerzhafter Akt“, in: Junge Kirche 29 (1968), S. 668
46 Heinz Kloppenburg, a.a.O., S. 2
47 Professor Dr. Bassarak, a.a.O. - Dabei verschwieg Bassarak, dass die Vorgänge in der Tschechoslowakei nur deshalb keinen Krieg zur Folge hatten, weil Tschechen und Slowaken sich der Besetzung ihres Landes nicht entgegenstellten.
48 Resolution des BAFA vom 13.-17.10.1965 in Budapest, zit. n. Albert Rasker, Zur Frage des Imperialismus und seiner Überwindung, in: Stimme der Gemeinde 18 (1966), S. 369-374
49