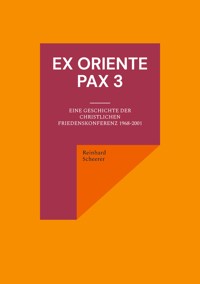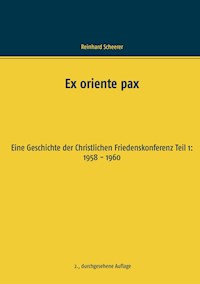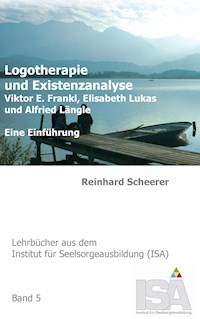
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Seit ihrer Publikation Ende der 1940er, Anfang der 1950er Jahre sind die Logotherapie und Existenzanalyse Viktor E. Frankls zumal unter kirchlich engagierten Beratern und Therapeuten auf großes Interesse gestoßen. Denn sie werden nicht nur weithin als mit dem christlichen Glauben vereinbar gesehen, sie lassen sich auch vom christlichen Glauben her verstehen und erlauben von daher die Hereinnahme seelsorglicher Elemente in das therapeutische Geschehen (und umgekehrt). Frankls Schülerin Elisabeth Lukas kann geradezu als Kronzeugin dafür gelten; andere - wie zum Beispiel Christa Meves - sind ihr darin gefolgt. Mit entscheidend dafür ist, dass es sich dabei um ein außenorientiertes Verfahren handelt, das die Heilung nicht von der Beschäftigung des Patienten mit sich selbst erhofft, sondern von seiner Ausrichtung auf den Sinn und die Werte, die ihm in seiner Lebenssituation entgegentreten, und von der Übernahme der Aufgaben, die sein Leben ihm stellt. Demgegenüber bedeutet die in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren von Alfried Längle vorgenommene Neuausrichtung von Logotherapie und Existenzanalyse eine entschiedene Abkehr von jedem Transzendenzbezug und eine ebenso entschiedene Hinwendung zur Innenorientierung. Dadurch wird aber das Original nicht weniger wertvoll. Es erneut ins Bewusstsein zu rufen und auf die vielfältigen Möglichkeiten hinzuweisen, die es nach wie vor bietet, ist das Anliegen dieser Publikation.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lehrbücher aus dem Institut für Seelsorgeausbildung Band 5
Für Esther
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Der lexikalische Befund
Eine erste Annäherung - Viktor E. Frankl
Von der Psychoanalyse zur Logotherapie
Die Sinnfrage in der Logotherapie
Das Menschenbild der Logotherapie
Exkurs: Frankl als Philosoph (I)
Logotherapie und Religion
Exkurs. Frankl als Philosoph (II)
Die Logotherapie in der Praxis
Die Arbeitslosigkeitsneurose
Die noogene Neurose
Die psychogene Neurose
Paradoxe Intention und Dereflexion
Ein zweiter Anlauf - Elisabeth Lukas
Methoden und Techniken der Logotherapie
Wider die herkömmliche Psychotherapie
Der Sinnglaube in der Logotherapie
Eine Zwischenbemerkung - Christa Meves
Ein letzter Schritt - Alfried Längle
Logotherapie
Existenzanalyse
Rückblick und Ausblick
Literaturverzeichnis
Vorwort
"Seit Auschwitz wissen wir, wessen der Mensch fähig ist. Und seit Hiroshima wissen wir, was auf dem Spiel steht." Das ist der erste Satz Viktor E. Frankls, den ich erinnere - und der mir auch sein Lebenswerk, die Logotherapie, sympathisch gemacht hat, lange bevor ich sie wirklich kennen lernte. Denn was mich seinerzeit beeindruckte, das war der Ernst, mit dem Frankl in seinem Vortrag an der Weltkonferenz "Die Rolle der Universität im Kampf um den Frieden" vom 25.-29. August 1969 in Wien dazu aufrief, aus dem Glauben an den einen Gott nun auch die Konsequenz des Wissens um die eine Menschheit zu ziehen: Anders sei ein Sinn, der für alle gilt, nicht darstellbar. Dabei blieb sich Frankl in seinem Engagement für den Frieden auch als Neurologe und Psychiater treu - ganz einfach deshalb, weil sich für ihn dieser Einsatz aus seinem Menschenbild ergab - weil sich der Mensch für ihn nicht in einem Interesse an seinen eigenen inneren Befindlichkeiten erschöpft, sondern auf die Welt hingeordnet ist und allenfalls so tun kann, als wäre er es nicht.
Von daher wurde Frankl nicht müde, immer wieder aufzurufen: "Die Welt liegt im Argen; aber es wird alles nur noch viel ärger werden, wenn nicht jeder einzelne sein Möglichstes tut." Und das ist nicht eben wenig - wenn man sich nur darauf einlässt, dass der Mensch mehr ist als ein Mutationsergebnis, mehr als das bloße Produkt von Erbe und Umwelt, mehr als das Produkt sozioökonomischer Bedingungen. Und auch darauf wies Frankl immer wieder hin. Dabei schreckte er, zumal in der Auseinandersetzung mit einer vermeintlichen Tiefenpsychologie, die ihre Patienten mehr oder weniger regelmäßig auf ihr Ego einschränkt, auch vor deutlicher Kritik nicht zurück. Und auch das sprach mich an: Hier meldete sich eine Stimme zu Wort, die Selbstverwirklichung und Sinnverwirklichung nicht nur zusammenschaute, sondern in eins setzte - eine für mich zu Beginn meines Studiums in der weltflüchtigen Atmosphäre des Psychobooms der 70er Jahre nachgerade befreiende Entdeckung.
Von daher griff ich dann natürlich auch zu den Schriften der Frankl-Schülerin Elisabeth Lukas. Sie stellte mir mit einer ihrer Formulierungen so etwas wie die nicht-religiöse Interpretation meines Lebens in der Nachfolge zur Verfügung. So betonte Lukas nicht nur: "Das Glück ist nicht, dass jemand sagen kann: 'Mir geht es gut'. Das Glück ist, wenn jemand sagen kann: 'Ich bin für etwas gut'." Sondern sie versicherte jedem, der es hören wollte, mit gleichem Ernst: "Du bist hier und jetzt zu etwas gerufen, du wirst gebraucht, dein Beitrag verändert die Welt, und sei er noch so winzig! Auf dich richtet sich eine Hoffnung der Welt, die sich, wenn du es willst, erfüllen könnte. Kümmern wir uns nicht um Lohn und Anerkennung seitens unserer Mitmenschen. Ihr Dank ist zwar eine sehr angenehme 'Draufgabe', aber das Wesentliche ist er nicht. Das Wesentliche ist diese uns ständig begleitende Hoffnung, die sich auf uns richtet, die Hoffnung, dass wir das Unsrige erbringen, die Welt in der wir leben, ein wenig heller und heiler zu gestalten...."
Dennoch dauerte es noch einmal gut drei Jahrzehnte, bis ich mich Frankl ernsthaft zuwandte und - von April 2009 bis Dezember 2011 - eine zweieinhalbjährige Ausbildung in Logotherapie und existenzanalytischer Beratung machte. Sie machte mich freilich nur noch neugieriger auf diesen Mann und auf seine Ideen, konnte ich im Verlauf dieser Ausbildung doch feststellen, dass ich vieles von dem, was mir da nahe gebracht wurde, bereits kannte und als Heilpraktiker für Psychotherapie längst erfolgreich genug praktizierte. Dieser Neugier verdanken sich auch die nachstehenden Ausführungen. Ich habe sie eine Einführung genannt; tatsächlich handelt es sich dabei jedoch um den Versuch einer Aneignung. Von daher trägt sie streckenweise den Charakter einer Zusammenstellung der für mich treffendsten Formulierungen Frankls; dabei werden sich Wiederholungen nicht immer vermeiden lassen1. Denn Frankl hat zwar viel publiziert, im Kern aber immer wieder dieselben Gedanken variiert und sich dabei - wiederum: für mich - einmal mehr, einmal weniger überzeugend ausgedrückt. Andererseits konnte und wollte ich aber auch auf die eine oder andere kritische Anmerkung nicht verzichten: Anders als Frankl bin ich kein Arzt, sondern Heilpraktiker. Und anders als Frankl bin ich auch kein Philosoph - nach seiner Promotion zum Dr. med. im Jahre 1930 promovierte Frankl 1948/49 auch noch zum Dr. phil. mit einer Arbeit unter dem Titel "Der unbewusste Gott" -, sondern Theologe. Von daher gehen diese Ausführungen aber auch über Frankl hinaus; seinen "Erben", Elisabeth Lukas und Alfried Längle, ist je ein eigener Abschnitt gewidmet.
1 An dieser Stelle sei wenigstens anmerkungsweise auf eine weitere Schwierigkeit hingewiesen: In den verbreiteten Sammelbänden - die auch die Grundlage dieser Arbeit darstellen; eine kritische Gesamtausgabe der Werke Frankls war für mich nicht erreichbar - werden dieselben Vorträge Frankls teils unter verschiedenen Titeln, teils in unterschiedlichen Fassungen angeboten und Auszüge aus andernorts bereits erschienenen Publikationen nicht immer als solche gekennzeichnet.
Der lexikalische Befund
Sucht man in den einschlägigen Lexika nach einer ersten Orientierung zum Thema, dann erfährt man beispielsweise, dass die Logotherapie die psychotherapeutische Technik in der Existenzanalyse sei, oder - anders herum - dass aus der existenzanalytischen Theorie eine eigene Behandlungsmethode, eben die Logotherapie, abgeleitet werde. Diese Theorie sei stark am philosophischen Daseinsbegriff Heideggers und an der Phänomenologie Husserls orientiert. Damit bewegten wir uns in der Begrifflichkeit der anthropologischen Medizin, im Rahmen einer daseinsanalytischen psychotherapeutischen Konzeption, der es darauf ankomme, das Gesamt der Bezüge des erkrankten Individuums zur Welt, den "Daseinsvollzug", in den Blick zu bekommen und nicht einseitig auf die Krankheitssymptome oder den Krankheitsverlauf zu schauen. In dem Lexikon Psychiatrie, Psychotherapie, medizinische Psychologie heißt es denn auch: "Die Daseinsanalyse geht somit von einem philosophischen Konzept aus. In der Anwendung auf die Psychiatrie ist das Ziel, den schizophrenen Kranken aus den Begriffssystemen der traditionellen Psychiatrie herauszulösen und ihm eine Menschlichkeit im Sinne der Existenzphilosophie zurückzugeben. Die traditionelle Unterscheidung zwischen endogenen, exogenen und psychogenen psychischen Erkrankungen verliert damit an Bedeutung."2 Der in diesen Zeilen mitschwingende Vorbehalt ist deutlich genug - und beruht doch nur auf der (Selbst-)Täuschung, als gäbe es psychotherapeutische Konzeptionen, die nicht von einem philosophischen Konzept ausgingen - und sei dies die deterministische Weltsicht der Newtonschen Physik, auf der bekanntlich die Begriffssysteme der klassischen Psychiatrie und mit ihr die Reduktion des kranken Menschen auf seine Krankheit beruhen.
Ein ganz anderer - und dann doch wieder nur derselbe - Vorbehalt spricht aus dem Wörterbuch der Psychoanalyse, wenn es die Daseinsanalyse einerseits als Sammelbezeichnung aller phänomenologischen Strömungen in der Psychotherapie definiert, andererseits aber auf die auf Ludwig Binswanger zurückgehende therapeutische Methode reduziert, "welche die freudianische Psychoanalyse mit der Phänomenologie Heideggers verbindet. Dabei wird das Subjekt in einer dreifachen Dimension gesehen: in seiner Beziehung zur Zeit, zum Raum und zur Welt."3 Denn damit erscheint auch hier wieder die Logotherapie - den Begriff Existenzanalyse kennt das Wörterbuch der Psychoanalyse nicht - als unwissenschaftlich, da sie das freudianische Triebkonzept und Freunds Vorstellung vom Es ablehne und statt dessen die Vorstellung eines spirituellen bzw. existentiellen Unbewussten als eines "vornehmen" Teils des Seelenlebens "bevorzuge".
Hier wie dort scheint Abgrenzung, wenn nicht Abwertung die Devise. Das gilt auf seine Weise wohl auch für das Wörterbuch der Analytischen Psychologie, insofern es keines der bislang genannten Stichworte - Logotherapie, Existenzanalyse, Daseinsanalyse - kennt4. Dieses Bemühen um Abgrenzung bzw. Abwertung prägt interessanterweise aber auch das Handwörterbuch der angewandten Psychologie. Denn hier ist es eine Vertreterin der Logotherapie selbst, die nicht nur die Unterschiede zwischen dem logotherapeutischen und dem psychoanalytischen, individualpsychologischen oder verhaltenstherapeutischen Vorgehen deutlich macht, sondern in ihrer Kommentierung einer gesprächspsychotherapeutischen Krisenintervention das relative Ungenügen der Gesprächspsychotherapie herausstellt: Gelte in der Gesprächspsychotherapie ein Gesprächsverlauf schon dann als erfolgreich, wenn sich der Klient von seinem Therapeuten verstanden fühle, sei dies in der Logotherapie erst dann der Fall, "wenn der Klient selber verstanden hat, was auf seinem Wege Wert ist, auf Rückzüge zu verzichten und tapfer voranzuschreiten, und was nicht."5 Denn: Der Begründer der Logotherapie, Viktor E. Frankl (1905 - 1997) stelle neben den Willen zur Lust (Freud) und den Willen zur Macht (Adler) den Willen zum Sinn. Dieser Sinn lasse sich nach Frankl nicht nur im ungestörten Schaffen, Erleben und Lieben finden, sondern auch in der Art und Weise, wie sich Menschen zu einer Leidenssituation stellen, deren Ursache sich nicht beseitigen lasse. Werde dieser Sinn nicht erfüllt, entstehe ein existentielles Vakuum. Das führe zu einem mit einem Sinnlosigkeitsgefühl einhergehenden Leere-Gefühl, charakterisiert durch Langeweile, Gleichgültigkeit, Interesselosigkeit und Mangel an Initiative. Diese existentielle Frustration sei jedoch nichts Krankhaftes, sondern zunächst einmal Ausdruck des Bestrebens, einen solchen Sinn nicht von anderen zu übernehmen, sondern eigenverantwortlich danach zu suchen. Sobald sich dieses existentielle Vakuum jedoch in Form neurotischer Symptome zeige, spreche Frankl von noogener Neurose. Diese Neurose breche dann aus, wenn sich - beispielsweise durch besondere Lebensumstände oder körperliche Krankheiten - aus dem Verlust der für einen Menschen spezifischen Sinn- und Wertmöglichkeiten eine "geistige Not" ergebe. Dann sei Logotherapie angezeigt, weil sie dem Leidenden dabei helfe, den Sinn seiner Existenz analytisch zu erhellen und in seinem Leben konkrete Sinnmöglichkeiten aufzuspüren.
2 Uwe Henrik Peters, Lexikon Psychiatrie, Psychotherapie, medizinische Psychologie. Mit einem englischdeutschen Wörterbuch als Anhang. München: Urban & Fischer 2000, S. 109
3 Elisabeth Roudinesco / Michel Plon, Wörterbuch der Psychoanalyse. Namen, Länder, Werke, Begriffe. Aus dem Französischen übersetzt von Christoph Eissing-Christophersen, Michael Ramaharomanana, Franziska Roelcke und Michael Wiesmüller. Wien: Springer 2004, S. 169
4 Lutz Müller / Anette Müller (Hg.), Wörterbuch der Analytischen Psychologie. Düsseldorf: Walter 2003
5 Elisabeth Lukas, Art. Logotherapie, in: Angela Schorr (Hg.), Handwörterbuch der angewandten Psychologie. Die angewandte Psychologie in Schlüsselbegriffen. Bonn: Deutscher Psychologen Verlag 1993, S. 452
Eine erste Annäherung - Viktor E. Frankl
Diese kurz gefasste Darstellung von Logotherapie und Existenzanalyse wirft mehr Fragen auf als sie beantwortet. Um so lohnender ist die Beschäftigung mit den Schriften des Begründers der Logotherapie, Viktor E. Frankl6, selbst. Als Einstieg bietet sich dazu seine bekannteste Schrift an, "...trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager", ist sie doch zugleich - neben seiner Autobiographie7 - seine wohl persönlichste Veröffentlichung: Frankl wurde 1940 nach Theresienstadt deportiert, von dort nach Auschwitz, dann nach Kaufering III und schließlich nach Türkheim in Bayern verschleppt. Dort war er nicht mehr als ein gewöhnlicher Häftling, "eben nichts als die bloße Nummer 119 104"8, lebte von 650 Kalorien am Tag, wog zuletzt gerade noch 40 kg, und war dabei die meiste Zeit als Erdarbeiter und als Streckenarbeiter beim Bahnbau tätig. Nicht ohne Stolz bezeichnete sich Frankl von daher gelegentlich als Überlebenden von vier Konzentrationslagern. Dennoch war die Veröffentlichung dieses Bandes zunächst anonym geplant. "Maßgeblich war mir hierfür meine Abneigung gegen ein Exhibitionieren von Erlebtem. Tatsächlich war die Niederschrift schon beendet, als ich mich davon überzeugen ließ, dass eine anonyme Veröffentlichung insofern entwertet würde, als der Mut zum Bekenntnis den Wert einer Erkenntnis erhöht. Daraufhin habe ich um der Sache willen auch auf nachträgliche Streichungen verzichtet..."9
Was Frankl hier vorlegt, ist demnach eine Erlebnisschilderung, kein Tatsachenbericht, mit dem Ziel einer Passion des unbekannten Lagerinsassen; dazu beschreibt er in einem ersten Teil, durch welche Phasen der Entmenschlichung die KZ-Häftlinge gehen mussten. Vor allem aber interessiert ihn, wie es einigen von ihnen möglich war, trotzdem "Ja" zum Leben zu sagen10. So erzählt Frankl zunächst vom Aufnahmeschock in Auschwitz, von dem Schrecken, der ihn von daher überkam - so glaubte er, ein paar Galgen und an ihnen Aufgehängte zu sehen -, und davon, dass unter dem Eindruck der Ausweglosigkeit der Situation, der ständig lauernden Todesgefahr und des Todes der Mehrheit der nach Auschwitz Deportierten, nahezu jedem Häftling der Gedanke an Selbstmord kam. Gleichzeitig klammerten sie sich an die Hoffnung, es könne einfach nicht so schlimm sein. Noch konnte sich keiner vorstellen, dass ihnen buchstäblich alles weggenommen wurde, auch Frankl nicht. So versuchte er, sein erst 1941 fertiggestelltes Manuskript der Ärztlichen Seelsorge zu retten und wandte sich dazu an einen "alten" Häftling. Der "beginnt zu verstehen, jawohl: zu Grinsen beginnt er übers ganze Gesicht, erst mehr mitleidig, dann mehr belustigt, spöttisch, höhnisch, bis er mit einer Grimasse mich anbrüllt und meine Frage mit einem einzigen Wort... quittiert... Er brüllt: "Scheiße!" Da weiß ich, wie die Dinge stehen. Ich mache das, was den Höhepunkt dieser ganzen ersten Phase psychologischer Reaktionen darstellt: ich mache einen Strich unter mein ganzes bisheriges Leben."11 Was ihm, was allen in dieser Situation blieb, war die - im wahrsten Sinne des Wortes - nackte Existenz und mit ihr der Galgenhumor und eine die Welt objektivierende und den Menschen distanzierende Stimmung des Zusehens und Abwartens.
Dann kam es allmählich zu einem inneren Absterben: "Leidende, Kranke, Sterbende, Tote - all dies ist ein so geläufiger Anblick nach einigen Wochen Lagerleben, dass es nicht mehr rühren kann."12 Dieses Gleichgültigwerden machte den Häftling bald auch unempfindlich für die Schläge, die ihn selbst trafen; schmerzlich an ihnen war nur noch der Hohn, der sie begleitete. Der Hunger rückte die bloße Lebenserhaltung in den Mittelpunkt des Interesses und führte zu einer radikalen Entwertung all dessen, was dem nicht diente. Diese Entwertung machte noch nicht einmal vor der eigenen Person halt: "Unter der Suggestion einer Umwelt, die vom Wert menschlichen Lebens und der Würde menschlicher Personen schon längst nichts mehr weiß, die vielmehr den Menschen ausschließlich zum willenlosen Objekt einer Ausrottungspolitik gemacht hat, vor deren Endziel sie nur noch eine Ausnützungspolitik der letzten Reste physischer Arbeitsfähigkeit gesetzt hat -, unter dieser allgemeinen Suggestion muss schließlich auch das eigene Ich eine Entwertung erfahren."13 Der Mensch im Konzentrationslager verlor das Gefühl, überhaupt noch Subjekt zu sein. Das ihn beherrschende Gefühl, bloßer Spielball zu sein, ließ ihn jeder Initiative ausweichen und sich vor jeder Entscheidung fürchten. Gleichzeitig war er gereizt - und das nicht nur, weil er hungrig und erschöpft war. Denn die Mehrheit der Häftlinge wurde dazu noch von einer Art Minderwertigkeitsgefühl geplagt; jeder von ihnen war einmal jemand oder glaubte zumindest, jemand gewesen zu sein, im Konzentrationslager aber wurde er so behandelt, als ob er ein Niemand wäre.
Doch die Erfahrung zeigt - und darum ist es Frankl nun vor allem zu tun -, "dass der Mensch sehr wohl anders kann..., dass man die Apathie eben überwinden und die Gereiztheit eben unterdrücken kann; dass also ein Rest von geistiger Freiheit, von freier Einstellung des Ich zur Umwelt auch noch unter dieser scheinbar absoluten Zwangslage, äußeren wie inneren, fortbesteht."14 Das ist der Beweis, "dass man dem Menschen im Konzentrationslager alles nehmen kann, nur nicht die letzte menschliche Freiheit, sich zu den gegebenen Verhältnissen so oder so einzustellen. Und es gab ein 'So oder so'!"15 Das ist der Beweis, dass sich der Mensch für oder gegen den Verfall an jene Mächte entscheiden kann, die ihn dazu verführen wollen, zum bloßen Objekt der äußeren Bedingungen zu werden. Von daher erscheint Frankl die seelische Reaktion der Häftlinge in den Konzentrationslagern denn auch als mehr "als bloßer Ausdruck gewisser leiblicher, seelischer und gesellschaftlicher Bedingungen - mögen sie alle, sowohl der Kalorienmangel der Nahrung als auch das Schlafdefizit und die verschiedensten seelischen 'Komplexe', noch so sehr den Verfall des Menschen an die Gesetzmäßigkeit einer typischen Lagerpsyche gleichsam nahelegen. In letzter Sicht erweist sich das, was mit dem Menschen innerlich geschieht, was das Lager aus ihm als Menschen scheinbar 'macht', als das Ergebnis einer inneren Entscheidung."16
Die Erfahrung zeigt aber auch, dass nur derjenige den Einflüssen des Lagers verfiel, der sich zuvor geistig und menschlich hatte fallen lassen, weil er keinen inneren Halt mehr besaß. Diese Haltlosigkeit zeigt sich in der typischen Redewendung: "Ich hab' ja vom Leben nichts mehr zu erwarten." Denn so spricht nur, wem der Sinn seines Daseins abhanden gekommen ist - weil er die Frage nach dem Sinn des Lebens allein in jener Naivität stellt, die darunter nichts weiter versteht, als schaffend etwas hervorzubringen und so irgendein Ziel zu verwirklichen. Halt gibt freilich nur der Sinn des Lebens in seiner Totalität, "die auch noch den Tod mit einbegreift und so nicht nur den Sinn von 'Leben' gewährleistet, sondern auch den Sinn von Leiden und Sterben."17 Denn Not und Tod machen das menschliche Dasein erst zu einem Ganzen - und das nicht nur im Konzentrationslager.
Frankl schließt daraus, dass es gar nicht darauf ankommt, was wir vom Leben noch zu erwarten haben, sondern darauf, was das Leben von uns erwartet. Und so fordert er zuletzt, dass wir nicht nach dem Sinn des Lebens fragen, sondern uns selbst als die Befragten erleben, an die das Leben Fragen stellt - Fragen, auf die wir nicht mit Worten, sondern nur mit Taten, durch ein entsprechendes Verhalten, die richtige Antwort geben. Denn: "Leben heißt letztlich eben nichts anderes als: Verantwortung tragen für die rechte Beantwortung der Lebensfragen, für die Erfüllung der Aufgaben, die jedem einzelnen das Leben stellt, für die Erfüllung der Forderung der Stunde."18 - "Diese Forderung, und mit ihr der Sinn des Daseins, wechselt von Mensch zu Mensch und von Augenblick und zu Augenblick. Nie kann also der Sinn menschlichen Lebens allgemein angegeben werden, nie lässt sich die Frage nach diesem Sinn allgemein beantworten - das Leben, wie es hier gemeint ist, ist nichts Vages, sondern jeweils etwas Konkretes, und so sind auch die Forderungen des Lebens an uns jeweils ganz konkrete. Diese Konkretheit bringt das Schicksal des Menschen mit sich, das für jeden ein einmaliges und einzigartiges ist. Kein Mensch und kein Schicksal lässt sich mit einem anderen vergleichen; keine Situation wiederholt sich. Und in jeder Situation ist der Mensch zu anderem Verhalten aufgerufen. Bald verlangt seine konkrete Situation von ihm, dass er handle, sein Schicksal also tätig zu gestalten versuche, bald wieder, dass er von einer Gelegenheit Gebrauch mache, erlebend (etwa genießend) Wertmöglichkeiten zu verwirklichen, bald wieder, dass er das Schicksal eben schlicht auf sich nehme. Immer aber ist jede Situation ausgezeichnet durch jene Einmaligkeit und Einzigartigkeit, die jeweils nur eine, eine einzige, eben die 'richtige' Antwort auf die Frage zulässt, die in der konkreten Situation enthalten ist. Sofern nun das konkrete Schicksal dem Menschen ein Leid auferlegt, wird er auch in diesem Leid eine Aufgabe, und ebenfalls eine ganz einmalige Aufgabe, sehen müssen."19
Damit ist Frankl im Kern davon überzeugt, dass der Mensch frei ist - frei nicht von etwas, etwa von den Bedingungen des Konzentrationslagers, unter denen zu leben er gezwungen ist, sondern frei zu etwas - dazu nämlich, sich zu dem Leben unter diesen Bedingungen so oder so zu stellen. Diese Freiheit verbürgt, dass der Mensch sein Leben unter allen Umständen sinnvoll gestalten kann. Denn sinnvoll ist nicht nur ein tätiges Leben, das der Mensch schöpferisch gestaltet. Sinnvoll ist auch nicht nur ein genießendes Leben, in dem der Mensch sich im Kunst- oder Naturerleben erfüllt, "sondern auch noch das Leben behält seinen Sinn, das - wie etwa im Konzentrationslager - kaum eine Chance mehr bietet, schöpferisch oder erlebend Werte zu verwirklichen, vielmehr nur noch eine letzte Möglichkeit zulässt, das Leben sinnvoll zu gestalten, nämlich in der Weise, in der sich der Mensch zu dieser äußerlich erzwungenen Einschränkung seines Daseins einstellt."20 Denn in der Art, wie ein Mensch sein unabwendbares Schicksal auf sich nimmt, entscheidet sich, ob er in diesem bis aufs äußerste zugespitzten Kampf um die Selbsterhaltung die Wertmöglichkeiten, die ihm sein schweres Schicksal bietet, verwirklicht oder verwirkt, und das heißt: ob er seine Menschlichkeit bewahrt oder vergisst. Denn was ist der Mensch? Der Mensch "ist das Wesen, das immer entscheidet, was es ist. Er ist das Wesen, das die Gaskammern erfunden hat; aber zugleich ist er auch das Wesen, das in die Gaskammern gegangen ist aufrecht und ein Gebet auf den Lippen."21
Es überrascht deshalb wohl nicht, dass Frankl mit seiner Einschätzung richtig lag, dieses Buch würde sich nicht recht verkaufen - jedenfalls, was seine österreichische Heimat betrifft. 1946 erschien eine erste Auflage von 3000 Exemplaren in einem Wiener Verlag, doch schon die zweite Auflage blieb liegen. Die Wende kam erst, als das Buch zwölf Jahre später ins Englische übersetzt wurde; allein in den USA erlebte es unter dem Titel, Man's Search for Meaning. An Introduction to Logotherapy, mehr als 50 Auflagen und erschien in mehr als neun Millionen Exemplaren, so dass die Library of Congress es schließlich auf die Liste der zehn einflussreichsten Bücher in den USA setzte.
Die zweite Veröffentlichung Frankls, die an dieser Stelle heranzuziehen ist, ist seine Ärztliche Seelsorge, steht diese doch in einem denkbar engen zeitlichen und inhaltlichen Zusammenhang mit seinem Erlebnisbericht aus dem Konzentrationslager. Zwar hatte Frankl eine erste Fassung dieser Arbeit bereits 1941 fertig gestellt, doch wurde sie ihm in der Desinfektionsbaracke in Auschwitz abgenommen. Von daher beruht der 1946 erschienene Text im Kern auf einer Rekonstruktion, die Frankl Anfang 1945 noch im KZ in 16 Fiebernächten in Angriff nahm - und damit zugleich wesentlich zu seinem Überleben beitrug. Damit beglaubigen sich diese beiden Titel - ...und trotzdem Ja zum Leben sagen und die Ärztliche Seelsorge - gegenseitig. Denn sie zeigen: Frankl lebt, was er lehrt, und er lehrt, was er lebt. Rückblickend urteilt Frankl deshalb sicherlich zu recht: "Damit (mit der Veröffentlichung der Ärztlichen Seelsorge - RS) war die dritte Wiener Richtung, die Logotherapie, auf die Beine gestellt."22
Schon im Buchtitel weist Frankl auf eine seines Erachtens grundlegend veränderte Situation hin, die notwendig zu einer Erweiterung des Horizontes der Psychotherapie führen müsse. So ist er davon überzeugt, dass angesichts der nicht allein von ihm konstatierten "Abwanderung der abendländischen Menschheit vom Seelsorger zum Seelenarzt"23 der Psychotherapie eine Art Statthalterfunktion zuwachse. Denn die Sprechstunde des Arztes sei zu einer Anlaufstelle für alle am Leben Verzweifelnden, an einem Sinn des Lebens Zweifelnden geworden. Ärztliche Seelsorge ist für Frankl damit zugleich Aufgabe jedes Arztes, nicht allein - und noch nicht einmal vor allem - des Neurologen, Psychiaters oder Psychotherapeuten. Vielmehr denkt Frankl hier insbesondere an Internisten, Orthopäden und Dermatologen, die mit chronisch Kranken, lebenslänglich Verkrüppelten bzw. Entstellten zu tun haben - mit Menschen also, "die unter einem nicht mehr gestaltend, sondern nur noch duldend zu bewältigenden Schicksal zu leiden haben."24 Von daher sieht er Logotherapie und Existenzanalyse ausdrücklich nicht als erste, sondern als "letzte Hilfe" und fasst deren Herzstück in die Worte: "Die Existenzanalyse musste den revolutionären und ketzerischen Schritt wagen, nicht nur die Leistungs- und Genussfähigkeit des Menschen sich zum Ziel zu setzen, sondern, darüber hinaus, auch in seiner Leidensfähigkeit eine grundsätzlich mögliche und tatsächlich notwendige Aufgabe zu sehen."25
Im Mittelpunkt der existenzanalytischen Besinnung steht deshalb das Schicksal, stehen deshalb Not und Tod, Leiden und Sterben, und deren Sinn. Dabei geht Frankl auch an dieser Stelle wieder davon aus, dass die Frage nach dem Sinn menschlichen Lebens nur dann recht verstanden wird, wenn der Mensch sie nicht etwa an das Leben stellt, sondern sich selbst als einen vom Leben Befragten erfährt. Denn dann wird klar: Nicht das Leben schuldet dem Menschen eine Antwort auf die Frage, was er wohl vom Leben noch zu erwarten habe, sondern der Mensch hat sein Leben zu verantworten. Er "schuldet" dem Leben seine ganz persönliche Antwort - eine Antwort, die nur er geben kann, die kein anderer für ihn geben kann, und eine Antwort, die nicht in Worten, sondern nur in Taten bestehen kann. Diese Unvertretbarkeit des Menschen sieht Frankl begründet in seiner Endlichkeit. Damit spricht er einerseits den Tod an als ein Wesensmerkmal des menschlichen Lebens, der wesentlich zum Leben dazu gehört - weil er es unumkehrbar, unwiederholbar macht und damit erst den Sinn menschlichen Daseins begründet: Wären wir unsterblich, wäre alles gleich-gültig. Dann käme es auf keinen einzigen Moment unseres Lebens wirklich an; denn dann ließe sich alles ja auch später noch erledigen. So aber, und nur so gilt, was Frankl in eines jener schönen Bilder fasst, mit denen er seine Leser immer wieder überrascht: "der Mensch gleicht einem Bildhauer, der den ungeformten Stein mit Meißel und Hammer so bearbeitet, dass das Material immer mehr an Form gewinnt. Der Mensch wieder verarbeitet den Stoff, den das Schicksal ihm liefert: bald schaffend, bald erlebend oder leidend, versucht er, aus seinem Leben an Werten 'herauszuschlagen', soviel er kann, an schöpferischen oder Erlebniswerten oder Einstellungswerten... (da) ihm für die Fertigstellung seines Kunstwerks eine beschränkte Zeit zur Verfügung gestellt ist, ... ihm aber jener Termin nicht bekanntgegeben wurde, an dem er das Werk wird abliefern müssen... weiß er niemals, wann er 'abberufen' wird, und ob nicht die Abberufung gar im nächsten Augenblick erfolgt. So ist er aber auch gezwungen, auf jeden Fall die Zeit zu nützen - auf die Gefahr hin, dass sein Werk als Torso zurückbleibt. Dass er es nicht vollenden konnte, macht es noch lange nicht wertlos. Der 'Fragmentcharakter' des Lebens (...) tut dem Sinn des Lebens keinen Abbruch."26
Diese im letzten optimistische Sicht versteht nur, wer sich mit Frankl auf eine Sicht der Vergangenheit als eines Vergangen-Seins einlässt. Frankl versteht darunter die sicherste Art von Sein - und menschliches Tun und Lassen von daher als ein "Hineinretten des Möglichen in die Wirklichkeit". So sind diese Taten und Unterlassungen einerseits vergangen, andererseits aber - in der Vergangenheit - für alle Ewigkeit in Sicherheit gebracht. Was vergeht, ist allein die Zeit, während das in ihr Geschehene unantastbar und unverletzlich ist. Und wieder fasst Frankl auch diese Überlegungen in ein Bild. Er schreibt: "Wollten wir aber versuchen, es im Gleichnis auszudrücken, dann könnten wir sagen: Der Pessimist gleicht einem Manne, der vor einem Wandkalender steht und mit Furcht und Trauer sieht, wie der Kalender - von dem er täglich je ein Blatt abreißt - immer schmächtiger und schmächtiger wird; während ein Mensch, der das Leben im Sinne des oben Gesagten auffassen würde, einem Manne gliche, der das Blatt, das er soeben vom Abreißkalender entfernt hat, fein säuberlich und behutsam zu den übrigen, schon früher abgerissenen legt, nicht ohne auf der Rückseite des Blattes eine tagebuchmäßige Notiz zu machen und nun, voll Stolz und Freude, dessen zu gedenken, was da alles in diesen Notizen festgelegt ist - was da alles in seinem Leben 'festgelebt' wurde. Was ist's, wenn dieser Mensch merkte, wie er altert? Sollte er - könnte er deshalb mit neidvollem Herzen auf die Jugend anderer Menschen oder mit wehmütigem auf die eigene blicken? Um was sollte er einen jungen Menschen denn beneiden - so wird er sich vielmehr denken müssen -, vielleicht um die Möglichkeiten, die ein junger Mensch noch hat, um dessen Zukunft? 'Danke schön', wird er sich denken, 'ich habe statt dessen Wirklichkeiten - in meiner Vergangenheit; nicht nur die Wirklichkeit der gewirkten Werke, sondern auch der geliebten Liebe und auch noch die der gelittenen Leiden. Und auf die bin ich am meisten stolz - mag ich auch um sie am wenigsten beneidet werden..."27 Denn auch und gerade das Leiden hat seinen Sinn. Wer unter diesem oder jenem leidet, der leidet, weil er es nicht leiden mag - weil er es nicht gelten lässt. Im Leiden setzt er sich damit auseinander, rückt innerlich davon ab, schafft Distanz zwischen seiner Person und dem, worunter er leidet. Leiden bewahrt ihn somit vor der Apathie, vor der seelischen Totenstarre. Solange er leidet, bleibt er lebendig, reift und wächst und erkennt, dass Endlichkeit nicht Sinnlosigkeit bedeutet.
Logotherapie und Existenzanalyse thematisieren die Endlichkeit des Menschen aber nicht nur im Sinne der Einmaligkeit menschlichen Daseins in seiner Zeitlichkeit, im Sinne seiner äußeren Beschränkung, sondern auch im Sinne der Einzigartigkeit jedes Menschen, im Sinne seiner inneren Beschränkung. Denn auch sie macht das Leben des Menschen nicht sinnlos; im Gegenteil, gerade sie gibt ihm Sinn. "Wären alle Menschen vollkommen, dann wären alle einander gleich, jeder einzelne durch jeden beliebigen Vertreter also ersetzlich. Gerade aus der Unvollkommenheit des Menschen folgt aber die Unentbehrlichkeit und Unaustauschbarkeit jedes Einzelnen; denn der Einzelne ist zwar unvollkommen, aber jeder ist es in seiner Art. Der Einzelne ist nicht allseitig, dafür einseitig und dadurch einzigartig."28