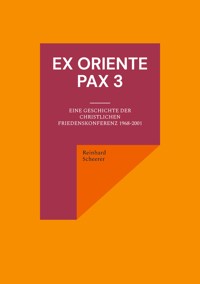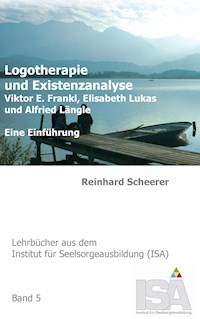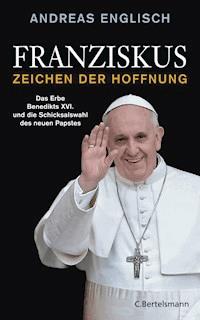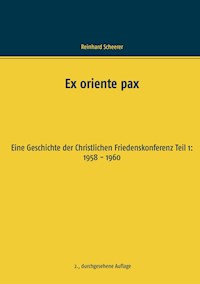
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Gegenstand dieser auf drei Bände angelegten Arbeit ist die Christliche Friedenskonferenz (CFK), die 1958 in Prag gegründet wurde. In diesem ersten Band geht es um die Hoffnung der Kommunisten, die Christen möchten vor der Kraft des Atheismus kapitulieren, und um die Hoffnung von Christen, die Kommunisten möchten von ihrem vermeintlich wissenschaftlichen Atheismus lassen - jeweils im Ergebis ihres gemeinsamen Friedenskampfes. Da geht es um die Appelle Linus Paulings und Albert Schweitzers, auf Atombombenexplosionen zu Versuchszwecken zu verzichten und atomar abzurüsten - und um die Haltung der Evangelischen Kirche in Deutschland zu den Bemühungen der christdemokratisch geführten Bundesregierung um Wiederbewaffnung und Ausrüstung der Bundeswehr mit atomaren Waffen. Da geht es um die die Gründung der CFK vorbereitenden Konferenzen tschechoslowakischer Kirchenarbeiter 1957 in Modra und in Prag, um das "Experiment" CFK, das meint die drei christlichen Friedenskonferenzen 1958, 1959 und 1960 - und um die theologischen Positionen Josef L. Hromádkas, der als der geistige und geistliche Vater der CFK zu gelten hat. Vor allem ihm (aber auch Männern und Frauen wie Emil Fuchs, Hans-Joachim Iwand, Renate Riemeck, Werner Schmauch und Richard K. Ullmann) ist es zu danken, dass der Christlichen Friedenskonferenz stets klar war, dass diese Welt nicht aus Engeln und Teufeln, sondern aus Menschen besteht; dass wir, wo es um Gut und Böse, um Recht und Unrecht, um Leben und Tod geht, alle auf derselben Seite stehen; und dass wir nicht in Sicherheit voreinander, sondern nur im Frieden miteinander eine Zukunft haben. Die Erinnerung daran scheint um so dringlicher, als die Fragen, die die CFK Ende der 1950er Jahre auf den Plan riefen, noch immer aktuell sind. Da ist der kalte Krieg, der unter dem Namen hybrid warfare den Systemgegensatz überdauert hat; da sind die Massenvernichtungsmittel und die mit ihnen gegebene Möglichkeit, alles Leben auf dieser Erde auszulöschen; und da ist der ungebrochene Anspruch der traditionell sich als christlich verstehenden Völker, die Welt nach ihrem Bild zu formen und ihren Interessen dienstbar zu machen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 601
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Esther
Inhaltsverzeichnis
Teil 1 – Hintergrund und Vorgeschichte
Einleitung
Der Hintergrund
Die Vorgeschichte
Die andere Sicht
Die Prager Theologie
Zur Theologie J. L. Hromádkas
An der Schwelle des Dialogs
Teil 2 – Das Experiment
Das Experiment
Der Geist von Prag
Die atomare Bedrohung der Welt
Der Kalte Krieg als theologisches Problem
Tagespolitik?
Die Junge Christliche Friedenskonferenz
Dokumente
Literaturverzeichnis
Einleitung
Gegenstand dieser Arbeit ist die Christliche Friedenskonferenz (CFK), eine Bewegung, die einmal als die ökumenische B-Mannschaft galt, und die 1958 in Prag gegründet wurde. Schon dies war für den Berlin-brandenburgischen Bischof und Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Otto Dibelius, Beweis genug für deren theologische und politische Unlauterkeit. Es überrascht deshalb nicht, dass er seinen Pfarrern die Teilnahme daran untersagte. Und es überrascht auch nicht, dass es der CFK nicht gelang, sich aus eigener Kraft in den Gemeinden bekannt zu machen; das besorgten unter anderen die Moralische Aufrüstung (Moral Re-Armament, MRA) und das Internationale Comité zur Verteidigung der christlichen Kultur, aber auch der westdeutsche Verfassungsschutz - im Geiste des Kalten Krieges, der Brückenorganisationen nicht schätzt, sondern in ihnen vorzugsweise Brückenköpfe des Feindes sieht. Und das besorgten im Zuge einer so genannten Aufarbeitung der Stasi-Belastung insbesondere der evangelischen Kirchen in den ehemaligen Ostblockstaaten all jene, die in den Mitarbeitern der CFK von Kommunisten eingesetzte Kirchenführer-Marionetten, naive fellow travellers oder Schlimmeres zu erkennen meinten. Im Westen ist die Christliche Friedenskonferenz deshalb immer eine Randerscheinung geblieben.
Wer jedoch über eine Fußnote der kirchlichen Zeitgeschichte eine größere Arbeit schreiben will, der muss sich erklären. Zumal dann, wenn unter den Älteren viele ihre Vorbehalte gegen sie haben und unter den Jüngeren kaum eine/r mehr weiß, um was es da geht. Zwei Gründe sind es, die mich dazu bewogen haben: Zum einen ist mir die Christliche Friedenskonferenz, sind mir vor allem der Westberliner Regionalausschuss der CFK und das Hendrik Kraemer Haus, in dem der Regionalausschuss zuhause war, gut anderthalb Jahrzehnte geistliche Heimat gewesen. (Kontakte zur internationalen CFK sind erst 1988, anlässlich ihres dreißigjährigen Bestehens, entstanden.) Dort habe ich schon als Student der Theologie meine ersten ökumenischen Erfahrungen gemacht, dort habe ich meine ersten theologischen Gehversuche unternommen. Dort habe ich auch den nötigen Rückhalt gefunden, als mich meine Kirche vor die Alternative stellte: Vikariat oder Mitarbeit in der CFK. Und als meine Bemühungen, mich zu habilitieren, gleichfalls an meinem Engagement in der CFK scheiterten. „Dann kann ich nichts für sie tun“, habe ich mehr als einmal von einem möglichen Gutachter gehört. Wenn ich diese Erfahrungen seinerzeit machen konnte, ohne darüber zu verbittern, dann wegen der Gemeinschaft, die mich dort trug. Und wenn ich heute diese Arbeit schreibe, dann nicht zuletzt deshalb, weil ich damit eine Dankesschuld abtragen will.
Zum anderen möchte ich an eine Bewegung erinnern, die in beispielhafter Weise darauf verzichtete, Sünde und Fehlbarkeit nur im privaten Leben zu bekennen, das politische Leben und die politische Verantwortung aber davon auszunehmen. Das erscheint mir um so dringlicher, als die Fragen, die die CFK Ende der 1950er Jahre auf den Plan riefen, noch immer aktuell sind. Da ist der Kalte Krieg, der unter dem Namen hybrid warfare den Systemgegensatz überdauert hat; da sind die Massenvernichtungsmittel und die mit ihnen gegebene Möglichkeit, alles Leben auf dieser Erde auszulöschen, die wir schlicht verdrängt haben; und da ist der ungebrochene Anspruch der traditionell sich als christlich verstehenden Völker, die Welt nach ihrem Bild zu formen und ihren Interessen dienstbar zu machen.
Hinzu kommt der von den politischen Eliten dieser Völker beklagte so genannte Rechtspopulismus, das ist die Übertragung dieser Identitätspolitik von der internationalen auf die nationale Ebene. Hinzu kommt aber auch, dass die dadurch hervorgerufenen Auseinandersetzungen (wie schon der Kampf zwischen Kapitalismus und Sozialismus) alle Merkmale eines Religionskrieges aufweisen. So werden der „Kampf gegen den Terror“ als Ersatz für die rote Gefahr beschworen und der militärische Schutz deutscher Interessen beispielsweise am Hindukusch als Übernahme von Verantwortung beworben. Und die Kirchen schweigen dazu, sei es, weil sie fürchten, durch wesentlich von den Selbstverständlichkeiten bundesdeutscher Politik abweichende Positionen an Einfluss zu verlieren, sei es, weil sie davon ausgehen, dass sich ihre Botschaft im Falle eines solchen Konflikts ohnehin als wirkungslos erweisen wird.
Die CFK ist dieses Risiko eingegangen. Denn ihr war klar, dass diese Welt nicht aus Engeln und Teufeln, sondern aus Menschen besteht; dass wir, wo es um Gut und Böse, um Recht und Unrecht, um Leben und Tod geht, alle auf derselben Seite stehen; und dass wir nicht in Sicherheit voreinander, sondern nur im Frieden miteinander eine Zukunft haben. So klein ihr Beitrag auch gewesen sein mag, sie hat damit dazu beigetragen, dass wir die Selbstvernichtung der Menschheit immer noch vor uns haben. Allerdings sind die Möglichkeiten dazu seither deutlicher größer geworden. Neben einem Atomkrieg kommen dafür jetzt auch die Folgen eines ungezügelten Wachstums in Frage. In den letzten Jahren ihrer Existenz hat sich die Christliche Friedenskonferenz deshalb auch damit befasst, dass sowohl Sozialismus als auch Kapitalismus materialistische Utopien sind, die konkurrierende Versionen eines irdischen Paradieses anbieten - und dass der Sozialismus die natürliche Umwelt nicht weniger belastete als der Kapitalismus. Aber zumindest versprach er, die irdischen Güter zu teilen, während der Kapitalismus darauf beharrt, dass das ökonomische Potential unendlich und Teilen daher irrelevant sei. Die Folgen sind beachtlich: Jeden Tag sterben 25.000 Menschen allein an verseuchtem Wasser. Jedes Jahr bleiben 20 Millionen Kinder aufgrund von Unterernährung geistig zurück. Und das ist nicht mehr alles. Anders als in der Vergangenheit, in der nur die Armen betroffen waren, ist es heute die ganze Menschheit. Denn, so Ronald Wright: „Wenn die Zivilisation überleben soll, muss sie von den Zinsen, nicht vom Kapital der Natur leben. Ökologische Daten sprechen dafür, dass die Menschheit Anfang der sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts rund 70 Prozent des jährlichen Ertrags der Natur verbraucht hat. Anfang der achtziger Jahre hatten wir 100 Prozent erreicht, und 1999 waren wir bei 125 Prozent angekommen. Solche Schätzungen mögen unpräzise sein, doch ihr Trend ist klar - sie weisen den Weg in den Bankrott.“1
Nun lässt Gottes Wort keinen Zweifel daran, dass dieser Himmel und diese Erde vergehen werden. Aber es macht ebenso deutlich, dass wir diesen Untergang nicht in eigener Regie heraufführen dürfen; das göttliche Gebot, die Erde zu bebauen und zu bewahren (1 Mo 1,28), bleibt in Geltung. Und das Gebot, Hüter unserer Geschwister zu sein, auch. Doch fehlt es auch heute wieder - wie 1958, als die CFK gegründet wurde - an unbequemen Mahnern, die eben daran erinnern und sich dabei nicht darauf beschränken, die Gewissen zu schärfen - die nicht ängstlich die Ebene meiden, auf der die Entscheidungen fallen, sondern beispielsweise darauf hinweisen: Wer für die Opfer des Krieges im Jemen sammelt, ohne sich gleichzeitig gegen den Export von Ersatzteilen für die saudische Bomberflotte zu stemmen, die diese Opfer schafft; wer für die Hungernden in der Welt sammelt, ohne sich gleichzeitig gegen die Lebensmittelspekulation zu stemmen, der mag zwar sein Gewissen beruhigen. Aber seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen wird er gerade nicht gerecht. Es überrascht deshalb sicher nicht, wenn sich diese Arbeit zuletzt auch der Hoffnung verdankt, es möchten wieder solch unbequeme Mahner entstehen.
Inhaltlich setzt diese Arbeit bei der Frage ein, warum sich die regierenden kommunistischen und Arbeiterparteien in den sozialistischen Ländern in den 1950er Jahren bereit fanden, eine christliche Friedenskonferenz nicht nur zu dulden, sondern in Teilen sogar zu unterstützen, obwohl sie die weltanschauliche Gleichberechtigung der christlichen Kirchen verneinten und ihrem als schädlich erachteten Einfluss durch administrative Maßnahmen Einhalt zu gebieten suchten. Sie vergegenwärtigt sodann die Auseinandersetzungen in jenen Jahren um die fortgesetzten Atombombenexplosionen zu Versuchszwecken, um die Bemühungen der Regierung Adenauer um eine Wiederbewaffnung Westdeutschlands und, im Zusammenhang damit, um die Ausrüstung der Bundeswehr mit Atomwaffen, und um die Vorschläge des polnischen Außenministers Rapacki zur Schaffung atomwaffenfreier Zonen in Europa. Besonderes Gewicht legt sie dabei auf die Initiativen Linus Paulings und Albert Schweitzers wie auf das Echo, das diese Initiativen nicht zuletzt in dem von 18 deutschen Atomphysikern unterschriebenen Göttinger Appell in Westdeutschland fanden. Zugleich würdigt sie die Rolle der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) in dieser Auseinandersetzung als integrierender und integrierter Faktor Adenauerscher Politik und als fester Größe im westlichen Lager.
Ist damit der Hintergrund ausgeleuchtet, vor dem allein die Gründung der CFK verständlich wird, wendet sich diese Arbeit der Vorgeschichte der Christlichen Friedenskonferenz zu. Sie thematisiert die beiden Konferenzen in Modra im Juli und in Prag im Dezember 1957, auf denen die protestantischen theologischen Fakultäten und die sie tragenden Kirchen in der Tschechoslowakei im Anschluss an den Appell Albert Schweitzers und in Aufnahme der Rede Dietrich Bonhoeffers auf der Jugendkonferenz des Weltbundes für Freundschaftsarbeit der Kirchen im August 1934 ein ökumenisches Konzil forderten, das sich mit dem Problem von Frieden und Krieg befassen und die Frage des Gebrauchs von Massenvernichtungsmitteln entscheiden sollte.
Die Diskussion einer alternativen Sicht schließt sich an, derzufolge es sich bei diesen Konferenzen (wie bei der dort in Aussicht genommenen christlichen Friedenskonferenz) um eine Initiative des tschechoslowakischen Staatsamtes für Kirchenfragen handele mit dem Ziel, nach der sowjetischen Militärintervention in Ungarn 1956 erneut in die Offensive zu gehen. Diese Sicht berührt sich mit den im Zuge der so genannten Aufarbeitung der Stasi-Belastung der evangelischen Kirchen erhobenen Vorwürfen; beide gründen in der Reduktion der CFK auf ihre politische Wirkung und darin in der kritiklosen Übernahme ihrer Einschätzung durch die Staatsämter für Kirchenfragen der sozialistischen Länder und durch die „tschekistische Internationale“.
Mit besonderem Interesse wendet sich diese Arbeit deshalb der Prager Theologie und dem sie lange Jahre prägenden Prager Systematiker Josef L. Hromádka zu. Sie tut dies im Gespräch sowohl mit seinen Kritikern als auch mit seinen Weggefährten. Am Ende dieser Untersuchung wird das Spannungsfeld deutlich, in dem sich die Arbeit der Christlichen Friedenskonferenz von Anfang an vollziehen sollte: Erwarteten die Kommunisten, dass sich die Christen durch ihre Teilnahme am Friedenskampf allmählich zu einer Kapitulation vor der Kraft des Atheismus verstehen könnten, hofften die Christen darauf, dass ihre Arbeit in der CFK die Kommunisten davon überzeugen werde, ihrerseits von einem vermeintlich wissenschaftlichen Atheismus zu lassen.
Ein Blick auf das „Experiment“ CFK (Josef L. Hromádka) schließt sich an. Das sind die drei Christlichen Friedenskonferenzen, die im Juni 1958, im April 1959 und im September 1960 in Prag stattfanden; sie wurden zusammengehalten durch ihre Ausrichtung auf ein ökumenisches Friedenskonzil und können von daher charakterisiert werden als Vorbereitungstreffen für eine „allchristliche Friedensversammlung“. Ihre Darstellung entspricht einer Forderung, die die CFK im Interesse einer Überwindung des kalten Krieges (und erst recht des kalten Kirchenkrieges als der giftigsten Gestalt des kalten Krieges) immer wieder erhoben hat: Sie nimmt die Dokumente der CFK beim Wort. Und sie nimmt ihre Verfasser ernst, die nach eigenem Bekunden nicht als Politiker und Diplomaten, sondern als Zeugen und Seelsorger in und mit der CFK tätig waren. Denn: Sie haben sich zwar immer wieder auch zu politischen Fragen geäußert und sind deswegen ebenso regelmäßig von der einen Seite gelobt und von der anderen getadelt worden. Aber es ist ihnen immer wieder gelungen, sich weder von dem einen noch von dem anderen bestimmen zu lassen und weder das Lob zu suchen noch den Tadel zu fürchten, sondern in der Freiheit der Kinder Gottes beisammen zu bleiben und das Gespräch über den Eisernen beziehungsweise über den Goldenen Vorhang hinweg nicht abreißen zu lassen.
Das ist nicht immer so geblieben; davon ist an anderer Stelle zu reden. Es überrascht deshalb nicht, dass schon dieses Beisammensein ein spannungsgeladenes war, ja, dass diese Spannungen die CFK mehr als einmal fast zerrissen hätten. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: (1) Wer sich zur Mitarbeit in der Christlichen Friedenskonferenz entschloss, der wollte im Westen, in der Regel in einem von einer christdemokratischen Partei geführten Land, als Christ erkennbar bleiben. Weil er sich in einer in einem sozialistischen Land beheimateten Organisation engagierte, weil er es wagte, das Wort „Frieden“ in den Mund zu nehmen, wurde er, zumal in Westdeutschland, bestenfalls als Kommunistenfreund abgestempelt - wie die 1960 in Stuttgart gegründete Deutsche Friedens-Union, deren Mitglieder als „Deutsche Freunde Ulbrichts“ geschmäht wurden. Der wurde observiert, wie das Beispiel des Geschäftsführers der Gesamtdeutschen Volkspartei (GVP), Arnold Haumann, zeigt. Und der wurde gegebenenfalls auch politisch verfolgt wie die sechs Mitglieder des Friedenskomitees der Bundesrepublik Deutschland, die im April 1960 von einer Staatsschutzkammer des Landgerichts Düsseldorf wegen Rädelsführerschaft in einer verfassungsfeindlichen Vereinigung verurteilt wurden. Dieser Prozess stellte auch einen Angriff auf die im Horizont der CFK vertretenen theologischen Positionen dar. Zeugen der Verteidigung in diesem Verfahren waren deshalb unter anderen auch Martin Niemöller, Josef L. Hromádka und Hans Joachim Iwand2. Mitarbeiter der CFK im Westen sahen sich deshalb oftmals genötigt, beispielsweise darauf abzuheben, dass im Osten etwa Kinder von Akademikern, und hier vor allem Pastorenkinder, nicht studieren durften. Dass gleichzeitig Arbeiter- und Bauernkinder, die im Westen nie davon hätten träumen können, eben diese Chance bekamen, war demgegenüber ohne Belang. Zugleich waren sie versucht, die Brüder im Osten zu beschuldigen, sich weder für Benachteiligte noch für zu Unrecht Verfolgte einzusetzen; selbst Hromádka musste sich immer wieder gegen den Vorwurf wehren, so ein „stummer Hund“ zu sein - und das nicht nur in den Gremien des ÖRK, sondern auch in denen der CFK.
(2) Wer sich im Osten zur Mitarbeit in der Christlichen Friedenskonferenz entschloss, der wollte zumeist als Christ erkennbar werden. Er war deshalb gehalten, zu zeigen, dass die Kirche Jesu Christi mehr ist als eine Agentur der Bourgeoisie, und der christliche Glaube mehr als bürgerliche Ideologie. Dazu brauchte es freilich einen „Erweis der Kraft“ (Emil Fuchs) auf dem Gebiet, auf dem die Kommunisten dafür offen waren: in jenem „Friedenskampf“, der ein Sich-Einlassen auf den Sozialismus, ein Mit-Tun beim Aufbau des Sozialismus einschloss. Das schloss eine Kritik am Osten zwar nicht aus, beschränkte diese jedoch auf eine immanente Kritik.
(3) Wer sich zur Mitarbeit in der Christlichen Friedenskonferenz entschloss, weil er ein anderes, besseres Modell der Friedenssicherung als das militärische befürwortete, der war genötigt, das Bedrohungsszenario zu teilen, das sein Umfeld prägte, wenn er überzeugen wollte. Im Westen konnte er deshalb kein sowjetisches Sicherheitsbedürfnis erkennen, vielmehr sah er die sowjetische Außenpolitik als Fortsetzung der zaristischen Westexpansion. Und im Osten begriff er containment und roll back als Ausdruck der Welteroberungspläne des Imperialismus und als Neuauflage aller bislang gescheiterten Versuche, die Sowjetunion zu zerschlagen und Russland aus Europa herauszuhalten. Wenn es trotzdem immer wieder gelang, miteinander im Gespräch zu bleiben, dann deshalb, weil diese Gegensätze eingebettet waren in die theologische Besinnung, und weil das gemeinsame Hören auf das Zeugnis der Schrift moderiert wurde von Brüdern, die sich weder darum sorgten, als Christen erkennbar zu bleiben, noch darum, als Christen erkennbar zu werden, sondern die sich im Vertrauen auf ihren Herrn darauf beschränkten, ihren Glauben zu leben. Und die deshalb von der Schuld der anderen stets an die eigene Schuld erinnert und von dem Recht der eigenen Seite stets an das Recht der anderen Seite gemahnt wurden.
Kernthema dieses Experiments war ein konsequenter Atompazifismus, zu dem sich 1983 in Vancouver auch die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen durchrang, und zu dem sich selbst der Internationale Gerichtshof in einem von der UN-Vollversammlung eingeholten Rechtsgutachten vom 8. Juli 1996 bekannte, als er urteilte, nicht erst der Einsatz, sondern bereits die Drohung mit der Atombombe verstoße gegen die Prinzipien und Regeln des humanitären Kriegs-Völkerrechts. Und Hauptforderung dieses Experiments war (neben der Überwindung des Kalten Krieges) die Ächtung der Massenvernichtungsmittel, namentlich der Atom“waffen“. Dazu ist es jedoch erst 2017 - 60 Jahre nach der Gründung, 30 Jahre nach dem Auseinanderfallen der CFK - mit der Verleihung des Friedensnobelpreises an die Internationale Kampagne für ein Atomwaffenverbot (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) und mit dem UN-Atomwaffenverbotsvertrag gekommen, wenn auch vorerst nur ansatzweise: die Regierungen Frankreichs, Großbritanniens, der Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China haben die o. g. Verleihung des Friedensnobelpreises boykottiert, und die offiziellen und die de facto Atommächte haben diesen Vertrag bislang ebenso wenig unterschrieben wie die NATO-Staaten.
Daneben schienen Themen auf, die die Christliche Friedenskonferenz in den kommenden Jahren beschäftigen sollten - so zum Beispiel die chinesische und die deutsche Frage, aber auch der politische Katholizismus oder der Friede zwischen den Generationen. Letzteres wurde wenig überraschend von der Jungen Christlichen Friedenskonferenz ins Gespräch gebracht, die im September 1960 im Anschluss an die 3. CFK tagte. Darum und um manch anderes wird es in einem zweiten Band dieser Geschichte der Christlichen Friedenskonferenz gehen; er wird ihren Weg in den Prager Frühling nachzeichnen, aber auch den Einmarsch von Truppen des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei bedenken und mit dem Tod ihres Präsidenten Josef L. Hromádka im Dezember 1969 enden. Ein dritter und letzter Band soll dann das Auseinanderfallen der CFK zwischen 1969 und 1971, ihre Neukonstituierung mit der IV. Allchristlichen Friedensversammlung Ende September, Anfang Oktober 1971 und ihre weitere Tätigkeit bis zu ihrer Auflösung Anfang der 1990er Jahre nachzeichnen.
Zuletzt bedanke ich mich bei allen, die die Entstehung dieses Buches begleitet haben. Mein besonderer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtbücherei Kaltenkirchen; ohne deren tatkräftige Unterstützung hätte ich diese Arbeit nicht schreiben können.
1 Ronald Wright, Eine kurze Geschichte des Fortschritts. Reinbek b. Hamburg: Rowohlt 2012 (2. Auflage), S. 137 - Vergleiche dazu auch Meinhard Miegel, Hybris. Die überforderte Gesellschaft. Berlin: Propyläen 2014 (2. Auflage), S. 164f.: „Zu unterschiedlichen Graden wirtschaften heute große Teile der Menschheit weit außerhalb dessen, was die Erde zu geben vermag, haben also nicht genug Wissen und Können, um ohne nachhaltige Schäden der Erde so viel abzuverlangen, wie sie es tun. Dabei treiben es die entwickelten Länder am tollsten, soll heißen: Nirgendwo ist der Abstand zwischen Wissen und Können auf der einen und der Beanspruchung irdischer Ressourcen und Ökosysteme auf der anderen Seite so groß wie hier. Wirtschaftete die Weltbevölkerung so wie die Nordamerikaner, aber auch einige europäische Völker, bräuchte sie hierfür vier Globen.“
2 Zum Prozessverlauf siehe Rüdiger Lang, Der Düsseldorfer Prozess, in: Stimme der Gemeinde XII (1960), Sp. 313-318. 341-346. 373378. 409-412. Zur Prozessführung siehe Heinrich Riebel, Zum Prozess gegen das Friedenskomitee, in: Junge Kirche XXI (1960), S. 253-254
Der Hintergrund
Die Christliche Friedenskonferenz war eine in einem Land des real existierenden Sozialismus beheimatete Organisation. Sie konnte nur entstehen, konnte nur bestehen im Einvernehmen mit Partei und Staat - und das meint in letzter Instanz: im Einvernehmen mit der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) und der UdSSR, auch wenn diese zunächst ihren tschechischen und nach 1968 ihren ungarischen Genossen so etwas wie ein Patronat über die CFK einräumten.
I
Eine Darstellung der CFK-Geschichte beginnt deshalb zweckmäßigerweise mit dem XX. Parteitag der KPdSU 1956. Denn hier entwickelte Nikita Sergejewitsch Chruschtschow auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges das Konzept der friedlichen Koexistenz von Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung. Anders als Lenin, der in der Epoche des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus mittelfristig kriegerische Auseinandersetzungen mit kapitalistischen Staaten für unvermeidlich hielt, orientierte Chruschtschow damit auf den friedlichen Wettbewerb zwischen Sozialismus und Kapitalismus unter Ausschluss militärischer Mittel: „Friedliche Koexistenz bedeutet die Regelung der zwischenstaatlichen Beziehungen von sozialistischen und kapitalistischen Staaten auf der Grundlage der Gleichberechtigung der Staaten, der gegenseitigen Achtung ihrer Souveränität, der territorialen Integrität, der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten des anderen Staates. F(riedliche) K(oexistenz) bedeutet Entwicklung ökonomischer, wissenschaftlicher und kultureller internationaler Zusammenarbeit auf der Grundlage des gegenseitigen Vorteils und die Lösung strittiger internationaler Fragen mit friedlichen Mitteln.“3 Dieses Konzept sei alles andere als defensiv gemeint. Es bedeute weder das Ende des Klassenkampfes um die soziale Befreiung der Ausgebeuteten noch des nationalen Befreiungskampfes der Unterdrückten, und auch nicht den Verzicht auf deren Unterstützung durch die sozialistischen Länder. Gleichwohl löste Chruschtschow am 17. April 1956 das wohl deutlichste Zeichen dieser Unterstützung, das Kommunistische Informationsbüro (Kominform), auf.
Vor allem aber unterbreitete er Abrüstungsvorschläge. So warb er namentlich für die vollständige atomare Abrüstung, schlug, als er damit bei den übrigen Atommächten keine Resonanz fand, zumindest einen Atomteststopp vor, legte aber auch Vorschläge für eine konventionelle Abrüstung vor, so zum Beispiel für den Abzug aller fremden Truppen aus Europa. Und er unterlegte diese Vorschläge immer wieder mit einseitigen Schritten der UdSSR, beispielsweise mit einem befristeten Stopp sowjetischer Atomexplosionen, in der erklärten Hoffnung, dieses Beispiel möge Schule machen. Nun ist hier nicht der Ort, diese Vorschläge4 im einzelnen zu diskutieren. Das würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Hier kann es nur um die Begründung gehen, die Chruschtschow für diese Aktionen gab, und um die Mühe, die er sich machte, diese Begründung zu kommunizieren. So betonte er nicht nur: „Der Kampf für den Frieden ist die Hauptgrundlage unserer Außenpolitik.“5 Sondern er nannte dafür auch zwei Beweggründe, einen praktischen und einen weltanschaulichen: (1) Die UdSSR brauche den Frieden für den erfolgreichen Aufbau des Kommunismus, und (2) Die sowjetischen Politiker seien der Ansicht, dass es nichts gebe, was wertvoller sei als der Mensch, und darum setzten sie alles daran, die Gefahr eines neuen Blutbades von der Menschheit abzuwenden. Der Kalte Krieg sei für ihn, Chruschtschow, deshalb „sowohl materiell als auch moralisch eine Last.“6 Diese Aussage Chruschtschows ist unbedingt glaubhaft. Sie ist es seit dem Ende der UdSSR um so mehr, als deren weltanschauliche und machtpolitische Gegner seither selbst darauf hinweisen, dass das Ende der UdSSR durch deren materielle Überforderung durch das ihr im Kalten Krieg aufgenötigte Wettrüsten zumindest mitverursacht wurde.
Dem entspricht, dass schon der Kalte Krieg der UdSSR aufgenötigt wurde. So äußerte Chruschtschow in seiner Rede auf der Tagung des Politischen Beratenden Ausschusses des Warschauer Vertrages am 24. Mai 1958: „Während des zweiten Weltkriegs bestand bekanntlich zwischen der Sowjetunion, den Vereinigten Staaten von Amerika, England und den anderen Staaten der Antihitlerkoalition eine enge Zusammenarbeit. Wenn an die Stelle dieser Zusammenarbeit Beziehungen des Argwohns, der Entfremdung und sogar einer gewissen Feindseligkeit getreten sind, so ist das gegen den Willen der Sowjetunion geschehen. Der Regierung der Vereinigten Staaten, und nicht nur ihr, geht eine Freundschaft mit Staaten, die ein anderes soziales und ökonomisches System als die USA haben, offenbar wider den Strich.“7 Denn, so Chruschtschow an anderer Stelle: „Die Imperialisten sind in großer Liebe zu den Völkern der sozialistischen Länder und in dem Wunsch entflammt, sie aus der kommunistischen 'Sklaverei' zu 'befreien'. Wovon wollen sie uns alle 'befreien', Genossen? Sie wollen die Arbeiter von den Werken und Fabriken befreien, um sie aus den Händen des Volkes in die Hände der Imperialisten zu übergeben. Sie wollen die Bauern vom Land befreien und es in den Besitz der Gutsbesitzer, der Landmagnaten überführen. Sie wollen das Volk von dem Recht befreien, seine, des Volkes Regierung frei zu wählen und die Menschen wieder dazu zwingen, für jene zu stimmen, die den Willen der Kapitalisten gehorsam erfüllen.“8
Hinzu kam das jahrhundertealte Bestreben zunächst der westeuropäischen Mächte, Russland aus Europa herauszuhalten. So wollten England und Frankreich bereits den ersten Krimkrieg 1854/56 als Konfrontation zwischen Ost und West verstanden wissen. Dieser geopolitische Konflikt wurde mit der Russischen Revolution lediglich durch eine ideologische Komponente ergänzt. So intervenierten England, Frankreich, die USA und Japan 1919 in Russland auf Seiten der antibolschewistischen Truppen militärisch; so schufen die Alliierten im Ergebnis des ersten Weltkrieges im gleichen Jahr den so genannten cordon sanitaire - einen aus den baltischen Staaten, Polen, der Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien und Jugoslawien bestehenden Sicherheitsgürtel westlich orientierter Staaten, der Europa vor dem Kommunismus und der Sowjetunion schützen sollte; und so wurden diese Staaten nach dem Ende der UdSSR im Zuge einer „heillosen Ost-Expansion“ (Peter Scholl-Latour) von Europäischer Union und NATO in das westliche Bündnissystem integriert. Von daher erweist sich die Antihitlerkoalition aus westlicher Sicht als ein unnatürliches Bündnis - und der Bruch zwischen den Alliierten 1944/45 „schlicht als absehbare Rückkehr zu gewohnten Sichtweisen“ (Bernd Stöver): Nicht von ungefähr wurden die Landesverratsbestimmungen in den USA bereits während des Krieges weit häufiger gegen Kommunisten und kommunistische Bestrebungen als gegen Nationalsozialisten angewandt.
Das hinderte Chruschtschow jedoch nicht, speziell den USA freundschaftliche Beziehungen anzubieten. So äußerte er während seines Besuchs 1959 in den USA: „Wir strecken Ihnen die Freundschaftshand entgegen. Wenn Sie sie nicht annehmen wollen - sagen Sie es frei und offen.“9 Doch rechnete er nicht mit einer schnellen Antwort; zu groß schienen ihm die Vorbehalte, die ihm entgegenschlugen. Denn, so noch einmal Chruschtschow wörtlich: „Ich sehe, dass die Amerikaner vor dem Kommunismus Angst haben wie ein Kaninchen vor einer Riesenschlange, und dass sie den gesunden Verstand verlieren. Nun gut, wir warten, bis Sie wieder zu sich kommen...“10 Und das sollte dauern, wie nachstehender Dialog mit dem US-amerikanischen Wirtschaftsvertreter White zeigt:
„White: Zur Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen uns bedarf es des Vertrauens, aber ein solches Vertrauen ist nicht vorhanden, da die amerikanischen Kommunisten Konflikte aller Art zwischen Industriellen und Arbeitern zu schaffen versuchen.
Chruschtschow: Hier, verehrter Herr, kann ich Ihnen nicht helfen. Sie kennen unser System so schlecht, dass ich Ihnen schwer klarmachen kann, warum. Möchten Sie etwa, dass ich Ihren Kommunisten sage, sie sollen das nicht tun?
White: Ja.
Chruschtschow: Wenn wir das Ihren Kommunisten sagten, würden sie antworten: Kümmern Sie sich nicht um fremde Angelegenheiten. Das gleiche würden wir auch den amerikanischen Kommunisten sagen, wenn sie sich in unsere Angelegenheiten einmischten.“11
Denn Konflikte zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern mussten (und müssen) nicht erst geschaffen werden; sie ergeben sich aus ihrem Gegnerbezug. Dafür die Kommunisten verantwortlich zu machen, geht deshalb an der Sache vorbei. Hinzu kommt, dass die Kommunisten in den USA im allgemeinen und in den US-amerikanischen Gewerkschaften im besonderen in den 1950er Jahren ohnehin bedeutungslos waren. Auch Chruschtschow machte diese Erfahrung: Den schärfsten Antikommunisten in den USA begegnete er unter Gewerkschaftlern. Trotzdem ersparte er seinen Gastgebern nichts. Ohne Wenn und Aber bekannte er sich: „Der Kapitalismus wird, wie Marx, Engels und Lenin bewiesen haben, vom Kommunismus abgelöst. Wir glauben daran.“12 Und auch über die praktischen Konsequenzen dieses Glaubens ließ er seine Gesprächspartner nicht im Ungewissen. Denn, so führte er aus, „die von Marx und Engels proklamierte Losung 'Proletarier aller Länder, vereinigt euch!' betrachten wir als heilige Devise.“13
Er scheute sich nicht einmal, den Kapitalismus und die Kapitalisten als gewissenlos zu erweisen. So definierte er die sozialistische Gesellschaft als das Reich, „wo denen, die arbeiten, Ehre und Achtung gebührt und wo die Verachtung denen gilt, die auf Kosten fremder Arbeit leben.“14 Und er beurteilte die Verhältnisse in den USA im Licht dieser Überzeugung. Er argumentierte: „Es ist doch klar, dass kein einzelner Mensch, auch nicht zusammen mit seiner Familie, selbst wenn es ihm vergönnt wäre, mehrere Leben zu leben, durch seine persönliche Arbeit eine Million, geschweige denn eine Milliarde Dollar verdienen kann. Das kann man nur schaffen, wenn man sich fremde Arbeit aneignet. Aber das widerspricht doch dem menschlichen Gewissen.“15
Wenn er sich trotzdem auf den Weg in die USA machte, dann deshalb, weil es ihm um „die Erlösung der Menschheit von der Gefahr eines atomaren Vernichtungskrieges“16 ging. Aber nicht allein er, „Die Sowjetunion hielt und hält es für ihre heilige Pflicht gegenüber der Menschheit, ein Verbot der Massenvernichtungsmittel, der Atom- und Wasserstoffwaffen, durchzusetzen.“17 Das schien ihm freilich nicht nur geboten, sondern auch möglich. Ausschlaggebend dafür war einmal mehr ein Glaube. Denn, so Chruschtschow weiter: „Wir glauben unbeirrt an die guten Absichten des Menschen. Wir glauben, dass die Menschen nicht geboren sind, einander zu töten, sondern um in Frieden und Freundschaft zu leben.“18
Doch war Chruschtschow Realist genug, um zu erkennen, dass die UdSSR dieses Ziel nicht im Alleingang erreichen konnte. Folgerichtig bekundete er mit den Teilnehmern der Beratung der kommunistischen und Arbeiterparteien 1957 in Moskau anlässlich des 40. Jahrestages der Oktoberrevolution die „Bereitschaft, die Bemühungen aller Staaten, Parteien, Organisationen, Bewegungen und einzelnen Personen zu unterstützen, die für den Frieden, gegen den Krieg eintreten, für friedliche Koexistenz, Einschränkung der Rüstungen und das Verbot der Anwendung und Erprobung von Kernwaffen.“19 Und der Erfolg gab ihm recht. Bereits in seiner Rede auf der Tagung des Politischen Beratenden Ausschusses des Warschauer Vertrages im Mai 1958 stellte er fest: „Für die friedliche Koexistenz der Staaten, ohne Ansehen der sozialen Systeme, die sich in ihnen herausgebildet haben, für die Lösung der unentschiedenen weltpolitischen Fragen durch friedliche Verhandlungen, für eine nachdrückliche internationale Entspannung setzen sich die gesellschaftlichen Massenorganisationen, die Gewerkschaftsverbände, Kulturschaffende und Wissenschaftler, Geistliche und Millionen einfacher Menschen in allen Ländern der Welt ein.“20
Diese Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Gläubigen, diese Einladung zur Mitarbeit noch an die Adresse von Geistlichen deutete sich bereits an in dem Beschluss des Zentralkomitees der KPdSU über die Fehler bei der Gestaltung der wissenschaftlich-atheistischen Propaganda unter der Bevölkerung vom November 1954. Die Die Kulturrevolution in der UdSSR überschriebene Studie zur führenden Rolle der KPdSU bei der Entwicklung der sowjetischen Kultur aus dem Jahre 1974 bemerkt dazu: „Während des Krieges hatten die Schwierigkeiten und Bitternisse und auch gewisse Einflüsse der bürgerlichen Ideologie günstige Bedingungen für die Belebung religiöser Überreste geschaffen. Dazu hatte nicht zuletzt das elastische Vorgehen der Kirchenvertreter beigetragen, die im Kampf gegen den Faschismus eine patriotische Position bezogen hatten. Nunmehr war eine systematische und geduldige Arbeit zur atheistischen Erziehung notwendig.“21
Denn mit Karl Marx waren auch für die sowjetischen Kommunisten Moral und Religion „ebenso viele bürgerliche Vorurteile, hinter denen sich ebenso viele bürgerliche Interessen verstecken.“22 Und mit Lenin war ihnen nicht die Religion wichtig, sondern das, „was aus der Geschichte und dem Leben in sie eingegangen ist.“23 Diesbezüglich urteilte zunächst Marx, nachdem die sozialen Prinzipien des Christentums achtzehnhundert Jahre Zeit gehabt hätten, sich zu entwickeln,
rechtfertigten sie die antike Sklaverei, die mittelalterliche Leibeigenschaft und die Unterdrückung des Proletariats;
predigten sie die Notwendigkeit einer herrschenden und einer unterdrückten Klasse und hätten für die letztere nur den frommen Wunsch, die erstere möge wohltätig sein;
erklärten sie alle Niederträchtigkeiten der Unterdrücker gegen die Unterdrückten entweder für die gerechte Strafe für die Sünde oder für Prüfungen, die der Herr in seiner unendlichen Weisheit über die Unterdrückten verhänge;
verschöben sie den Ausgleich aller Ungerechtigkeit in den Himmel und rechtfertigten so die Ungerechtigkeit auf der Erde
24
.
Das könne aber auch gar nicht anders sein, so Marx an anderer Stelle, denn die Religion solle die Welt stützen, ohne dass sich die Welt der Religion unterwerfe, gehe es doch immer wieder und immer nur darum, „weltlich bestimmen zu wollen, wie die Religion innerhalb der Politik aufzutreten habe.“25 Und Lenin fasste das, was aus der Geschichte und dem Leben in die Religion eingegangen sei, in die Worte: „Heiligsprechung der Unwissenheit und Unterwürfigkeit einerseits, der Leibeigenschaft und der Monarchie andererseits“26. Marx erkannte darin „die Feigheit, die Selbstverachtung, die Erniedrigung, die Unterwürfigkeit“27 der Gläubigen; und Lenin charakterisierte die Religion von daher als „eine Art geistigen Fusels, in dem die Sklaven des Kapitals ihr Menschenantlitz und ihre Ansprüche auf ein halbwegs menschenwürdiges Leben ersäufen.“28
Unter diesen Umständen hatten Marxisten-Leninisten die Religion in zweifacher Hinsicht zu bekämpfen. Zum einen galt ihnen dieser Kampf als ein Kampf gegen den Fatalismus, „gegen die Ideologie der Unterwerfung unter höhere Mächte, gegen den Glauben, dass mit unserer Macht nichts getan sei“29; denn ihnen war klar, dass der Sozialismus nicht durch Hoffen und Harren auf höhere Mächte, sondern nur durch Vertrauen in die eigene Kraft vorankommt. Und eben darum musste es ihnen gehen. Denn, so noch einmal Karl Marx: „Die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des Volkes ist die Forderung seines wirklichen Glücks. Die Forderung, die Illusion über einen Zustand aufzugeben, ist die Forderung, einen Zustand aufzugeben, der der Illusion bedarf. Die Kritik der Religion ist also im Kern die Kritik des Jammertales, dessen Heiligenschein die Religion ist.“30 Das aber heißt: „Die Kritik der Religion endet mit der Lehre, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei, also mit dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist.“31
Damit war die Religion nicht allein mit Pamphleten zu bekämpfen, und schon gar nicht mit beleidigenden Ausfällen gegen die Geistlichkeit und die Gläubigen, wie der o. g. Beschluss des Zentralkomitees der KPdSU ausdrücklich vermerkt, sondern nur durch deren Einbeziehung in den Klassenkampf. Schon Lenin musste feststellen: „Keine Aufklärungsschrift wird die Religion aus den Massen austreiben, die, niedergedrückt durch die kapitalistische Zwangsarbeit, von den blind waltenden, zerstörerischen Kräften des Kapitalismus abhängig bleiben, solange diese Massen nicht selbst gelernt haben werden, diese Wurzel der Religion, die Herrschaft des Kapitals in all ihren Formen vereint, organisiert, planmäßig, bewusst zu bekämpfen.“32 Von daher hatte die eingangs zitierte Bereitschaft der kommunistischen und Arbeiterparteien, die Bemühungen aller Organisationen und einzelnen Personen, religiöse Gemeinschaften und Menschen unterschiedlicher Glaubensbekenntnisse eingeschlossen, zu unterstützen, eine doppelte Zielsetzung: sie sollte Unterstützung für die sowjetische Außenpolitik generieren, und sie war als Bestandteil des marxistisch-leninistischen Kampfes gegen die Religion konzipiert.
Ziel dieses Kampfes war nicht der Atheismus, sondern ein Materialismus, wie ihn Friedrich Engels bei den deutschen sozialdemokratischen Arbeitern beobachten konnte. Engels stellte fest, „dass der Atheismus bei ihnen sich schon überlebt hat; dieses rein negative Wort hat auf sie keine Anwendung mehr, indem sie nicht mehr in einem theoretischen, sondern nur noch in einem praktischen Gegensatz zum Gottesglauben stehen: Sie sind mit Gott einfach fertig, sie leben und denken in der wirklichen Welt und sind daher Materialisten.“33 Und Marx interpretierte: „Indem die Wesenhaftigkeit des Menschen und der Natur, indem der Mensch für den Menschen als Dasein der Natur und die Natur für den Menschen als Dasein des Menschen praktisch, sinnlich anschaubar geworden ist, ist die Frage nach einem fremden Wesen, nach einem Wesen über der Natur und dem Menschen - eine Frage, welche das Geständnis von der Unwesentlichkeit der Natur und des Menschen einschließt - praktisch unmöglich geworden. Der Atheismus, als Leugnung dieser Unwesentlichkeit, hat keinen Sinn mehr, denn der Atheismus ist eine Negation des Gottes und setzt durch diese Negation das Dasein des Menschen; aber der Sozialismus als Sozialismus bedarf einer solchen Vermittlung nicht mehr; er beginnt von dem theoretisch und praktisch sinnlichen Bewusstsein des Menschen und der Natur als des Wesens. Er ist positives, nicht mehr durch die Aufhebung der Religion vermitteltes Selbstbewusstsein des Menschen, wie das wirkliche Leben positive, nicht mehr durch die Aufhebung des Privateigentums, den Kommunismus, vermittelte Wirklichkeit des Menschen ist.“34
Mit anderen Worten: Ziel dieses Kampfes war es, dass sich bei den Gläubigen, die sich auf eine Zusammenarbeit mit Marxisten-Leninisten einließen, „die Religion immer mehr auf die Begründung der Motivation ihres Engagements beschränkte und immer weniger als spezifischer Inhalt in die Ziel- und Mittelbestimmung ihres Handelns einging.“35 Doch fällt es schwer, anzugeben, worin genau sich ein spezifischer, friedensdienlicher Inhalt gläubigen Handelns hätte unterscheiden können - beispielsweise von der im Appell der internationalen Beratung der kommunistischen und Arbeiterparteien 1969 in Moskau unter anderem auch an die Adresse religiöser Gemeinschaften und einzelner Gläubiger gerichteten Aufforderung, „die Einstellung der USA-Aggression in Vietnam, den Abzug der amerikanischen Truppen, die Respektierung der souveränen Rechte des vietnamesischen Volkes sowie Unabhängigkeit, Freiheit und Frieden für Vietnam zu fordern; durchzusetzen, dass die Folgen der Aggression Israels im Nahen Osten auf der Grundlage der Resolution des UNO-Sicherheitsrates beseitigt werden;
für die restlose Liquidierung des Kolonialismus und Neokolonialismus und die Erringung der Unabhängigkeit durch alle unterdrückten Völker, für die Einstellung der Kriege der portugiesischen Kolonialisten, für die Ausrottung der Schmach des Rassismus in Südafrika und wo immer er sonst in Erscheinung tritt wie auch für die Beseitigung der korrupten Regimes, dieser Lakaien der Auslandsmonopole, zu kämpfen;
ihre Bemühungen im Kampf für die vollständige Verwirklichung der Prinzipien der friedlichen Koexistenz der Staaten, ungeachtet ihrer Gesellschaftsordnung, für internationale Entspannung, für die Regelung der ungelösten internationalen Fragen auf dem Verhandlungswege, gegen die Anschläge der Imperialisten auf die Unabhängigkeit und Souveränität der Völker und auf ihr Selbstbestimmungsrecht, für die Entwicklung einer umfassenden, gleichberechtigten Zusammenarbeit der Länder zu verstärken.“36
Gleichwohl unterstützen viele Gläubige namentlich in den in der NATO zusammengeschlossenen Ländern den US-amerikanischen Krieg in Vietnam, die Kämpfe der portugiesischen Kolonialmacht gegen die Unabhängigkeit von Angola, Mosambik und den Kapverdischen Inseln, und das Apartheidregime in Südafrika in der Meinung, damit dem Kommunismus zu widerstehen. Sie trugen damit das Ihre zur Verlängerung dieser Kriege und zur Vergrößerung der Leiden der Bevölkerung in diesen Ländern bei. Dasselbe gilt für ihre bedingungslose Unterstützung der Expansion Israels.
Auf der anderen Seite galt den Marxisten-Leninisten ihr Kampf gegen die Religion als ein Kampf gegen „Pfaffen und bürgerliche Frömmler“ (Lenin). So fragte zunächst Marx die verordneten Vertreter des christlichen Staates wie der Staatskirche, „straft nicht jeder Augenblick eures praktischen Lebens eure Theorie Lügen? Haltet ihr es für Unrecht, die Gerichte in Anspruch zu nehmen, wenn ihr übervorteilt werdet? Aber der Apostel schreibt, dass es Unrecht sei. Haltet ihr euren rechten Backen dar, wenn man euch auf den linken schlägt, oder macht ihr nicht einen Prozess wegen Realinjurien anhängig? Aber das Evangelium verbietet es. Verlangt ihr vernünftiges Recht auf dieser Welt, murrt ihr nicht über die kleinste Erhöhung einer Abgabe, geratet ihr nicht außer euch über die geringste Verletzung der persönlichen Freiheit? Aber es ist euch gesagt, dass dieser Zeit Leiden der künftigen Herrlichkeit nicht wert sei, dass die Passivität des Ertragens und die Seligkeit in der Hoffnung die Kardinaltugenden sind. Handelt der größte Teil eurer Prozesse und der größte Teil der Zivilgesetze nicht vom Besitz? Aber es ist euch gesagt, dass eure Schätze nicht von dieser Welt sind“37, und erwies sie damit als Heuchler.
In diesem Sinne erkundigte sich Chruschtschow bei den nach eigenem Bekunden wiedergeborenen Christen in den USA: „Wie kann man einen Gottesdienst abhalten und die Waffen mit Weihwasser besprengen, die für die Vernichtung von Menschen bestimmt sind, wie kann man jene Menschen segnen, die andere Menschen töten sollen, nur weil diese eine andere Sprache sprechen oder sich zu einem anderen Glauben bekennen? … Liegt etwa darin die höchste Offenbarung der Menschlichkeit und Ehrlichkeit? Nein, das ist eine Maske. Man versteckt sich oft hinter Gott, um die Gefühle der Gläubigen auszunutzen und die Menschen zu betrügen. Aber das ist doch einfach Pharisäertum.“38 Und er machte ihnen schließlich den Vorwurf der Gotteslästerung. Denn, so noch einmal Chruschtschow wörtlich: „Einige der Staatsmänner der USA beginnen und schließen ihre Reden mit einem Anruf Gottes, damit Gott den Völkern Frieden und Wohlergehen schenke..., betreiben aber in Wirklichkeit etwas anderes. Welche Gotteslästerung!“39 Gleichzeitig bezeichneten viele bürgerliche Politiker die Kommunisten als gottlos! Sie scheuten noch nicht einmal vor seiner, Chruschtschows, Dämonisierung zurück. So wusste Chruschtschow zu berichten, dass ihm der Vertreter der United Nations Relief and Rehabilitation Agency (UNRRA) in der Ukraine, Marshall Mcduffy, gesagt habe, „'Wenn Sie nach Amerika kämen, würde großer Nutzen daraus entspringen.' Ich fragte: 'Weshalb?' Mcduffy antwortete: 'Einige Amerikaner glauben, Sie hätten Hörner. Wenn sie sehen würden, dass Sie keine Hörner haben, wäre das ein großer Erfolg.'“40
Mcduffy spielte damit auf die Parabel an, mit der der US-amerikanische Protestantismus die Antihitlerkoalition kommentierte. John Haynes Holmes fasste sie im Christian Century in die Worte: „Satan (Hitler) unternahm in seinem Hochmut den Versuch, die Himmel zu erstürmen. Aber Michael (Churchill) und seine Engel verteidigten die Zinnen des Himmels. Und der Krieg begann und wütete ein Jahr und neun Monate lang, und Satan gewann manchen Sieg über Michael. Aber Beelzebub (Stalin) nahm nicht teil am Kampf. Er sah Satan zu und zog Nutzen aus dessen Kampf zu seinem eigenen Vorteil. Und Satan misstraute Beelzebub, und er sandte seine besten Heerscharen gegen Beelzebub. Und Beelzebub bot alle seine Heerscharen auf gegen Satan. Und es war Krieg in der Hölle... Michael aber sah dies und freute sich. Und er stieg auf die Zinne des Himmels... Und er rief laut, dass er kein Wort von allem zurücknehme, das er gegen Beelzebub gesagt, aber er fügte hinzu: 'Wir haben jetzt nur ein Ziel und eine unwiderrufliche Aufgabe: Satan zu überwinden! Und jeder Dämon der gegen Satan kämpft, soll unsere Hilfe haben.' Und er entsandte eine Gesandtschaft des Himmels zur Hölle, und er verhandelte mit Beelzebub, und er wurde ein Herz und eine Seele mit ihm. Und Michael kam zu Gott und berichtete dem Allerhöchsten, was er getan hatte und sprach: 'Siehe, o Gott, Beelzebub ist jetzt unser Freund. Wir bitten dich, dass er aufgenommen werde in unsere Reihen und mit Licht gekrönt werde und erhalte dein eigenes Schwert'... Und Gott lachte.“41 Es ist nicht bekannt, ob Chruschtschow diese Parabel kannte; davon, dass Mcduffy sie kannte, dürfte auszugehen sein.
Bestätigte sich damit für die sowjetischen Kommunisten einmal mehr das Urteil Lenins - „Der Marxismus betrachtet alle heutigen Religionen und Kirchen, alle religiösen Organisationen stets als Organe der bürgerlichen Reaktion, die die Ausbeutung verteidigen und die Arbeiterklasse verdummen und umnebeln sollen.“42 - konnte es bei der Bekämpfung der Religion nur um die fortwährende Zurückdrängung des Einflusses der Kirchen in der UdSSR und in den übrigen Staaten des real existierenden Sozialismus gehen. Folgerichtig hieß es in der bereits zitierten Untersuchung der Kulturrevolution in der UdSSR diesbezüglich: „Im Kampf gegen die reaktionäre Ideologie und religiösen Vorurteile misst die Partei, wie sie es stets getan hat, der Schaffung neuer kommunistischer und religionsfreier Bräuche, Sitten und Feste sowie der Ersetzung alter und schädlicher Traditionen durch fortschrittliche, neue eine große Bedeutung bei. So werden in der Estnischen SSR, wo noch vor kurzem der Einfluss der Kirche recht stark war, als Gegengewicht zur Konfirmation Tage der Jugend durchgeführt, wo die Volljährigkeit der jungen Menschen gefeiert wird. Beinahe in allen Republiken finden heute die Trauungen zum größten Teil feierlich in den Eheschließungspalästen statt.“43
Damit sind die Grenzen aufgezeigt, in denen eine christliche Friedenskonferenz möglich war. Sie ergaben sich einerseits aus dem Bestreben der UdSSR, Unterstützung für ihre Außenpolitik zu generieren, andererseits standen sie in denkbar engem Zusammenhang mit dem Kampf der KPdSU gegen die Religion. So öffnete sich die Partei seit ihrem XX. Parteitag 1956 für eine Zusammenarbeit mit Christen im Friedenskampf, bekundete ihre Bereitschaft, selbst Geistliche in ihrem Engagement für den Frieden zu unterstützen - und intensivierte gleichzeitig ihre Bemühungen um die weitere Marginalisierung der Kirchen. Gläubigen musste diese doppelte Zielsetzung als in sich widersprüchlich erscheinen, da ihnen Glaube ohne Glaubensgemeinschaft, Christentum ohne Kirche kaum vorstellbar ist. Kommunisten dagegen erschien diese Konzeption als in sich konsistent. Sie beriefen sich dabei auf Lenin, der zum Umgang mit Gläubigen wie mit nicht proletarischen Bevölkerungsschichten im nachrevolutionären Russland darauf hinwies, sie „kann man nicht davon jagen, man kann sie nicht unterdrücken, mit ihnen muss man zurechtkommen, sie kann (und muss) man nur durch eine sehr langwierige, langsame, vorsichtige organisatorische Arbeit ummodeln und umerziehen.“44
II
Eine Darstellung der Geschichte der Christlichen Friedenskonferenz hat sich sodann des politischen Klimas zu vergewissern, in dem die Konferenz gegründet wurde. Dieses Klima war geprägt von der o. g. Rückkehr zur Normalität in den Beziehungen der westlichen Alliierten zu Russland beziehungsweise zur UdSSR. Dieses Klima war aber auch geprägt von der Erfahrung des zweiten Weltkrieges und der sich aus diesen Erfahrungen ganz selbstverständlich ergebenden Forderung, „Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg!“ So erinnert sich Ján Michalko, seit 1947 Professor an der Slowakischen Protestantisch-Theologischen Fakultät in Modra und einer der Mitbegründer der CFK, an das Jahr 1945: „Am lebhaftesten erinnere ich mich an die Nachricht über die Kapitulation Nazideutschlands am 9. Mai und über das Ende des zweiten Weltkriegs. Damals entschloss ich mich, mein Leben der Idee des Friedens zu widmen. In dieser Zeit der Euphorie über den Sieg über den Faschismus kam es mir nicht in den Sinn, dass es schon bald wieder nötig werden würde, für den Frieden zu arbeiten und zu kämpfen. Das geschah etwa ein Jahr nach Kriegsende, nachdem Churchill in seiner berüchtigten Rede in Fulton den sogenannten Kalten Krieg offiziell erklärt hatte.“45 Dementsprechend engagierte er sich gemeinsam mit dem späteren Präsidenten der CFK, dem Professor für systematische Theologie an der Prager Comenius-Fakultät, Josef L. Hromádka, im Tschechoslowakischen Friedensrat, dessen Präsidium er seit 1954 angehörte. Und er unterstützte wie dieser den Weltfriedenskongress, der im April 1949 gleichzeitig in Paris und Prag tagte - jenen Kongress, für den Pablo Picasso das Symbol der Friedenstaube gestaltete.
Karl Kleinschmidt, Domprediger zu Schwerin, gehörte zu den Teilnehmern dieses Kongresses46. Nach seiner Rückkehr aus Paris gründete er ein Komitee der Kämpfer für den Frieden, aus dem der Friedensrat der DDR hervorging. Denn er war überzeugt: „Es genügt nicht, sich mit den Friedenserklärungen der Kirchen zu begnügen. Man muss sich zusammentun mit allen, die den Frieden ernstlich wollen, und mit ihnen gemeinsam für den Frieden kämpfen, was immer sie sonst auch für gut und richtig halten.“47 Und auch der CFK gehörte er schließlich an; 1961 nahm er an der ersten und 1964 an der dritten Allchristlichen Friedensversammlung in Prag teil.
Wenn sich der Weltfriedensrat im Laufe der Jahre auch ein umfassenderes Programm gab - in den 1980er Jahren trat er ein für „das Verbot der Kernwaffen und aller Massenvernichtungswaffen und die Beendigung des Wettrüstens, die Beseitigung ausländischer Militärstützpunkte, allgemeine, gleichzeitige und kontrollierte Abrüstung, für die Durchsetzung der Prinzipien der friedlichen Koexistenz in den Beziehungen zwischen Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung; die Beilegung von Streitigkeiten auf friedlichem Wege durch Verhandlungen; die europäische Sicherheit, die Unterstützung des Kampfes der kolonialen und unterdrückten Völker um ihre nationale Unabhängigkeit“48 - beschränkte sich sein Vorgänger, das Ständige Komitee des o. g. Weltfriedenskongresses unter dem Eindruck der entsetzlichen Folgen der US-amerikanischen Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki noch auf den im März 1950 veröffentlichten Stockholmer Appell. Er lautet: „Wir fordern das absolute Verbot der Atomwaffe als einer Waffe des Schreckens und der Massenvernichtung der Bevölkerung. Wir fordern die Errichtung einer strengen internationalen Kontrolle, um die Durchführung des Verbotes zu sichern. Wir sind der Ansicht, dass die Regierung, die als erste die Atomwaffe gegen irgendein Land benutzt, ein Verbrechen gegen die Menschheit begeht und als Kriegsverbrecher zu behandeln ist. Wir rufen alle Menschen der Welt, die guten Willens sind, auf, diesen Appell zu unterzeichnen.“ Dieser Appell stieß auf große Resonanz; weltweit hatten sich „Bereits Anfang der fünfziger Jahre... in Unterstützung des Stockholmer Appells des Weltfriedensrates 500 Millionen Menschen in aller Welt gegen Atomwaffen ausgesprochen.“49
Das Entsetzen, das aus diesem Appell spricht, wurde von vielen geteilt, so auch von Albert Schweitzer. Schweitzer sprach schon im ersten Weltkrieg davon, dass der moderne Mensch im Zeichen des Niedergangs der Kultur lebe - und dass das nicht eine Folge des Krieges sei, sondern dass der Krieg Ausdruck dieses Niedergangs sei. Warnte er im ersten Weltkrieg noch, dass der moderne Mensch in Gefahr sei, seine Menschlichkeit zu verlieren, urteilte er nach dem zweiten Weltkrieg, dass dieser seine Menschlichkeit bereits verloren habe. Das aber hieß für Schweitzer: „Wir treiben auf einem reißenden Strom oberhalb eines großen Katarakts, ohne zu merken, dass die Strömung immer stärker wird, und dass wir bald nicht mehr imstande sein werden, der unten wartenden Vernichtung zu entrinnen.“50 Wenn sich Schweitzer deshalb nach dem Abwurf der US-amerikanischen Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki und unter dem Eindruck der die weitere Entwicklung dieser Bomben begleitenden Versuchsexplosionen immer wieder gegen deren Herstellung, Erprobung und Anwendung aussprach, dann gerade nicht um politischer, sondern um ethischer Erwägungen willen: Im Gespräch mit Albert Einstein, Linus Pauling und anderen überzeugte sich Schweitzer davon, „dass die Idee der Ehrfurcht vor dem Leben sich jetzt in der unmittelbaren Auseinandersetzung mit der nuklearen Kriegsgefahr zu beweisen und zu bewähren hatte. So wurde er namentlich in den letzten eineinhalb Jahrzehnten, die ihm vergönnt waren, zu dem unermüdlichen Streiter für den Frieden, als der er im Gedächtnis der Völker fortlebt. Den Frieden als Voraussetzung allen Lebens zu sichern - dieses Ziel erklärte er als Existenzfrage der Menschheit und als Aufgabe der Völker.“51
Besonders nachdrücklich tat er dies in seiner Das Problem des Friedens in der heutigen Welt überschriebenen Dankesrede anlässlich der Verleihung des Friedensnobelpreises im November 1954 sowie in dem zunächst von Radio Oslo ausgestrahlten und dann von Hunderten Radiostationen weltweit übernommenen Appell an die Menschheit im April 1957. Noch deutlicher wurde Schweitzer ein Jahr später, im April 1958, in drei weiteren, Verzicht auf Versuchsexplosionen, Die Gefahr eines Atomkrieges und Verhandlungen auf höchster Ebene überschriebenen Sendungen; in einer Broschüre zusammengefasst erschienen sie unter dem Titel Friede oder Atomkrieg auch gedruckt. Darin informierte Schweitzer über die tatsächlichen Gefahren radioaktiver Strahlung, wie sie im Ergebnis der Atombombenexplosionen zu Versuchszwecken entstanden war. Er tat dies auf der Grundlage der im Januar 1958 von Linus Pauling an den Generalsekretär der UNO übergebenen, von 9235 Wissenschaftlern aus 44 Ländern unterschriebenen Petition52, die eindeutig feststellt, dass die durch die Versuchsexplosionen erzeugte Radioaktivität eine Gefahr für alle Gegenden der Erde bedeutet und in kommenden Generationen mehr und mehr Missgeburten zur Folge haben wird.
Pauling war seit 1946 Mitglied des Emergency Committee of Atomic Scientists, das in dem Bewusstsein der Verantwortung der Wissenschaftler für die Folgen ihrer Entdeckungen gründete und vor den von Atombomben ausgehenden Gefahren warnte. 1957 formulierte Pauling, ausgelöst durch eine Untersuchung des Biologen Barry Commoner zur Anreicherung von Strontium 90 in Milchzähnen, die o. g. Petition. Gleich Schweitzer wandte sich Pauling darin gegen die Beruhigungspropaganda der USA und Englands für die Fortsetzung der Versuche, die immer wieder behauptete, dass die Gefahr der durch die Atombombenexplosionen entstehenden Radioaktivität nicht so groß sei, dass sie eine Einstellung der Versuche erforderlich mache. In den USA galt Pauling deshalb als Galionsfigur jeder als kommunistisch verdächtigten Friedensoffensive; die Verleihung des Friedensnobelpreises an Pauling 1963 erschien deshalb in weiten Kreisen als eine Verunglimpfung der USA.
Neben gesundheitlichen machte Schweitzer völkerrechtliche Bedenken geltend. So stellte er immer wieder zwei Fragen: „Fort und fort redet man uns von einem 'erlaubten Maximum der Bestrahlung'. Wer denn hat es erlaubt? Wer denn ist befugt, es zu erlauben?“53 Denn es gebe keine unschädliche Dosis der Bestrahlung. Und weil die Menschheit deshalb durch die Versuche gefährdet sei, und also das Recht habe, zu verlangen, dass sie aufhörten, fragte er weiter: „Wer gibt denn diesen Mächten das Recht, in Friedenszeiten Erprobungen von Waffen vorzunehmen, die sämtliche Länder der Welt in schwerster Weise zu schädigen vermögen? Was sagt das in unserer Zeit hochgepriesene und von den Vereinten Nationen auf den Thron erhobene Völkerrecht dazu? Sieht es aus dem Tempel, in dem es thront, nicht mehr in die Welt hinaus? Man hole es heraus, dass es sich in ihr umsehe und seines Amtes walte.“54
Seien schon die Versuchsexplosionen zu beenden, sei ein Atomkrieg erst recht zu verhindern. Denn, so Schweitzer wörtlich: „Ein mit den heutigen Atomwaffen für die Erhaltung einer als gefährdet angesehenen Freiheit geführter Krieg kann nicht leisten, was man von ihm erwartet. Diejenigen, für die er geführt wird, werden in seinem Verlaufe zu leben aufgehört haben oder nachher elend dahinsiechen. An Stelle der Freiheit würde ihnen die Vernichtung zuteil. Die radioaktiven Staubwolken, die ein zwischen dem Osten und dem Westen geführter Atomkrieg zur Folge hätte, würden auf der ganzen Erde das Weiterexistieren von Menschen in Frage stellen... Ein Atomkrieg ist also das unvorstellbar Sinnlose und Grausige, das unter keinen Umständen Tatsache werden darf.“55 Gleichwohl sei die Gefahr, dass der Kalte Krieg in einen Atomkrieg übergehe, größer als je zuvor. Durch die Stationierung US-amerikanischer Atomraketen in Westdeutschland könnten weite Gebiete der Sowjetunion bis Moskau und Charkow beschossen werden; damit seien die Voraussetzungen für einen zwischen den USA und der Sowjetunion auf europäischem Boden mit Atomwaffen geführten Landkrieg gegeben.
In dieser Situation begrüßte Schweitzer ausdrücklich den Rapacki-Plan. Im Dezember 1957 schlug der polnische Außenminister Rapacki vor, dass Polen, die Tschechoslowakei, Ost- und Westdeutschland zu atomwaffenfreien Zonen werden sollten - für Schweitzer nicht nur ein vernünftiger Vorschlag, sondern mehr noch ein lichter Schein im Dunkel. Und weil mit diesem Vorschlag die öffentliche Meinung in Europa durchaus einverstanden war, gab Schweitzer sich der Hoffnung hin: „Vorüber sind auch die Zeiten, in denen NATO-Generäle und europäische Regierungen miteinander über die Erstellung von Abschussrampen und Lagerung von Atomwaffen auf deren Gebiet entschieden. Angesichts der Gefahr eines Atomkrieges, die dies zur Folge haben könnte, kommt das bisherige politische Verfahren nicht mehr in Betracht. Geltung kommt nur noch Abmachungen zu, die von den Völkern als solchen sanktioniert werden.“56
Gleichzeitig setzte sich Schweitzer für Verhandlungen auf höchster Ebene ein. Und er plädierte für Sachlichkeit. Mehr noch, er stellte klar: „Sachlich ist, dass auf dieser Konferenz nur Fragen, die es ganz direkt mit dem Verzicht auf Atomwaffen zu tun haben, zur Verhandlung kommen sollen.“57 Denn die Versuchsexplosionen und die Verwendung von Atomwaffen trügen den absolut zwingenden Grund dafür, dass sie nicht weiter stattfinden dürften, in sich selber. Zuvor zu erfüllende Bedingungen könnten deshalb nicht in Betracht kommen. Die Verhandlungen über ein Abrüstungsabkommen waren für Schweitzer also nicht die Voraussetzung dieses Verzichts, sondern seine Folge. Zugleich widersprach er jeder Dämonisierung der Sowjetunion. Entsprechenden Befürchtungen im Westen hielt er entgegen, dass die Sowjetunion vielleicht doch nicht ganz so bösartig sei, dass sie nur daran denke, sich auf Europa zu stürzen, um es zu verschlingen, und vielleicht auch nicht ganz so dumm, dass sie sich mit diesem unverdaulichen Brocken den Magen verderbe. Denn, so Schweitzer wörtlich: „Das Bewusstsein, dass wir miteinander Menschen sind, ist uns in Kriegen und Politik abhanden gekommen. Wir kamen dazu, miteinander nur noch als Angehörige verbündeter oder gegnerischer Völker zu verkehren und in den sich daraus ergebenden Ansichten, Vorurteilen, Zuneigungen und Abneigungen gefangen zu bleiben. Nun heißt es wiederentdecken, dass wir miteinander Menschen sind und uns zu bemühen haben, uns gegenseitig zuzugestehen, was in dem Wesen des Menschen als moralische Fähigkeit vorhanden ist.“58
Damit stieß Schweitzer auf ein geteiltes Echo. Im Westen wurden ihm diese Appelle „bitter übel“ (Gerald Götting) genommen, denn „Die von verlogenen Kreuzzugsparolen gegen den 'Osten' vergiftete Welt spürte in dem Rufer zum Frieden ihren Feind und behandelte ihn entsprechend.“59 So erklärte beispielsweise United States and World Report, „der 'Appell' Schweitzers diene nur den Kommunisten, und Schweitzer, der selbst nichts davon verstehe, lasse sich ganz und gar 'durch die unklaren propagandistischen Angaben der Freunde Russlands' leiten.“60 Auf der anderen Seite verpflichteten sich die Teilnehmer an der auf Initiative des Lehrkörpers der protestantischen theologischen Fakultäten in der Tschechoslowakei vom tschechoslowakischen ökumenischen Rat für den 2. - 5. Dezember 1957 einberufenen Konferenz, auf der die Weichen für die Gründung der CFK gestellt wurden, „im Sinne des Appells von Albert Schweitzer in unseren Gemeinden und Kirchen alles dafür (zu) tun, dass alle Glieder unserer Kirchen zu der dauernden und unumstößlichen Überzeugung kommen, dass der Atomkrieg Aufruhr gegen Gott ist“61.
Nicht unerwähnt bleiben darf in diesem Zusammenhang auch der Aufruf Bertrand Russells vom 9. Juli 1955. Darin appellierte der Mathematiker und Philosoph gemeinsam mit Albert Einstein, Max Born und anderen Physikern an die Verantwortung der Wissenschaftler für die Verwendung der von ihnen geschaffenen Massenvernichtungsmittel; 1957 entstanden daraus die Pugwash Conferences on Science and World Affairs - Treffen ebenso sachkundiger wie einflussreicher Wissenschaftler zu Fragen der atomaren Bedrohung, einem Atomteststopp, der Nichtweiterverbreitung von Massenvernichtungsmitteln usw. Diesen Ansatz machte sich auch die o. g. Vorkonferenz der Christlichen Friedenskonferenz zu eigen, als sie sich der Sachkunde des Dekans der Fakultät für technische Physik und Kernphysik an der Technischen Hochschule Prag, des Atomphysikers V. Petržilka, versicherte.
Wie nahe Russell Schweitzer - ungeachtet aller weltanschaulichen Differenzen - stand, zeigt Russells offener Brief an die sowjetische und an die US-amerikanische Führung, der am 23. November 1957 in der englischen Zeitschrift New Statesman veröffentlicht wurde. Darin sorgte sich Russell um die weitere Existenz der Menschheit, da ein mit atomaren Massenvernichtungsmitteln geführter Weltkrieg nicht zum Sieg der einen oder anderen Seite, sondern zur Vernichtung beider Seiten führen werde. Das erste Opfer sei freilich die Kultur. Russell warnte: „Um den Tod wirksamer vorbereiten zu können, wird die Bildung verzerrt und verstümmelt werden müssen. Jede menschliche Errungenschaft, die nicht von Hass und Furcht inspiriert ist, wird aus den Lehrplänen der Schulen und Universitäten verdrängt werden.“62 Um so nachdrücklicher stellte Russell die gemeinsamen Interessen Russlands und Amerikas heraus - beide könnten nicht nur neun Zehntel ihrer derzeitigen Rüstungsausgaben sparen, wenn sie sich gemeinsam der Erhaltung des Friedens in der Welt widmeten. Gemeinsam könnten sie zudem die Weiterverbreitung von Kernwaffen verhindern und so der internationalen Anarchie wehren. Dazu sei nur eines notwendig; „dass der Osten und der Westen ihre gegenseitigen Rechte anerkennen, dass sie anerkennen: Beide müssen lernen, Seite an Seite zu leben, und zur Verbreitung ihrer respektiven Ideologie Argumente statt Gewalt gebrauchen. Es ist nicht notwendig, dass die eine oder die andere Seite auf den Glauben an die eigene Lehre verzichtet. Notwendig ist nur, dass sie auf Versuche verzichtet, ihren Glauben mit Waffengewalt zu verbreiten.“63
III
Von besonderem Gewicht sind in diesem Zusammenhang zudem die Ereignisse in Westdeutschland. Denn einen Friedensvertrag mit ganz Deutschland gab es noch nicht, der die deutschen Ostgrenzen endgültig geregelt hätte, so dass die Situation durch weit reichende Gebietsansprüche der Bundesrepublik insbesondere gegenüber Polen gekennzeichnet und in der das innerdeutsche Verhältnis durch den Alleinvertretungsanspruch der BRD gegenüber der DDR bestimmt war. Es ist an dieser Stelle deshalb auch an die außerparlamentarische Opposition in der Ära Adenauer, genauer: an die Aktionsgemeinschaft gegen die atomare Aufrüstung der Bundesrepublik und an die „Kampf dem Atomtod“-Ausschüsse zu erinnern. Denn obwohl auch und gerade in Westdeutschland Begriffe wie Frieden und Koexistenz als Bestandteile der kommunistischen Ideologie bezeichnet wurden und Friedensaktivitäten, die auch die Versöhnung mit dem Osten einschlossen, als Verrat an der westlichen Seite galten64, stieß der o. g. Stockholmer Appell auch hier auf große Resonanz. Einen der Gründe dafür fasste der hessen-nassauische Kirchenpräsident und Präsident der Deutschen Friedensgesellschaft (DFG), Martin Niemöller, in die Worte:
„Der zweite Weltkrieg ist zu Ende - wie wir alle gedacht haben: nicht zuletzt dank der Anwendung der Atombombe in Hiroshima und Nagasaki. So dachten wir! Der zweite Weltkrieg ist nicht zu Ende, und kein Mensch vermag zu sagen, wie er beendet werden kann! Gegen Ende des Jahres 1954 brachte die Wochenzeitung 'Die Welt' eine Meldung, die unwidersprochen blieb. Danach war von über 30.000 seit dem Bombenabwurf in Nagasaki geborenen Kindern jedes 7. Kind anomal: 471 wurden tot geboren, 1048 mit degenerierten Knochen, Muskeln oder Nerven, 429 ohne Nasen und Ohren, 254 mit missgebildeten Lippen und Zungen, 59 mit Wolfsrachen, 243 mit anomalen inneren Organen, 47 mit Gehirnschäden, 25 ohne Gehirn und 8 ohne Augen und Augenhöhlen. - Nachwirkungen? Ja, aber leider Nachwirkungen, die nicht einmalig sind und zu Ende gehen. In Nagasaki und Hiroshima werden weiterhin anomale Kinder geboren, und wir sind vor rund zwei Monaten durch einen deutschen Universitätsprofessor und Atomwissenschaftler dahin unterrichtet worden, dass die durch Radioaktivität verursachten Erbschäden erst nach 30 bis 40 Generationen
ihr volles Ausmaß erreichen werden. Da ist also in 800 Jahren, wenn es sich so verhält, immer noch der 2. Weltkrieg! Und Hiroshima ist ja nun kein Einzelfall mehr; seither haben Explosionen stattgefunden, die ähnliche, nur weit größere Auswirkungen haben. Der Atomkrieg ist im Gange, und der Atomtod geht um, auch ohne dass es zum Krieg kommt. Der amerikanische Nobelpreisträger Prof. Dr. Linus Pauling hat die Todesopfer der bisherigen Versuche für die Zeit bis Anfang 1957 auf annähernd eine Million geschätzt und die Zahl der durch diese Versuche verursachten Missgeburten auf rund 200.000 in dieser Generation.“65
Noch einmal verstärkt wurden die Ausführungen Niemöllers durch die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik und die damit verbundenen Bemühungen der Regierung Adenauer, die Bundeswehr auch mit atomaren Waffen auszurüsten. Im April 1957 veröffentlichten 18 deutsche Atomphysiker - unter ihnen die Nobelpreisträger Max Born, Otto Hahn und Werner Heisenberg - den Göttinger Appell, in dem sie vor den Gefahren warnten, die sich aus einer solchen Politik ergaben. Unmissverständlich bekannten sich die Göttinger Achtzehn zu der Überzeugung: „Für ein kleines Land wie die Bundesrepublik glauben wir, dass es sich heute noch am besten schützt und den Weltfrieden noch am ehesten fördert, wenn es ausdrücklich und freiwillig auf den Besitz von Atomwaffen jeder Art verzichtet.“66 Und im Februar 1958 wandten sich 44 Universitätsprofessoren in einem von Renate Riemeck, Professorin an der Pädagogischen Hochschule Braunschweig, initiierten Aufruf „nun, da die Warnungen der Wissenschaftler von den verantwortlichen Politikern offensichtlich übergangen würden“67, zu einem politischen Streik an die Gewerkschaften. Unterzeichnet wurde dieser Appell unter anderen von den Theologieprofessoren Otto Bauernfeind, Herbert Braun, Hermann Diem, Renatus Hupfeld, Hans Joachim Iwand, Hermann Strathmann, Georg Wehrung und Ernst Wolf. Gleichzeitig sprachen sich in einer Umfrage des Emnid-Instituts, Bielefeld, zur Einstellung der Bevölkerung in der Bundesrepublik zur Errichtung von Atomraketenbasen 83% der Bevölkerung gegen die Atombewaffnung der Bundeswehr und 52% für einen politischen Streik zu ihrer Verhinderung aus.
In dieser Situation entstand zunächst die Aktionsgemeinschaft gegen die atomare Bewaffnung der Bundeswehr. Sie war eine Gründung des „Fränkischen Kreises“ um den Würzburger Volkswirtschaftler Franz Paul Schneider, eine lose Gruppierung von Angehörigen geistiger Berufe, die seit 1953 für die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands durch Beratungen von Beauftragten der beiden deutschen Regierungen mit dem Ziel einer Eingliederung Deutschlands in ein europäisches Sicherheitssystem eintrat. Wie diese wurde die Aktionsgemeinschaft - der neben Schneider unter anderen der katholische Religionsphilosoph Johannes Hessen, der Studentenpfarrer und Chefredakteur der Stimme der Gemeinde Herbert Mochalski, Martin Niemöller, Renate Riemeck und der Vorsitzende der Kirchlichen Bruderschaft Württemberg Herbert Werner angehörten - nicht nur vom