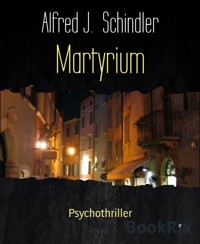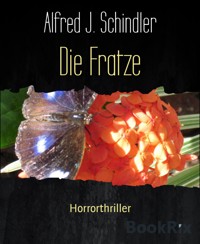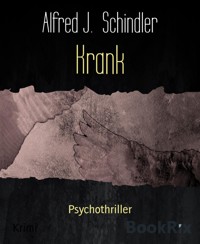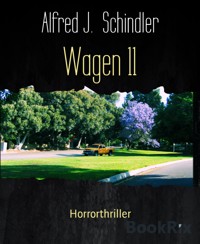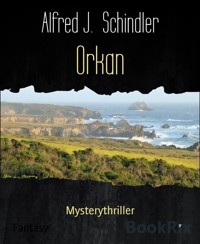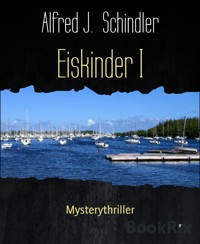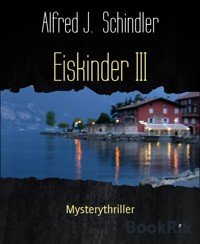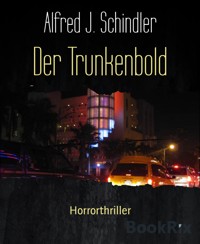1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Beim Abendessen in einer Bauernfamilie kippt plötzlich Wilhelm, einer der jüngeren Brüder vom Stuhl, und ist tot. Blankes Entsetzen spiegeln seine weit geöffneten Augen. Man fragt sich, was er zuletzt sah. Die Diagnose des herbeigerufenen Arztes ist: Hinterwandinfarkt. Robert, Wilhelms älterer Bruder, steht am offenen Grab des Verstorbenen und der Pfarrer hält seine traurige Rede. Robert betrachtet die vielen Leute und plötzlich sieht er Rebecca Malenko. Sie ist eine Frau, die die Not der Leute ausnutzt und ihnen ihre Sachen billig abkauft. Bei Auktionen holt sie dann das Zehnfache heraus. Rebecca kommt näher und kondoliert allen Angehörigen. Und zu Robert sagt sie leise: „Er war einer meiner besten Kunden“. Dabei lächelt sie hintergründig. „Was hat er dir verkauft, Rebecca?“ „Da kann ich dir leider nicht sagen, mein Freund!“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Exitus 30. Februar
Horrorthriller
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenAlfred J. Schindler
Exitus
30. Februar
Horrorthriller
von
Alfred J. Schindler
VORWORT
Unsere gesamte Familie saß gemeinsam am großen Tisch beim Abendessen, als sich mein jüngerer Bruder Wilhelm plötzlich an die Brust griff, in sich zusammen sank, vom Stuhl kippte und starb. Kein einziger Ton kam noch über seine Lippen: Kein Schmerzensschrei, kein heftiges Atmen - nichts. Nur seine Augen waren weit aufgerissen. Blankes Entsetzen stand in den Augen meiner Angehörigen, und keiner von uns konnte glauben, was soeben geschehen war. Ich sprang hoch und tastete nach Wilhelms Puls, aber da war nichts zu spüren. Ich versuchte, Herzmassagen zu machen, aber ich wusste in meinem tiefsten Inneren, dass meine Bemühungen sinnlos waren. Der unbarmherzige Gevatter Tod hatte mit seiner furchtbaren Sichel unverhofft und hinterhältig zugeschlagen. Klammheimlich war er in unser Zimmer geschlichen und hatte sich Einen von uns geholt.
Konrad, Wilhelms elfjähriger Sohn, weinte bitterlich. Er kniete neben seinem toten Vater und schluchzte und schüttelte verzweifelt seine schlaffe Hand. Und Sylvia, Wilhelms Frau, kapierte gar nicht, dass ihr geliebter Mann soeben gestorben war. Vater rief sofort den Notarzt, aber dieser konnte bei seinem Eintreffen nur noch den Tod meines Bruders feststellen, nachdem er dessen Augen, die ins Leere blickten, für immer geschlossen hatte. Es war ein grauenhafter Abend, und unsere Familie war zutiefst erschüttert, wie man sich gut vorstellen kann.
Wilhelm, den man hinterher obduzierte, hatte sich zu seinen Lebzeiten, und natürlich auch zuletzt, bester Gesundheit erfreut. Er, der Mittdreißiger, war ein guter Fußballer gewesen, er hatte reichlich gejoggt, weder geraucht, noch getrunken, und es wollte uns einfach nicht in den Sinn, dass er so urplötzlich gestorben war. Die anfängliche Diagnose des Notarztes wurde vom Krankenhaus bestätigt:
Hinterwandinfarkt.
01
Wir stehen am offenen Grab von Wilhelm, und der Pfarrer hält seine traurige Rede. Nahezu das halbe Städtchen ist anwesend, wie es scheint. Dutzende von Kränzen umhüllen den Sarg, der auf einem dieser kleinen, schwarzen Wägelchen hergebracht wurde. Es regnet leicht, und viele Leute verstecken sich unter ihren Schirmen. Zudem unterstreicht ein leichter Ostwind die beklemmende Atmosphäre.
Links und rechts türmt sich ein phantastisches Bergmassiv auf, das unser niedliches Städtchen Steinbruck umgibt. Nein, es umgibt es nicht! Es umklammert es regelrecht, denn Steinbruck liegt in einer tiefen Schlucht. Ja, es kommt mir immer wieder so vor, als ob der Ort von einer überdimensionalen Faust in diese tiefe Furt hineingepresst worden wäre. Ich fragte mich schon oft, wer überhaupt auf die Idee gekommen war, genau hier einen Ort zu gründen.
Der Anblick dieser beiden Berge ist gewaltig. Sie wirken ungemein beeindruckend auf den Betrachter. Man kommt sich so wahnsinnig winzig und zerbrechlich vor, wenn man steil nach oben blickt. Was wäre, überlege ich, wenn dieses gewaltige Steinmassiv plötzlich in sich zusammenstürzen würde? Steinbruck würde pulverisiert werden, genau wie all die Menschen und Tiere, die hier leben. Ich glaube, dass jeder einzelne Einwohner unseres Ortes gelegentlich solcherlei Gedanken hat.
„ ...Herr im Himmel. Nimm ihn, unseren guten Wilhelm Goldner in dein Himmlisches Reich auf. Viel zu früh ist er von uns gegangen...“
Sylvia, dieses bildhübsche Weib, steht wie versteinert am offenen Grab ihres verstorbenen Mannes. Ihr Gesicht ist verschleiert. Nun wird der Sarg ganz, ganz langsam in unser Familiengrab hinunter gelassen. Meine Großeltern liegen dort unten, sowie zwei Onkeln, und eine Tante. Die vier Männer in ihren schwarzen Anzügen haben nicht viel zu tragen, denn Wilhelm war ein Leichtgewicht. Wahrscheinlich ist der Sarg schwerer, als er selbst, überlege ich insgeheim. Das Bestattungsinstitut hatte ihn zuvor optisch schön hergerichtet: dunkelblauer Anzug, schwarze Lackschuhe und ein weißes Hemd mit dunkelroter Krawatte. So hatte ich ihn heute Morgen gesehen, als ich einen letzten Blick auf ihn geworfen hatte: stumm, mit gefalteten Händen, lag er in seinem Sarg. Unfassbar. Mutter sagte, dass er seinem Herrn sauber und anständig gekleidet gegenüber treten soll. Ach, was haben wir Menschen doch für seltsame Ideen.
Ich betrachte die vielen Leute, die um mich herumstehen, und plötzlich sehe ich sie: Rebecca Malenko. Sie ist also auch hier, geht es durch meinen Kopf. Ich kenne sie schon, solange ich zurückdenken kann. Damals, als ich noch ein kleiner Bursche war, stand sie vor uns Jungen und verteilte Bonbons. Sie war sehr beliebt bei uns. Das kann man wohl sagen! Die Meinung der Erwachsenen über sie in der Stadt ist jedoch geteilt. Gerade die älteren Leute haben an ihr so Einiges auszusetzen. Man wirft ihr hinter vorgehaltener Hand vor, sich an den Einwohnern von Steinbruck jahrzehntelang bereichert zu haben. Manche bezeichnen sie sogar als alte Hexe. Andere wiederum lassen nichts auf sie kommen.
„Ihr seid meine zukünftigen Kunden! Hört ihr?“, hatte sie uns zugerufen. Und sie lachte dabei ganz unverschämt, wenn sie ihre Süßigkeiten verteilte, auf die wir natürlich ganz scharf waren.
„Wenn es euch irgendwann einmal schlecht gehen sollte, Mädels und Jungs, dann könnt ihr jederzeit in meine Pfandleihe kommen! Ich helfe euch gerne aus eurem Schlamassel!“
Wir wussten damals nicht, was sie damit meinte. Sie hatte nur gesagt, dass sie uns helfen würde. Und genau deswegen mochten wir sie. Nach meiner rechnerischen Schätzung dürfte sie inzwischen mehr als achtzig Jahre alt sein, die gute Rebecca. Aber in meinen Augen ist sie nicht gealtert. Es ist doch seltsam, wie jung sie noch aussieht! Man schätzt sie allerhöchstens auf sechzig Jahre! Wenn überhaupt! Ja, sie könnte auch ohne weiteres als Mittfünfzigerin durchgehen.
Diese Frau ist völlig anders, als ihre Zeitgenossinnen. Man kann sie mit den alten Frauen, die hier in Steinbruck leben, in keiner Weise vergleichen. Alleine, wie sie sich kleidet! Und wie sich bewegt! Die Zeit scheint an ihr vorüber gegangen zu sein.
Auf wie vielen Beerdigungen wird sie wohl in den letzten fünfzig, sechzig Jahren gewesen sein? Auf hundert? Auf zweihundert? Es waren sicherlich mehr.
Sie überlebt sie wohl alle!
Was denkt sich eigentlich ein Mensch in diesem hohen Alter, wenn er zu einer Beerdigung geht? Sieht er sich schon selbst als die kommende Hauptfigur? Ich persönlich hasse Beerdigungen. Ich versuche, sie zu meiden, wann immer es möglich ist. Aber in diesem Fall war es wohl unumgänglich.
„Robert!“, flüstert mir Laura ins Ohr.
„Was ist denn?“
„Die Alte starrt andauernd zu uns herüber!“
„Wirklich?“
„Ja. Hast du es denn noch nicht bemerkt?“
„Du meinst Rebecca?“
„Ja.“
„Nein. Ich habe es nicht bemerkt.“
Selbstverständlich habe ich es längst wahrgenommen! Ich frage mich, warum ich es gegenüber Laura, meiner Freundin, abstreite. Mutter wirft uns einen mahnenden Blick zu. Sie findet es wohl nicht richtig, dass wir hier, am Grab ihres jüngeren Sohnes, flüstern. Sie ist um Jahre gealtert, genau wie mein Vater Edgar. Tief gebeugt steht er am Grabe seines Sohnes, und ich wüsste allzu gerne, was gerade in ihm vor sich geht.
Ich schaue unauffällig zu der „Alten“ hinüber. Die Entfernung zwischen ihr und uns beträgt ungefähr zehn Meter. Sie wirkt fast unscheinbar, zwischen all den anderen Leuten. Aber dies dürfte wohl ein Trugschluss sein. Nein, diese Frau hat es in sich. Man spürt regelrecht die unbändige Lebensfreude, die von ihr ausgeht. Sie hält eine rote Rose in der Hand, die sie wahrscheinlich anschließend in Wilhelms Grab werfen will. Je länger ich sie betrachte, desto unheimlicher erscheint sie mir. Ich versuche, woanders hinzuschauen, aber sie blickt mir direkt ins Gesicht.
Was hat sie nur?
Warum starrt sie mich so an?
Die Rede unseres Pfarrers ist zu Ende. Gott sei Dank. Ich fröstele innerlich, obwohl die Temperatur sehr angenehm ist. Es dürfte wohl um die zwanzig Grad haben, heute, am...
... 20. Mai 1965.
Für meine Eltern und auch für uns direkte Angehörige beginnt der wohl denkwürdigste Moment unseres bisherigen Lebens: ein Trauernder nach dem anderen geht an uns vorbei, kondoliert uns und wirft ein Blümchen in Wilhelms Grab. Der Zug der Kondolierenden will kein Ende nehmen. Es sind sicherlich vierhundert Leute, die Wilhelm das Letzte Geleit geben. Wie vergänglich der Mensch doch ist! Überlege ich. Es hätte genauso gut mich treffen können! Ein Blutpfropfen im Herzen, und alles ist vorbei.
Wie grausam.
Und wie hinterhältig!
Plötzlich steht Rebecca vor uns. Ihr Blick ist unergründlich, als sie Sylvia kondoliert. Wir verstehen aber nicht, was sie zu ihr spricht. Sie geht, nachdem sie Konrad mit der Hand über den Kopf gestrichen hat, einen Schritt weiter, hin zu meinen Eltern, und sagt:
„Mein herzliches Beileid, Rosa und Edgar!“ Und sie schüttelt ihnen die Hände.
Jetzt kommt sie auf uns zu. Wir stehen ja direkt neben meinen Eltern: „Mein Beileid, Laura und Robert. Besonders dir, mein Junge, denn er war dein Bruder.“
Sie greift nach meiner Hand und ich erschrecke, als ich diese kalte Hand in meiner spüre. Ihr Druck ist stark.
„Danke, Rebecca.“, antworte ich mit trockener Kehle.
„Er war ein solch guter Mensch, und ein...
... noch besserer Kunde.“, flüstert sie mir zu.
Was redet sie denn da? Er soll ihr Kunde gewesen sein? Wieso sollte Wilhelm ihre Pfandleihe beehrt haben? Nein, das hätten wir gewusst. Wir, die Familie. Wir sind zwar keine reichen Bauern, aber in ihre Pfandleihe mussten wir bisher noch nicht gehen. Ich werde mich mal mit Sylvia unterhalten müssen, denn grundlos sagte Rebecca dies nicht!
Die Alte hat mich mit ihren Worten völlig verunsichert. Ja, das hat sie geschafft. Laura hatte es glücklicherweise auch gehört. Sie ist meine Zeugin.
Der anschließende Leichenschmaus findet, wie es bei allen Beerdigungen so üblich ist, in unserer Dorfschänke statt. Diese befindet sich direkt am Marktplatz, nahe unserer kleinen Kirche. Hier, in dieser Gaststätte, finden bis zu einhundert Leute Platz. Mutter hat unsere engsten Freunde, sowie einige gute Bekannte, dazu eingeladen. Logischerweise fehlen weder der Bürgermeister, noch der Herr Pfarrer. Die Verwandten, die aus den verschiedensten Städten und Dörfern angereist sind, sind selbstverständlich auch anwesend. Es gibt Kaffee und Kuchen, und Sylvia wird von allen Seiten bedauert. Ich sitze direkt neben ihr, zusammen mit Laura. Unsere Eltern haben gegenüber Platz genommen. Vater bestellt sich einen doppelten Schnaps, und Mutter rügt ihn leise. Weit hinten, in der Ecke, am letzten Tisch, sehe ich Rebecca sitzen. Ihre Andeutung am offenen Grab spukt unentwegt durch meinen Kopf:
„Du, Vater!“, sage ich leise.
„Was ist denn, Robert?“
„Rebecca sagte zu mir, draußen auf dem Friedhof, dass Wilhelm ein guter Mensch, und ein noch besserer Kunde war!“
„Ihr Kunde?“
„Nun, ich nehme es an!“
„Er war doch nicht ihr Kunde!“
„Sie brachte es aber so herüber.“
„Sie spinnt, die Alte.“
„Meinst du wirklich?“
„Ja. Sie war schon immer etwas verrückt.“
Ich frage mich, ob er mit seiner Behauptung richtig liegt. Nein, diese Frau hat ihre Sinne beisammen. Die weitere Unterhaltung lenkt mich etwas von meinen Überlegungen ab. Man redet über Wilhelm, als ob er noch leben würde. Man erzählt sich die eine oder andere Anekdote, bei der er mitgemischt hatte. Man lobt ihn in den höchsten Tönen, was größtenteils berechtigt ist. Bürgermeister Hugo Schlicht erzählt gerade mit erhobener Stimme, was für ein toller Fußballer Wilhelm doch war. Alle Leute um ihn herum sind seiner Meinung, obwohl es die Wenigsten wissen.
Plötzlich fällt mir mein kleiner Neffe Konrad auf: er sitzt schweigend neben seiner Mutter und hat den Kopf in beide Hände gestützt. Sein Blick ist abwesend, wie es scheint.
„Konrad!“
„Ja, Onkel Robert?“
Er ist wirklich geistesabwesend. Wahrscheinlich denkt er gerade über seinen verstorbenen Vater nach.
„Was ist denn mit dir, mein Junge?“
„Was soll denn sein?“
„Bist du so traurig?“
„Ja, Onkel Robert.“
Seine Mutter legt den Arm um seine knochige Schulter. Er, der Knabe, wird nun wohl ihr gesamter Lebensinhalt werden.
Wir, die Familie, leben allesamt auf unserem großen Bauernhof. Sylvia hat natürlich eine eigene Wohnung, genau wie Laura und ich. Laura wohnt erst seit kurzem bei uns. Meine Eltern leben im Haupthaus. Wir nennen es so. Und unsere Magd Johanna und der gute Knecht Max haben ebenfalls eine kleine Wohnung für sich, parallel im Nebengebäude, in dem auch Laura und ich, sowie Sylvia und Konrad leben. Johanna und Max haben sich auf unserem Hof kennen- und lieben gelernt.
Mutter schaut mich an und sagt: „Wir müssen jetzt fest zusammenhalten, Robert.“
„Das haben wir doch immer getan, Mutter!“
„Du weißt schon, wie ich es meine.“
Was meint sie denn? Hat sie Angst, dass Sylvia uns mit Konrad irgendwann verlassen wird? So abwegig ist dieser Gedanke gar nicht! Sie ist noch jung, ich glaube zweiunddreißig, und sie hat ihr Leben noch vor sich. Aber wie ich sie einschätze, wird sie bei uns bleiben. Es wäre ein gewaltiger Schlag für uns, wenn sie auch noch ausfallen würde.
Ich muss nun Wilhelms Arbeit mitmachen. Ich werde es aber alleine nicht schaffen können: all die Tiere, die Felder, der Hof selbst. Vater kann nicht mehr so, wie er gerne möchte. Er hat verschiedene Wehwehchen, die laufend behandelt werden müssen: Arthrose, Gicht und Ischias plagen ihn. Die Hauptlast liegt also auf meinen Schultern.
Wir besitzen sechzig Kühe und ungefähr einhundertdreißig Schweine. All diese Tiere müssen Tag für Tag versorgt werden. Sie kennen keine Feier- oder Ruhetage. All das ist von einer einzigen Person nicht zu bewältigen. Laura, mein Goldschatz, arbeitet nicht auf dem Bauernhof mit. Sie ist Sprechstundenhilfe, und sie ist bei unserem Arzt, Herrn Dr. Dörfler, in der einzigen Praxis hier in Steinbruck, fest angestellt.
Es wird viel getrunken in diesen schweren Stunden. Ich kenne Vaters Blick, wenn er zu viel intus hat. Plötzlich sagt er halblaut:
„Verflucht. Ich kann mir das nicht erklären.“
Mutter schaut ihn von der Seite fragend an und sagt: „Was meinst du, Edgar?“
„Wilhelms Tod.“
„Er hatte einen Herzinfarkt!“
„Ja, ja...“
Ich lege meine Hand auf seine: „Was willst du damit sagen, Vater?“
„Dass ich es nicht verstehen kann. Er lebte so gesund, er war vollkommen fit, und trotzdem soll er an einem Infarkt gestorben sein.“
„Die Ärzte haben ihn obduziert! An der Todesursache gibt es nichts anzuzweifeln!“
„Ich zweifle trotzdem.“
„Woran denkst du, Vater?“