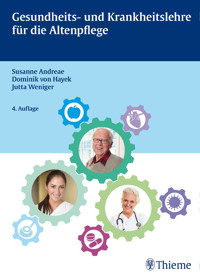29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Thieme
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Express Pflegewissen
- Sprache: Deutsch
Schnelle Aufnahme, lange Wirkung EXPRESS Pflegewissen - Die schnelle Antwort auf alle Ihre Fragen im kleinen, praktischen Format. Das Wichtigste zur Altenpflege in drei Buchteilen: Teil 1 Arbeiten in der Altenpflege Teil 2 Alte Menschen unterstützen und pflegen Teil 3 Altenpflege bei speziellen Erkrankungen - komprimierte, übersichtliche Informationen zum schnellen Nachschlagen - präzise und praxisorientiert aufbereitet - mit wertvollen Praxistipps und vielen prägnanten Merksätzen Mit EXPRESS Pflegewissen sind Sie gewappnet für alle Fragen im Stationsalltag und sparen wertvolle Zeit!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 696
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Kapitelübersicht
Teil 1: Arbeiten in der Altenpflege
1 Der Beruf Altenpflege
2 Der alte Mensch
3 Rahmenbedingungen und Qualitätssicherung
4 Rechtliche und betriebswirtschaftliche Rahmenbedingungen
Teil 2: Alte Menschen fördern, unterstützen und pflegen
5 Anleiten, beraten, Gespräche führen
6 Geplant arbeiten – der Pflegeprozess
7 Alte Menschen bei der Wohnraum- und Wohnumfeldgestaltung sowie der Tagesgestaltung unterstützen
8 Konzepte und rehabilitative Maßnahmen
9 Prophylaxen
10 Unterstützung bei der Selbstpflege
Teil 3: Altenpflege bei speziellen Erkrankungen
11 Bei Diagnostik und Therapie mitwirken
12 Pflege des alten Menschen mit Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems
13 Pflege des alten Menschen mit Erkrankungen der Atmungsorgane
14 Pflege des alten Menschen mit Erkrankungen des Blut- und Lymphsystems
15 Pflege des alten Menschen mit Erkrankungen des Bewegungssystems
16 Pflege des alten Menschen mit Erkrankungen des Verdauungssystems
17 Pflege von alten Menschen mit Erkrankungen des Stoffwechsels
18 Pflege des alten Menschen mit Erkrankungen der Nieren und Harnwege
19 Pflege von Patienten mit Erkrankungen des Nervensystems
20 Pflege des alten Menschen mit Demenz und gerontopsychiatrischen Erkrankungen
21 Pflege des alten Menschen mit Erkrankungen der Geschlechtsorgane
22 Pflege alter Menschen mit Erkrankungen der Haut und der Sinnesorgane
23 Pflege multimorbider, schwerstkranker und sterbender Menschen sowie Pflege bei chronischen Schmerzen
24 Pflege des alten Menschen mit Infektionskrankheiten
Teil 4: Anhang
25 Hygienisches Arbeiten
26 Erste Hilfe
27 Abrechnung von Leistungen in der häuslichen Altenpflege
EXPRESSPflegewissen
Altenpflege
399 Abbildungen56 Tabellen
Georg Thieme Verlag Stuttgart ∙ New York
Bibliografische Information der
Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek
verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte
bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Layout: Melanie Erlewein, Stuttgart
Zeichnungen:
Karin Baum, Mannheim
Regina Bracht, Hattingen
Angelika Brauner, Hohenpreißenberg
Viorel Constantiescu, Bukarest, Rumänien
Roland Geyer, Weilerswist
Martin Heffmann, Ittlingen
Helmut Holtermann, Dannenberg
Fotografen:
Paavo Blåfield, Kassel
Alexander Fischer, Sinzheim-Winden
© 2009 Georg Thieme Verlag KG
Rüdigerstraße 14
D-70469 Stuttgart
Unsere Homepage: http://www.thieme.de
Umschlaggestaltung: Thieme Verlagsgruppe
Umschlagfoto: Alexander Fischer,
Sinzheim-Winden
eISBN: 978-3-13-167481-4
1 2 3 4 5 6
Wichtiger Hinweis: Wie jede Wissenschaft ist die Medizin ständigen Entwicklungen unterworfen. Forschung und klinische Erfahrung erweitern unsere Erkenntnisse, insbesondere was Behandlung und medikamentöse Therapie anbelangt. Soweit in diesem Werk eine Dosierung oder eine Applikation erwähnt wird, darf der Leser zwar darauf vertrauen, dass Autoren, Herausgeber und Verlag große Sorgfalt darauf verwandt haben, dass diese Angabe dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes entspricht. Für Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen kann vom Verlag jedoch keine Gewähr übernommen werden. Jeder Benutzer ist angehalten, durch sorgfältige Prüfung der Beipackzettel der verwendeten Präparate und gegebenenfalls nach Konsultation eines Spezialisten festzustellen, ob die dort gegebene Empfehlung für Dosierungen oder die Beachtung von Kontraindikationen gegenüber der Angabe in diesem Buch abweicht. Eine solche Prüfung ist besonders wichtig bei selten verwendeten Präparaten oder solchen, die neu auf den Markt gebracht worden sind. Jede Dosierung oder Applikation erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Autoren und Verlag appellieren an jeden Benutzer, ihm etwa auffallende Ungenauigkeiten dem Verlag mitzuteilen.
Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
schnell finden, schnell lesen, schnell verstehen. Das ist das Grundkonzept der Reihe Express Pflegewissen. Wenn Sie wenig Zeit auf Station haben, ist die schnelle, übersichtliche Antwort der absolute Trumpf. Die Reihe bietet Ihnen gebündelt Information, die Sie sich durch den Charakter des raschen Nachschlagewerks ganz einfach erschließen können.
Als Erinnerungsstütze finden Sie zu jeder Thematik kurz gefasste Grundlagen und darauf aufbauend spezifische pflegerische und medizinische Fachinformationen, die präzise und praxisorientiert Ihre Fragen beantworten. Ideal für Wiedereinsteiger nach der Elternzeit oder für Pflegende, die den Fachbereich wechseln.
Bewusst haben wir das Format klein und handlich gehalten. Das Buch ist robust und hält jede Menge Wasser- und Desinfektionsmittelspritzer aus. Es ist der ideale Begleiter auf Station. Setzen Sie es dort ein, wo die Fragen entstehen, in der Praxis.
Es werden immer die gleichen Gliederungspunkte verwendet. So finden Sie sich ebenso mühelos in jedem Kapitel zurecht, wie in jedem Band der Reihe. Nicht zuletzt trägt ein schönes Erscheinungsbild des Buches dazu bei, es gerne aufzuschlagen und darin zu blättern.
Wir wünschen Ihnen häufige und schnelle Verwendung und viel Freude am Besitz dieses hochwertigen Buches.
Ihr Thieme-Redaktionsteam
Quellenangaben
Abt-Zegelin A. Bettlägerigkeit ist kein unumkehrbares Schicksal. In: Pro Alter 2 (2003) 48 Andreae S, von Hayek D, Weniger J. Krankheitslehre. 2. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2006
Bär M et al. Emotional bedeutsame Situationen im Alltag demenzkranker Heimbewohner. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 36 (2003): 454ff.
Basler et al. Beurteilung von Schmerz bei Demenz (BESD) – Untersuchung zur Validität eines Verfahrens zur Beobachtung des Schmerzverhaltens. Schmerz 20 (2006): 519-26.
Bienstein C et al. Atmen. Stuttgart: Thieme; 2000
Bienstein C, Fröhlich A. Basale Stimulation in der Pflege. Die Grundlagen. Hannover: Kallmeyer; 2003
Bodenmüller-Kroll R. Dialog in der Pflege. Behandeln oder übersehen? Mundtrockenheit – Ein Leitfaden. Wedel: Medac. Medizinische Gesellschaft für klinische Spezialpräparate; 2001
Brauer H et al. Leitfaden Gedächtnistraining. Stuttgart: memo; 1995
Buchholz T, Gebel-Schürenberg A, Nydahl P, Schürenberg A. Der Körper: eine unförmige Masse – Wege zur Habitationsprophylaxe. In: Die Schwester/Der Pfleger 7 (1998): 570ff.
Charlier S, Hrsg. Soziale Gerontologie. Stuttgart: Thieme; 2007
Darmann I. Moralische Entscheidungsfindung in pflegerischen Situationen. In: Kriesel P. et al. Hrsg. Pflege lehren – Pflege managen. Eine Bilanzierung innovativer Ansätze. Frankfurt a.M.: Mabuse; 2001: 259ff.
Defloor T, Grypdonck M. Do pressure relief cushions really relieve pressure? In: Western Journal of nursing research 2 (1989) 44
Deutsches Netzwerk für Qualitätssicherung in der Pflege, Hrsg. Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege. Osnabrück: Eigendruck Fachhochschule; 2002
Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege, Hrsg. Expertenstandard Sturzprophylaxe in der Pflege. Osnabrück: Sonderdruck DNQP; 2006
Eißing E. Berührung in der Pflege. In: Lauber A, Schmalstieg P. Pflegerische Interventionen, Stuttgart: Thieme; 2004
Fiechter V, Meier M. Pflegeplanung. Eine Anleitung für die Praxis. 10. Aufl. Basel: Recom; 1998
Fröhlich A. Wahrnehmungsstörung und Wahrnehmungsförderung. Heidelberg: Edition Schindele; 1992
Frowein M. Einschätzung der Thrombosegefährdung – Ein Score kann bei der Pflegeanamnese eingesetzt werden. In: Pflegezeitschrift 11 (1997)
Georg J, Frowein M, Hrsg. Pflege Lexikon. Wiesbaden: Ullstein Medical; 1999
Gerlach U et al. Innere Medizin für Pflegeberufe. 7. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2006
Grünewald M. Der Krankenpflegeprozess. Bildungszentrum für Kompetenzentwicklung im Gesundheitswesen. Düsseldorf: Universitätsklinikum Düsseldorf; 2004
Grützner C. ATL Sich waschen und kleiden. In: Kellhauser E. et. al. Hrsg. Thiemes Pflege, 10. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2004
Hirzel-Wille M. Suizidalität im Alter. Individuelles Schicksal und soziales Phänomen. Bern: Peter Lang AG, Europäischer Verlag der Wissenschaften; 2002
Hof H. Mykologie für Mediziner. Stuttgart: Thieme; 2003
IGAP (Institut für Innovationen im Gesundheitswesen und angewandte Pflegeforschung). Dekubitus: Ein drückendes Problem. 10. Aufl. 2006
Juchli L. Pflege. Praxis und Theorie der Gesundheits- und Krankenpflege. 8. Aufl. Stuttgart: Thieme; 1991
Jung E, Moll I. Dermatologie. Duale Reihe. Stuttgart: Thieme; 2003
Kellnhauser E et al, Hrsg. Thiemes Pflege. Professionalität erleben. 10. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2004
Kirschnick O. Pflegetechniken von A – Z. Stuttgart: 3. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2006
Kliegel R et al. Prozessdissoziationen in der kognitiven Altersforschung. In: Kruse A Psychosoziale Gerontologie, Band 1: Grundlagen. Göttingen: Hogrefe; 1998
Knopf M. Gedächtnisleistung und Gedächtnisförderung. In: Kruse A. Psychosoziale Gerontologie, Band 1. Göttingen: Hogrefe; 1998
Köther I, Gnamm E, Hrsg. Thiemes Altenpflege. 1. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2007
Krohwinkel M. Fördernde Prozesspflege – Konzepte, Verfahren und Erkenntnisse. In: Osterbrink J, Hrsg. Erster internationaler Pflegetheorienkongress Nürnberg. Bern: Huber; 1998: 134ff.
Lexikon der Krankheiten und Untersuchungen. 2. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2008
Leymann H. Mobbing. Psychoterror am Arbeitsplatz und wie man sich dagegen wehren kann. Reinbek b. Hamburg: Rowohlt; 1993
Maciejewski B et al. Qualitätshandbuch Leben mit Demenz. Köln: KDA; 2001
Matthes W. Pflege als rehabilitatives Konzept. Hannover: Vincentz; 1993
Medizinischer Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen e.V. Hrsg. Grundsatzstellungnahme Pflegeprozess und Dokumentation – Handlungsempfehlungen zur Professionalisierung und Qualitätssicherung in der Pflege. Essen: MDS; 2005
Metzing S. Schmerzeinschätzung bei Menschen, die nicht sprechen können. In: Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege, Hrsg. Expertenstandard Schmerzmanagement in der Pflege bei akuten oder tumorbedingten chronischen Schmerzen. Osnabrück: Eigendruck Fachhochschule; 2005: 67ff.
Neander K, Birkenfeld R. Der Einfluss verschiedener Lagerungshilfsmittel zur Dekubitusprophylaxe auf den Auflagedruck und den perkutanen Sauerstoffdruck. In: Pflege 1 (1988) 57
Notter LE, Hott JR. Grundlagen der Pflegeforschung, 2. Aufl. Bern: Huber; 1994
Nydahl P, Bartoszek G, Hrsg. Basale Stimulation. Neue Wege in der Pflege Schwerstkranker, 4. Aufl. München: Urban & Fischer; 2003
Oestreicher E et al. HNO, Augenheilkunde, Dermatologie und Urologie für Pflegeberufe. Stuttgart: Thieme; 2003
Paetz B, Benzinger-König B. Chirurgie für Pflegeberufe. 20. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2004
Runge M. Gehstörungen, Stürze, Hüftfrakturen. Darmstadt: Steinkopff; 1998
Schulz von Thun F. Miteinander reden, Band 1–3. Reinbek b. Hamburg: Rowohlt; 1998
Schwerdt R. Eine Ethik für die Altenpflege. Bern: Huber; 1998
Skibbe X, Löseke A. Gynäkologie und Geburtshilfe für Pflegeberufe. 2. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2006
Sökeland J. Katheterismus. 2. Aufl. Balingen: Spitta; 1998
Sökeland J. Urologie für Pflegeberufe, 7. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2000
Sowinski Ch, Maciejewski B. Von schlechten Hilfsmitteln und ungeeigneten Interventionen zu effizienter Prophylaxe und Therapie. In: „Do’s“ und „Don’ts“ in der Dekubitusprophylaxe. Sonderdruck KDA 2002
Stanjek K. Sozialwissenschaften. München: Urban und Fischer; 1998
Tideiksaar R. Stürze und Sturzprävention. Bern: Hans Huber; 2000
Weltgesundheitsorganisation (WHO). Gesundheit 21 – Gesundheit für alle im 21. Jahrhundert. Kopenhagen: Europ. Schriftenreihe „Gesundheit für alle“ Nr. 6., WHO Regionalbüro für Europa; 1998
Wiesemann C, Erichsen N, Behrendt H et al. Pflege und Ethik. Leitfaden für Wissenschaft und Praxis. Stuttgart: Kohlhammer; 2003
Mitarbeiterverzeichnis
Dr. Susanne Andreae
Fachärztin für Allgemeinmedizin
Dozentin an Krankenpflegeschulen,
Lehrbeauftragte für Allgemeinmedizin
an der Universität Freiburg
Lärchenweg 26
78713 Schramberg
Günter Baier
Dipl.-Verwaltungswirt
Resper Gasse
17 51674 Wiehl
Christine Bäumler
Sport- und Gymnastiklehrerin,
Kinästhetiktrainerin, Trainerin für
Sturzprävention
Fliederweg 13
73116 Wäschenbeuren
Christiane Becker
Lehrerin für Pflegeberufe
Hamelmannstr. 12
44141 Dortmund
Renate Berner
Krankenschwester,
Dipl-Pflegewirtin (FH)
Lindpaintnerstr. 74
70195 Stuttgart
Dr. Ingo Blank
Arzt, Dozent, Journalist
Burgenstraße 33
71116 Gärtingen
http://www.ingoblank.de
Carmen Boczkowski
Krankenschwester,
Pflegedienstleitung
Parkinson-Zentrum
Gertrudis Klinik Biskirchen
Karl-Ferdinand-Broll Str. 2-4
35638 Leun-Biskirchen
Dr. Bettina Brinkmann
St. Bonifatius Hospital
Klinik für Urologie und Kinderurologie
Wilhelmstr. 13
49808 Lingen (Ems)
Dr. Olaf Anselm Brinkmann
Chefarzt
Klinik für Urologie und Kinderurologie
Wilhelmstr. 13
49808 Lingen (Ems)
Siegfried Charlier
Dipl.-Pädagoge und Dipl.-Supervisor (DGSv)
Auf dem Korb 58a
51789 Lindlar
Dr. Ilona Csoti
Chefärztin
Parkinson-Zentrum Gertrudis Klinik Biskirchen
Karl-Ferdinand-Broll Str. 2-4
35638 Leun-Biskirchen
Sieglinde Denzel
Dipl.-Psychologin
Martinsberg 14
78564 Reichenbach am Heuberg
Marcus Eck
Krankenpfleger und Praxisanleiter
Klinikum Region Hannover
Krankenhaus Hannover Nordstadt
Haltenhoffstr. 41
30167 Hannover
Eva Eißing
Krankenschwester, Lehrerin für
Pflegeberufe
Im Steeler Rott 22
45276 Essen
Dr. Bärbel Ekert
Dipl.-Psychologin, Theologin
Mörikestr. 13
72532 Gomadingen
Christiane Ekert
Dipl.-Psychologin
Robert-Leicht-Str. 141b
70569 Stuttgart
Petra Fickus
Krankenschwester,
Fachkrankenschwester für Intensivpflege,
Dipl-Pflegepädagogin (FH)
Johannes-Gutenberg-Universitätskliniken
Weiterbildung in den Gesundheitsfachberufen
Am Pulverturm 13
55101 Mainz
Renate Fischer
Krankenschwester mit Fachweiterbildung für
Endoskopie,
Dipl.-Pflegepädagogin (FH)
Schule für Gesundheits- und Krankenpflege
Katholisches Klinikum Koblenz
Thielenstr. 13
56073 Koblenz
Dr. Ferenc Fornadi
Ärztlicher Direktor
Gertrudis Klinik Biskirchen
Karl-Ferdinand-Broll-Str. 2-4
35638 Leun-Biskirchen
Michaela Friedhoff
Pflegeinstruktorin Bobath BIKA®
Kursleiterin für Basale Stimulation,
Pflegedienstleitung
HELIOS-Klinik Holthausen
Am Hagen 20
45527 Hattingen/Ruhr
PD Dr. Gert Gabriëls
Arzt für Innere Medizin, Nephrologie,
Diabetologie, Hypertensiologie
Leitender Oberarzt, Medizinische Klinik
und Poliklinik D
Universitätsklinikum Münster
Albert-Schweitzer-Str.33
48149 Münster
Else Gnamm
Altenpflegerin, Lehrerin für Altenpflege
Schubertstr. 21
72800 Eningen
Elke Goldhammer
Pflegewissenschaftlerin (FH),
Fachkrankenschwester für die Pflege in der Onkologie
Kursleitung Palliative Care, Kursleitung
Weiterbildung Pflege in der Onkologie
Universitätsklinikum Münster
Weiterbildungsstätte für Intensivpflege,
Anästhesie u. Pflege in der Onkologie
Schmeddingstr. 56
48129 Münster
Matthias Grünewald
Dipl. Pflegepädagoge
Fachkrankenpfleger für Intensivpflege und
Anästhesie
Universitätsklinikum Düsseldorf
Bildungszentrum
Moorenstr. 5
40225 Düsseldorf
Felicitas Grundmann
Gesundheits- und Krankenpflegerin
Breite Straße 86a
58452 Witten
Astrid Hammer
Krankenschwester Dipl.-Pflegepädagogin (FH)
Hebammenschule Johannes-Gutenberg-Universitätskliniken
Am Pulverturm 13
55101 Mainz
Anja Heißenberg
Krankenschwester, Dipl.-Pflegepädagogin (FH)
Hoffmannstraße 26
63165 Mühlheim am Main
Walter Hell
Richter am Amtsgericht
Am Alten Einlaß 1
86150 Augsburg
Eva Hokenbecker-Belke
Dipl. Pflegewirtin (FH), Fachkrankenschwester für Intensivpflege und Anästhesie
Case Managerin (DGCC), Qualitätsmanagementbeauftragte (QMB-TÜV)
Lippstädter Str. 34
59510 Lippetal
Gundula Höppner
Krankenschwester, Praxisanleiterin,
Kinästhetiktrainerin
Ostertor 20
32469 Petershagen
Prof. Dr. Christian Jassoy
Univ.-Professor für Virologie
Institut für Virologie und Immunbiologie
Johannisallee 30
04103 Leipzig
Lotte Kaba-Schönstein
Prof. Dipl.-Soz.päd, Dipl.-Soz.wirtin
Hochschule Esslingen
Flandernstr. 101
73732 Esslingen
Dr. Mette Kaeder
Neurologin, Sozialmedizinerin
Ltd. Oberärztin der Neurologischen Klinik
Helios Klinik Ambrock
Ambrocker Weg 60
58091 Hagen-Ambrock
Olaf Kirschnick
Leiter der Berufsfachschule für Pflegeberufe
am Kreiskrankenhaus Tauberbischofsheim
Albert-Schweitzer-Straße 35
97941 Tauberbischofsheim
Elke Kobbert
Projektverantwortliche im Bildungszentrum des Robert-Bosch-Krankenhauses Stuttgart
Franz-Knauff-Str. 15
69115 Heidelberg
Ilka Köther
Lehrerin für Pflegeberufe,
Krankenschwester, Fachkrankenschwester für
Gemeindekrankenpflege
Manchesterstr. 36
33604 Bielefeld
Dr. Dr. Heidemarie Kremer
University of Miami
Department of Psychology
Dickinson Drive, 37D
Coral Gables, FL 33124
USA
Vera Kuhlmann
Gemeinschaftskrankenhaus
Gerhard-Kienle-Weg 18
58313 Herdecke
Andreas Kutschke
Pflegewissenschaftler BCsN,
Krankenpfleger für geriatrische Rehabilitation
Hochstr. 23
41189 Mönchengladbach
Annette Lauber
Krankenschwester, Dipl.-Pflegepädagogin (FH)
Ausbildungszentrum für Pflegeberufe Robert-Bosch-Krankenhaus
Auerbachstr. 110
70376 Stuttgart
Birte Mensdorf
Krankenschwester, Lehrerin für Pflegeberufe,
Kommunikationswirtin
Ludwig-Pfau-Str. 20
70175 Stuttgart
Susanne Mettrop
Krankenschwester, Lehrerin für Pflegeberufe
Bitzenweg 15a
51789 Waldbröl
Nicole Meyer
Dipl.-Pflegewirtin (FH)
Oberhabbach 3
51789 Lindlar
Ricky Nusser-Müller-Busch, MSc (Neureha)
Ltd. Logopädin, F.O.T.T.-Instruktorin
Unfallkrankenhaus Berlin
Abteilung Logopädie
Warener Str. 7
12683 Berlin
Peter Nydahl
Krankenpfleger, Kurs- und Weiterbildungsleiter
Basale Stimulation in der Pflege
Sternstr. 2
24116 Kiel
Rainer Ochel
Dipl.-Verwaltungswirt
Am Stockweg 7
51645 Gummersbach
Jürgen Ohms
Dipl. Pflegepädagoge (FH)
Leitung Contilia Akademie GmbH
St.-Marien-Hospital
Kaiserstr. 50
45468 Mülheim an der Ruhr
Dr. Brigitte Osterbrink
Leiterin der Akademie für Gesundheitsberufe
Mathias-Spital Rheine
Frankenburgstr. 31
48431 Rheine
Philipp Papavassilis
Assistenzarzt
UKM Klinik und Poliklinik für Urologie
Albert-Schweitzer-Str. 33
48149 Münster
Dr. Klaus Maria Perrar
Leitender Oberarzt der Abteilung für
Gerontopsychiatrie
Rheinische Kliniken Düren
Meckerstr. 15
52353 Düren
Ursula Pfäfflin-Müllenhoff
Altenpflegerin, Lehrerin i.R.
Am Rennerweiher 3
90562 Heroldsberg
Johanne Plescher-Kramer
Krankenschwester Fachkrankenschwester für
Anästhesie und Intensivpflege,
Dipl.-Pflegepädagogin (FH) Grafschafter Klinikum gGmbH Krankenpflegeschule
Albert-Schweitzer-Str. 10
48527 Nordhorn
Hartmut Rolf
Lehrer für Pflegeberufe (Diplom)
Schulleiter Fachschule für Altenpflege der
Wilhelmshilfe e.V.
Marbachstr. 11
73035 Göppingen
PD Dr. Claudia Rössig
Oberärztin
Universitätskinderklinik Münster
Pädiatrische Hämatologie und Onkologie
Albert-Schweitzer-Str. 33
48149 Münster
Brigitte Sachsenmaier
Lehrerin für Pflegeberufe, Stomatherapeutin
Ziegelstr. 42
73084 Salach
Sabine Sappke-Heuser
Juristin
Klosterberg 3
53804 Much
Andreas Schilde
Staatlich anerkannter Altenpfleger und
TQM-Beauftragter
Goldhähnchenweg 19
12359 Berlin
E-Mail: [email protected]
Dr. Christof Schnürer
Facharzt für Innere Medizin
Facharzt für Allgemeinmedizin
Römerstr. 6
79410 Badenweiler
Joachim Scholz
Lehrer für Pflegeberufe, Pflegedienstleiter
Wiesenstraße 8
51766 Engelskirchen
E-mail: webmasterjoachimscholz.de
PD Dr. Andreas Schwarzkopf
Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie, Ö.b.u.b. Sachverständiger für Krankenhaushygiene
Mangelsfeld 4
97708 Bad Bocklet-Großenbrach
Hannelore Seibold
Krankenschwester, Dipl.-Sozialpädagogin
Manchesterstr. 36
33604 Bielefeld
Erika Sirsch, BScN, MScN
Krankenschwester für Geriatrische
Rehabilitation
Domhofstr. 6
46519 Alpen
Franz Sitzmann
Fachkrankenpfleger für Krankenhaushygiene, tätig in verschiedenen Krankenhäusern,
Altenpflegeheimen, heilpädagogischen
Einrichtungen
Weg zum Poethen 87
58313 Herdecke/Ruhr
Prof. Dr. Dr. Jürgen Sökeland
em. Direktor der Urologischen Klinik
Dortmund
Institut für Arbeitsphysiologie an der
Universität
Ardeystr. 67
44139 Dortmund
Annegret Sow
Diplom-Pflegepädagogin (Univ.)
Klinikum Region Hannover GmbH
Schulzentrum
Roesebeckstr. 15
30449 Hannover
Dr. Karin Steinhage
Journalistin
Inspirative Communication oHG
Tresckowstr. 62
20253 Hamburg
Gabriele Steinhäußer
Krankenschwester, Lehrerin für Pflegeberufe
Friedrichstr. 22
73614 Schorndorf
Raimund Stollberg
Dipl.-Sozialarbeiter, Dipl.-Gerontologe
Hauptstr. 36a
51519 Odenthal
Heiner Terodde
Praxisanleiter, Fachkrankenpfleger für
Intensivpflege u. Anästhesie
Oberschwabenklinik gGmbH
Elisabethenstraße 15
88212 Ravensburg
Ruth Uessem
Stellv. Leiterin Fachseminar
Pflegeberufe VHS Oberbergischer Kreis
Lebrechtstr. 27
51647 Gummersbach
Lothar Ullrich
Ltd. Lehrer für Pflegeberufe, Supervisor,
Fachkrankenpfleger
Weiterbildungsstätte für
Intensivpflege & Anästhesie und Pflege in der Onkologie
Universitätsklinikum Münster
Schmeddingstr. 56
48129 Münster
Maike Unger
Stationsleitung
Gemeinschaftskrankenhaus
Gerhard-Kienle-Weg 4
58313 Herdecke
Jutta Weniger
Krankenschwester, Dipl.-Pflegepädagogin (FH)
Herdstr. 16/1
78050 Villingen-Schwenningen
Susanne Werschmöller
Krankenschwester
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke
Gerhard-Kienle-Weg 4
58313 Herdecke
Thomas Werschmöller
Krankenpfleger im intensivmedizinischen
Bereich, Primary Nurse, Stationsleitung
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke
Gerhard-Kienle-Weg 4
58313 Herdecke
Dr. Felicitas Witte
Ärztin und Wissenschaftsjournalistin
Rheinländerstr. 12
4056 Basel
Schweiz
PD Dr. Christian Wülfing
Klinik und Poliklinik für Urologie
Universitätsklinikum Münster
Albert-Schweitzer-Str. 33
48129 Münster
Dr. Dietmar Zinßer
Internist, Diabetologe DDG
Marktstr. 54
71364 Winnenden
Inhaltsverzeichnis
Teil 1: Arbeiten in der Altenpflege
1 Der Beruf Altenpflege
1.1 Altenpflegegesetz
1.2 Berufsverbände und -organisationen
1.3 Pflegeforschung und praktische Anwendung
1.4 Im Team arbeiten
1.5 Gesund bleiben im Beruf
1.6 Konflikte und Krisen
2 Der alte Mensch
2.1 Alter als Veränderungsprozess
2.2 Ethniespezifische und interkulturelle Aspekte
2.3 Glaubens- und Lebensfragen
2.4 Familie und soziale Beziehungen
3 Rahmenbedingungen und Qualitätssicherung
3.1 Säulen der Sozialversicherung
3.2 Träger, Dienste und Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens
3.3 Vernetzung, Koordination, Kooperation
3.4 Pflegeüberleitung
3.5 Qualitätssicherung – ein Überblick
3.6 Fachaufsicht
4 Rechtliche und betriebswirtschaftliche Rahmenbedingungen
4.1 Grundrechte
4.2 Schweigepflicht und Datenschutz
4.3 Arbeits- und Zivilrecht
4.4 Vorsorgemöglichkeiten
4.5 Heimrecht und Heimaufsicht
4.6 Finanzierung von Leistungen
4.7 Arbeitsorganisation
Teil 2: Alte Menschen fördern, unterstützen und pflegen
5 Anleiten, beraten, Gespräche führen
5.1 Kommunikationsmodell von Schulz von Thun
5.2 Regeln der Kommunikation
5.3 Kommunikative Grundhaltung
5.4 Vorüberlegungen zum Gespräch
5.5 Gesprächsarten
5.6 Technik der Gesprächsführung
5.7 Alltagsberatung und berufliche Beratung
5.8 Beratung Angehöriger
5.9 Die Vier-Stufen-Methode zur Anleitung
6 Geplant arbeiten – der Pflegeprozess
6.1 Schritt 1: Informationen sammeln
6.2 Schritt 2: Pflegeprobleme und Ressourcen erkennen
6.3 Schritt 3: Pflegeziele planen
6.4 Schritt 4: Pflegemaßnahmen planen
6.5 Schritt 5: Durchführung der Pflege
6.6 Schritt 6: Pflegeevaluation
7 Alte Menschen bei der Wohnraumund Wohnumfeldgestaltung sowie der Tagesgestaltung unterstützen
7.1 Alten- und behindertengerechte Gestaltung der Wohnung
7.2 Technische Ausstattung
7.3 Unfallverhütung
7.4 Grundlagen der Haushaltshygiene und -organisation
7.5 Hilfe bei der Alltagsstrukturierung
7.6 Themenorientierte Aktivierungsangebote
7.7 Kreatives Werken, Malen, Arbeiten mit Ton und Handarbeiten
7.8 Spiele, Singen, Musizieren
7.9 Gedächtnistraining und Gehirnjogging
7.10 Tierhaltung und Tierbetreuung
7.11 Alte Menschen und Medien
7.12 Seniorenvertretungen
8 Konzepte und rehabilitative Maßnahmen
8.1 Gesundheitsförderung und Prävention
8.2 Unterstützung pflegender Angehöriger bei präventiven Maßnahmen
8.3 Rehabilitation
8.4 Biografiearbeit
8.5 Kinästhetik
8.6 Basale Stimulation
8.7 Realitätsorientierungstraining
8.8 Gedächtnistraining
8.9 Validation
8.10 Snoezelen
8.11 10-Minuten-Aktivierung
9 Prophylaxen
9.1 Dekubitusprophylaxe
9.2 Pneumonieprophylaxe
9.3 Thromboseprophylaxe
9.4 Sturzprophylaxe
9.5 Kontrakturenprophylaxe
9.6 Zystitisprophylaxe
9.7 Obstipationsprophylaxe
9.8 Prophylaxe von Mundschleimhautveränderungen
10 Unterstützung bei der Selbstpflege
10.1 Sich bewegen
10.2 Sich pflegen
10.3 Essen und Trinken
10.4 Ausscheiden können
10.5 Ruhen und schlafen
10.6 Sich als Mann oder Frau fühlen und verhalten
10.7 Mit existenziellen Erfahrungen des Lebens umgehen können
Teil 3: Altenpflege bei speziellen Erkrankungen
11 Bei Diagnostik und Therapie mitwirken
11.1 Rechtliche Grundlagen und Rahmenbedingungen
11.2 Bei der ärztlichen Visite mitwirken
11.3 Umgang mit Geräten (Medizinproduktegesetz)
11.4 Medikamente richten und verabreichen
11.5 Injektionen
11.6 Richten und Anschließen von i.v. Infusionen
11.7 Zentraler Venenkatheter
11.8 Umgang mit Portsystemen
11.9 Verbandwechsel
11.10 Wundbehandlung
11.11 Inhalation
11.12 Sauerstoffgabe
11.13 Absaugen der oberen Atemwege
11.14 Wechsel und Pflege der Trachealkanüle
11.15 Puls messen
11.16 Blutdruck messen
11.17 Blutzucker messen
11.18 Flüssigkeit bilanzieren
11.19 Mittelstrahlurin gewinnen
11.20 Urinuntersuchung
11.21 Harnblase katheterisieren
11.22 Einläufe und digitale Ausräumung
11.23 Versorgung eines Kolostomas und Urostomas
11.24 Irrigation
12 Pflege des alten Menschen bei Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems
12.1 Koronare Herzkrankheit
12.2 Herzinfarkt
12.3 Herzinsuffizienz
12.4 Endokarditis
12.5 Herzrhythmusstörungen
12.6 Hypertonie
12.7 Arterielle Verschlusskrankheit
12.8 Akuter Arterienverschluss
12.9 Varikosis
12.10 Thrombophlebitis
12.11 Phlebothrombose
13 Pflege des alten Menschen bei Erkrankungen der Atmungsorgane
13.1 Akute Bronchitis
13.2 Chronisch obstruktive Bronchitis
13.3 Asthma bronchiale
13.4 Aspirationspneumonie
13.5 Lungenembolie
13.6 Lungenemphysem
13.7 Lungenödem
13.8 Bronchialkarzinom
14 Pflege des alten Menschen bei Erkrankungen des Blut- und Lymphsystems
14.1 Anämie
14.2 Leukämie
15 Pflege des alten Menschen bei Erkrankungen des Bewegungssystems
15.1 Osteoporose
15.2 Morbus Bechterew
15.3 Subkapitale Humerusfraktur
15.4 Schenkelhalsfraktur und TEP
15.5 Koxarthrose
15.6 Rheumatoide Arthritis
16 Pflege des alten Menschen bei Erkrankungen des Verdauungssystems
16.1 Refluxkrankheit
16.2 Magengeschwür
16.3 Magenkarzinom
16.4 Zwerchfellhernie
16.5 Cholelithiasis
16.6 Pankreatitis
16.7 Pankreaskarzinom
16.8 Leberzirrhose
16.9 Reizdarmsyndrom
16.10 Darmkarzinom
16.11 Ileus
16.12 Peritonitis
17 Pflege von alten Menschen bei Erkrankungen des Stoffwechsels
17.1 Diabetes mellitus
17.2 Hyperthyreose
18 Pflege des alten Menschen mit Erkrankungen der Nieren und Harnwege
18.1 Chronische Niereninsuffizienz
18.2 Akutes Nierenversagen
18.3 Blasenentzündung
18.4 Pyelonephritis
18.5 Nephrolithiasis
18.6 Inkontinenz
19 Pflege von Patienten bei Erkrankungen des Nervensystems
19.1 Schlaganfall
19.2 Morbus Parkinson
19.3 Zerebrale Krampfanfälle
19.4 Multiple Sklerose
20 Pflege des alten Menschen bei Demenz und gerontopsychiatrischen Erkrankungen
20.1 Demenzen
20.2 Delir
20.3 Depression
20.4 Abhängigkeitserkrankungen im Alter – Beispiel Alkoholabhängigkeit
20.5 Besonderheiten in der Pflege von Menschen mit gerontopsychiatrischen Erkrankungen
21 Pflege des alten Menschen mit Erkrankungen der Geschlechtsorgane
21.1 Descensus uteri
21.2 Mammakarzinom
21.3 Vulvakarzinom
21.4 Benigne Prostatahyperplasie
21.5 Prostatakarzinom
22 Pflege alter Menschen mit Erkrankungen der Haut und der Sinnesorgane
22.1 Chronische Wunden
22.2 Pilzerkrankungen
22.3 Grauer Star
22.4 Glaukom
22.5 Sehbehinderung und Blindheit
22.6 Altersschwerhörigkeit
23 Pflege multimorbider, schwerstkranker und sterbender Menschen sowie Pflege bei chronischen Schmerzen
23.1 Pflege multimorbider Menschen
23.2 Unterstützung schwerstkranker und sterbender Menschen
23.3 Schmerzsyndrom
24 Pflege des alten Menschen bei Infektionskrankheiten
24.1 AIDS
24.2 Herpes zoster
24.3 Tuberkulose
Teil 4: Anhang
25 Hygienisches Arbeiten
25.1 Desinfektion
25.2 Hygienische Händedesinfektion
25.3 Umgang mit sterilen Handschuhen
25.4 Schutzhandschuhe kontaminationsfrei ausziehen
26 Erste Hilfe
26.1 Überprüfen der Vitalfunktionen
26.2 Schock
26.3 Verbrennung/Verbrühung
26.4 Elektrounfall
26.5 Erfrierung
26.6 Unterkühlung
26.7 Verätzung
26.8 Vergiftung
26.9 Wundversorgung
26.10 Frakturen
26.11 Schädel-Hirn-Trauma (SHT)
26.12 Kardiopulmonale Reanimation
27 Abrechnung von Leistungen in der häuslichen Altenpflege
27.1 Einige Rechtsgrundlagen für die Abrechnung
27.2 Abrechnung in der Häuslichen Pflege nach SGB XI
27.3 Abrechnung in der Häuslichen Krankenpflege nach SGB V
Sachregister
Teil 1:
Arbeiten in der Altenpflege
Der Beruf Altenpflege
Der alte Mensch
Rahmenbedingungen und Qualitätssicherung
Rechtliche und betriebswirtschaftliche Rahmenbedingungen
1 Der Beruf Altenpflege
1.1 Altenpflegegesetz
Definition: Mit dem am 01.08.2003 in Kraft getretenen Altenpflegegesetz wird die Ausbildung in der Altenpflege erstmals bundeseinheitlich geregelt. Es umfasst z.B. Bestimmungen zur Dauer und Zielsetzung der Ausbildung.
Die Ausbildung in der Altenpflege soll die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln, die zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Pflege einschließlich der Beratung, Begleitung und Betreuung alter Menschen erforderlich sind. Dies umfasst u.a. die geplante Pflege alter Menschen, Mitwirken an der Behandlung und Rehabilitationskonzepten kranker alter Menschen, Gesundheitsberatung und die Begleitung Sterbender.
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung. Die praktische Ausbildung in der Altenpflege findet primär in stationären sowie in ambulanten Pflegeeinrichtungen statt. Einzelne Abschnitte der praktischen Ausbildung können in anderen Einrichtungen stattfinden (z.B. geriatrische Rehabilitationseinrichtungen, Einrichtungen der offenen Altenhilfe, usw.). Die rechtlichen Strukturen der Ausbildung in der Altenpflege werden in Abb. 1.1 dargestellt.
Definition: Die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für den Beruf der Altenpflegerin und des Altenpflegers trat am 26.11.2002 in Kraft. Sie macht konkrete Angaben über die verschiedenen Bereiche der Ausbildung, z.B. zu:
Gliederung von theoretischer und praktischer AusbildungPflicht zu Jahreszeugnissen, Benotung und TeilnahmebescheinigungenPrüfungseinzelheiten, Bestimmungen zur Führung der BerufsbezeichnungAbb. 1.1 Strukturen der Ausbildung der Altenpflege.
1.2 Berufsverbände und –organisationen
Definition: Berufsverbände sind vorwiegend auf freiwilliger Basis gebildete, fachlich organisierte Vereinigungen mit dem Ziel gemeinsamberufliche, wirtschaftliche und kulturelle Interessen der Mitglieder zu wahren und nach außen hin zu vertreten (Meyers Taschenlexikon 24 Bände, 1983).
Bündelung der Interessen möglichst vieler Angehöriger eines Berufs um Interessen z.B. gegenüber Gesetzgeber und Öffentlichkeit durchzusetzen
Forum zur Diskussion und Klärung berufsspezifischer Fragen
bevorzugter Zugang zu beruflich relevanten Informationen, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Mitglieder sowie sonstige Vergünstigungen
Berufsverbände und Organisationen der Pflege (Auswahl).
DBVA
(Deutscher Berufsverband für Altenpflege): Er beschäftigt sich als einziger Pflegeverband ausschließlich mit der Interessenvertretung der Altenpflege.
DBfK
(Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe): Er fördert im Bereich Altenpflege z.B. „die Unterstützung professionell Pflegender in ihrem kompetenten Handeln und ihrer beruflichen Entwicklung“.
DPR
(Deutscher Pflegerat): Er hat als Dachorganisation und Bundesarbeitsgemeinschaft der Pflegeverbände das Ziel, die „Positionen der Pflegeorganisationen zu koordinieren und deren politische Durchsetzung zu steuern.“
Pflegekammer. Eine Pflegekammer existiert bislang nicht; ein entsprechender Förderverein bemüht sich, diese zu bilden. Ziel der Pflegekammer soll sein, eine sachgerechte professionelle Pflege sowie die ordnungsgemäße Berufsausübung zu gewährleisten.
Definition: Eine Kammer ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Ihr Auftrag liegt in der beruflichen Selbstverwaltung, der Berufsaufsicht, der Förderung des Berufsstandes durch Berufsausbildung und Fortbildung und in der Vertretung des Berufszweiges nach außen.
ICN International Council of Nurses. Der ICN ist ein Zusammenschluss von 122 nationalen Berufsverbänden der Pflege und vertritt weltweit Millionen von Pflegenden. Der Verband hat zum Ziel, Pflege von hoher Qualität für alle sicherzustellen und sich für eine vernünftige Gesundheitspolitik weltweit einzusetzen. Der Vertreter Deutschlands ist der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) e.V.
Landespflegekonferenzen.
Gremium der Landesregierungen der Bundesländer
konstruktive Diskussion und Beratung für die Akteure der Pflege
Forum für die Förderung und Weiterentwicklung der Pflege
Sicherung einer zeitgemäßen, klientenorientierten Pflege
Maßnahmen und Offensiven gegen Fachkräftemangel in der Pflege
„Runder Tisch Pflege“.
einberufen vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und dem Bundesministerium für Gesundheit
Vertreter aus Verbänden, Ländern, Kommunen, Praxis und Wissenschaft
Themen u.a.: Gewinnung einer ausreichenden Personenzahl für Pflegeberufe, Möglichkeiten zur Verringerung des Verwaltungsaufwands in der Pflege
1.3 Pflegeforschung und praktische Anwendung
1.3.1 Grundlagen der Pflegeforschung
Definition: „Im strengsten Sinne befasst sich die Pflegeforschung mit der systematischen Untersuchung der Pflegepraxis sowie mit den Auswirkungen dieser Praxis auf die betroffenen Kranken bzw. die Gesundheit der gesamten Bevölkerung“ (Notter u. Hott 1994).
Wer forscht?
normalerweise forschungskompetente Berufsangehörige
auch andere Wissenschaften, z.B. die Sozioökonomie, z.B. zur Erkenntnisgewinnung über Organisation, Stellung und Bedeutung der Pflege
Wie wird geforscht?
Pflegeforschung stellt und bearbeitet Fragen aus pflegerischer Perspektive.
Pflegeforschung forscht systematisch, d.h. mit Konzept und Theorie.
Pflegeforschung ist eine Wissenschaft: Sie bedient sich gültiger und verlässlicher Methoden, z.B. der Empirie (= Feldstudie) usw.
Forschungsaspekte
Forschung zur Pflegepraxis
beschäftigt sich z.B. mit traditionellen oder neuen Pflegemethoden oder Pflege als Beziehungsprozess wie
Gefühlsarbeit in der Pflege (Paseka 1991; Overlander 1994),
Kälte- und Wärmebehandlung als Dekubitusprophylaxe (Bienstein u.a. 1990).
Forschung zum Pflegemanagement
beschäftigt sich mit Pflege als Organisation und Institution, also z.B. mit
Arbeitszeitstrukturen, Organisationssystemen der Pflege,
wirtschaftlichen und berufspolitischen Fragestellungen.
Forschung zur Pflegeausbildung und Weiterbildung
beschäftigt sich z.B. mit
Lehr- und Lernprozessen, Ausbildungsbedingungen und -inhalten,
Curriculumentwicklung, Pflegegeschichte.
Merke: Pflegeforschung befasst sich in erster Linie mit der Effektivität pflegerischen Handelns und mit den dieses Handeln unmittelbar beeinflussenden Faktoren. Was Pflegende tun und wie sie es tun, wird eingebunden in ein theoretisches Konzept.
1.3.2 Praktische Anwendung der Pflegeforschung
Pflegeforschung wird nicht zum Selbstzweck betrieben, sondern u.a. mit dem Ziel, die Pflegepraxis zu verbessern. Das bedeutet, dass pflegepraktische Themen zum Gegenstand der Pflegeforschung werden und in der Praxis vorherrschende Fragen und Probleme aufgegriffen und gültige Antworten gesucht werden.
Umsetzung von Forschungsergebnissen
Zweck.
Erzeugung und Sicherung von Qualität in der Pflege
Reduktion von Pflegefehlern, Erzeugung höherer Patientenzufriedenheit
ökonomischere Gestaltung pflegerischer Arbeit zum Wohl des Patienten
Steigerung der Berufsidentität der Pflegenden durch die Verbesserung der Pflege
Verdeutlichung der therapeutischen Relevanz der Pflege durch Pflegeerfolge auf der Basis wissenschaftlich gesicherter Erkenntnisse
Notwendige Veränderungen. Wenn Forschungsergebnisse für die Pflegepraxis nützlich und in der Praxis anwendbar sein sollen, dann müssen die gewonnenen Erkenntnisse vor allem den Praktikern zugänglich gemacht werden. Die Anwendung von Forschungsergebnissen bedeutet:
Veränderungen im Arbeitsablauf innerhalb von Gesundheitseinrichtungen
Veränderungen auf struktureller oder organisatorischer Ebene
Veränderungen bei den Pflegenden, z.B. ein Umdenken, um sich neuen Abläufen zu öffnen oder ein Abschied von traditionellen Maßnahmen
Standards
Nationale Expertenstandards
Diese Standards werden von Fachpersonen entwickelt, die auf dem jeweiligen Gebiet besondere Kenntnisse besitzen. Durch eine kritische Bewertung des aktuellen Forschungsstands spiegeln Expertenstandards den aktuellen Stand der Pflegewissenschaft zu zentralen pflegerischen Themen wider. Sie sind in 3 Ebenen unterteilt:
Strukturebene
. Welche Rahmenbedingungen sollten gegeben oder welche Arbeitsmittel sollten vorhanden sein? Hier geht es z.B. um Verantwortungsbereiche und erforderliche Kompetenzen des Personals.
Prozessebene
. Was wird von wem wie getan?
Ergebnisebene
. Wie ist der Ist-Zustand nach Durchführung geeigneter Maßnahmen? Welche Ziele wurden erreicht?
DNQP (Deutsches Netzwerk für Qualitätssicherung in der Pflege). Dies ist ein Zusammenschluss von Pflegenden, die sich mit Qualitätsentwicklung in der Pflege befassen. Es leitet und begleitet die Entwicklung der Expertenstandards:
Ein neuer Standard wird von ca. 10 bis 12 Fachexperten erstellt.
In einer Fachkonferenz wird er vorgestellt, diskutiert und verabschiedet.
Danach wird er vom DNQP im Internet und in Buchform veröffentlicht.
Anschließend wird der neue Standard in ca. 20 Einrichtungen getestet.
Praxisstandards
Praxisstandards werden von Pflegeteams für die eigene Einrichtung entwickelt oder käuflich erworben (z.B. Stösser-Dekubitusprophylaxe-Standard). Sie beschreiben das fachliche Qualitätsniveau, das in der jeweiligen Einrichtung tatsächlich umgesetzt werden soll und enthalten meist detaillierte Handlungsanweisungen. Praxisstandards können auf der Grundlage von Expertenstandards entwickelt werden.
1.4 Im Team arbeiten
Definition: Ein Team ist mehr als eine Anzahl von zusammenarbeitenden Menschen. Es entsteht erst durch die Entwicklung bestimmter sozial-emotionaler Gruppenstrukturen.
1.4.1 Kennzeichen von Team und Teamarbeit
Team.
emotionale Bindung an die Gruppe und starker Zusammenhalt („Wir-Gefühl“)
gemeinsame Leistungsverantwortung
wechselseitige Beziehungen zwischen den Teammitgliedern
teaminterne Rollen, Positionen, Normen und Kommunikationsformen
Teamarbeit.
Übernahme von Verantwortung, auch für die Gruppenleistung
Zielorientierte und effiziente Zusammenarbeit; offene Kommunikation
Engagement entsprechend der Fähigkeiten in gleichem Ausmaß
Unterstützung und Ergänzung der Teammitglieder; hohe Motivation
gleiche Rechte und Pflichten für alle (mit Ausnahme des Teamleiters)
deutliches Gefühl der Zugehörigkeit und Zusammengehörigkeit
Neben Erfolgen des Teams sind auch Erfolge einzelner Teilnehmer möglich und willkommen.
1.4.2 Teamfähigkeit
Definition:Teamfähigkeit ist die Fähigkeit, sich in eine Gruppe konstruktiv und sozial zu integrieren, und somit die eigenen Kompetenzen in Zusammenarbeit mit den Gruppenmitgliedern zugunsten des Gruppenziels und des Gruppenzusammenhaltes einzusetzen.
sprachliche Kompetenz, Interaktions- und Konfliktfähigkeit
Kooperations- und Konsensfähigkeit: Fähigkeit zu Zusammenarbeit, Toleranz, Rücksichtnahme, Engagement für das Gruppenziel
Integrationsfähigkeit: Fähigkeit zu integrierendem Wirken in der Gruppe
Merke: Sollten im Team Konflikte auftreten, ist Kommunikation eine Möglichkeit der Konfliktbewältigung (s. hier). Manchmal ist eine autoritäre Klärung des weiteren Vorgehens die nötige Richtlinie für eine gelingende Kommunikation.
Unterschiedliche informelle Rollenverteilung
Oft übernehmen einzelne Teammitglieder in einer informellen Rollenverteilung Rollen, die nirgends offiziell festgeschrieben sind (nach Belbin 1996):
Der
„Macher“
versucht Prozesse voranzutreiben.
Der
„Beobachter“
hält sich zunächst zurück, analysiert die Situation.
Der
„Teamarbeiter“
zeigt gute Kooperation zugunsten des Gruppenzieles.
Der
„Spezialist“
benatwortet Spezialfragen mit hoher Sachkenntnis.
Der
„Perfektionist“
achtet auf Fehlerfreiheit und übernimmt vieles selbst.
Der
„Fürsorgende“
ist informell Ansprechpartner für Sorgen und Nöte.
Merke: Insgesamt gilt es, die Verschiedenartigkeit des Teams konstruktiv zu nutzen: Ältere Bewohner, die ihre Enkel vermissen, freuen sich über Gespräche mit jungen Auszubildenden oder Praktikanten. Migranten können von Pflegenden betreut werden, die ihre Muttersprache sprechen.
1.4.3 Interdisziplinäre Zusammenarbeit
Um die bestmögliche pflegerische und medizinische Versorgung alter Menschen zu gewährleisten ist die Zusammenarbeit verschiedener Bereiche nötig. So gehören zu Teams in der Altenpflege nicht nur die Pflegenden, sondern auch die Mitarbeiter der Hauswirtschaft und technische Dienste, Verwaltungsmitarbeiter usw. sowie bei häuslichen Pflegediensten die Einsatzleitungen, Sachbearbeiterinnen usw.
Grundvoraussetzung für das Gelingen von Rehabilitationsmaßnahmen (s. hier) ist Kommunikation und Kooperation im therapeutischen Team, also z.B. mit der Physiotherapie, der Ergotherapie, aber auch der Seelsorge, dem Sozialdienst usw. Hier stellt das Pflegeheim oder der häusliche Pflegedienst häufig eine Schnittstele für Informationen, Terminabsprachen und die weitere Ablaufplanung dar.
Zusammenarbeit mit Ärzten
Die Pflegende informiert den Hausarzt, wenn sich Pflegesituation oder Krankheitsbild ändern. Sie ist die Informantin für den Arzt, denn dank des regelmäßigen Kontakts kann sie Änderungen im Zustand des Bewohners oder Kunden der häuslichen Pflege viel schneller erkennen als der betreuende Arzt, der den Patienten nur bei gelegentlichen Hausbesuchen sieht.
Wichtig ist nicht nur, sich gegenseitig zu informieren – auch eine gegenseitigeWertschätzung ist nötig. Wenn der Arzt die Informationen oder Pflegevorschläge der Pflegenden nicht ernst nimmt oder diese sich nicht um die Anweisungen des Hausarztes kümmert, ist keine vernünftige Versorgung des Patienten möglich. Werden Änderungen in den Pflegemaßnahmen nötig, muss der Arzt diese in der Pflegedokumentation vermerken, um für eine lückenlose Dokumentation zu sorgen.
Merke: Koordinator der Zusammenarbeit aller medizinischen Leistungen ist der Hausarzt. Er stellt Überweisungen zu Fachärzten aus, berät den Patienten und begleitet ihn medizinisch.
1.5 Gesund bleiben im Beruf
1.5.1 Arbeitsschutzmaßnahmen
Eine erhöhte Infektionsgefahr entsteht durch
Verletzung mit kontaminierten Kanülen oder Lanzetten,
Kontamination von wunden Stellen z.B. mit infektiösem Blut, Urin oder Sekret,
Kontamination der Schleimhäute von Augen, Mund und Nase durch Blutspritzer,
Hepatitis B und C sowie HIV-Infektionen.
Entsorgung von benutzten Materialien
gebrauchte Kanülen nach Gebrauch nicht wieder in die Kanülenhülle stecken
Kanülen sofort nach Gebrauch persönlich in einer speziellen Box entsorgen
Spritzen, scharfe und zerbrechliche Gegenstände nur umschlossen entsorgen
Abfallsammelsysteme müssen speziell für spitze und scharfe Gegenstände beschaffen sein. Diese Abfallbehälter
umschließen die Abfälle sicher; sind verschließbar, bruch- und stichfest,
dürfen Abfälle bei Stoß, Druck oder Fall nicht freisetzen,
sind durchdringungsfest und feuchtigkeitsresistent.
Verhalten bei Nadelstichverletzung oder Verletzung mit kontaminiertem Material
Maßnahmen bei Stich- und Schnittverletzung:
Blutung der Wunde anregen
Wunde mit alkoholischem Präparat desinfizieren
Wunde mit einem Verband schützen
Kontamination der Schleimhaut:
kontaminierte Stellen mit PVP-Jod desinfizieren
sofort gründlich mit destilliertem Wasser (Aqua dest.) oder 0,9%-iger Kochsalzlösung abspülen
Kontamination von wunden Hautstellen:
kontaminierte Stellen mit PVP-Jod desinfizieren
Kontamination der intakten Haut:
intakte Haut mit einem alkoholischen Präparat desinfizieren
Verletzungen melden:
unverzüglich Betriebsarzt über Verletzung bzw. Kontamination informieren
jede Verletzung dokumentieren und Berufsgenossenschaft melden
1.5.2 Rückenschonendes Arbeiten
Organisatorische Maßnahmen
Überblick über die bestehende Situation und die Tätigkeit verschaffen:
Wie sieht z.B. das Funktions- und Krankheitsbild des Betroffenen aus?
Welche Art Kraftanstrengung und Muskeleinsatz wird entstehen?
Welche Hilfsmittel stehen Ihnen dazu zur Verfügung?
Sollte eine helfende Kollegin unterstützend einbezogen werden?
Hebepraxis
Bett auf die richtige Höhe anpassen
nicht heben, wo man ziehen kann
körpernah arbeiten
Drehen ohne starke Rotation des Rumpfes
immer mit beiden Armen gleichzeitig arbeiten, Rücken gestreckt halten
Wirbelsäule durch Anspannen der Rumpfmuskulatur stabilisieren
eins nach dem anderen: erst anheben, dann die Last umsetzen
größere Lasten auf kleinere Gewichtseinheiten verteilen
Merke: Das kinästhetische Modell (s. hier) ist ein Bestandteil des rückenschonenden Arbeitens. Es soll bei sämtlicher Unterstützung, z.B. bei der Körperpflege, beim An- und Auskleiden oder beim Ausscheiden, einbezogen werden.
1.5.3 Psychohygienische Strategien und Maßnahmen
Definition:Psychohygiene ist die „Lehre von der Pflege geistig-seelischer Gesundheit.“ (Wörterbuch der Psychiatrie und medizinischen Psychologie). Psychohygiene umfasst die Entwicklung von Handlungskompetenzen, die eine angemessene Auseinandersetzung mit den Anforderungen der Umwelt ermöglichen. Synonym: Sozialhygiene, psychische Hygiene
Es gilt das Prinzip, individuelle Stresssituationen zu erkennen, und daraus Bewältigungsstrategien zu entwickeln:
1. Schritt: Erkennen der Situation.
Welche belastende Situation? Wie hoch ist der Leidensdruck?
Welche Störungen oder Erkrankungen liegen vor?
2. Schritt: Bewertung und Einschätzung der belastenden Ereignisse.
persönliche Einstellung gegenüber stressauslösenden Situationen
Umgang mit Stresssituationen: z.B. Ärger, Konflikte, Probleme
Bewertung: Welche Bedeutung haben die Ereignisse für mich?
Sind Stresssituationen vermeidbar oder unvermeidbar?
Transparenz der Rolle im Team: Rollenkonflikt, Erwartungsdruck
3. Schritt: Entwicklung von Bewältigungsstrategien.
sich öffnen: Konflikte ansprechen und gemeinsam nach Lösungen suchen
Stress vermeiden: z.B. realistisches Zeitmanagement, Neinsagen lernen
Abgrenzung des Berufs- und Privatlebens bei ausgleichender Freizeitplanung
Entspannungstechniken, z.B. progressive Muskelentspannung, Yoga
Üben und Erfahren neuer Verhaltensmuster, berufliche Weiterbildung
Sorge um Feedback bei KollegInnen, Leitungen, ggf. Supervison
an organisatorischen Veränderungen mitwirken, ggf. Psychotherapie
1.5.4 Weitere Möglichkeiten der Gesundheitsförderung
soziale Unterstützung: z.B. soziales Netz in der Familie, Partnerschaft
Supervision: Analyse und Klärung von Prozessen in der Arbeit und im Team
Organisationsberatung: z.B. durch strukturierende Maßnahmen
Organisationsentwicklung: z.B. durch die Entwicklung von Leitbildern
Zeitmanagement: z.B. durch Tagespläne oder -listen, Prioritäten setzen
persönlicher Arbeitsstil: z.B. Biorhythmus, Schlaf und Ernährung beachten
1.6 Konflikte und Krisen
1.6.1 Umgang mit ethischen Konfliktsituationen
In der Altenpflege entstehen häufig ethische Konfliktsituationen, die die Balance zwischen Abhängigkeit und Selbstbestimmung (oder Autonomie) berühren. Pflegende müssen darauf vorbereitet sein, eigene Entscheidungen zu treffen, die praktische Konsequenzen nach sich ziehen können. In der Altenpflege sind dies z.B. Konfliktsituationen, in denen
Betroffene Wünsche äußern, die ihrem Wohl abträglich sind (z.B. Verweigerung von Medikamenten, Nichteinhalten der Bettruhe),
Pflegende sich zum einen ihrer Einrichtung verpflichtet fühlen und zum anderen den Anforderungen der Betroffenen,
unterschiedliche Werte im Umgang mit Menschen mit Migrationshintergrund zu Konflikten führen.
Zwischen Abhängigkeit und Selbstbestimmung
Im ganzheitlichen Menschenbild steht der Mensch im Mittelpunkt (Abb. 1.2): Körper, Seele und soziales Umfeld sind eine Einheit. Ein zu hohes Ausmaß an Fürsorglichkeit behindert die Selbstbestimmung der Bewohner, für die ein Recht auf Achtung der Autonomie formuliert werden kann.
Recht auf Achtung der Autonomie
Recht auf „informierte Zustimmung“:
Recht auf ausreichende, verständliche Information, um die eigene Lage einschätzen zu können.
Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Leib
sowie
Recht auf Einwilligung oder Ablehnung einer Handlung.
Recht auf Selbstbestimmung in Bezug auf das Eigenwohl:
Recht über pflegerische und medizinische Eingriffe individuell zu entscheiden.
Recht auf Wahl zwischen möglichen Alternativen:
Ernst zu nehmende Alternativen sind nicht immer, jedoch in den meisten Fällen vorhanden.
Recht auf eine möglichst geringe Einschränkung des Handlungsspielraums:
z.B. die Möglichkeit geben, eigene Kleidung zu tragen (Wiesemann, Erichsen, Behrendt et al. 2003,
s. hier
ff).
Abb. 1.2 Mensch und Umgang. a Das ganzheitliche Menschenbild stellt den Menschen in den Mittelpunkt und betrachtet ihn in seiner Gesamtheit. b Im Umgang wird berücksichtigt, was der Mensch benötigt, um sich als Mensch zu fühlen.
Merke: Pflegekräfte tragen Verantwortung für die Bedingungen der Entscheidungsfindung, z.B. eine ausreichende Informiertheit, nicht aber für das Handeln und die Entscheidung des Betroffenen selbst.
In einem ethischen Konflikt moralisch handeln
Voraussetzung hierfür ist die Entscheidungs- und Handlungsfreiheit und das Vorhandensein von Handlungsalternativen. Um den Einfluss von emotionalen Faktoren (Gefühlen) einzuschränken sollten ethische Einschätzungen möglichst im Gespräch mit anderen Pflegenden vorgenommen werden.
Problemstellung
Beispiel: Eine Bewohnerin wünscht, auf den Rücken gedreht zu werden und damit auf ihren gerade granulierenden Dekubitus. Die Pflegende sieht den Erfolg der langen Wundbehandlung schwinden.
Hier stehen folgende Normen in einem Spannungsfeld zueinander:
Norm der Selbstbestimmung der Bewohnerin, Norm der Gesundheitsfürsorge
finanzielle Aspekte (Norm der sozialen Zuträglichkeit in Bezug auf das kollektiv finanzierte Gesundheitssystem)
Analyse
Prüfung der Handlungsalternativen. Zunächst steht eine realitätsgetreue und sachgerechte Erfassung der Situation im Vordergrund. Dabei sind Handlungsalternativen zu prüfen (z.B. 30-Grad-Lagerung oder Rückenlage für wenige Minuten). Hier sind Sachkompetenz mindestens ebenso wichtig wie die Fähigkeit zur moralischen Reflexion.
Prüfung der Handlungsfolgen. Die Handlungsfolgen bzw. Wirkungen der pflegerischen Handlungen sind abzuschätzen und abzuwägen. Dabei ist die Fähigkeit der Betroffenen zur Selbstbestimmung und eine evtl. Schädigung der Pflegenden oder anderer Personen, die sich verletzt fühlen, weil ihre Bemühungen untergraben werden, zu prüfen. Aufgrund der ungleichen Machtstruktur und der Verletzlichkeit und Hilflosigkeit der Bewohnerin sollte deren Position bei der Abwägung der Folgen besonderes Gewicht beigemessen werden (Darmann in Kiesel 2001, s. hierff).
1.6.2 Aggression und Gewalt in der Pflege
Aggression
Definition: Unter aggressivem Verhalten versteht man Verhaltensweisen, die eine Schädigungsabsicht beinhalten.
Gewaltempfindung und Aggressivität. Es muss unterschieden werden zwischen Gewaltempfindung und Aggressivität. Gewaltempfindung wird aus der Sicht des Opfers definiert, Aggressivität wird als Schädigungsabsicht vom Täter her definiert.
Gewalt
Definition: Beim Gewaltbegriff wird unterschieden:
personelle Gewalt: als von einer einzelnen Person ausgehend empfundeninstitutionelle Gewalt: Strukturen und Regeln einer Einrichtung werden als mit einer Schädigungsabsicht verbunden erlebt.Bestimmte Regeln der Hausordnung und der Tagesstruktur eines Pflegeheimes können als Gewalt erlebt werden, z.B. wenn es nur zu festen Zeiten Essen gibt, man zu bestimmten Zeiten schlafen soll oder die Verabreichung von Medikamenten.
Beispiel: Eine Pflegende kommt in das Zimmer einer demenziell erkrankten Bewohnerin und spricht sie an: „Guten Morgen, Frau Gebauer, ich möchte Sie waschen“. Sie deckt die Bewohnerin auf und beginnt mit der Körperpflege. Aus Frau Gebauers Perspektive sieht die Situation so aus: Sie liegt tief schlafend im Bett, die Schwester kommt, zieht die Bettdecke weg und macht sie nass. Sie empfindet dieses Verhalten als störend und glaubt, man wolle ihr etwas antun.
Die Bewohnerin im Beispiel empfindet die pflegerische Handlung als Gewalt, obwohl vonseiten der Pflegenden keinerlei Schädigungsabsicht (Aggression) vorliegt. Andererseits werden abwehrende Verhaltensweisen von Bewohnern häufig als „aggressiv“ bewertet, aber oft nicht ausreichend hinterfragt. Geeignete Fragen sind z.B.: „War wirklich ich gemeint?“ oder „Möchte mich tatsächlich jemand schädigen?“.
Merke: Absicht des Handelnden und Empfindung des Betroffenen stimmen in der Pflege häufig nicht überein. Geeignet sind hier der Perspektivwechsel (s. hier), der z.B. hinterfragt: „Wie empfindet die Bewohnerin meine Pflegehandlung?“ oder, bei abwehrendem Verhalten, Maßnahmen der basalen Stimulation (s. hier).
1.6.3 Berufstypische Konflikte
Helfer-Syndrom
Definition: Unter Helfer-Syndrom versteht man eine Konstellation von Persönlichkeitsfaktoren, die eine Entstehung des Burn-out-Syndroms begünstigen.
Merkmale der Helfer-Persönlichkeit
Man ist nicht in der Lage, Wünsche zu äußern oder sich Wünsche selbst zu erfüllen. Sie werden angesammelt und meist zu spät als Vorwürfe geäußert.
Es besteht ein starkes Bedürfnis, gebraucht zu werden.
Es bestehen starke Abhängigkeitsbeziehungen. Nein sagen fällt schwer.
Die eigene Belastungsgrenze wird nicht wahrgenommen oder ignoriert.
Man kann sich nicht vorstellen, Anerkennung und Zuneigung zu bekommen, ohne für andere etwas getan, eine Leistung erbracht zu haben.
Privatbeziehungen sind asymmetrisch; bestehen zu „Hilfebedürftigen“.
Es fällt schwer, Hilfe anzunehmen. Von Patienten wird dies aber erwartet.
Lob und Anerkennung können nicht angenommen werden. Stattdessen fallen Bemerkungen wie „Das ist doch selbstverständlich“, „Ich tue doch nur meine Pflicht“. Eigene Kommentare wie „Das ist mir wirklich gut gelungen“ fehlen.
Burn-out-Syndrom
Definition:Burn-out ist ein psychischer und/oder physischer Erschöpfungszustand nach anhaltendem berufsbedingtem Stress (Abb. 1.3).
Ursachen
Rollenkonflikt
zwischen idealisiertem Berufsbild und Berufsrealität
fachliche Anforderungen
: Veränderungen, Verantwortung, Zeitdruck
emotionale Belastungen
: Konfrontation mit Verlusten und Tod
zwischenmenschliche Konflikte
: mit Partner, Mitarbeitern, Patienten
organisatorische Bedingungen
: politische Ebene, Arbeitszeiten, Leitung
Persönlichkeitsstruktur
: Stress, Helfer-Persönlichkeit
Verlauf
enthusiastische Phase
: Begeisterung für den Beruf
Stagnation und Frustration
: Verlust von Idealen; Enttäuschungserlebnisse
Apathie
: Rückzug, Gleichgültigkeit, Schuldgefühle
körperlicher und psychischer Zusammenbruch
: häufige, lange Fehlzeiten
Kennzeichen
körperliche und emotionale Erschöpfung
zynisch-abwertende Haltung gegenüber dem Hilfesuchenden
Gefühl, der beruflichen Aufgabe nicht mehr gewachsen zu sein
Abb. 1.3 Burn-out-Prozess. In jeder der typischen Phasen gibt es Möglichkeiten, den Prozess des Ausbrennens zu unterbrechen.
Prävention und Bewältigungsstrategien
Wahrnehmung von Problemen mittels lösungsorientierter Sichtweise
Selbstpflegekonzept, z.B. sorgfältige Psychohygiene (
s. hier
)
Merke: Die lösungsorientierte Sichtweise befördert eine Lösungsfindung mit „ja, und…“-Überlegungen anstatt sie mit „ja, aber“-Äußerungen zu blockieren. Zum konstruktiven Umgang mit Problemen gehören Ideenentwicklung, Kreativität, Bewegung, Humor und Lachen.
Mobbing
Definition: „Der Begriff Mobbing beschreibt negative kommunikative Handlungen, die gegen eine Person gerichtet sind (von einer oder mehreren anderen Personen) und die sehr oft über einen längeren Zeitraum hinaus vorkommen und damit die Beziehung […] kennzeichnen“ (Leymann 1993).
Ursachen
betriebliche Organisationsstrukturen, Konfliktfähigkeit der Beteiligten
Führungsstil der Vorgesetzten, beteiligter Personenkreis
Verlauf
Phase: ungelöste Konflikte, Schuldzuweisungen, persönliche Angriffe
Phase: systematische Schikane, Verweigerung einer Klärung, Isolation
Phase: betriebliche Fehlentscheidungen (z.B. Abmahnung wegen Fehlzeiten)
Phase: Eigenkündigung, langfristige Krankschreibungen, Frühpensionierung
Kennzeichen
ständige Wiederholung feindseliger Handlungen über einen langen Zeitraum
Ausgrenzung einer Person durch Beleidigungen und Schikanen
zunehmende Unterlegenheit einer Partei bei zunehmender Macht der anderen
Wechselbeziehung von Angriff und Abwehr; nicht nur Täter und Opfer
Einbeziehung anderer als Zuschauer, Weggucker oder Helfer und Mittäter
Entwicklung eines gruppendynamischen Prozesses
Mobbing-Handlungen.
Angriffe auf die Möglichkeit, sich mitzuteilen: z.B. durch ständiges Unterbrechen
Angriffe auf die sozialen Beziehungen: z.B. man wird wie Luft behandelt
Angriffe auf das soziale Ansehen: z.B. man verbreitet Gerüchte
Angriffe auf die Qualität der Berufs- und Lebenssituation: z.B. man weist dem Betroffenen keine Arbeitsaufgabe zu oder gibt ihm ständig neue Aufgaben
Angriffe auf die Gesundheit: z.B. Androhung von körperlicher Gewalt
Mobbing-Betroffene.
haben schwache Positionen oder werden in einem Betrieb neu eingestellt
haben eine besonders gute Qualifikation und zeigen sehr gute Leistungen
fallen irgendwie auf, z.B. durch eine Besonderheit oder eine Behinderung
sind gerade in den Beruf eingetreten oder stehen vor dem Rentenalter
gehören einer Minderheit an
Merke: Mobbing verstößt gegen die Grundrechte, die im Grundgesetz verankert sind (Artikel 1 bis 3, s. hier). Durch die Verletzung der Menschenwürde macht sich die Mobbing ausübende Person strafbar. Nach dem Strafgesetz werden Beleidigungen, üble Nachreden oder Tätlichkeiten verfolgt.
Prävention
Durch den einzelnen Mitarbeiter.
Psychohygiene; Stressbewältigungsmechanismen (
s. hier
)
Aufbau eines sozialen Netzes; Erweiterung der Kommunikationsfähigkeiten
Weiterbildung im Umgang mit Konflikten; Ansprechen betroffener Personen
Verweigerung, destruktives Verhalten (z.B. Schikanen) zu unterstützen
Durch den Betrieb.
Schaffung eines motivierenden Arbeitsklimas durch den Führungsstil
Fortbildungsangebote in Stressbewältigung und Konfliktfähigkeit
Schaffung eines Bewusstsein für die Gefährlichkeit des negativen Verhaltens
Ansprechpartner für Streitfälle sowie Einzel- und Teamsupervision anbieten
Bewältigungsstrategien
sich aktiv verhalten: sich wehren, anstatt das Geschehen zu übersehen
Problem ansprechen: beim richtigen Adressaten Unterstützung suchen
Mobbing-Berater hinzuziehen: geschulte Fachkräfte einsetzen
gerichtliche Schritte: Betroffene bekommen oft Recht.
2 Der alte Mensch
2.1 Alter als Veränderungsprozess
2.1.1 Physiologische Alterungsprozesse
Der biologische Alterungsprozess ist noch nicht genau erklärbar. Vermutlich wirken zahlreiche Prozesse nebeneinander; die Theorien lauten wie folgt:
„genetische Regulation“
: Verursachung des Alterungsprozesses durch sog. Geronto-Gene
Zellschädigung
: Verursachung von Zellschäden durch sog. Radikale, die nicht repariert werden und zu einer Funktionseinschränkung der Zelle führen
Abnahme funktioneller Reserven
: altersbedingt abnehmende Reserven, mit denen der Mensch auf Belastungen reagieren kann
Veränderungen der einzelnen Organsysteme
Herz-Kreislauf-System
abnehmende Elastizität der Arterien im Kreislauf-System
Rückgang der Dehnbarkeit der Arterien durch Ablagerungen in der Gefäßwand
steigender Druck im Gefäßsystem (sowohl diastolisch als auch systolisch)
Zunahme der durchschnittlichen Herzmuskeldicke in der linken Kammer
abnehmende Pumpleistung, verminderte Versorgung durch die Herzkranzgefäße
Atmungsorgane
Elastizitätsverlust des Lungengewebes, zunehmende Starrheit des Brustkorbs
Abnahme des Lungenvolumens und der Vitalkapazität
geringere Sauerstoffaufnahme in den Lungen, geringerer Sauerstoffgehalt im Blut
herabgesetzte Selbstreinigungsfunktion der Atemwege
Nierenfunktion und Flüssigkeitshaushalt
Nieren.
regelmäßige altersbedingte, krankhafte Funktionseinschränkungen
keine normale Nierenfunktion mehr bei älteren Menschen
Flüssigkeitshaushalt.
auf 50% herabgesetzter Wassergehalt des Körpers (von 60%); dadurch stärkere Auswirkungen von Veränderungen im Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt
herabgesetzte Empfindlichkeit für Durstgefühl durch abnehmende Ausschüttung des Dursthormons ADH, selbst bei Flüssigkeitsmangel
Harnwege.
abnehmendes Fassungsvermögen der Harnblase mit vermehrtem Wasserlassen
Prostatavergrößerung, verlangsamte Blasenentleerung („Wasserlassen auf Raten“)
Verdauungssystem
Abnahme der Darmbewegungen, Verlangsamung des Transports mit Verstopfung
weniger Verdauungssekrete durch Rückbildung von Magen- und Darmschleimhaut
geringere Aufnahme von z.B. Eisen, Kalzium, Vitaminen
Blutzuckerspitzen durch Abnahme der Leistung von Leber und Pankreas
verlangsamter Abbau und verstärkte Wirkung von Alkohol
Blut- und Immunsystem
Abnahme des blutbildenden Knochenmarks mit verlangsamter und herabgesetzter Antwort der körpereigenen Immunabwehr gegenüber Infektionen
ausbleibende Vermehrung der Leukozyten mit Anfälligkeit für Infektionen
langsamere Nachbildung von Erythrozyten mit anhaltender Anämie
Bewegungsapparat
Muskulatur.
stetige Abnahme der Muskelmasse (bei 60- bis 70-Jährigen um ca. 30%)
allgemeiner Kraft- und Leistungsverlust sowie die Neigung zu Fehlstellungen in den Gelenken, da die Stabilisierung durch die Muskeln geringer wird
Knochen.
Abnahme des Kalksalzgehaltes der Knochen mit Verschmälerung des inneren Gerüsts der Knochen und erhöhter Knochenbrüchigkeit (Frakturgefahr)
Osteoporose durch Versiegen der Östrogenproduktion in den Wechseljahren
Verlust des Knorpelüberzuges mit Abnutzungsprozessen der Gelenke, führt zu einer schmerzhaften Funktionseinschränkung des Gelenkes (Arthrose)
Haut
Rückbildung des Unterhautfettgewebes
trockenere schlaffere, weniger elastische und empfindlichere Haut
bräunliche Pigmentflecken an lichtexponierten Stellen („Altersflecken“)
Nervensystem
Verlust von Nervenzellen im gesamten Nervensystem
auch beim gesunden älteren Menschen Auftreten der für die Alzheimerdemenz typisch veränderten Nervenzellen („Alzheimerfibrillen“)
Abnahme des Hirngewichts um 40–50% (Altersatrophie)
zunehmender Gehalt an Wasser (Liquor) im Gehirn
abnehmendes Reaktionsvermögen: langsamere Entscheidungen in unübersichtlichen Situationen, verzögerte Orientierung, erschwerte Gedächtnisbildung
Sinnesorgane
häufig Seh- und Hörbeeinträchtigungen und Schwerhörigkeit
Hormonsystem
Die normalen Altersveränderungen im Hormonsystem betreffen bei beiden Geschlechtern in erster Linie die Geschlechtshormone. Diese Veränderungen haben Auswirkungen auf zahlreiche Organe, aber auch auf das subjektive Verarbeiten des „Älterwerdens“.
Bei Frauen.
Nachlassen der Bildung der Geschlechtshormone Östrogen und Progesteron in den Eierstöcken zwischen dem 45. und 60. Lebensjahr
Ausbleiben der Periodenblutung und Ende der Fortpflanzungsfähigkeit
Beckenbodenschwäche, Harninkontinenz sowie Anstieg des Risikos für Osteoporose oder Herzinfarkt durch die fehlende Wirkung des Östrogens
Hitzewallungen, Schwitzen, Schlafstörungen oder Kopfschmerzen im Rahmen dieser „Wechseljahre“ (Klimakterium), aber auch massive psychische Probleme wie Nervosität, Stimmungslabilität oder Depressionen
Bei Männern.
„Wechseljahre“ mit hormonellen Veränderungen zwischen dem 45. und 65. Lebensjahr und Auswirkungen auf Körper und Seele
Prostatavergrößerung, nachlassende sexuelle Lust und Erektionsstörungen durch Nachlassen der Testosteronproduktion in den Hoden
Osteoporose, Fettgewebszunahme, Blutarmut oder Muskelabbau durch starkes Absinken des Testosteronspiegel
auch Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen oder Depressionen
Andere Hormone.
Auch hier lässt die Wirkung im Alter nach, sei es durch die Abnahme der Empfindlichkeit für ein Hormon (z.B. beim Adrenalin) oder durch eine verminderte Ausschüttung durch die Hormondrüsen (z.B. bei der Schilddrüse).
Die Auswirkungen sind nicht so schwerwiegend wie bei den Geschlechtshormonen.
2.1.2 Soziale Veränderungsprozesse
Bis ins Alter steht der Mensch in sozialen Beziehungen. Heute gestalten sich die Lebenssituationen bezüglich der Kontakte höchst unterschiedlich: Der eine Mensch lebt in seiner Partnerschaft und hat viele Angehörige, der andere ist allein. Ausschlaggebend dafür können folgende Faktoren sein:
bisherige Teilnahme am sozialen Leben in der Familie, im Bekanntenkreis sowie in der kommunalen oder kirchlichen Gemeinde
Verfügbarkeit von Rollen oder Aufgaben
Bewegungsradius: Ist der alte Mensch mit Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln mobil oder ist nicht einmal das Verlassen von Wohnung oder Bett möglich?
finanzielle Situation, sozialer Status
Kommunikationsmöglichkeiten (Hörvermögen, Mediennutzung usw.)
Abhängigkeit von anderen Menschen, z.B. durch Pflegebedürftigkeit
Psychische Veränderungen
Emotionalität. Während viele Menschen im höheren Lebensalter eine gewisse Gelassenheit entwickeln, kommt es auch häufig zu einer verstärkten affektiven Labilität mit Weinen, Reizbarkeit oder Zornesausbrüchen; Verhaltensweisen, die man sich früher nicht erlaubte. Depressive Verstimmungen und Depressionen nehmen im Alter zu. In diesem Zusammenhang ist auch auf die erhöhte Suizidrate in dieser Altersgruppe hinzuweisen.
Persönlichkeit. Persönliche Eigenheiten können mit dem Alter abflachen oder verstärkt hervortreten. So wird manch strenger Vater als Opa sanfter, Sparsamkeit kann sich im Alter zu Geiz entwickeln. Die Fähigkeit, auf körperliche, psychische und soziale Einflüsse angemessen zu reagieren, nimmt bei manchen älteren Menschen ab. So kann es zu einer anhaltenden Trauerreaktion kommen, wenn der Verlust eines Menschen, eines Gegenstandes oder der Tod eines Tieres zu beklagen ist.
2.2 Ethniespezifische und interkulturelle Aspekte
2.2.1 Kultur als Orientierungssystem
Eine Kultur ist ein Orientierungssystem,
an dem eine Gesellschaft und die darin eingebundenen einzelnen Menschen ihr Handeln ausrichten,
das u.a. aus Symbolen, Repräsentations- und Kommunikationsmitteln besteht,
dessen symbolische Mittel wie Sprache, Wohnstile und Rituale sich an die gesellschaftlichen Bedingungen anpassen,
deren Angehörige das gleiche Verständnis dieser symbolischen Mittel haben.
Aspekte der Migration
Definition:Migration bedeutet einen (i.d.R. freiwilligen) Ortswechsel mit längerfristigem Aufenthalt in einem anderen Staat. Man unterscheidet:
Migranten der 1. Generation: Menschen, die selbst zu-/ auswandertenMigranten der 2. und 3. Generation: die Kinder von Migranten und deren Kindeskinder, die ihren Eltern gefolgt sind bzw. im Aufnahmeland geboren WurdenDie Wertvorstellungen, Ideen und Bedeutungsinhalte verschiedener Kulturen unterscheiden sich. Sie führen zur Abgrenzung. Dies führt u.a. dazu, dass Migranten, die von einer Kultur in eine andere wechseln
häufig mit ihren bisherigen Deutungsmustern nicht mehr zurechtkommen und
plötzlich mit einem ihnen unbekannten Regelwerk konfrontiert sind.
Integration. Hierbei handelt sich um einen wechselseitigen Prozess der Veränderung und Auseinandersetzung mit der jeweiligen Kultur. Ob dieser gelingt, ist abhängig von
den individuellen Fähigkeiten und Einstellungen des Zuwandernden und
den Möglichkeiten, die die Aufnahmegesellschaft ihnen gibt.
2.2.2 Besonderheiten der Pflege bei Migranten
In vielen Ländern werden Maßnahmen der Grundpflege ausschließlich von Angehörigen übernommen. Werden in Deutschland lebende Migranten pflegeabhängig, fällt es ihnen zumeist schwer, wenn diese von ihnen fremden Menschen, den Pflegenden, wahrgenommen wird.
Wertschätzung und Empathie. Dies sind die wichtigsten Eigenschaften, über die Pflegende verfügen sollten, wenn sie im interkulturellen Kontext Aufgaben der Grundpflege übernehmen. Außerdem sollten sie die individuellen Bedürfnisse und Gewohnheiten im Rahmen des Pflegeprozesses erfassen.
Interkultureller Bezugsrahmen. Um hier Probleme zu erkennen, benötigen Pflegende Wissen über den jeweiligen kulturellen Zusammenhang. Sie müssen Pflegebedürftige in deren individuellem Wirklichkeitserleben erfassen und begleiten. Nur so kann eine Ausgrenzung durch das „Anderssein“ überwunden werden.
Unterstützung der Körperpflege bei Muslimen
Fließendes Wasser. Muslime waschen sich nur unter fließendem Wasser. Ein Waschlappen ist ihnen fremd und wird als unhygienisch empfunden. Bei Bewohnern, die im Bett gewaschen werden müssen, wird die Intimpflege daher unter Verwendung eines Kruges mit fließendem Wasser durchgeführt. Beim Wachen der Hände und Füße sollte die Pflegende diese mit einem über die Waschschüssel gehaltenen Krug begießen.
Weitere Besonderheiten der Grundpflege. Das Schneiden der Nägel, Rasieren der Achselhöhle, der Schamhaare und meist auch der übrigen Körperbehaarung gehört bei den Muslimen zur Grundhygiene.
Merke: Grundpflegerische Maßnahmen sollten bei Muslimen grundsätzlich von gleichgeschlechtlichen Pflegenden durchgeführt werden.
Rituelle Reinheit
Die rituelle Reinheit der Muslime dient der Vorbereitung auf die Begegnung mit Gott im Gebet; die äußere Reinheit ist ein Symbol für die innere Reinheit. Es werden 2 Waschungen unterschieden:
Ganzwaschung
(arab. Ghsl, türk. Gusül): Sie umfasst die Reinigung des gesamten Körpers durch ein Vollbad. Diese Waschung wird nach dem Wochenbett, der Menstruation, nach sexuellen Ergüssen, vor dem Freitagsgebet und zusätzlich nach Bedarf (z.B. ärztliche Untersuchungen im Intimbereich) durchgeführt.
Teilwaschung
(arab.Wudu, türk. Abdest): Sie findet vor einem Pflichtgebet, d.h. 5 Mal pro Tag, statt. Sie umfasst das Waschen der Hände, Unterarme, Mund, Zähne, Nase, Gesicht, Ohren, sowie Füße bis über die Knöchel unter fließendem Wasser. Außerdem ist sie nötig, wenn ein Muslim mit unreinen Stoffen in Berührung gekommen ist, z.B. Stuhlgang, Urin, Blut.
Merke: Beim Ausscheidungsvorgang ist die Intimsphäre sehr wichtig; Erwachsene Muslime müssen ihre Genitalien vor allen Erwachsenen verbergen. Urin und Stuhlgang gelten als unrein. Zur Reinigung dient fließendes Wasser. Muslime benötigen daher eine Wasserkanne auf der Toilette.
Essen und Trinken bei Muslimen
Fleisch
Muslime verzichten auf den Verzehr von Schweinefleisch. Es gibt zudem Muslime, die darauf achten, dass es sich um geschächtetes Fleisch handelt, d.h. Fleisch, das nach islamischen Ritualen geschlachtet wurde.Wenn man ihnen dieses nicht bieten kann, kann vegetarische Kost, die frei von tierischen Fetten ist, eine Alternative sein.
Alkohol
Da Muslime keinen Alkohol trinken ist zudem darauf zu achten, dass auch die Speisen keinen Alkohol enthalten. Auch Arzneien dürfen keine Mittel enthalten, die nach islamischen Quellen als verboten gelten. Dazu gehören alle flüssigen Arzneien, die Alkohol enthalten sowie aus dem Schwein gewonnene Präparate oder Arzneibestandteile wie Gelatine.
Fasten
Im Monat Ramadan verzichten gläubige Muslime zwischen Morgendämmerung und Sonnenuntergang auf jegliche feste und flüssige Nahrung, Rauchen und Geschlechtsverkehr. Nach Sonnenuntergang wird dafür häufig umso üppiger gespeist. Am Ende des Fastenmonats findet das drei Tage dauernde Ramadanfest statt. Das Fasten dient dazu, Leidenschaften und Begierden beherrschen zu lernen.
Ausnahmen. Es gibt besondere Gruppen, die von der Fastenpflicht entbunden sind, um ihren Körper nicht zusätzlich zu belasten, z.B. Kranke. Allerdings sind die Grenzen im Koran nicht detailliert beschrieben. Muslimische Kranke geraten oft in einen Konflikt innerhalb ihres Wertesystems. Sie müssen gut aufgeklärt werden, welche Risiken ein Nahrungsverzicht mit sich bringt.
2.2.3 Interkulturelle Kommunikationskompetenz
Multikulturelle Kommunikation
Die Kommunikation zwischen Angehörigen verschiedener Kulturen ist besonders anfällig für Missverständnisse. Daher sollte der Kommunikationsablauf sowie z.B. Körpersprache, Tonfall, kulturspezifische Kommunikationsstile in Fortbildungen geschult werden. Außerdem ist das Lernen von Schlüsselbegriffen und Sätzen (z.B. Essen, Seife, „Wie geht es Ihnen?“) sinnvoll.
Merke: Die Kommunikationshaltung im multikulturellen Pflegealltag sollte von Interesse, Aufgeschlossenheit und Akzeptanz gegenüber dem Fremden geprägt sein.
Neue Denkweisen
Beim Umgang mit Migranten sind Pflegende häufig mit fremd erscheinenden Verhaltensweisen, Wertvorstellungen und Verhaltensnormen konfrontiert, auch im Bereich der Kommunikation. Um diese zu verstehen und adäquat handeln zu können, bedarf es der Fähigkeit zur kritischen Selbstreflexion. Pflegende können z.B. bestimmte Verhaltensweisen verstehen, indem sie sich neue Denk-, Empfindungs- und Verhaltensweisen erschließen, ohne die eigene kulturelle Identität aufzugeben.
Praxistipp: Übung zu interkultureller Kommunikation im Dreischritt:
Beschreiben: Was sehe ich (nur beobachtete Fakten)?Interpretieren: Was denke ich (über das, was ich sehe)?Bewerten: Was fühle ich (über das, was ich denke)? Ich sehe eine Frau muslimischer Herkunft, die eine Hand vor den Mund hält.Sie gähnt, weil sie sich zu langweilen scheint.Das ist nicht schlimm, es stört mich doch nicht.2.3 Glaubens- und Lebensfragen
2.3.1 Religiöse Fragen des Alters
Definition:Religion ist ein kulturelles, weltanschauliches Phänomen, das menschliches Verhalten und Denken prägt und Wertvorstellungen beeinflusst. Fast alle Religionen gehen von der Existenz eines oder mehrerer über-weltlicher Wesen (z.B. einem Gott oder von Geistern) aus.
Es ist davon auszugehen, dass jeder einzelne alte Mensch eine individuelle Religiosität aufweist, d.h. es gibt nicht die eine Altersreligiosität. Zwar sind nicht alle älteren Menschen kirchlich gebunden – dennoch haben die meisten eine individuelle Entwicklung des Glaubens durchgemacht. Sie stellen sich Fragen nach dem Lebenssinn, nach dem Umgang mit Krankheit, Leiden und Sterben und fragen nach dem, was nach dem Tode kommt:
Umgang mit Erkrankungen
: Gerade in als bedrohlich empfundenen Situationen finden viele Menschen im Glauben das Fundament zur Gestaltung ihres Lebens. Die Gemeinschaft im Glauben vermittelt ihnen Halt, Geborgenheit und Sicherheit.
Umgang mit Grenzsituationen
: Nach dem Vierten Altenbericht von 2002 ist „Glaube“ ein Bereich, der im Alter einen höheren Stellenwert erfährt.
Umgang mit Altern und Tod
: Die Endlichkeit des Lebens berührt den Menschen in seiner ganzen Existenz. Ältere Menschen wünschen sich Pflegende, die für ihre spirituellen und religiösen Fragen offen sind: Alt-Werden erleben, näher rückender Tod und Endlichkeit.
2.3.2 Sinn finden im Alter
Das höhere Alter ist die Periode des Lebens, in der auf fast allen Ebenen des Seins die Funktionen beeinträchtigt sind. Obwohl die damit einhergehenden Probleme medizinisch meist gelindert werden können, fällt es vielen Menschen sehr schwer, Leid und Bedrohung zu verarbeiten und in ihr Sinnsystem zu integrieren:
Die Folgen der körperlichen Entwicklung bedeuten für viele eine Einschränkung ihrer Beschäftigung und Rollen und eine Trennung vom alten Lebensentwurf.
Das Selbstbild wird nun nicht mehr als aktiv und unternehmend wahrgenommen. Sinnbezüge und Definitionen des Selbst aufrechtzuerhalten, wird immer schwieriger.
Neue Sinnorientierungen aufzubauen ist schwierig – die Lebenszeit reicht nicht mehr, um z.B. ein ganz neues Leben zu beginnen.
Die meisten alten Menschen haben Angst, durch Pflegebedürftigkeit ihre Autonomie oder ihr Gedächtnis und ihre Orientierung zu verlieren.
Daher wünschen sich viele ältere Menschen meistens einen möglichst schnellen Tod, der sie mitten aus einem sinnerfüllten Leben herausreißt.
2.4 Familie und soziale Beziehungen
2.4.1 Familie
Eine Familie erfüllt folgende Funktionen:
Versorgung der Kinder
: sowohl körperliche als auch psychische Versorgung (Liebe und emotionaler Rückhalt)
Sozialisation
: Vermittlung von Normen,Werten und Einstellungen an die Kinder, um in dieser Gesellschaft zurechtzukommen
Versorgung der Großelterngeneration
: Diese Funktion befindet sich im Umbruch.
Veränderungen der Familienstrukturen. In den letzten Generationen haben sich Strukturen und Zuständigkeiten innerhalb von Familien verändert. Gründe bzw. Folgen sind:
Zunahme räumlicher Entfernung durch größere Mobilität
Zunahme der inneren Distanz mit Funktionsverlust der Großeltern
selbstbestimmtes Altern durch neue Rollen und finanzielle Unabhängigkeit
Rollenkonflikte, z.B. hinsichtlich der Erziehung der Enkel
Pflegende Angehörige
Trotz der sich ändernden Familienstrukturen werden die meisten Pflegebedürftigen in Privathaushalten und von Familienangehörigen, Freunden und Bekannten betreut und versorgt.
Motivation
Verpflichtung
: Kinder fühlen sich Eltern gegenüber verpflichtet, für sie zu sorgen, da sie ein Leben lang für sie selbst da waren.
Dankbarkeit
: Es besteht das emotionale Bedürfnis, den Eltern etwas von dem zurückzugeben, was sie selbst bekommen haben.
Druck durch andere
: Tritt besonders auf, wenn z.B. eine Angehörige weiblich, ungebunden, beruflich flexibel oder in einem Pflegeberuf tätig ist.
finanzielle Interessen
: Geldbeträge werden nicht an ein Pflegeheim gezahlt, das Erbe wird also nicht verringert.
Hauptpflegepersonen
Dies sind vorwiegend Ehefrauen, Töchter oder Schwiegertöchter. Sie übernehmen damit umfassende und verantwortungsvolle Aufgaben.
Belastungen
Pflegende Angehörige können selbst an die Grenzen ihrer seelischen und körperlichen Belastungsfähigkeit gebracht werden. Wenn gegenseitige Erwartungen und Verpflichtungen immer stärker zunehmen, kann die Pflege auch die betroffenen Pflegefamilien, Ehepartner und Kinder belasten (Abb. 2.1).
Abb. 2.1 Belastungen pflegender Angehöriger.
Merke: Wenn Familie bzw. Angehörige auch in Zukunft ihren alten, hilfebedürftigen Eltern die soziale Heimat erhalten und Pflege übernehmen sollen, brauchen sie beratende, entlastende und finanzielle Unterstützung (s. hier).
2.4.2 Soziale Beziehungen
Soziale Beziehungen gehören zu den Grundbedürfnissen aller Menschen. Hier leben wir Rollen, die unser Leben prägen und soziale Kontakte schaffen. Mit jeder Rolle ist eine andere Anforderung verbunden, in jeder Rolle wird eine andere Art von Zuwendung, Nähe und Gebrauchtwerden erlebt.
Soziale Beziehungen im Alter
Häufig sind alte Menschen gut in soziale Netzwerke integriert. Meistens handelt es sich dabei um Mitglieder der Familie oder Gleichaltrige.
Generationsübergreifende Kontakte außerhalb der Familie sind dagegen selten.
Die meisten alten Menschen können auch im höheren Lebensalter auf eine Vertrauensperson zurückgreifen.
Die Mehrzahl der über 80-jährigen Menschen bleibt in familiale und freundschaftliche Kontakte integriert.
Mit zunehmendem Alter steigt der Anteil der alten Menschen, die informelle Hilfe benötigen.
Soziale Isolation im Alter
Definition:Soziale Isolation ist ein Zustand des Alleinseins, der als negativ oder bedrohlich erlebt wird. Zur Aufrechterhaltung von Kontakten und Beziehungen sind Fähigkeiten und Fertigkeiten nötig, die sich aufgrund verschiedener Alternsprozesse verändern.
Folgende Veränderungen erschweren es dem älter werdenden Menschen Kontakte zu pflegen:
biologische Veränderungen: Schwerhörigkeit, Immobilität, Angst vor Stürzen
psychosoziale Veränderungen: Überforderung durch Reize, Depression
soziokulturelle Veränderungen: finanzielle Not, Tod von Bezugspersonen usw.
Merke: