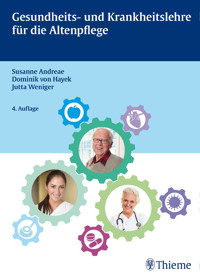54,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Thieme
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Du spezialisierst dich während der generalistischen Ausbildung auf die Alten-/Langzeitpflege bzw. absolvierst deine Ausbildung bei einem Träger in diesem Bereich? Oder du bist Pflegeassistent*in und trittst eine Stelle im Bereich der Alten- bzw. Langzeitpflege an? Dann ist I care Altenpflege Langzeitpflege dein idealer Begleiter für Theorie und Praxis.
Du erhältst schnellen Zugriff auf geriatrisches Fachwissen, das über das pflegerische Basiswissen hinausgeht. Der Buchinhalt steht dir ohne weitere Kosten digital auf icare.thieme.de zur Verfügung (Zugangscode im Buch).
Leichter Lernen: Mit dem Konzept aus Orientieren, Verstehen und Merken unterstützt dich das neue Lehrbuch bei diesen Themen:
- Grundlagen des Altenpflegeberufs
- Kommunizieren und Zusammenarbeiten
- Pflegebasismaßnahmen und Pflegetechniken
- Menschen beim Wohnen und in der Lebensgestaltung unterstützen
- kritische Lebenssituationen und Krisensituationen
- Menschen mit psychischen und kognitiven Problemen pflegen
- ausgewählte Erkrankungen in der Alten- und Langzeitpflege
Professionell pflegen: I care Altenpflege Langzeitpflege vermittelt das notwendige Wissen rund um die Besonderheiten der Altenpflege. So kannst du gezielt auf die spezifischen Bedürfnisse älterer Menschen eingehen und diese kompetent pflegen.
I care Altenpflege Langzeitpflege begleitet dich in der Pflegeausbildung und ist v.a. beim Vertiefungseinsatz der optimale Begleiter.
Es legt die inhaltlichen Grundlagen für den Erwerb der Kompetenzen nach Anlage 4 zum §28 der PflAPrVO und ermöglicht dir einen optimalen Berufseinstieg. Auch für den Wiedereinstieg in den Beruf und die Begleitung im Arbeitsalltag bietet das Lehrbuch die wichtigsten Inhalte.
Für Einrichtungen, die Rahmen des neuen Personalbemessungssystems (PeBeM), nun vermehrt Pflegeassistent*innen einstellen werden, bietet I care Altenpflege Langzeitpflege für Qualifikation und Fortbildung der neuen Kolleg*innen in diesem Bereich die optimale Wissensgrundlage – verständlich und praxisnah.
Mit der praktischen WISSEN TO GO App hast du auch von unterwegs Zugriff auf die zentralen Inhalte der Alten- und Langzeitpflege.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 2135
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
I care – Altenpflege Langzeitpflege
Verfasser
Susanne Andreae, Walter Anton, Jasmin Schön, Dominik von Hayek
Mitarbeitende Autoren
Norman Karl Held, Andreas Hoffmann, Pajam Rais Parsi, Monika Urban
622 Abbildungen
Vorwort
Lieber Leserinnen und Leser,
wir Menschen sind schon eine sonderbare Spezies. Alle wollen wir alt werden – nur alt sein, das wollen die wenigsten. Warum eigentlich nicht? „Das Alter“ kann ein wunderbarer Lebensabschnitt sein, in dem man seinen Alltag frei und selbstbestimmt genießen kann. Aktivität, Kreativität, Spiritualität ... Ohne den Stress und die Zwänge der Berufs-Jahre kann man Schätze in dieser Zeit finden, die man in den Jahrzehnten davor aus Zeitmangel verpasst hat. Doch zur Wahrheit gehört auch: In dieser Lebensphase liegen Freud und Leid nah beisammen. Teil des Altwerdens sind oft auch Krankheiten und sich daraus entwickelnde Einschränkungen. Und genau an dieser Stelle kommen Sie ins Spiel! Denn Ihr Plan ist, eine vertiefte pflegerische Kompetenz in diesem Bereich aufzubauen. Und ganz entscheidend dafür, ob Menschen auch noch am „Abend ihres Seins“ ein selbstbestimmtes und glückliches Leben führen können, ist die Frage, welche Pflege sie erfahren. Auch Menschen, die nach einem Schlaganfall schwer beeinträchtigt sind, können Freude im Alltag empfinden und ein würdevolles Leben leben – wenn sie jemanden in ihrem Umfeld haben, der sich professionell um sie kümmert. Gleiches gilt auch für junge Menschen, die z.B. aufgrund einer fortschreitenden neurodegenerativen Erkrankung einen Langzeitpflegebedarf haben.
Dieses Buch liefert Ihnen das pflegerische Expertenwissen, das Sie für diesen anspruchsvollen Beruf brauchen. Auf viele Fragen, die sich Ihnen in Ihrer Ausbildung oder im Praxiseinsatz in der Alten- und Langzeitpflege stellen, finden Sie hier Antworten – auch für die Vorbereitung aufs Examen oder später im Arbeitsalltag. Wir wünschen Ihnen viel Freude am Beruf und dass Ihnen dieses Buch ein guter Begleiter auf Ihrem Weg ist.
Das Verfasser-Team und Ihre Thieme-Pflege-Redaktion
Geleitwort
Wir sind ein Land, in dem Menschen alt werden können und viele von ihnen lange gesund bleiben. Im Jahr 2019 waren von den 83 Mio. Einwohnern 15,6 Mio. über 65 Jahre alt. Hochrechnungen gehen davon aus, dass 2040 20% von uns über 65 sein werden. Das ist zuerst mal nicht erschreckend. Aber die Tatsache, dass die größte Gruppe der pflegebedürftigen Personen über 65 ist, während gleichzeitig die Zahl der pflegenden Personen abnimmt, erfüllt einen schon mit Sorge. Dies trifft nicht nur auf die beruflich Pflegenden zu. Auch die Zahl der pflegenden Angehörigen nimmt ab. Immer mehr Familien haben nur ein bis zwei Kinder. So müssen sich Söhne oder Töchter manchmal allein um mehrere pflegebedürftige Eltern oder Großeltern kümmern. Gleichzeitig weigern sich ältere Personen nicht selten, eine Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung anzufertigen, in der Annahme, das könnten ja dann die Angehörigen irgendwie regeln. Doch ist es dann soweit, fühlen sich diese oftmals überfordert: Ein Schlaganfall, ein Herzinfarkt, die Verschlechterung der Lungensituation: Das kann sehr schnell gehen. Vielen wird auch das Schicksal eines dementiellen Prozesses nicht erspart – und damit Probleme, die im ersten Moment unlösbar scheinen: die Tochter in Hamburg, der Sohn in Leipzig und die bedürftige Mutter in Köln. Wie soll das gehen? Töchter und (seltener) Söhne bestellen das Taxi für den Hausarztbesuch, sie organisieren die Fußpflege, sie gehen telefonisch die Lebensmittel im Kühlschrank mit ihnen durch – nicht selten parallel zu ihrem normalen Arbeitsalltag. Diese Betreuung durch Angehörige ist unersetzlich. Umso bedauerlicher, dass wir keine reguläre zugehende Beratung kennen, wie sie z.B. in der Schweiz ab dem 70. Lebensjahr stattfindet.
Was bedeutet es, alte Menschen in unserem Land zu pflegen? Da sind die verschiedenen Settings zu berücksichtigen: in der eigenen Häuslichkeit, in der stationären Langzeitpflege, Kurzzeit- oder Tagespflege, im Krankenhaus, Hospiz oder der Rehabilitation. Dabei kann der Pflegebedarf weit variieren – zwischen einer kleinen Unterstützung bis hin zu einer umfänglichen 24-stündigen Begleitung. Diese kann von einer Orientierung, z.B. für Menschen mit dementiellen Prozessen, bis hin zu einer hohen technikinvasiven Versorgung einer beamteten Person gehen. Dabei gilt für alle pflegerischen und medizinischen Settings, dass die Patient:innen immer älter werden – egal ob auf der Intensivstation, in der Notaufnahme oder in der ambulanten Pflege. Unsere stationären Langzeiteinrichtungen sehen seit Jahren eine deutliche Zunahme von multimorbid erkrankten Menschen. Es ist nicht mehr selten, dass selbst beatmungspflichtige Bewohner:innen inzwischen dort versorgt werden müssen.
Neue Versorgungsformen werden in den kommenden Jahren wichtiger werden, z.B. Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz. Buurtzorg- Modelle der ambulanten Versorgung werden erprobt und Brückenstationen eingerichtet. Zentren der Primärver- sorgung werden ebenso zum Angebot gehören, wie die Implementierung von Community Health Nurses, die direkt in der Gemeinde zum tragen kommen werden.
Die Anforderungen an die Pflegekräfte nehmen durch diese Entwicklungen weiter zu: Wahrnehmungs-Kompetenzen gewinnen in der Pflege alter Menschen weiter an Bedeutung. Weitere Kompetenzen, die wichtiger werden sind: Schmerzen richtig einschätzen können, Bewegung fördern, gesunde Ernährung unterstützen und Biografiearbeit als einen wichtigen Baustein anwenden, der hilft, den Zugang zu Menschen zu finden, die das hier und jetzt nicht mehr erfassen können. In der Folge wird in vielen Bereichen eine dreijährige Berufsausbildung nicht mehr ausreichen, um eine Person für ihre lebenslange Berufstätigkeit zu qualifizieren. Hier sind Konzepte erforderlich, Kompetenzen weiterzuentwicklen, u.a. in der Gerontopsychiatrie, der palliativen und onkologischen Pflege. Gleichzeitig wird sich Pflege fortwährend auch auf neue, aktuelle Anforderungen einstellen müssen: Beispiel ist die Corona-Pandemie, in der z.B. rasch umfassende Hygienekonzepte entwickelt und implementiert werden mussten. Nicht zuletzt müssen sich beruflich Pflegende darauf vorbereiten, dass ethische Fragen immer mehr in den Vordergrund treten. Der Internationale Verbund der Pflegenden (ICN) hat bereit 1953 einen Ethikkodex verabschiedet, der Pflegende verpflichtet für ihr berufliches Handeln und für die Weiterentwicklung des Berufes die Verantwortung aktiv in die Hand zu nehmen.
Seien Sie stolz darauf, diesen Beruf gewählt zu haben, er bietet so viele Möglichkeiten wie kaum ein anderer. Seien Sie aber auch bereit, Verantwortung zu übernehmen für die, die Sie pflegen, deren Angehörigen und – nicht zuletzt – für sich selbst. Denn nur wenn es Ihnen gut geht, Sie sich sicher in Ihrem beruflichen Handeln fühlen, wird es auch denen gut gehen, die sie versorgen. Dieses Buch wird einen wichtigen Beitrag zu einer gelungenen pflegerischen Versorgung alter Menschen leisten. Nehmen sie das Angebot wahr.
Christel Bienstein, Berlin, Oktober 2022Präsidentin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe
Danksagung
Wir danken dem Alexander-Stift und besonders den Gemeindepflegehäusern Korb und Ludwigsburg für ihr großes Engagement bei unseren Fotoaufnahmen für dieses Buch.
Darüber hinaus möchten wir uns bei allen zentral Verantwortlichen und Mitarbeitern in den Häusern für ihre Zeit, Geduld und Mitarbeit bei unseren Foto- und Videoaktionen bedanken.
Unser ganz besonderer Dank gilt allen Pflegeempfängerinnen und Pflegeempfängern, die bereit waren mitzuwirken.
Inhaltsverzeichnis
Titelei
Vorwort
Geleitwort
Danksagung
Teil I Grundlagen des Altenpflegeberufs
1 Profession Altenpflege
1.1 Geschichte der Altenpflege
1.1.1 Anfänge der Altenpflege
1.1.2 Institutionalisierte Altenarbeit
1.2 Was ist Pflege?
1.2.1 Definition des ICN
1.2.2 Definition der WHO
1.3 Pflege als Beruf
1.3.1 Merkmale einer Profession
1.3.2 Nichtberufliche Pflege
1.4 Altenpflege als Beruf
1.4.1 Ausbildung
1.4.2 Aufgaben und Einsatzgebiete der Altenpflege
1.4.3 Fort- und Weiterbildung
1.4.4 Studium
1.5 Rollen und Rollenkonflikte
1.5.1 Rolle
1.5.2 Erwartungen an die Rolle
1.5.3 Rollenarten
1.5.4 Rollenbelastungen
1.5.5 Rollenkonflikte
1.5.6 Umgang mit Rollenkonflikten
2 Rechtliche und politische Grundlagen der Altenpflege
2.1 Einführung
2.2 Versorgung alter Menschen als politische und gesellschaftliche Aufgabe
2.2.1 Freie Wohlfahrtspflege und ihre Rolle in der Versorgung alter Menschen
2.2.2 Politische Maßnahmen im Bereich der Altenarbeit
2.3 Gesetzliche Grundlagen der Altenpflege – Perspektive des Pflegebedürftigen
2.3.1 Grundgesetz
2.3.2 Sozialversicherungen
2.3.3 Testament
2.4 Gesetzliche Grundlagen der Altenpflege – Perspektive der Einrichtung
2.4.1 Heimrecht: Heimgesetzgebung
2.4.2 Infektionsschutzgesetz
2.5 Gesetzliche Grundlagen der Altenpflege – Perspektive der Mitarbeiter
2.5.1 Ausbildungsrecht: Pflegeberufegesetz (PfBG) und Pflegeberufe-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (PflAPrV)
2.5.2 Arbeitsrecht
2.5.3 Schweigepflicht
2.5.4 Freiheitsentziehende Maßnahmen
3 Aspekte des Alterns
3.1 Einführung
3.2 Was ist Altern?
3.3 Aspekte des Alterns aus biologischer Sicht
3.3.1 Biologische Modelle des Alterungsprozesses
3.3.2 Abnahme der funktionellen Reserven und Anpassungsfähigkeit
3.3.3 Unterschiedliche Arten von biologischen Alterungsprozessen
3.3.4 Veränderungen der einzelnen Organsysteme
3.4 Psychologische Aspekte des Alterns
3.4.1 Psychologische Modelle des Alterns
3.5 Aspekte des Alterns aus soziologischer Sicht
3.5.1 Lebenserwartung
3.5.2 Alterspyramide und Geburtenrückgang
3.5.3 Merkmale und Besonderheiten der älteren Bevölkerung
4 Pflegetheorien in der Altenpflege
4.1 Einführung
4.2 Grundbegriffe der Pflegetheorien
4.3 Das Rahmenmodell fördernder Prozesspflege mit integrierten AEDLs/ABEDLs (Monika Krohwinkel)
4.3.1 Biografischer und beruflicher Hintergrund
4.3.2 Grundbegriffe der Theorie
4.4 Theorie des Selbstpflegedefizits von Dorothea Orem
4.5 Kritische Reflektion/Resümee
5 Gesundheit und Krankheit im Alter
5.1 Gesundheit und Krankheit – Begriffsklärung
5.1.1 Biologisch-medizinische Betrachtungsweise
5.1.2 WHO-Definition von Gesundheit
5.2 Paradigmenwandel und Neubelebung von Public Health
5.2.1 Das Paradigma der Pathogenese
5.2.2 Das Paradigma der Salutogenese (A. Antonovsky)
5.3 Gesundheitsprobleme im Alter
5.4 Krankheit und Pflegebedürftigkeit im Alter
5.5 Gesundheit alter Menschen unterstützen
5.5.1 International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)
5.5.2 Gesundheitsprobleme früh erkennen und Risikofaktoren senken
5.5.3 Partizipation ermöglichen und Selbstwirksamkeit stärken
5.5.4 Körperliche Gesundheit stärken
5.5.5 Personenbezogene Faktoren positiv beeinflussen
5.5.6 Umweltfaktoren positiv beeinflussen
5.6 Persönliche Gesunderhaltung der Pflegefachkräfte
5.6.1 Arbeitsbedingungen im Berufsfeld Pflege
5.6.2 Gesundheitsförderung von beruflich Pflegenden
6 Menschen in Settings der Alten- und Langzeitpflege versorgen
6.1 Demografische Grundlagen
6.2 Stationäre Langzeitpflege
6.2.1 Grundsätze der stationären Langzeitpflege
6.2.2 Organisationsstruktur der stationären Langzeitpflege
6.2.3 Alte Menschen in Einrichtungen der stationären Langzeitpflege betreuen und versorgen
6.3 Pflegestützpunkte
6.3.1 Organisationsstruktur und Grundsätze von Pflegestützpunkten
6.3.2 Alte Menschen im Pflegestützpunkt beraten
6.4 Einrichtungen der Akutversorgung
6.4.1 Organisationsstruktur und Grundsätze in Einrichtungen der Akutversorgung
6.4.2 Alte Menschen in Einrichtungen der Akutversorgung versorgen und begleiten
6.5 Einrichtungen der Rehabilitation
6.5.1 Organisationsstruktur und Grundsätze in Einrichtungen der Rehabilitation
6.5.2 Alte Menschen in Einrichtungen der Rehabilitation versorgen
6.6 Ambulante Pflegedienste
6.6.1 Organisationsstruktur und Grundsätze der ambulanten Pflege
6.6.2 Alte Menschen und ihre Angehörigen im ambulanten Bereich begleiten und versorgen
6.7 Einrichtungen der Gerontopsychiatrie
6.8 Einrichtungen der Tagespflege
6.8.1 Organisationsstruktur und Grundsätze der Einrichtungen der Tagespflege
6.8.2 Alte Menschen in Einrichtungen der Tagespflege versorgen
6.9 Wohngemeinschaften
6.9.1 Allgemeines und Grundsätze
6.9.2 Alte Menschen in Wohngemeinschaften betreuen und versorgen
6.10 Einrichtungen für junge Pflegebedürftige
6.10.1 Allgemeines, Organisationsstrukturen und Grundsätze
6.10.2 Bedürfnisse junger Pflegebedürftiger
6.11 Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
6.11.1 Was bedeutet „Behinderung“?
6.11.2 Organisationsstrukturen und Grundsätze der Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
6.11.3 Alte Menschen mit Behinderung versorgen, begleiten und pflegen
7 Pflegeprozess und Dokumentation in der Altenpflege
7.1 Grundlagen
7.1.1 Pflegeprozess als Problemlösungsprozess
7.1.2 Pflegeprozess als Beziehungsprozess
7.1.3 Pflegeprozessmodell nach Fiechter und Meier
7.1.4 Vor- und Nachteile der Pflegeprozessplanung
7.2 Pflegedokumentation
7.2.1 Ziele und Funktionen der Pflegedokumentation
7.2.2 Rechtliche Aspekte zur Pflegedokumentation
7.2.3 Pflegedokumentation in der Praxis
7.2.4 EDV-gestützte Pflegedokumentationssysteme
7.3 Durchführung der Pflegeprozessplanung und -dokumentation
7.3.1 Phase 1 – Erhebung des Pflegebedarfs und Assessmentverfahren
7.3.2 Phase 2 – Planung von Pflegezielen und Pflegemaßnahmen
7.3.3 Phase 3 – Durchführung der Pflege und Umsetzung von Pflegestandards
7.3.4 Phase 4 – Evaluation (Auswertung) der Pflege als Beitrag zur Qualitätssicherung
7.4 Entbürokratisierung der Pflegedokumentation
7.4.1 Das Strukturmodell
7.4.2 Ergebnisse des Projektes
8 Qualitätsmanagement in der Altenpflege
8.1 Einführung und Begriffsklärung
8.2 Geschichte der Qualitätssicherung
8.3 Qualitätsdimensionen nach Donabedian
8.4 Gesetzliche Rahmenbedingungen für Qualitätssicherung in der Altenpflege
8.4.1 Pflegeversicherungsgesetz SGBXI
8.4.2 Pflegequalitätssicherungsgesetz (PQsG, 2001)
8.4.3 Pflegeweiterentwicklungsgesetze und Pflegestärkungsgesetze
8.4.4 Heimrecht: Heimgesetz, Landesheimgesetze sowie Wohn- und Teilhabegesetze der Länder
8.5 Interne Maßnahmen der Qualitätssicherung
8.5.1 Qualitätssicherung als einrichtungsinterner Prozess
8.5.2 Qualitätszirkel
8.5.3 Bewohner als Kunde – Erwartungen und Kundenzufriedenheit
8.5.4 Beschwerdemanagement
8.5.5 Leitbild
8.5.6 Organigramm und Stellenbeschreibungen
8.5.7 Fehlermanagement
8.5.8 Pflegesysteme und Pflegeorganisationsformen
8.5.9 Pflegevisite
8.5.10 Anwendung von Pflegekonzepten
8.5.11 Selbstmanagement
8.6 Externe Maßnahmen der Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle
8.6.1 Gesetzliche Pflichtüberprüfungen
8.6.2 Benotung der Altenpflegeeinrichtungen
8.6.3 Zertifizierung
8.6.4 Nationale Expertenstandards und Rolle der Pflegeforschung
9 Ethik in der Altenpflege
9.1 Grundlagen der Pflegeethik
9.2 Die Prinzipienethik
9.2.1 Prinzip der Autonomie
9.2.2 Prinzip der Fürsorge
9.2.3 Prinzip des Nichtschadens
9.2.4 Prinzip der Gerechtigkeit
9.3 Ethische Entscheidungskonflikte
9.3.1 Entscheidungskonflikte in Bezug auf das Prinzip der Autonomie
9.3.2 Entscheidungskonflikte in Bezug auf das Prinzip der Fürsorge
9.3.3 Entscheidungskonflikte in Bezug auf das Prinzip des Nichtschadens
9.3.4 Entscheidungskonflikte in Bezug auf das Prinzip der Gerechtigkeit
10 Kommunizieren und Zusammenarbeiten
10.1 Mit alten Menschen kommunizieren
10.1.1 Grundlagen der Kommunikation
10.1.2 Kommunikation gestalten
10.2 Anleiten, Informieren, Beraten und Edukation
10.2.1 Einführung
10.2.2 Anleiten
10.2.3 Informieren
10.2.4 Lernprozesse optimieren
10.2.5 Beratung
10.2.6 Edukation
10.3 Zusammenarbeit und Kommunikation im interdisziplinären Team der Altenpflege
10.3.1 Zusammenarbeit und Kommunikation im Team
10.3.2 Pflegevisite
10.3.3 Fallbesprechung/kollegiale Beratung
10.4 Interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Altenpflege
10.4.1 Berufsgruppen im interdisziplinären Team
10.4.2 Aufgaben der Berufe im interdisziplinären Team
10.4.3 Delegation im interdisziplinären Team
Teil II Pflegebasismaßnahmen und Pflegetechniken
11 Hygiene in der stationären und ambulanten Langzeitpflege
11.1 Einführung
11.2 Hygiene des Pflegepersonals
11.3 Reinigung, Desinfektion und Sterilisation
11.3.1 Reinigung
11.3.2 Desinfektion
11.3.3 Sterilisation
12 Wahrnehmung und Beobachtung
12.1 Wahrnehmung
12.1.1 Wahrnehmungsprozess
12.1.2 Beeinträchtigungen der Wahrnehmung
12.1.3 Wahrnehmungs- und Beurteilungsfehler
12.1.4 Möglichkeiten zur Wahrnehmungsverbesserung
12.2 Systematische Beobachtung
12.2.1 Ziele der pflegerischen Beobachtung
12.2.2 Beobachtungsprozesses
12.2.3 Beobachtungskriterien
12.2.4 Beobachtungsarten
12.2.5 Hilfsmittel zur Beobachtung
12.2.6 Dokumentation der Beobachtungen
12.3 Vitalparameter messen und bewerten
12.3.1 Puls
12.3.2 Blutdruck
12.3.3 Körpertemperatur
12.3.4 Atmung
12.3.5 Bewusstsein
13 Körperpflege und Bekleidung
13.1 Bedeutung der Körperpflege
13.2 Bedeutung der Kleidung
13.3 Kleidung von Pflegenden
13.3.1 Dienst- bzw. Berufskleidung
13.3.2 Schutzkleidung
13.4 Beobachtung bei der Körperpflege
13.4.1 Gesundheitszustand, Haut und Hautanhangsorgane beobachten
13.4.2 Individuelle Bedürfnisse, Gewohnheiten, Ressourcen und Fähigkeiten erfassen
13.5 Unterstützung bei der Körperpflege und beim An- und Auskleiden
13.5.1 Hilfe zur Selbsthilfe
13.5.2 Zeitpunkt der Körperpflege
13.5.3 Pflegemittel
13.5.4 Möglichkeiten die Körperpflege durchzuführen
13.6 Grundsätze der Bekleidung von Heimbewohnern
13.6.1 An- und Auskleiden
14 Prophylaxen
14.1 Grundlagen
14.2 Erhaltung und Förderung der Mobilität
14.2.1 Zielsetzung
14.2.2 Aufgaben der Pflegenden
14.2.3 Ergebniskriterien Expertenstandard
14.3 Dekubitusprophylaxe
14.3.1 Zielsetzung
14.3.2 Aufgaben der Pflegenden
14.3.3 Ergebniskriterien Expertenstandard
14.4 Sturzprophylaxe
14.4.1 Zielsetzung
14.4.2 Aufgaben der Pflegenden
14.4.3 Ergebniskriterien Expertenstandard
14.5 Kontrakturenprophylaxe
14.5.1 Zielsetzung und Ergebniskriterien
14.5.2 Aufgaben der Pflegenden
14.6 Thromboseprophylaxe
14.6.1 Zielsetzung und Ergebniskriterien
14.6.2 Aufgaben der Pflegenden
14.7 Pneumonieprophylaxe
14.7.1 Zielsetzung und Ergebniskriterien
14.7.2 Aufgaben der Pflegenden
14.8 Sicherung und Förderung der oralen Ernährung
14.9 Dehydratationsprophylaxe
14.10 Förderung der Harnkontinenz
14.10.1 Zielsetzung
14.10.2 Aufgaben der Pflegenden
14.10.3 Ergebniskriterien Expertenstandard
14.11 Obstipationsprophylaxe
14.11.1 Zielsetzung und Ergebniskriterien
14.11.2 Aufgaben der Pflegenden
14.12 Soor- und Parotitisprophylaxe
14.12.1 Zielsetzung und Ergebniskriterien
14.12.2 Aufgaben der Pflegenden
14.13 Intertrigoprophylaxe
14.13.1 Zielsetzung und gefährdete Hautstellen
14.13.2 Aufgaben der Pflegenden
15 Pflegekonzepte und Biografiearbeit
15.1 Aktivierende Pflege
15.2 Basale Stimulation
15.2.1 Bedeutung von Berührung in der Pflege
15.2.2 Spezielle Pflegeangebote
15.3 Biografiearbeit
15.3.1 Fakten und Lebensgeschichten
15.3.2 Der Weg zur Biografie
15.4 Bobath-Konzept
15.4.1 Grundlage
15.4.2 Ziele
15.4.3 Maßnahmen
15.5 Kinästhetik
15.5.1 Teilkonzepte
15.5.2 Kinästhetik in der Praxis
15.6 Pflegekonzepte bei Menschen mit Demenz
15.6.1 Validation nach N. Feil
15.6.2 Integrative Validation (IVA) nach N. Richard
15.6.3 Realitätsorientierungstraining (ROT)
15.6.4 Milieutherapie
15.6.5 Snoezelen
15.6.6 Tiergestützte Biografiearbeit (TGB, nach M. Giruc)
16 Ernährung und Ausscheidung im Alter
16.1 Ernährung
16.1.1 Bedeutung der Ernährung im Alter
16.1.2 Grundlagen der Ernährungslehre im Alter
16.1.3 Mangelernährung im Alter
16.1.4 Pflegeschwerpunkte beim Ernährungsmanagement älterer Menschen
16.1.5 Besonderheiten bei der Ernährung von Menschen mit Demenz
16.2 Ausscheidung
16.2.1 Bei der Ausscheidung unterstützen
16.2.2 Ausscheidungen beobachten
16.2.3 Harninkontinenz
16.2.4 Stuhlinkontinenz
16.2.5 Darmeinläufe
16.2.6 Übelkeit und Erbrechen
16.2.7 Umgang mit unangenehmen Gefühlen
17 Medikamentenmanagement im Alter
17.1 Grundlagen des Medikamentenmanagements
17.1.1 Begriffsdefinitionen der Pharmakologie
17.1.2 Pharmakokinetik und Pharmakodynamik
17.1.3 Applikationsformen und Darreichungsformen
17.2 Rechtliche Rahmenbedingungen des Medikamentenmanagements
17.2.1 Gesetzliche Vorschriften im Umgang mit Arzneimitteln
17.2.2 Delegation
17.3 Besonderheiten bei der Arzneimitteltherapie im Alter
17.4 Pflegerische Aufgaben bei der Medikamentenvergabe
17.4.1 Medikamente beschaffen und aufbewahren
17.4.2 Medikamente bereitstellen
17.4.3 Medikamente verabreichen
17.4.4 Pflegeempfänger beobachten und Medikamentengabe dokumentieren
17.4.5 Maßnahmen zur Optimierung der Arzneimitteltherapie
17.5 Arzneimittelabusus im Alter
17.6 Versorgungskontinuität im Medikamentenmanagement
18 Wundmanagement und invasive Maßnahmen
18.1 Wundmanagement
18.1.1 Wundarten und Wundbeurteilung
18.1.2 Wundheilung
18.1.3 Wundtherapie
18.1.4 Verbandswechsel
18.1.5 Wunddokumentation
18.2 Injektionen
18.2.1 Injektionen verabreichen
18.3 Infusionen
18.3.1 Infusionen verabreichen
18.4 Sondenernährung
18.4.1 Sondennahrung
18.4.2 Sondennahrung verabreichen
18.4.3 Medikamentenapplikation
18.4.4 Verbandswechsel bei einer perkutanen Sonde durchführen
18.5 Katheterismus
18.5.1 Katheterarten
18.5.2 Pflege bei einem Harnblasenkatheter
18.5.3 Transurethralen Blasendauerkatheter legen
18.5.4 Transurethralen Blasendauerkatheter entfernen
18.5.5 Suprapubischer Blasenkatheter (SPK)
18.6 Weitere invasive Maßnahmen
18.6.1 Absaugen
18.6.2 Sauerstoffgabe
18.6.3 Tracheostoma
18.6.4 Enterostoma
Teil III Alte Menschen beim Wohnen und in der Lebensgestaltung unterstützen
19 Wohnen
19.1 Bedeutung des Wohnens im Alter
19.1.1 Alters- und seniorengerechtes Wohnen
19.2 Wohn- und Versorgungsformen für alte Menschen
19.2.1 Wohnen zuhause – angepasst oder barrierefrei
19.2.2 Betreutes Wohnen zuhause
19.2.3 Altersgerechte Quartierprojekte
19.2.4 Service-Wohnen (betreutes Wohnen)
19.2.5 Wohngemeinschaften für Senioren
19.2.6 Mehrgenerationenwohnen
19.2.7 Einrichtungen stationärer Langzeitpflege
19.2.8 Teilstationäre Einrichtungen
19.2.9 Unterstützung beim Einzug in eine stationäre Langzeiteinrichtung
20 Soziale Netzwerke und Beziehungen im Alter
20.1 Der Mensch als Teil sozialer Netzwerke
20.2 Funktionen sozialer Netzwerke im Alter
20.3 Soziale Netzwerke in der heutigen Gesellschaft
21 Schnittstellen von Einrichtungen der Altenpflege
21.1 Externe Schnittstellen einer Altenpflegeeinrichtung
21.2 Interne Schnittstellen einer Altenpflegeeinrichtung
22 Biografieorientierte Tagesgestaltung
22.1 Biografiearbeit mit alten Menschen
22.1.1 Bedeutung der Biografie
22.1.2 Grundsätze der Biografiearbeit
22.1.3 Methoden der Biografiearbeit
22.2 Tagesgestaltung
23 Beschäftigungsangebote für Senioren
23.1 Gestaltung von Beschäftigungsangeboten
23.1.1 Grundsätze
23.1.2 Ziele
23.1.3 Didaktische Gestaltung
23.2 Beispiele für Beschäftigungsangebote
23.2.1 Gesellschaftsspiele
23.2.2 Einsatz von Tieren
23.2.3 Weitere Beispiele
24 Kultursensible Altenpflege
24.1 Demografische Entwicklung
24.1.1 Migration der letzten Jahrzehnte
24.1.2 Alternde Migranten in Deutschland
24.1.3 Anforderungen an pflegerische Dienstleistungen
24.2 Theoretische Grundlagen
24.2.1 Theorie der transkulturellen Pflege
24.3 Pflege von alten Menschen mit Migrationshintergrund
24.3.1 Leitideen für die Gestaltung pflegerischer Prozesse
24.3.2 Beratung und Begleitung – Einbeziehung Angehöriger
25 Sexualität im Alter
25.1 Einführung
25.2 Geschlechtliches Verständnis im Alter
25.3 Sexualverständnis der letzten Jahrzehnte
25.4 Aspekte von Partnerschaft und Sexualität im Alter
25.5 Formen des sexuellen Erlebens
25.6 Sexuelle Vielfalt im Alter
25.7 Geschlechtsrollenverständnis in anderen Kulturen
25.8 Pflege und Begleitung im Altenpflegesetting
25.8.1 Perspektive der Pflegenden
25.8.2 Förderung geschlechtsspezifischer Identität
25.8.3 Intimsphäre akzeptieren und fördern
25.8.4 Veränderungen und Einschränkungen erkennen und berücksichtigen
25.8.5 Verhaltensveränderungen durch Gewalterfahrungen
25.8.6 Besonderheiten bei der Begleitung von Menschen mit Demenz
Teil IV Hochbelastete und kritische Lebenssituationen
26 Krisenhafte Situationen im Alter
26.1 Altersarmut
26.1.1 Ursachen von Altersarmut
26.1.2 Folgen von Altersarmut
26.2 Verwahrlosung
26.2.1 Symptome
26.2.2 Ursachen
26.2.3 Pflege und Begleitung von Menschen mit Verwahrlosungstendenz
26.2.4 Vermüllungssyndrom
26.3 Aggression und Gewalt in der Langzeitpflege
26.3.1 Prinzip des Nichtschadens
26.3.2 Aggression
26.3.3 Gewalt
26.4 Coping und Bewältigungsstrategien
26.4.1 Arten von Bewältigungsstrategien
26.4.2 Möglichkeiten zur Stressbewältigung
26.5 Umweltbedingte Krisensituationen
26.5.1 Brandschutz
26.5.2 Evakuierung
27 Onkologie – Krebserkrankungen im Alter
27.1 Grundlagen
27.1.1 Risikofaktoren
27.1.2 Tumorentstehung
27.1.3 Tumoreinteilung
27.1.4 Prävention
27.1.5 Symptome bösartiger Tumoren
27.1.6 Tumorausbreitung (Metastasierung)
27.1.7 TNM-Klassifikation
27.2 Therapie
27.2.1 Therapieziele
27.2.2 Therapiemöglichkeiten
27.2.3 Prognose
27.3 Pflege in der Onkologie
27.3.1 Fatigue
27.3.2 Einschränkungen der Knochenmarksfunktion
27.3.3 Unterstützung bei Körperbildveränderungen
27.3.4 Unterstützung bei Beeinträchtigungen der Sexualität
27.4 Ausgewählte Tumorerkrankungen
27.4.1 Mammakarzinom
27.4.2 Kolorektales Karzinom
27.4.3 Bronchialkarzinom
27.4.4 Korpuskarzinom/Endometriumkarzinom
27.4.5 Prostatakarzinom
27.4.6 Malignes Melanom
28 Pflege und Begleitung von Menschen mit akuten und chronischen Schmerzen
28.1 Rechtliche Grundlagen des Schmerzmanagements
28.1.1 Ausbildungs- und Prüfungsverordnung
28.1.2 Sozialgesetzbuch
28.1.3 Betäubungsmittelgesetz
28.1.4 Ethische Aspekte und Expertenstandard
28.2 Schmerzen
28.2.1 Schmerzentstehung
28.2.2 Schmerzempfinden
28.3 Schmerz und seine Bedeutung
28.3.1 Schmerz als multidimensionales Geschehen
28.3.2 Perspektive der Betroffenen
28.3.3 Perspektive der Pflege
28.3.4 Schmerzarten
28.4 Schmerzmanagement
28.4.1 Schmerzeinschätzung
28.4.2 Handlungsstruktur pflegerisches Schmerzassessment
28.5 Medikamentöse Schmerztherapie
28.5.1 Aufgaben der Pflegefachkräfte im Rahmen der medikamentösen Schmerztherapie
28.5.2 Begleitmedikation
28.5.3 Peripher wirksame Analgetika
28.5.4 Zentral wirksame Analgetika
28.5.5 WHO-Stufenschema
28.6 Nicht medikamentöse Therapien und Techniken zur Schmerzlinderung
28.6.1 Physikalische Therapien
28.6.2 Entspannungsmethoden und kognitive Techniken
28.6.3 Schmerztherapie in der Naturheilkunde
29 Palliative Care
29.1 Palliative Care und Hospizarbeit
29.1.1 Bedeutung von Hospizen
29.1.2 Ambulante Palliative Care
29.1.3 Palliative Geriatrie
29.2 Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen
29.3 Aufgaben der Pflegefachkräfte
29.3.1 Pflegerische Kompetenzen
29.3.2 Pflegerische Vorgehensweise
29.4 Palliativmedizin
29.4.1 Symptomkontrolle
29.4.2 Häufige Beschwerden und ihre Behandlung
29.4.3 Palliative Sedierung
29.5 Sterben in gewohnter Umgebung
29.5.1 Angehörige unterstützen
29.5.2 Rechtliche Vorsorgen
29.5.3 Zuhause sterben
29.6 Sterbeprozess
29.6.1 Sterbephasen
29.6.2 Pflegerische Versorgung Verstorbener
Teil V Alte Menschen mit psychischer und kognitiver Beeinträchtigung pflegen
30 Einführung in die Psychiatrie und Gerontopsychiatrie
30.1 Krankheitszeichen in der Psychiatrie
30.1.1 Psychopathologie
30.1.2 Testverfahren
30.2 Gerontopsychiatrie
30.2.1 Besonderheiten der Gerontopsychiatrie – Rechtliche Aspekte
30.2.2 Grundlagen gerontopsychiatrischer Pflege
30.3 Therapiemöglichkeiten
30.3.1 Psychotherapie und andere nicht medikamentöse Therapieformen
30.3.2 Medikamentöse Therapie
31 Häufige psychiatrische Krankheitsbilder im Alter
31.1 Akuter Verwirrtheitszustand
31.1.1 Ursachen
31.1.2 Symptome
31.1.3 Pflegerische Erstmaßnahmen
31.1.4 Diagnostik
31.1.5 Therapie
31.1.6 Krankheitsverlauf
31.2 Demenz
31.2.1 Häufigkeit
31.2.2 Symptome
31.2.3 Einteilung
31.2.4 Pflege und Begleitung von Menschen mit Demenz
31.3 Affektive Störungen
31.3.1 Depression
31.3.2 Manie
31.3.3 Suizidalität
31.3.4 Schizophrene Störungen
31.3.5 Störungen durch psychotrope Substanzen
31.3.6 Neurotische Störungen
31.3.7 Belastungsreaktionen
31.3.8 Psychosomatische Störungen
32 Schlaf und Schlafstörungen
32.1 Schlaf
32.1.1 Schlafdauer und Schlafphasen
32.1.2 Schlaf im Alter
32.1.3 Pflegerische Beobachtung
32.2 Schlafstörungen
32.2.1 Einteilung
32.2.2 Ursachen
32.2.3 Therapie
32.2.4 Pflege und Begleitung von Menschen mit Schlafstörungen
Teil VI Ausgewählte Erkrankungen in der Alten- und Langzeitpflege
33 Erkrankungen des Herzens und des Kreislaufsystems
33.1 Einführung
33.2 Steckbrief Herzkreislaufsystem
33.2.1 Herz
33.2.2 Kreislauf- und Gefäßsystem
33.3 Erkrankungen der Herzkranzgefäße
33.3.1 Koronare Herzkrankheit (KHK)
33.3.2 Myokardinfarkt
33.4 Erkrankungen des Herzmuskels
33.4.1 Herzinsuffizienz
33.4.2 Herzrhythmusstörungen
33.5 Erkrankungen der Arterien
33.5.1 Periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK)
33.6 Erkrankungen der Venen
33.6.1 Varizen
33.6.2 Thrombophlebitis
33.6.3 Phlebothrombose
33.6.4 Chronisch-venöse Insuffizienz (CVI)
33.6.5 Pflege von Menschen mit Erkrankungen der Venen
33.7 Blutdruckregulationsstörungen
33.7.1 Hypotonie
33.7.2 Hypertonie
34 Erkrankungen des Atmungssystems
34.1 Einführung
34.2 Steckbrief Atmungssystem
34.2.1 Obere Atemwege
34.2.2 Untere Atemwege
34.2.3 Altersspezifische Veränderungen der Sauerstoffaufnahme in der Lunge
34.3 Akute Lungenerkrankungen
34.4 Chronische Lungenerkrankungen
34.4.1 Chronische Bronchitis
34.4.2 Obstruktive Lungenerkrankungen
34.4.3 Lungenemphysem
34.4.4 Schlafapnoe
34.4.5 Bronchialkarzinom
34.4.6 Larynxkarzinom
35 Erkrankungen des Verdauungssystems
35.1 Einführung
35.2 Steckbrief Verdauungssystem
35.2.1 Aufgaben des Verdauungssystems
35.2.2 Wandaufbau des Verdauungstrakts
35.2.3 Oberer und unterer Verdauungstrakt
35.3 Funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen
35.3.1 Allgemeine Merkmale
35.3.2 Obstipation
35.3.3 Diarrhö
35.4 Erkrankungen der Mundhöhle
35.4.1 Mundgeruch
35.4.2 Mundsoor
35.5 Erkrankungen der Speiseröhre
35.5.1 Sodbrennen
35.5.2 Dysphagie
35.6 Erkrankungen des Magens
35.6.1 Gastritis
35.6.2 Gastroduodenale Ulkuskrankheit
35.7 Erkrankungen des Darms
35.7.1 Chronisch entzündliche Darmerkrankungen
35.7.2 Divertikulose
35.7.3 Hämorrhoiden
35.8 Erkrankungen der Leber
35.8.1 Chronische Hepatitis
35.8.2 Leberzirrhose
35.8.3 Lebertumoren
35.9 Erkrankungen der Gallenblase
35.9.1 Cholelithiasis
35.10 Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse
35.10.1 Akute Pankreatitis
35.11 Bösartige Tumoren des Verdauungstrakts
35.11.1 Ösophaguskarzinom
35.11.2 Magenkarzinom
35.11.3 Gallenblasen- und Gallengangskarzinom
35.11.4 Pankreaskarzinom
35.11.5 Kolorektales Karzinom
35.12 Erkrankungen der Bauchhöhle
35.12.1 Hernie
36 Erkrankungen der Niere und Harnwege
36.1 Einführung
36.2 Steckbrief Harnsystem
36.2.1 Nieren
36.2.2 Harnwege
36.3 Entzündliche Erkrankungen
36.3.1 Harnwegsinfekte
36.4 Erkrankungen der Nieren
36.4.1 Niereninsuffizienz (Nierenversagen)
36.4.2 Uro-/Nephrolithiasis
36.5 Erkrankungen der ableitenden Harnwege
36.5.1 Blasenkarzinom
36.5.2 Harninkontinenz
37 Erkrankungen des Hormonsystems und des Stoffwechsels
37.1 Einführung
37.2 Steckbrief Hormonsystem
37.2.1 Aufgaben der Hormone
37.2.2 Eigenschaften und Einteilung der Hormone
37.2.3 Wirkmechanismus von Hormonen
37.2.4 Regulation der Hormonkonzentration
37.3 Erkrankungen der Schilddrüse
37.3.1 Struma (Kropf)
37.3.2 Hypothyreose
37.3.3 Hyperthyreose
37.3.4 Schilddrüsenkarzinom
37.4 Stoffwechselerkrankungen
37.4.1 Diabetes mellitus
37.4.2 Hyperurikämie und Gicht
37.4.3 Hyperlipoproteinämien
38 Erkrankungen des Blut- und Immunsystems
38.1 Einführung
38.2 Steckbrief Blut, Immun- und Lymphsystem
38.2.1 Funktion und Zusammensetzung des Bluts
38.2.2 Immunsystem
38.2.3 Lymphsystem
38.3 Anämie (Blutarmut)
38.3.1 Eisenmangelanämie
38.3.2 Megaloblastäre Anämie
38.3.3 Renale Anämie
38.4 Erkrankungen des roten Knochenmarks
38.4.1 Aplastische Anämie
38.4.2 Polyglobulie
38.4.3 Leukämie
38.5 Erkrankungen des Blutgerinnungssystems
38.5.1 Hämorrhagische Diathese
39 Erkrankungen des Bewegungssystems
39.1 Einführung
39.2 Steckbrief Bewegungssystem
39.2.1 Knochen und Gelenke
39.2.2 Skelettsystem
39.3 Erkrankungen der Knochen
39.3.1 Osteoporose
39.4 Erkrankungen der Gelenke
39.4.1 Fehlstellungen
39.4.2 Amputation
39.4.3 Arthrose
39.5 Rheumatische Erkrankungen
39.5.1 Rheumatoide Arthritis
39.5.2 Polymyalgia rheumatica
39.6 Knochentumoren
40 Erkrankungen des Nervensystems
40.1 Einführung
40.2 Steckbrief Nervensystem
40.2.1 Nervengewebe
40.2.2 Zentrales Nervensystem (ZNS)
40.2.3 Peripheres Nervensystem (PNS)
40.2.4 Knochen, Gefäße und Hirnhäute
40.2.5 Diagnostik bei Erkrankungen des Nervensystems
40.3 Durchblutungsstörungen des ZNS
40.3.1 Hirninfarkt
40.3.2 Hirnblutungen
40.3.3 Pflege und Begleitung nach einem Schlaganfall
40.4 Bewusstseinsstörungen
40.4.1 Schädel-Hirn-Trauma
40.4.2 Apallisches Syndrom
40.5 Entzündliche Erkrankungen des ZNS
40.5.1 Multiple Sklerose
40.6 Degenerative Erkrankungen des ZNS
40.6.1 Morbus Parkinson
40.7 Anfallserkrankungen
40.7.1 Epileptisches Anfallsleiden
40.8 Erkrankungen des Rückenmarks
40.8.1 Amyotrophe Lateralsklerose
40.8.2 Querschnittsyndrom
40.9 Erkrankungen des peripheren Nervensystems
40.9.1 Herpes zoster
40.9.2 Polyneuropathie
40.10 Neurologische Schmerzsyndrome
40.10.1 Restless-Legs-Syndrom
41 Erkrankungen der Sinnesorgane
41.1 Einführung
41.2 Steckbrief Sinnesorgane
41.2.1 Ohr
41.2.2 Auge
41.3 Erkrankungen der Ohren
41.3.1 Schwerhörigkeit
41.3.2 Tinnitus
41.3.3 Vertigo
41.4 Erkrankungen der Augen
41.4.1 Erkrankungen des Augenlids
41.4.2 Bindehauterkrankungen
41.4.3 Linsenveränderungen
41.4.4 Erkrankungen der Netzhaut
41.4.5 Erkrankungen des Sehnervs
41.4.6 Pflege und Begleitung von Menschen mit Sehbehinderung/Blindheit
42 Erkrankungen der Haut
42.1 Einführung
42.2 Steckbrief Haut
42.2.1 Aufgaben der Haut
42.2.2 Aufbau der Haut
42.2.3 Haut im Alter
42.3 Akute Wunden
42.4 Chronische Wunden
42.4.1 Dekubitus
42.5 Ekzematöse Erkrankungen
42.5.1 Austrocknungsekzem
42.6 Entzündliche Hauterkrankungen
42.6.1 Durch Bakterien verursachte Hauterkrankungen
42.6.2 Durch Pilze verursachte Hauterkrankungen
42.6.3 Durch Parasiten verursachte Hauterkrankungen
42.7 Allergische Hauterkrankungen
42.7.1 Allergie
42.7.2 Urtikaria
42.7.3 Arzneimittelexanthem
42.8 Hautneubildungen
42.8.1 Gutartige Neubildungen im Alter
42.8.2 Weißer Hautkrebs
42.8.3 Malignes Melanom
43 Erkrankungen der Geschlechtsorgane
43.1 Einführung
43.2 Steckbrief Geschlechtsorgane
43.2.1 Weibliche Geschlechtsorgane
43.2.2 Männliche Geschlechtsorgane
43.3 Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane
43.3.1 Descensus uteri
43.3.2 Entzündliche Erkrankungen
43.3.3 Maligne Tumoren
43.4 Erkrankungen der männlichen Geschlechtsorgane
43.4.1 Epididymitis
43.4.2 Paraphimose
43.4.3 Benigne Prostatahyperplasie
43.4.4 Prostatakarzinom
44 Infektionskrankheiten
44.1 Einführung
44.2 Steckbrief Infektionen
44.2.1 Infektionserreger
44.2.2 Abwehrfunktionen des Wirts
44.2.3 Infektionsprophylaxe
44.2.4 Sonderfall: Infektion mit MRSA
44.3 Infektiöse Atemwegserkrankungen
44.3.1 Influenza
44.3.2 Akute Bronchitis
44.3.3 Pneumonie
44.3.4 COVID-19
44.4 Infektiöse Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts
44.4.1 Gastroenteritis
44.4.2 Chronische Virushepatitis (Leberentzündung)
45 Notfallsituationen in der Alten- und Langzeitpflege
45.1 Einführung
45.2 Bewusstseinsstörungen
45.2.1 Unklare Bewusstlosigkeit
45.2.2 Herz-Kreislauf-Stillstand
45.2.3 Kreislaufschock
45.2.4 Hypertensive Krise
45.2.5 Lungenembolie
45.2.6 Akuter Arterienverschluss
45.3 Gastrointestinale Notfälle
45.3.1 Akutes Abdomen
45.3.2 Ileus
45.4 Unfälle
45.4.1 Verschlucken/Aspiration
45.4.2 Verbrennung
45.4.3 Unterkühlung
45.4.4 Vergiftung
45.4.5 Verätzung
45.4.6 Schädel-Hirn-Trauma (SHT)
45.4.7 Frakturen im Alter
46 Quellenverzeichnis
46.1 I Grundlagen des Altenpflegeberufs
46.2 II Pflegebasismaßnahmen und Pflegetechniken
46.3 III Alte Menschen beim Wohnen und in der Lebensgestaltung unterstützen
46.4 IV Hochbelastete und kritische Lebenssituationen
46.5 V Alte Menschen mit psychischer und kognitiver Beeinträchtigung pflegen
46.6 VI Ausgewählte Erkrankungen in der Alten- und Langzeitpflege
Anschriften
Sachverzeichnis
Impressum/Access Code
Teil I Grundlagen des Altenpflegeberufs
1 Profession Altenpflege
2 Rechtliche und politische Grundlagen der Altenpflege
3 Aspekte des Alterns
4 Pflegetheorien in der Altenpflege
5 Gesundheit und Krankheit im Alter
6 Menschen in Settings der Alten- und Langzeitpflege versorgen
7 Pflegeprozess und Dokumentation in der Altenpflege
8 Qualitätsmanagement in der Altenpflege
9 Ethik in der Altenpflege
10 Kommunizieren und Zusammenarbeiten