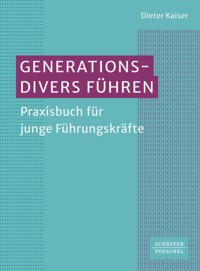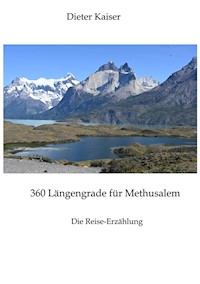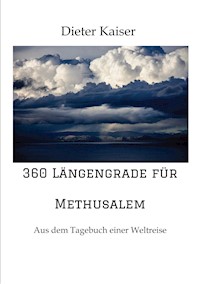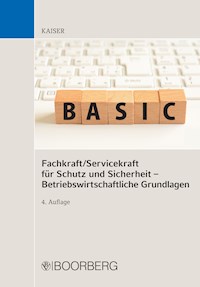
Fachkraft/Servicekraft für Schutz und Sicherheit - Betriebswirtschaftliche Grundlagen E-Book
Dieter Kaiser
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Richard Boorberg Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wichtige Grundkenntnisse für die Ausbildung Das Lehrbuch vermittelt umfassend die wesentlichen Inhalte der Wirtschafts- und Sozialkunde. Der Autor behandelt unter anderem folgende Einzelthemen: Wirtschaftsordnungen: Freie Marktwirtschaft/Planwirtschaft/Soziale Marktwirtschaft Wirtschaftsbereiche und Produktionsfaktoren Betriebswirtschaftliche Grundlagen: Betriebswirtschaftliches Handeln Unternehmensformen/Betriebsorganisationen: Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Vorstand, Hauptversammlung, Genossenschaftsversammlung Lohn- und Gehaltsabrechnung: Betriebswirtschaftliche Kennzahlen und Leistungsrechnung Auf aktuellem Stand Der Inhalt des Buches spiegelt die aktuelle Ausbildungsordnung der Fachkraft für Schutz und Sicherheit wider, die dem Beriech »Wirtschaft und Soziales« wesentliches Gewicht beimisst. Die komplett überarbeitete 4. Auflage ermöglicht den Auszubildenden einen leicht verständlichen Zugang zum relevanten betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Grundlagenwissen. Hierzu wurde auf eine klare Gliederung und eine nachvollziehbare Darstellung der Inhalte Wert gelegt, wie etwa durch ein Kapitelregister am Seitenrand. Wirtschaftliche Zusammmenhänge verstehen Arbeitgeber der Sicherheitswirtschaft erwarten von ihren Sicherheitsfachkräften neben fachlichen Kenntnissen auch betriebswirtschaftliches Wissen. So können wirtschaftliche Veränderungen früher erkannt und betriebliche Abläufe mit geeigneten Maßnahmen angepasst werden, um Kundenakzeptanz und Bestand der Unternehmen zu sichern. Empfehlenswert für: Das Fachbuch ist vorrangig auf die 3-jährige Berufsausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit zugeschnitten. Die Inhalte aber auch für 2-jährige Berufsausbildung zur Servicekraft für Schutz und Sicherheit geeignet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieter Kaiser, geb. 1965, Master of Arts mit Schwerpunkt Personalentwicklung (M.A.), geprüfter Betriebswirt (IHK), Leasingfachwirt (IHK), Einzelhandelskaufmann (IHK); ist seit 2003 als freiberuflicher Dozent für Universitäten, Hochschulen sowie private Bildungsträger und als ehrenamtlicher IHK- Prüfer tätig. Seine Themenschwerpunkte Betriebswirtschaft, Personalmanagement, Projektmanagement, Organisationsentwicklung, Marketing und die Ausbildung der Ausbilder (AdA) werden durch seine 20-jährige Berufserfahrung im Bankenbereich ergänzt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek | Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet unter www.dnb.de abrufbar.
4. Auflage, 2022
ISBN 978-3-415-07339-5
© 2007 Richard Boorberg Verlag
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Titelfoto: tamayura39 – stock.adobe.com
E-Book-Umsetzung: abavo GmbH, Nebelhornstraße 8, 86807 Buchloe
Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG | Scharrstraße 2 | 70563 StuttgartStuttgart | München | Hannover | Berlin | Weimar | Dresdenwww.boorberg.de
Vorwort zur 4. Auflage
Von den künftigen Fachkräften für Schutz und Sicherheit erwarten Arbeitgeber, gerade in Zeiten der Pandemie, die Umsetzung neuer Sicherheitsauflagen. Zudem bestehen Herausforderungen wie sich ständig verändernde Rahmenbedingungen in der Arbeitswelt – etwa Projektarbeit oder Remote-Work. Diese machen zusätzlich zu den fachlichen Kenntnissen und Fertigkeiten auch die Bewertung betriebswirtschaftlicher Auswirkungen, ein Verständnis für die Zusammenhänge im Unternehmen sowie das Wissen um die Gesamtentwicklungen der Sicherheitsbranche notwendig. Dies spiegelt sich auch in der aktuellen Ausbildungsordnung der Fachkraft für Schutz und Sicherheit wider, die dem Bereich „Wirtschaft und Soziales“ wesentliches Gewicht beimisst.
Das vorliegende Fachbuch in vierter Auflage kommt diesem Bedürfnis nach und vermittelt umfassend die wesentlichen Inhalte zu diesem Bereich der Ausbildung. Für die Auszubildenden sollen wirtschaftliche Kenntnisse und das Wissen über die Sicherheitswirtschaft transparent gemacht werden. Der Transfer in die berufliche Praxis versetzt die Auszubildenden in die Lage, über die fachlichen Inhalte hinaus auch die wirtschaftlichen Auswirkungen einer Entscheidung darstellen, bewerten und berücksichtigen zu können. Mit dieser Qualifikation können die Auszubildenden das betriebswirtschaftliche Spannungsfeld zwischen Kundenakzeptanz bzw. Kundenzufriedenheit und dem wirtschaftlichen Fortbestehen der Sicherheitsunternehmen erfolgreich steuern und bearbeiten.
Die Inhalte des Buches dienen auch zur Prüfungsvorbereitung für die Servicekraft für Schutz und Sicherheit. Aus der Ausbildungsordnung für die Servicekraft für Schutz und Sicherheit werden die Themen „Berufsausbildung, Arbeits- und Tarifrecht sowie Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes“ behandelt. Speziell die zunehmende Bearbeitung von Kundenaufträgen als Projekte wurde in der vierten Auflage im Bereich Projektmanagement neu intrigiert. Zusätzlich zur Fachkompetenz der Auszubildenden wird auch deren Methodenkompetenz gestärkt.
Die komplett überarbeitete Neuauflage soll den Auszubildenden auch weiterhin einen leicht verständlichen Zugang zum relevanten betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Grundlagenwissen ermöglichen. Hierzu wurde Wert auf eine klare Gliederung und eine nachvollziehbare Darstellung der Inhalte gelegt, wie etwa durch ein Kapitelregister am Seitenrand.
An Stellen im Buch, wo geschlechtsneutrale Formulierungen aus Gründen der Lesbarkeit unterbleiben, sind ausdrücklich stets alle Geschlechter angesprochen.
München, im Sommer 2022
Der Verfasser
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Vorwort zur 4. Auflage
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Volkswirtschaftliche Grundlagen
1.1 Volkswirtschaftliche Produktionsfaktoren
1.1.1 Produktionsfaktor Boden
1.1.2 Produktionsfaktor Arbeit
1.1.2.1 Ausführende Arbeit
1.1.2.2 Dispositive Arbeit
1.1.3 Produktionsfaktor Kapital
1.2 Wirtschaftssektoren (Wirtschaftsbereiche)
1.2.1 Primärer Wirtschaftssektor (Urproduktion)
1.2.2 Sekundärer Wirtschaftssektor (Gewerbliche Produktion)
1.2.3 Tertiärer Wirtschaftssektor (Dienstleistungen)
1.3 Wirtschaftsordnungen
1.3.1 Planwirtschaft (Kollektivprinzip)
1.3.2 Freie Marktwirtschaft (Individualprinzip)
1.3.3 Soziale Marktwirtschaft
1.3.4 Merkmale von Wirtschaftsordnungen
1.4 Wirtschaftspolitik im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft
1.4.1 Sozialpolitik
1.4.2 Wettbewerbspolitik
1.4.3 Globalsteuerung der Wirtschaft (Stabilitätsgesetz)
1.4.3.1 Stabilität des Preisniveaus
1.4.3.2 Hoher Beschäftigungsstand
1.4.3.3 Außenwirtschaftliches Gleichgewicht
1.4.3.4 Wirtschaftswachstum
1.4.3.5 Gerechte Einkommens- und Vermögensverteilung (erweitertes Ziel)
1.4.3.6 Ökologischer Umbau des Wirtschaftssystems (erweitertes Ziel)
1.4.4 Instrumente staatlicher Wirtschaftspolitik
1.4.4.1 Fiskalpolitik (Steuerpolitik)
1.4.4.2 Ausgabenpolitik (Geldpolitik)
1.4.4.3 Außenwirtschaftspolitik
1.4.4.4 Lohnpolitik
1.4.4.5 Wirtschaftsaufsichts- und Wirtschaftsförderungsrecht
1.5 Begriff und Wesen der Konjunktur
1.5.1 Wirtschaftliche Schwankungen
1.5.1.1 Saisonelle Schwankungen
1.5.1.2 Strukturelle Schwankungen
1.5.1.3 Konjunkturelle Schwankungen
1.5.2 Konjunkturzyklus
1.5.2.1 Hochkonjunktur (Boom)
1.5.2.2 Rezession (Abschwung)
1.5.2.3 Depression
1.5.2.4 Aufschwung (Expansion)
1.6 Der Wirtschaftskreislauf
1.6.1 Staat und private Haushalte
1.6.2 Staat und Unternehmen (Betriebe)
1.6.3 Private Haushalte und Unternehmen (Betriebe)
1.6.4 Private Haushalte und Banken
1.6.5 Unternehmen und Banken
1.6.6 Unternehmen und Ausland
2 Betriebswirtschaftliche Grundlagen
2.1 Wirtschaften (wirtschaftliches Handeln)
2.1.1 Bedürfnisse
2.1.1.1 Bedürfnisarten
2.1.1.1.1 Dringlichkeit der Bedürfniserfüllung
2.1.1.1.2 Bedürfnisäußerung
2.1.2 Bedarf und Nachfrage
2.1.3 Güter
2.1.3.1 Freie Güter
2.1.3.2 Wirtschaftliche Güter
2.1.3.2.1 Materielle Güter (Sachgüter)
2.1.3.2.2 Immaterielle Güter
2.1.4 Ökonomische Prinzipien (Prinzip der Wirtschaftlichkeit)
2.1.4.1 Maximalprinzip (Erfolgsmaximierung)
2.1.4.2 Minimalprinzip (Sparprinzip)
2.2 Betriebswirtschaftliche Produktionsfaktoren
2.2.1 Arbeit (menschliche Arbeitskraft)
2.2.2 Betriebsmittel
2.2.3 Werkstoffe (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe)
2.2.4 Rechte
2.3 Sach- und Dienstleistungsunternehmen
2.3.1 Sachleistungsunternehmen
2.3.2 Dienstleistungsunternehmen
2.3.2.1 Handelsunternehmen
2.3.2.2 Kreditinstitute (Banken)
2.3.2.3 Versicherungsinstitute
2.3.2.4 Öffentliche Versorgungsunternehmen
2.4 Funktionen in Sach- und Dienstleistungsunternehmen
2.4.1 Funktionsbereich Geschäftsführung
2.4.1.1 Wirtschaftliche Unternehmensziele
2.4.1.2 Soziale Unternehmensziele
2.4.1.3 Ethische Unternehmensziele
2.4.2 Funktionsbereich Beschaffung/Einkauf
2.4.3 Funktionsbereich Fertigung/Produktion
2.4.4 Funktionsbereich Marketing und Vertrieb
2.4.4.1 Marketing-Mix
2.4.5 Funktionsbereich Personalwesen
2.4.6 Funktionsbereich Rechnungswesen/Finanzierung
2.4.6.1 Controlling
2.5 Grundlagen der Betriebsorganisation (Unternehmensorganisation)
2.5.1 Aufbauorganisation
2.5.1.1 Einlinienorganisation (Einliniensystem)
2.5.1.2 Stablinienorganisation
2.5.1.3 Mehrlinienorganisation
2.5.1.4 Spartenorganisation
2.5.1.5 Matrixorganisation
2.5.2 Ablauforganisation
2.5.2.1 Darstellungs- und Durchführungsformen
2.5.2.2 Flussdiagramm
2.5.2.3 Arbeitsablaufkarte
2.5.2.4 Arbeitsanweisung
2.5.2.5 Projektmanagement
Merkmale eines Projekts
Organisation von Projekten
Projektarten
Aufgabenumfänge (Komplexität)
Projektbeteiligte – Rollen
Formen der Projektorganisation
Ablauforganisation von Projekten
A. Ablauf eines Projekts nach Phasen (Phasenmodell)
B. Zeitlichen Projektablauf planen
C. Projektabschluss
2.6 Entscheidungsmerkmale für Unternehmensformen
2.6.1 Privatrecht
2.6.2 Öffentliches Recht
2.6.3 Firma
2.6.4 Geschäftsführung/Vertretung/Organe
2.6.5 Finanzierung
2.6.6 Haftung
2.6.7 Juristische Person
2.6.8 Handelsregister
2.6.9 Auflösung
2.7 Privatrechtliche Unternehmensformen
2.7.1 Einzelunternehmen
2.8 Personengesellschaften
2.8.1 Stille Gesellschaft
2.8.2 Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR)
2.8.3 Partnerschaftsgesellschaft (PartG)
2.8.4 Offene Handelsgesellschaft (OHG)
2.8.5 Kommanditgesellschaft (KG)
2.9 Kapitalgesellschaften
2.9.1 Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
2.9.2 Modernisierung des GmbH-Rechts (MoMiG)
2.9.2.1 Überblick der Änderungen zur GmbH-Gründung
2.9.2.2 Handelsregistereintragung
2.9.2.3 Haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft (UG)
2.9.3 Aktiengesellschaft (AG)
2.9.4 Europäische Aktiengesellschaft SE
2.9.4.1 Gründung der Europäischen Aktiengesellschaft
2.9.4.2 Rechtsgrundlagen der Europäischen Aktiengesellschaft
2.9.4.3 Gründungsvorteile einer Europäischen Aktiengesellschaft
2.9.5 Organe der Kapitalgesellschaften (GmbH und AG)
2.9.5.1 Größenklassen für Kapitalgesellschaften
2.9.5.2 Publizitätspflicht (Offenlegungspflicht) von Jahresabschlüssen
2.9.6 Organe der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
2.9.6.1 Geschäftsführer einer GmbH
2.9.6.2 Aufsichtsrat einer GmbH
2.9.6.3 Gesellschafterversammlung einer GmbH
2.9.6.4 Zusammenfassung Organe einer GmbH
2.9.7 Organe der Aktiengesellschaft
2.9.7.1 Vorstand einer Aktiengesellschaft
2.9.7.2 Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft
2.9.7.3 Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft
2.9.7.4 Zusammenfassung Organe einer Aktiengesellschaft
2.10 Genossenschaften
2.10.1 Eingetragene Genossenschaft (e. G.)
2.10.2 Organe einer eingetragenen Genossenschaft (e. G.)
2.10.2.1 Vorstand einer eingetragenen Genossenschaft
2.10.2.2 Aufsichtsrat einer Genossenschaft
2.10.2.3 Generalversammlung einer Genossenschaft
2.10.2.4 Zusammenfassung Organe einer Genossenschaft
2.11 Rechtsform GmbH & Co. KG
2.12 Rechtsform GmbH & Co. OHG
2.13 Rechtsform KGaA
2.14 Der Verein
2.14.1 Nichtwirtschaftlicher Verein (Idealverein)
2.14.2 Wirtschaftlicher Verein
2.14.3 Schritte zur Vereinsgründung
2.14.4 Eintragung ins Vereinsregister
2.14.5 Vereinsorgane
2.14.5.1 Vorstand
2.14.5.2 Mitgliederversammlung
2.14.6 Beendigung eines Vereins
2.15 Rechtsformen des öffentlichen Rechts
2.15.1 Anstalten des öffentlichen Rechts
2.15.2 Körperschaften
2.15.2.1 Gebietskörperschaften
2.15.2.2 Personalkörperschaften
2.15.3 Stiftungen
2.16 Vertretungsvollmachten (Prokura/Handlungsvollmacht)
2.16.1 Handlungsvollmacht
2.16.2 Umfang der Handlungsvollmacht
2.16.3 Prokura
2.16.4 Arten von Prokura
2.17 Märkte und Marktformen
2.17.1 Marktformen
2.17.2 Marktpreise
2.17.2.1 Nachfragerüberhang (Verkäufermarkt)
2.17.2.2 Angebotsüberhang (Käufermarkt)
2.17.2.3 Gleichgewichtspreis (Wettbewerbspreis)
2.18 Preisbildung
2.18.1 Marktorientierte Preisbildung
2.18.2 Kostenorientierte Preisbildung
2.18.3 Unverbindliche Preisempfehlung
2.18.4 Vertikale Preisbindung
2.18.5 Preisdifferenzierung
2.18.5.1 Räumliche Preisdifferenzierung
2.18.5.2 Zeitliche Preisdifferenzierung
2.18.5.3 Preisdifferenzierung nach der Absatzmenge
2.18.6 Funktionen von Marktpreisen
2.18.6.1 Allokationsfunktion (Lenkungsfunktion)
2.18.6.2 Ausschaltungsfunktion
2.18.6.3 Signalfunktion
2.18.6.4 Ausgleichsfunktion
2.19 Betriebswirtschaftliche Kennzahlen
2.19.1 Produktivität
2.19.2 Wirtschaftlichkeit
2.19.3 Rentabilität
2.19.4 Liquidität
2.19.4.1 Liquidität 1. Grades
2.19.4.2 Liquidität 2. Grades
2.19.4.3 Liquidität 3. Grades
2.19.5 Maßnahmen zur Liquiditätssicherung
2.19.5.1 Vorauszahlung
2.19.5.2 Anzahlung
2.19.5.3 Zahlung bei Lieferung
2.19.6 Liquiditätsverlust
2.19.7 Zusammenfassung betriebswirtschaftliche Kennzahlen
2.20 Interessenvertretungen
2.20.1 Fachverbände
2.20.2 Kammern
2.21 Unternehmenszusammenschlüsse in der Wirtschaft
2.21.1 Arbeitsgemeinschaft
2.21.2 Interessengemeinschaft
2.21.3 Kartelle
2.21.4 Syndikate
2.21.5 Konzerne
2.21.5.1 Konzerne auf Gleichordnung
2.21.5.2 Konzerne auf Unterordnung (einseitige Beherrschung)
2.21.5.3 Konzern in Form einer Holding (Dachgesellschaft)
2.21.6 Trust (Fusion)
2.21.6.1 Fusion durch Aufnahme
2.21.6.2 Fusion durch Neubildung
3 Lohn- und Gehaltsabrechnung
3.1 Bruttolohnermittlung
3.2 Steuerliche Abzüge
3.2.1 Lohnsteuer
3.2.2 Kirchensteuer
3.2.3 Solidaritätszuschlag
3.2.4 Zusammenfassung steuerlicher Abzüge
3.3 Sozialversicherungsabzüge
3.3.1 Krankenversicherung
3.3.2 Pflegeversicherung
3.3.3 Rentenversicherung
3.3.4 Arbeitslosenversicherung / Arbeitsförderungsversicherung
3.3.5 Unfallversicherung
3.3.6 Zusammenfassung Sozialversicherungsabzüge
3.4 Nettolohnermittlung
3.5 Persönliche Abzüge
3.6 Persönliche Bezüge
3.7 Auszahlungsbetrag
4 Betriebswirtschaftliche Leistungsrechnung
4.1 Publizitätspflicht von Unternehmen
4.1.1 Unterlagen für die Öffentlichkeit
4.1.2 Veröffentlichungsumfang
4.2 Struktur Unternehmensbilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung
4.2.1 Bilanz
4.2.2 Gewinn- und Verlustrechnung
4.3 Kosten und Leistungen im Unternehmen
4.3.1 Einzelkosten
4.3.2 Gemeinkosten
4.4 Kostenarten
4.4.1 Kostenarten auf Basis von Produktionsfaktoren
4.4.2 Kostenarten auf Basis ihrer Zurechenbarkeit
4.4.3 Kostenarten auf Basis primärer und sekundärer Kosten
4.4.4 Kostenarten auf Basis von betrieblichen Funktionen
4.4.5 Kostenarten auf Basis der Leistungsabhängigkeit
4.4.5.1 Fixkosten
4.4.5.2 Variable Kosten
4.5 Kostenstellen
4.5.1 Kostenstellenbildung nach Funktionsbereichen
4.5.2 Kostenstellenbildung nach Verantwortungsbereichen
4.5.3 Kostenstellenbildung nach räumlichen Aspekten
4.5.4 Arten von Kostenstellen
4.5.4.1 Hauptkostenstellen
4.5.4.2 Allgemeine Kostenstellen
4.5.4.3 Hilfskostenstellen
4.6 Betriebsabrechnung
4.6.1 Kostenartenrechnung
4.6.2 Kostenstellenrechnung
4.6.3 Zusammenfassung im Betriebsabrechnungsbogen (BAB)
4.7 Kostenträger
4.7.1 Kostenträgerzeitrechnung
4.7.2 Kostenträgerstückrechnung
4.7.3 Unterscheidung Vorkalkulation und Nachkalkulation
4.7.3.1 Vorkalkulation
4.7.3.2 Nachkalkulation
4.8 Deckungsbeitrag
4.8.1 Deckungsbeitragsrechnung
5 Berufsausbildung im Unternehmen
5.1 Rahmenbedingungen für die Berufsausbildung
5.1.1 Inhalte der Ausbildungsordnung
5.1.2 Ausbildungsdauer
5.1.3 Verkürzung der Ausbildungsdauer
5.1.4 Ordentliche Beendigung der Ausbildungsdauer
5.1.5 Verlängerung der Ausbildungsdauer
5.2 Ausbildungsvertrag
5.2.1 Wesentliche Inhalte des Ausbildungsvertrages
5.2.2 Bezeichnung anerkannter Ausbildungsberuf
5.2.3 Art, sachliche und zeitliche Gliederung der Berufsausbildung
5.2.4 Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte
5.2.5 Dauer der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit
5.2.6 Dauer der Probezeit
5.2.7 Zahlung und Höhe der Ausbildungsvergütung
5.2.8 Dauer des Urlaubes
5.2.9 Kündigungsvoraussetzungen
5.2.10 Anwendbare Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen
5.3 Rechte und Pflichten von Ausbildenden und Auszubildenden
5.3.1 Pflichten des Auszubildenden (§ 13 BBIG)
5.3.2 Pflichten des Ausbildenden (§ 14 BBIG)
5.3.3 Erstuntersuchungspflicht für jugendliche Auszubildende
5.3.4 Nachuntersuchungspflicht für jugendliche Auszubildende
5.4 Eignung für die Berufsausbildung von Auszubildenden
5.4.1 Eignung der Ausbildungsstätte
5.4.2 Eignung von Ausbildenden und Ausbildern
5.4.3 Fachliche Eignung von Ausbildern
5.5 Jugend- und Auszubildendenvertretung im Betriebsrat
5.5.1 Wahlen zur Jugend- und Ausbildungsvertretung
5.5.2 Rechte einer Jugend- und Ausbildungsvertretung
5.5.3 Aufgaben einer Jugend- und Ausbildungsvertretung
6 Arbeitsrecht und Tarifvertragsrecht
6.1 Individuelles Arbeitsrecht
6.1.1 Dienstvertrag/Arbeitsvertrag
6.1.2 Wesentliche Inhalte Dienstvertrag/Arbeitsvertrag
6.1.3 Beginn und Dauer des Arbeitsverhältnisses
6.1.3.1 Probezeit
6.1.3.2 Arbeitsort
6.1.3.3 Tätigkeitsbeschreibung des Arbeitnehmers
6.1.3.4 Vergütung/Entgelt
6.1.3.5 Verpflichtung zur Entgeltfortzahlung
6.1.3.6 Arbeitszeitvereinbarungen
6.1.3.7 Jahresurlaub
6.1.4 Kündigung
6.1.4.1 Außerordentliche Kündigung des Arbeitsvertrages
6.1.4.2 Ordentliche Kündigung
6.1.4.3 Kündigungsfrist
6.1.4.4 Zustimmung des Betriebsrates bei Kündigung
6.1.4.5 Besonderer Kündigungsschutz für bestimmte Personengruppen
6.1.5 Schwerbehinderte Menschen
6.1.6 Hinweis auf Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen
6.1.7 Zusatzvereinbarungen im Arbeitsvertrag
6.1.8 Zeugnispflicht des Arbeitgebers
6.2 Kollektives Arbeitsrecht
6.2.1 Tarifvertragspartner Gewerkschaft
6.2.2 Tarifvertragspartner Arbeitgeberverbände
6.2.3 Tarifvertrag
6.2.3.1 Rahmentarifvertrag (RTV)
6.2.3.2 Manteltarifvertrag
6.2.3.3 Lohn- und Gehaltstarifvertrag
6.2.3.4 Sondertarifvertrag
6.2.3.5 Absicherungs- und Rationalisierungsschutzabkommen
6.2.4 Tarifvertragsverhandlungen (Arbeitskampf/Streik)
6.2.5 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)
6.2.6 Aufgaben des Betriebsrats
6.2.7 Rechte des Betriebsrates
6.2.7.1 Informationsrecht
6.2.7.2 Anhörungsrecht
6.2.7.3 Beratungsrecht
6.2.7.4 Mitwirkungs- und Einspruchsrecht
6.2.7.5 Mitbestimmungsrecht
6.2.8 Rahmenbedingungen für die Betriebsratsarbeit
6.2.9 Mitbestimmung in Kapitalgesellschaften (Unternehmen)
6.2.9.1 Betriebsverfassungsgesetz 1952
6.2.9.2 Mitbestimmungsgesetz 1976
6.2.9.3 Montan-Mitbestimmungsgesetz 1951
6.2.10 Betriebsvereinbarung
6.2.10.1 Zustandekommen von Betriebsvereinbarungen
6.2.10.2 Inhalt von Betriebsvereinbarungen
7 Vertragsrecht
7.1 Vertragsparteien
7.1.1 Rechtsfähigkeit
7.1.2 Geschäftsfähigkeit
7.1.2.1 Geschäftsunfähigkeit
7.1.2.2 Beschränkte Geschäftsfähigkeit
7.1.3 Willenserklärung
7.1.3.1 Anfechtung von Willenserklärungen
7.1.3.2 Anfechtungsfrist
7.1.3.3 Nichtigkeit von Willenserklärungen
7.2 Vertragsablauf von Rechtsgeschäften
7.2.1 Angebot
7.2.1.1 Form des Angebots
7.2.1.2 Angebotsverbindlichkeit
7.2.1.3 Leistungsbeschreibung und Warenbeschreibung
7.2.2 Lieferbedingungen
7.2.2.1 Lieferkosten/Beförderungskosten
7.2.2.2 Zahlungsbedingungen
7.2.2.3 Gerichtsstand
7.2.3 Annahme
7.2.3.1 Form der Annahme
7.2.3.2 Auftragsbestätigung
7.2.3.3 Kaufmännisches Bestätigungsschreiben
7.2.3.4 Lieferung
7.2.4 Rechnungserstellung
7.2.4.1 Kleinstrechnungen (§ 33 Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung)
7.2.4.2 Pflichtangaben in Rechnungen
7.2.5 Gesetzliche Gewährleistung
7.2.5.1 Sach- und Rechtsmangel
7.2.5.2 Gewährleistungsrechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmangel
7.2.5.3 Gewährleistungsfrist
7.2.5.4 Privatkauf
7.2.5.5 Verbrauchsgüterkauf
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
AG
Aktiengesellschaft
AGS
Amtlicher Gemeindeschlüssel
AKS
Allgemeine Kostenstelle
AktG
Aktiengesetz
ArbPlSchG
Gesetz über den Schutz des Arbeitsplatzes bei Einberufung zum Wehrdienst (Arbeitsplatzschutzgesetz)
BAB
Betriebsabrechnungsbogen
BBG
Beitragsbemessungsgrenze
BBIG
Berufsbildungsgesetz
BEEG
Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
BetrVG
Betriebsverfassungsgesetz
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
BIP
Bruttoinlandsprodukt
BUrlG
Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer (Bundesurlaubsgesetz)
db
Deckungsbeitrag
e. G.
eingetragene Genossenschaft
e. K.
eingetragener Kaufmann
EFZG
Gesetz über die Zahlung des Arbeitsentgelts an Feiertagen und im Krankheitsfall (Entgeltfortzahlungsgesetz)
EU
Europäische Union
GbR
Gesellschaft bürgerlichen Rechts
GenG
Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (Genossenschaftsgesetz)
GewO
Gewerbeordnung
GG
Grundgesetz
GKV
Gesetzliche Krankenversicherung
GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHG
Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH-Gesetz)
GWB
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
GWKS
Hauptkostenstelle Geld- und Werttransporte
HGB
Handelsgesetzbuch
HKS
Hilfskostenstelle für die Hauptkostenstelle OKS-A + OKS-B
HwO
Gesetz zur Ordnung des Handwerks (Handwerksordnung)
i. d. R.
in der Regel
i. Gr.
in Gründung
IG
Industriegewerkschaft
JArbSchG
Jugendarbeitsschutzgesetz
KLR
Kosten- und Leistungsrechnung
KMU
Kleinere und mittlere Unternehmen
KSchG
Kündigungsschutzgesetz
MuSchG
Gesetz zum Schutze der erwerbstätigen Mutter (Mutterschutzgesetz)
NachwG
Gesetz über den Nachweis der für ein Arbeitsverhältnis wesentlichen Arbeitsbedingungen (Nachweisgesetz)
OHG
Offene Handelsgesellschaft
OKS-A
Kostenstelle Objektschutz kleine Unternehmen
OKS-B
Kostenstelle Objektschutz große Unternehmen
PKS
Hauptkostenstelle Personenschutz
PublG
Gesetz über Rechnungslegung von bestimmten Unternehmungen und Konzernen (Publizitätsgesetz)
SGB
Sozialgesetzbuch
StabG
Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft
TVG
Tarifvertragsgesetz
UStDV
Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung
UStG
Umsatzsteuergesetz
UWG
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
VKS
Hauptkostenstelle Veranstaltungsservice
VTKS
Vertriebsstelle
VWKS
Verwaltungsstelle
VWL
Vermögenswirksame Leistungen
ZPO
Zivilprozessordnung
1.1Volkswirtschaftliche Grundlagen
Die Volkswirtschaft beinhaltet die gesamte wirtschaftliche Betrachtung und den wirtschaftlichen Aufbau/Struktur eines einzelnen Staates und dient auch dem wirtschaftlichen Vergleich zwischen Staaten. Die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft (Staat bzw. Land) wird durch Kennzahlen wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP) oder Bruttosozialprodukt ausgedrückt. Ein Index für die volkswirtschaftliche Situation ist der Konjunkturzyklus. Dieser bestimmt, in welcher Konjunkturphase sich die betrachtete Volkswirtschaft befindet.
Im ersten Kapitel dargestellt sind die Produktionsfaktoren aus volkswirtschaftlicher Sicht, die Wirtschaftssektoren einer Volkswirtschaft, der erweiterte Wirtschaftskreislauf (Geldkreislauf) und die unterschiedlichen Wirtschaftsordnungen. Hierbei werden auch die staatlichen Einwirkungsmöglichkeiten auf die Wirtschaft betrachtet (bezogen auf die Bundesrepublik Deutschland).
1.11.1Volkswirtschaftliche Produktionsfaktoren
Güter zu beschaffen oder diese in einem Produktionsprozess zu erzeugen und die so hergestellten Güter am Markt zu verteilen, wird aus der volkswirtschaftlichen Betrachtungsweise als „produzieren“ bezeichnet. Diese Produktion von Gütern kann nur erfolgen, wenn der in der Natur vorhandene Produktionsfaktor Boden verbraucht wird. Die menschliche Arbeit ist ein weiterer Produktionsfaktor, welcher sinnvoll im Herstellungsprozess eingesetzt wird. Da beide Produktionsfaktoren in einer Volkswirtschaft von Anfang an vorhanden sind, werden sie als originäre (ursprüngliche) Produktionsfaktoren bezeichnet.
Als derivativer (abgeleiteter) Produktionsfaktor wird das Kapital bezeichnet, da aus dem Verkauf der hergestellten Güter dem Unternehmen als Ersatz für den Produktionsfaktorenverbrauch wieder Geld in Form von Umsatzerlösen zufließt. Derivative Produktionsfaktoren entstehen durch das Zusammenwirken von originären Produktionsfaktoren. Somit kennt die Volkswirtschaft grundsätzlich drei Produktionsfaktoren:
•
Boden
•
Arbeit
•
Kapital
Im erweiterten Blickwinkel wird als vierter Produktionsfaktor (derivativ) das menschliche Wissen (Know-how) gesehen. Dieser zusätzliche Produktionsfaktor ist aus dem originären Produktionsfaktor Arbeit abgeleitet. Die Stellung der Bildung (Wissen) wird immer wichtiger, da im ständigen Wandel (naturwissenschaftliche, technische, handwerkliche und kaufmännische Weiterentwicklung) der Arbeitswelt das Wissen eine wichtige Voraussetzung für den Einstieg sowie für den Verbleib im Erwerbsleben eines Menschen ist.
1.1.11.1.1Produktionsfaktor Boden
Dieser Produktionsfaktor ist nicht vermehrbar und somit absolut knapp. Der Oberbegriff Boden beinhaltet neben den von der Natur zur Verfügung gestellten Ressourcen (Bodenschätze) auch die Erzeugung von Lebensmitteln oder Naturprodukten durch landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Anbau. Er dient auch als Entscheidungsbasis für einen bestimmten Standort (z. B. klimatische Bedingungen, Transportwege). Somit beinhaltet der Produktionsfaktor Boden drei Funktionen, eine Abbaufunktion (Gewinnung von Bodenschätzen), eine Anbaufunktion (Erzeugung von Lebensmitteln oder Holz) und die Standortfunktion für Unternehmen und Haushalte.
Aufgrund der Knappheit des Produktionsfaktors Boden wurde neben der ökonomischen Nutzung auch der ökologischen Nutzung (Maßnahmen zum Umweltschutz und die Beseitigung vorhandener Umweltschäden) mehr Gewicht verliehen.
1.1.21.1.2Produktionsfaktor Arbeit
Der Mensch ist aus volkswirtschaftlicher Betrachtung der Träger des Produktionsfaktors Arbeit, da seine geistige und körperliche Tätigkeit auf die Erzielung eines Einkommens ausgerichtet ist. Als wesentliches Unterscheidungsmerkmal wird die Arbeit in ausführende Arbeit (körperliche Tätigkeiten) und dispositive Arbeit (geistige Tätigkeiten) gegliedert. Der körperlichen und geistigen Gesundheit kommt der Wandel des Produktionsfaktors Arbeit zugute: In der Arbeitswelt steigt zum einen der Anteil an dispositiven Arbeiten (z. B. aufgrund maschineller Unterstützung), zum anderen wird der Mensch immer mehr von ausführender Arbeit entlastet.
Für beide Tätigkeitsbereiche (ausführende und dispositive Arbeit) ist eine gute Ausbildung, ein großes Fachwissen und die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen (Aus- und Weiterbildung) erforderlich. Aus diesem Grunde leitet sich der vierte Produktionsfaktor Wissen aus dem originären Produktionsfaktor Arbeit ab.
1.1.2.11.1.2.1Ausführende Arbeit
Körperliche Tätigkeiten (ausführende Arbeit) verlangen ein hohes Maß an manuellen Kenntnissen und Fertigkeiten. Besondere Anforderungen werden auch an Muskelkraft, Geschicklichkeit und Beweglichkeit gestellt. Neben dem Fachwissen ist hier eine gute körperliche Konstitution der ausführenden Person erforderlich.
1.1.2.21.1.2.2Dispositive Arbeit
Geistige Tätigkeiten (dispositive Arbeit) zeichnen sich eher durch Organisations-, Kontroll- und Planungstätigkeiten aus. Sie stellen besondere Anforderungen an das Denkvermögen und das Wissen der Person.
1.1.31.1.3Produktionsfaktor Kapital
Der Produktionsfaktor Kapital kann nur durch das Zusammenwirken der Produktionsfaktoren Boden und Arbeit entstehen. Die erzeugten Güter und Dienstleistungen werden nicht selbst verbraucht, sondern am Markt verkauft. Die dadurch erzielten Verkaufspreise (Umsatzerlöse) fließen zum Erzeuger zurück. Übersteigt der Verkaufspreis die Kosten für den Einsatz der Produktionsfaktoren, entsteht Kapital. Dieses Kapital steht dem Erzeuger dann für neue Investitionen zur Verfügung.
1.21.2Wirtschaftssektoren (Wirtschaftsbereiche)
Aus volkswirtschaftlicher Betrachtung werden die Unternehmen in drei Wirtschaftssektoren (Wirtschaftsbereiche) untergliedert. Diese Gliederung kann jedoch nach Sinn und Zweck der statistischen Betrachtung feiner (auf vier Wirtschaftssektoren) oder auch gröber (auf zwei Wirtschaftssektoren) gefasst werden. Somit werden Sachleistungsbetriebe in den primären und sekundären Wirtschaftssektor und die Dienstleistungsbetriebe in den tertiären Wirtschaftssektor zusammengefasst.
1.2.11.2.1Primärer Wirtschaftssektor (Urproduktion)
Dort sind grundsätzlich Betriebe zusammengefasst, welche den Produktionsfaktor Boden nutzen. Die wirtschaftliche Nutzung des Produktionsfaktors Boden lässt sich in Abbaubetriebe (Bergbau, Binnenseefischereibetriebe, Holzgewinnungsbetriebe, Wasserkraftwerke, Windkraftwerke), Anbaubetriebe (Land- und Forstwirtschaftsbetriebe) und in Bebauungsbetriebe (Bauwirtschaft) untergliedern. Der primäre Wirtschaftssektor stellt die Urproduktion dar.
1.2.21.2.2Sekundärer Wirtschaftssektor (Gewerbliche Produktion)
Zum sekundären Wirtschaftssektor gehören Industriebetriebe, welche aus Rohstoffen Güter und Dienstleistungen industriell herstellen (Glaswarenindustrie, Fleischwarenindustrie, Lederindustrie, Metallindustrie etc.). Auch Teile des Handwerks gehören dazu. Sie stellen marktreife Produkte selbstständig her (produzierendes Handwerk). Der Produktionsfaktor Boden wird hier zur Bebauung von Werkshallen, Firmengebäuden genutzt.
1.2.31.2.3Tertiärer Wirtschaftssektor (Dienstleistungen)
Im tertiären Wirtschaftssektor werden Dienstleistungen (immaterielle Güter) erzeugt. Sie werden von Handelsbetrieben, freien Berufen und Dienstleistungsbetrieben erbracht, ohne ein tatsächliches Produkt (Ware) herzustellen. Die Dienstleistung wird vom Kunden empfunden und erlebt. Die Entwicklung der menschlichen Arbeit hat sich im Laufe der Zeit von der Urerzeugung (Primärer Sektor) hin zum Dienstleistungsgewerbe (tertiärer Wirtschaftssektor) entwickelt. Die Dienstleistung Sicherheit mit ihren speziellen Leistungen zählt zu diesem Wirtschaftssektor.
Gründe für die sprunghafte Entwicklung dieses Wirtschaftsbereiches sind die Bedürfnissteigerung der Nachfrager in den Bereichen:
•
Mobilität (Zuwachs der Dienstleistungen Handel und Verkehr)
•
Besitzstandswahrung (Zuwachs Versicherungsdienstleistungen)
•
Sicherheitsbedürfnis (Zuwachs von Sicherheitsdienstleistungen)
•
Bargeldlose Zahlungen (Zuwachs der Bankdienstleistungen)
•
Geldanlage (Zuwachs der Beratungsdienstleistung)
•
Freizeit (Zuwachs an Freizeitanlagen, Fitnesseinrichtungen)
•
Gesundheit (Zuwachs von Ernährungsberatungen)
Für manche Dienstleistungsbereiche ist der Neueinstieg/eine Neugründung relativ kostengünstig, da gerade am Beginn von zu Hause aus gearbeitet werden kann. Bei bestimmten Dienstleistungsbereichen jedoch ist von Anfang an ein aufwendiger Maschinen- oder Fuhrpark (z. B. Spedition) erforderlich. Auch Sicherheitsunternehmen benötigen von Beginn an ein hohes Startkapital, da neben Kosten für fachgerechte Ausrüstung auch hohe Lohnkosten für jeden Auftrag anfallen.
1.31.3Wirtschaftsordnungen
Jeder Staat besitzt die freie Entscheidung, welche Wirtschaftsordnung er sich geben möchte. Bei der Wahl der Wirtschaftsordnung spielen immer kulturelle Gesichtspunkte, gesellschaftliche Gesichtspunkte, soziale Gesichtspunkte, die rechtliche Ordnung und politische Gesichtspunkte eine wichtige Rolle. Die Wirtschaftsordnung eines Staates spiegelt die reale Erscheinungsform einer Volkswirtschaft wider und regelt den Aufbau sowie den Ablauf des Wirtschaftens. Somit werden die Beziehungen der Wirtschaftseinheiten zueinander durch die gewählte Wirtschaftsordnung geregelt. Die Wirtschaftseinheiten/Wirtschaftssubjekte innerhalb einer Volkswirtschaft sind:
•
Staat (öffentliche Haushalte)
•
Unternehmen
•
Private Haushalte
•
Banken
•
Ausland
Als Idealtypen werden die freie Marktwirtschaft (Verkehrswirtschaft) und die Planwirtschaft (Zentralverwaltungswirtschaft) bezeichnet. In der Geschichte jedoch haben sich diese Idealtypen nicht durchgesetzt, stattdessen wurden Mischformen (Elemente aus beiden Idealtypen) entwickelt. Folgende Wirtschaftsordnungen werden von der Volkswirtschaft unterschieden:
•
Planwirtschaft (Kollektivprinzip)
•
Freie Marktwirtschaft (Individualprinzip)
•
Soziale Marktwirtschaft
1.3.11.3.1Planwirtschaft (Kollektivprinzip)
Die Wirtschaftsordnung der Planwirtschaft stellt den Staat in den Vordergrund und ist gekennzeichnet durch gesellschaftliches Eigentum, Regelung der gesamten wirtschaftlichen Planungen (Mehrjahrespläne, Jahresplan) und durch Regelung des Marktes. Eine zentrale Stelle lenkt und steuert den wirtschaftlichen Fortgang des Staates. Die erforderlichen Produktionsgüter (Maschinen etc.) werden den staatseigenen Betrieben in Form von Kontingenten zugeteilt. Ebenfalls wird der Wettbewerb und somit auch das Angebot am Markt durch eine zentrale Wirtschaftsplanung bestimmt.
Die Bedürfnisse und Wünsche der einzelnen Bürger (private Haushalte) nach bestimmten Dienstleistungen und Gütern blieben in der Planerstellung unberücksichtigt. Das Kollektivprinzip weist also dem Einzelnen eine untergeordnete Rolle gegenüber dem Staat (bzw. der Wirtschafsbehörde) zu. Die Berufswahl oder die Arbeitsplatzwahl wird ebenfalls von dieser zentralen Stelle gesteuert.
Diese Wirtschaftsordnung war in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR) durch die Regierung angeordnet. Die Merkmale begründen bestimmte Engpässe und die daraus entstehenden Wartezeiten bei Gütern bzw. Dienstleistungen. Die Menschen in dieser Wirtschaftsordnung mussten sich in ihrem wirtschaftlichen Verhalten dem übergeordneten Staatsplan anpassen.
1.3.21.3.2Freie Marktwirtschaft (Individualprinzip)
Für die soziale Absicherung jedoch ist in erster Linie der Mensch selbst verantwortlich. Somit hängt es von der wirtschaftlichen Kraft des Einzelnen ab, welche Vorsorge/Absicherung er treffen kann. Für wirtschaftlich schwächere Personen steht im Bedarfsfalle lediglich eine geringe Mindestversorgung zur Verfügung. Dieses Individualprinzip vertraut darauf, dass der Großteil über ausreichende Mittel zur Absicherung verfügt.
1.3.31.3.3Soziale Marktwirtschaft
Die soziale Markwirtschaft stellt eine Weiterentwicklung der beiden Wirtschaftsordnungen Planwirtschaft und der freien Marktwirtschaft dar. Sie trägt somit Elemente von beiden in sich und verbindet die wirtschaftliche Freiheit der Wirtschaftseinheiten mit dem sozialen Fortschritt und sozialer Sicherheit. Soziale Gerechtigkeit und Glättung von sozialer Ungleichgewichtung werden mit dem freiheitlichen Individualprinzip zu einer wirtschaftlichen Grundordnung verbunden. Somit soll der wirtschaftliche Erfolg der Wirtschaftseinheiten ermöglicht werden, ohne die soziale Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit zu vergessen. Leitlinien der sozialen Marktwirtschaft sind:
•
Marktwirtschaftlicher Wettbewerb (Wettbewerbspolitik)
•
Freies Unternehmertum (Gewinnstreben) unter Berücksichtigung der sozialen Verantwortung
•
Privateigentum an Produktionsmitteln (Staat, Verbände und Privatleute)
•
Sozialbindung des Eigentums, d. h. der Gebrauch des Eigentums soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen (lt. Grundgesetz)
•
Wirtschaftspolitische Aufgaben des Staates
•
Soziale Aufgaben des Staates
•
Tarifautonomie der Sozialpartner
•
Abwägen der Interessen des Einzelnen und der Gesellschaft
Dem Staat fallen somit in dieser Wirtschaftsordnung folgende wirtschaftspolitische und soziale Aufgaben zu:
•
Bildung von sozialen Sicherungssystemen (Sozialgesetzgebung)
•
Wettbewerbspolitik (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen/GWB)
•
Globalsteuerung der Wirtschaft (Stabilitätsgesetz)
•
Maßnahmen zur Einkommensumverteilung (Redistributionspolitik)
•
Umweltpolitik
Die Bundesrepublik Deutschland (BRD) hat die Wirtschaftsordnung der sozialen Marktwirtschaft. Den Rahmen gibt das im Mai 1949 in Kraft getretene Grundgesetz vor, da dort festgelegt wurde, dass die Bundesrepublik Deutschland ein sozialer Staat ist und den Wirtschaftssubjekten eine freie Berufs- und Arbeitsplatzwahl, Gewerbefreiheit und der Schutz des Privateigentums garantiert wird.
1.3.41.3.4Merkmale von Wirtschaftsordnungen
Hier werden die wesentlichen Elemente (Systemmerkmale) der oben aufgeführten Wirtschaftsordnungen zur besseren Übersicht und Lernkontrolle in Tabellenform gegenübergestellt:
Systemmerkmale
Planwirtschaft
Freie Marktwirtschaft
Soziale Marktwirtschaft
Grundordnung
Kollektivprinzip
Individualprinzip
Kollektiv- + Individualprinzip
Planungsmöglichkeit
Zentral durch staatliche Planungsbehörden
Dezentral durch Wirtschaftseinheiten
Dezentral durch Wirtschaftseinheiten + staatliche Wirtschaftspolitik
Wirtschaftseinheiten
Unterordnung wirtschaftlicher Planungsvorgaben
Freie wirtschaftliche Entscheidung
Freie wirtschaftliche Entscheidung
Eigentum
Gesellschaftliches Eigentum
Privateigentum
Privateigentum + Sozialpflicht des Eigentums
Unternehmensziele
Planerfüllung
Gewinn
Gewinn + soziale Verantwortung
Unternehmensform
Staatsbetriebe
Freies Unternehmertum
Freies Unternehmertum
Preisbildung
Staatlich festgesetzte Preise
Angebot + Nachfrage
Angebot + Nachfrage unter Beachtung des Wettbewerbs
Lohnfestsetzung
Staatliche Behörde
Sozialpartner
Sozialpartner
1.41.4Wirtschaftspolitik im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft
In der sozialen Marktwirtschaft fallen dem Staat bestimmte Aufgaben zu, um unerwünschte wirtschaftliche und soziale Folgen aus der freiheitlichen Wirtschaftsordnung zu verhindern (z. B. Bildung von Monopolstellungen am Markt, soziale Absicherung der Arbeitnehmer etc.). Im Rahmen der Sozialpolitik, der Wettbewerbspolitik und der Wirtschaftspolitik nimmt der Staat seine Aufgabenstellung in der sozialen Marktwirtschaft wahr. Die Regierung, das Parlament, die Banken und Interessenverbände greifen somit in das wirtschaftliche Geschehen ein.
1.4.11.4.1Sozialpolitik
Die Aufgabe der Sozialpolitik besteht darin, der breiten Bevölkerung ein engmaschiges Netz an sozialen Leistungen im Bedarfsfalle zu bieten (z. B. Erziehungsgeld). Aber auch die Absicherung bestimmter Personenkreise bzw. persönlicher Situationen (z. B. Arbeitsförderungsversicherung, Ausbildungsförderungen, Rente wegen Erwerbsunfähigkeit) ist Ziel der Sozialpolitik. Aufgrund gesetzlich vorgeschriebener Mitgliedschaften werden Beiträge vom Versicherten an die jeweiligen Träger abgeführt (siehe Kapitel 3. Lohn- und Gehaltsabrechnung) und stehen dem Versicherten im Bedarfsfalle zur Verfügung. Dieses soziale Netz ist derzeit gekennzeichnet durch ständige politische Reformvorhaben und Anpassung in der Sozialgesetzgebung (Sozialgesetzbuch) sowie im Arbeitsrecht. Die wichtigsten Versicherungen (Säulen) der Sozialpolitik sind:
•
Krankenversicherung
•
Pflegeversicherung
•
Rentenversicherung
•
Arbeitslosenversicherung
•
Unfallversicherung
1.4.21.4.2Wettbewerbspolitik
Um den Wettbewerb am Markt (als Basis für eine funktionierende Wirtschaft) zu erhalten, hat der Staat Gesetze und Verordnungen erlassen. Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) regelt die Zusammenarbeit zwischen den Privatunternehmen (bei Unternehmenskonzentrationen oder Kooperationen etc.) und kontrolliert somit, ob ein Wettbewerb am Markt weiterhin gegeben ist. Sollte sich durch Zusammenschlüsse von Privatunternehmen eine Machtstellung (Monopolstellung) ergeben, die einen Eintritt eines Mitbewerbers sinnlos machen würde, wird dieser Zusammenschluss nicht genehmigt. Ebenfalls werden wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen wie Preiskartelle oder Importkartelle vom Gesetzgeber nicht genehmigt und sind verboten (§ 1 GWB).
Ebenfalls sorgt der Gesetzgeber über das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) dafür, dass ein fairer Wettstreit zwischen den Unternehmen am Markt vollzogen wird. Das Gesetz soll den Konsumenten vor irreführenden Angaben und Angeboten schützen und somit Transparenz am Markt bringen. Das Auftreten und die Angaben der Unternehmen dürfen nicht durch wettbewerbswidrige Maßnahmen gekennzeichnet sein (z. B. irreführende Werbung). Ein wettbewerbswidriges Verhalten kann von einem Mitbewerber angezeigt werden (bei der Industrie- und Handelskammer oder einer Zentrale zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs) und das betroffene Unternehmen wird aufgefordert, diese bestimmte Maßnahme zu unterlassen (§ 8 UWG).
1.4.31.4.3Globalsteuerung der Wirtschaft (Stabilitätsgesetz)
•
Vollbeschäftigung
•
Stabilität des Preisniveaus
•
Außenwirtschaftliches Gleichgewicht (Zahlungsbilanzausgleich mit dem Ausland)
•
Stetiges sowie angemessenes Wirtschaftswachstum
Da es in der Praxis leider unmöglich ist, alle Ziele gleichzeitig zu erreichen (konkurrierende Ziele), werden die Stabilitätsziele auch als magisches Viereck bezeichnet. Dieses Viereck kann zu einem magischen Sechseck erweitert werden durch Aufnahme der Ziele nach gerechter Einkommens- und Vermögensverteilung und dem ökologischen Umbau des Wirtschaftssystems.
Abb. 1 Magisches Viereck/Ziele des Stabilitätsgesetzes zur Globalsteuerung der Wirtschaft
Im magischen Sechseck wurde das Zielsystem um zwei weitere Ziele erweitert:
•
Gerechte Einkommensverteilung und Vermögensverteilung
•
Ökologischer Umbau des Wirtschaftssystems
1.4.3.11.4.3.1Stabilität des Preisniveaus
Unter der Stabilität des Preisniveaus wird das Gleichgewicht der Preise verstanden. Somit sollten die Preise aller Güter im Durchschnitt auf gleichem Niveau verbleiben (absolute Preisstabilität). Da es keiner Wirtschaftspolitik bisher gelungen ist, die absolute Preisstabilität zu erreichen, wird eine jährliche Steigerung des allgemeinen Preisniveaus von 3 % (Durchschnittspreise) unter der Stabilität des Preisniveaus verstanden.
1.4.3.21.4.3.2Hoher Beschäftigungsstand
Ein hoher Beschäftigungsstand hat grundsätzlich zur Hauptaufgabe, die Auslastung sämtlicher Produktionsfaktoren (Arbeitskraft, Arbeitsmittel und Kapital) zu erreichen. Jedoch wird unter hohem Beschäftigungsstand auch die Auslastung des Produktionsfaktors Arbeit verstanden. Über die Arbeitslosenquote oder das Verhältnis von offenen Stellen zur Gesamtzahl der registrierten Arbeitslosen wird die Erreichung dieses Stabilitätsziels gemessen. Was ein hoher Beschäftigungsstand konkret in Zahlen bedeutet, wird von der Politik neu definiert.
1.4.3.31.4.3.3Außenwirtschaftliches Gleichgewicht
Entsprechen die Devisenabflüsse einer Volkswirtschaft den Devisenzuflüssen einer Volkswirtschaft, so ist ein außenwirtschaftliches Gleichgewicht