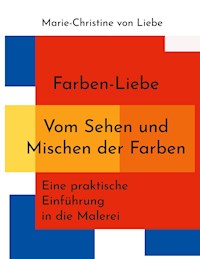
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Nicht nur Einsteiger in die Malerei haben oftmals einen großen Informationsbedarf: Was sind die Grenzen von Aquarell, die Besonderheiten der Ölmalerei oder die Vorteile von Acryl? Woran erkenne ich beim Kauf Unterschiede in der Qualität? Was sind Komplementärfarben und wie kann ich sie einsetzen? Wozu kann ich warme und kalte Farben brauchen? Auf diese und weitere Fragen gibt dieses Buch verständlich, kompakt und fundiert Antwort. Denn Ihre eigene Kreativität können Sie viel leichter umsetzen, wenn Sie wissen wie sich das Farbmaterial verhält und wie wir Farben und Bildraum wahrnehmen. Anhand von Werken aus den internationalen Museen werden die Regeln der Bildgestaltung anschaulich erläutert. Giotto, Michelangelo, die Impressionisten oder die Lehrer und Schüler am Bauhaus kannten die Regeln. Die Erkenntnisse aus mehreren Jahrhunderten werden hier zusammengeführt, vermutlich zum ersten Mal. Die Autorin ist Kunsthistorikerin und Malerin. Mit 70 Abbildungen, davon 65 farbig
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Vom Sehen der Farben
Farben sind Licht
Licht im Auge
Vom Mischen der Farben
Sichtbare Farben
Übersichtliches Farben-Modell
Malfarben mischen
Das Material der Farben
Farbgebende Pigmente
Bindemittel und Maltechnik
Acrylmalerei
Aquarellfarben
Tempera
Ölmalerei
Klassische Technik
Alla-Prima-Technik
Fett auf mager
Weitere Maltechniken
Jenseits der Farbe
Linie und Raum
Zeichnen nach dem Modell
Räumlichkeit durch Gestaltung
Hell und Dunkel
Ideale Proportionen
Farben und Kontraste
Simultan-Kontrast
Komplementär-Kontrast
Relative Farben
Sukzessiv-Kontrast
Bunt-Unbunt-Kontrast
Farbe-an-sich-Kontrast
Raum durch Farbe
Warme und kalte Farben
Nah-Fern-Kontrast
Bildgestaltung
Ein zugänglicher Bildraum
Quantitäts-Kontrast
Qualitäts-Kontrast
Keine Patentrezepte
Farben kaufen
Welche Qualität?
Welche Farbtöne?
Passender Malgrund
Atelier-Einrichtung
Farbtraditionen
Gelebte Farben-Liebe
Buchtipps
Danksagung
Über die Autorin
Einleitung
Wenn Sie die „Farben-Liebe“ in der Hand halten, dann stehen die Chancen gut, dass Sie sich intensiver der Malerei widmen wollen. Das sind doch sehr schöne Aussichten. Dieses Buch will Sie dabei praktisch unterstützen. Es ist aus meinen eigenen Fragen und Recherchen im Laufe der Zeit entstanden.
Sie finden hier, möglichst kompakt, grundlegende Informationen zu den Farben als optisches Phänomen und als Material der Malerei im herkömmlichen Sinne. Dabei erläutere ich die Grundprinzipien hinter den Dingen, denn ich gehe davon aus, dass es sowohl schneller wie nachhaltiger ist, Systematiken zu verstehen und eventuell selbst auszuprobieren, als Vorgaben nur nachzuahmen und mühsam auswendigzulernen.
Den Einstieg bildet das menschliche Sehen von Farben. Dabei handelt es sich um nichts Anderes als die Interpretation verschiedener Wellenlängen des Lichts. Eine sehr persönliche Sache, bei der unser Gehirn und die gemachten Erfahrungen eine zentrale Rolle spielen.
Natürlich erfahren Sie auch wie wir Farben im Bild sehen, wie sich Kontraste und Nachbarfarben auswirken und welches überhaupt die Grundfarben sind, aus denen sich möglichst alle anderen Bunttöne mischen lassen. Das hat im Laufe der Jahrhunderte schon viele Künstler beschäftigt.
Vorab nur so viel: Je nach Medium unterscheiden wir hier zwischen den aktiven und additiven Lichtfarben am Bildschirm (Rot, Grün, Blau), dem Bunttrio am Drucker (Cyanblau, Magenta und Zitronengelb) und den subtraktiven, reflektierten Objektfarben (Gelb, Rot und Blau). Für die Malerei lassen sich die Beziehungen der Farbtöne zueinander gut am Farbkreis des Bauhauslehrers Johannes Itten nachvollziehen.
Um Ihnen exaktere Empfehlungen geben zu können, mit welchem Gelb, Rot und Blau sich in einem breiten Spektrum, sowohl bei Orange, Grün und Violett, ansprechende Mischtöne ergeben, liegen dieser Auflage etwas aufwändigere Versuchsreihen zugrunde. Ich freue mich, Ihnen nun in den Kapiteln „Farben kaufen“ und „Vom Mischen der Farben“ exaktere Empfehlungen als bisher geben zu können, welche Farbpigmente ein gutes Grunfarbentrio ergeben.
Ich hoffe, Sie finden auf den folgenden Seiten viele Informationen, die Sie in Ihrem eigenen, individuellem Schaffensprozess schnell weiterbringen und wünsche Ihnen gutes, kreatives Gelingen und noch mehr Freude beim Ausleben Ihrer ganz persönlichen Farben-Liebe!
München, im September 2021
Marie-Christine von Liebe
Vom Sehen der Farben
Farben sind Licht
Unsere Welt ist wunderbar bunt. Doch woher kommt diese Farbigkeit? Diese Frage haben sich die Menschen bereits in früheren Generationen gestellt. Lange gab es alle erdenklichen Vorstellungen, bis hin zu der Idee eines Lichtstrahls aus dem Auge. Es war der britische Forscher Sir Isaac Newton (1643–1727), der mit seinem Experiment regelrecht Licht ins Dunkel brachte. Seinen Versuchsaufbau schickte er 1671 als Zeichnung an die Royal Society in London. Denn diese hatte sich dazu verpflichtet, die Wissenschaft durch wiederholbare Experimente zu einer objektiven Forschung anzuregen.
Isaac Newton, Farbspektrum im Licht, 1671
Bei seinem Versuch ließ Newton einen Lichtstrahl durch eine kleine Öffnung in eine dunkle Kammer fallen. Dann führte er das Licht über die Kanten eines geschliffenen Glasdreiecks, eines Prismas. Der Strahl wurde abgelenkt und damit sozusagen aufgebrochen. Das zunächst gebündelte, weiße Licht fächerte sich in einen farbigen Streifen auf, und das gesamte Spektrum der Regenbogenfarben wurde sichtbar. Diesen bunten Lichtstreifen führte Newton dann durch eine Linse, und so wurde das Licht erneut zu einem weißen Strahl gebündelt.
Mit diesem Experiment war der Beweis gelungen, dass die Farben im Licht nicht dadurch entstanden waren, dass das Prisma den Strahl eingefärbt, beschädigt oder irgendwie sonst dauerhaft verändert hätte. Seither weiß man: Die Farben des Regenbogens sind in einem weißen Lichtstrahl stets vorhanden, nur sozusagen von außen für uns nicht immer sichtbar. Oder genauer formuliert: Im normalen Tageslicht sind alle Farben, alle Wellenlängen des Lichts enthalten. Nehmen wir diese Wellen alle gleichzeitig wahr, dann sehen wir dies als Weiß. Sehen wir hingegen eine beschränkte, klar umgrenzte Wellenlänge erkennen wir eine bunte Farbe.
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) hat für seine berühmte Farbenlehre von 1810 Newtons Experiment nachgestellt. Da er ein anderes Ergebnis bekam, hielt er dessen Beobachtungen für falsch. Er hatte schlichtweg übersehen, dass Newton in einer dunklen Kammer experimentiert hatte, und seine Versuche in einem hellen Raum ausgeführt.
Farbige Lichtwellen
Was wir als eine bute Farbe sehen, ist also Licht einer bestimmten Wellenlänge. Die Unterschiede der jeweiligen Strahlung nehmen wir normalerweise durch die Farbigkeit wahr. Experimente mit Blinden haben gezeigt, dass ein roter Raum auch jenseits des Sehens anders empfunden wird als ein blauer.1
Dass wir unsere Welt in bunten Farben sehen können, ist wunderschön. Aus Sicht von Biologie und Evolution ist das allerdings kein Luxus. Diese menschliche Fähigkeit ist eher ein Teil unseres Frühwarnsystems, zugegeben ein besonders schöner. Denn farbig heben sich Objekte besser von ihrem Hintergrund ab, und es lässt sich auch über weitere Entfernungen mehr erkennen.
Physiologisch ist das Sehen, insbesondere das Sehen von Farben, ein enormer Aufwand, bei dem viele Aspekte ineinander spielen müssen.
1 Schon Niels Finsen (1860-1904), Nobelpreisträger für Medizin 1903, betrieb intensive Forschungen dazu wie Licht und Farben auf den menschlichen Körper wirken.
Licht im Auge
Voraussetzung für das Sehen von Farben ist, dass genug Licht ins Auge gelangt, denn sonst können wir lediglich Hell und Dunkel unterscheiden. Am Aufbau des Auges können wir die Vorgänge des Sehens gut nachvollziehen.
Den vorderen Abschluss des Augapfels bildet die Hornhaut oder Cornea. Sie ist wie ein Fenster nach außen. Ist sie gesund und transparent, sehen wir klar.
Direkt dahinter liegt der wichtige Bereich von Iris und Linse.
Der farbige Ring der Iris (Regenbogenhaut) trägt die Pigmente, die unsere Augenfarbe bestimmen. Er kann die Größe seiner Öffnung blitzschnell mit winzigen Muskeln verändern, um bei Bedarf das empfindliche Augeninnere vor zu viel Licht zu schützen. Ist es dämmrig, wird die Iris ganz schmal, um möglichst viel vom spärlichen Licht in das Innere des Augapfels einzulassen. Dann wirkt der schwarze Punkt der Pupille besonders groß. In Wahrheit hat sich nur der Ring der davorliegenden Iris zurückgezogen, und wir sehen mehr von dem ansonsten dunklen, weil fast geschlossenen Innenraum des Augapfels.
Auf den Linsen-Apparat folgt der Glaskörper des Augapfels. Seine runde Form bekommt er durch eine wässrig gefüllte Hülle aus drei Häuten. Auf der inneren Netzhaut (Retina) sind die Stäbchenzellen für die Unterscheidung von Hell und Dunkel recht breit verteilt. Bei schlechten Lichtverhältnissen sehen wir mit diesen Zellen immerhin schwarz-weiß. Vom Licht erreicht werden diese Zellen, wenn die Pupille geweitet ist, weil sich die Iris zu einem schmalen Ring zurückgezogen hat.
Bei wenig Licht können wir keine Farben sehen
Ist es hell genug, so wird der farbige Ring im Auge so breit, dass das Licht als gebündelter Strahl ins Auge fällt. Dieser ist dann kräftig genug, um bis zur hinteren Wand des Augapfels zu gelangen. Denn dort, wo die lange Nervenverbindung ins Gehirn abgeht, liegt das Areal des scharfen und farbigen Sehens. Dieser Bereich, der sogenannte „Gelbe Fleck“ (Makula), beherbergt Millionen winziger Zellen. Er liegt genau in gerader Linie hinter der Linse.
Während der Ring der Iris reguliert, wieviel Licht ins Innere des Auges gelangt, bestimmt die Linse, was wir wie scharf sehen. Denn wenn wir fokussieren, stellen wir ihre Form auf die entsprechende Entfernung ein. Die Veränderung erfolgt durch winzige Muskeln. Je elastischer die Linse ist, desto besser können wir sowohl in der Nähe als auch in der Ferne sehen. Ist der Augapfel schön rund, trifft das „Dia“ der Außenwelt, das Bild aus farbigen Lichtstrahlen, genau richtig auf die Makula, und wir können ein scharfes Bild sehen.
Nur bei Helligkeit klappt das Farbensehen
Zellen für das Farbensehen
Die Zellen für das Sehen von Farben haben die Form von Zapfen, und es gibt sie in drei Längen, die jeweils auf eine Grundfarbe spezialisiert sind: lange für langwelliges Licht, also Rot, mittlere für Grün und kurze für das kurzwellige blaue Licht. Da wir sehr viel mehr Farben sehen, ist der Normalzustand des Farbensehens eine gemischte Reizung aller drei Zelltypen. Bereits im Sehen werden also die Farben durch Mischung erzeugt.
Das im Auge wahrgenommene Bild können wir uns wie das farbige Bild eines Beamers vorstellen. Viele Lichtstrahlen in unterschiedlichen Wellenlängen ergeben ein auf die Makula projiziertes Abbild desjenigen Ausschnitts der Welt, auf den unsere Augen gerade fokussiert sind.
Übersteuerte Farben
Damit wir aus den Zellreizungen im Auge ein Bild bekommen, müssen die Informationen ans Gehirn weitergeleitet werden. Erst im Sehzentrum, im Hinterkopf, entstehen aus den empfangenen Nerveninformationen unsere Bilder der Außenwelt. Für unser Gehirn ist das viel Arbeit, und schnell muss es auch gehen. Daher versucht es, ein bisschen zu tricksen: Es filtert heraus, was es aus Erfahrung für unwichtig hält, oder ergänzt selbsttätig, was es glaubt, längst verstanden zu haben.
Das führt auch zum Effekt der Farb-Konstanz: Ein gewohnter Gegenstand erscheint uns bei jeder Tageszeit und jedem Wetter farblich völlig gleich. Doch nimmt man es genau, dann müsste er sich morgens und abends farblich verändern. Im Urlaub, also in ungewohnter Umgebung, fällt uns das manchmal auf. Denn zu diesen Tageszeiten ist der Einfallswinkel des Sonnenlichts ein anderer, und damit auch die Wellenlängen des Lichts und die dadurch entstehenden Farben. Die Gegenstände in unserem Umfeld müssten dann also eigentlich rötlicher wirken. Doch da wir die Erfahrung gemacht haben, dass uns allein durch eine Veränderung der Tageszeit in unserem Heim keine Gefahr droht, filtert unser Gehirn die Information „veränderte Farbigkeit“ aus. So bleiben wir ruhig, wenn unsere Umgebung es auch ist, und sparen Kräfte für Situationen, in denen Panik und Flucht angebracht sein könnten.
Hält unser Gehirn umgekehrt Unterschiede jedoch für besonders wichtig, verstärkt es diese sogar noch, wie wir im Kapitel zu den Kontrasten noch sehen werden.
Andere Augen, andere Farben
Jeder hat andere Augen. Offensichtlich ist das bei der Augenfarbe. Sie hängt davon ab, wie viele Pigmente auf dem Ring der Iris liegen. Sind es wenige, erscheinen die Augen blau, da das Innere des Augapfels wässrig gefüllt ist. Dann gelangt prinzipiell mehr Licht ins Auge. Je mehr Pigmente auf dem Augenring liegen, desto dunkler ist die Augenfarbe, und desto besser wird das Augeninnere vor zu viel Sonne geschützt.
Doch nicht nur die Augenfarbe ist angeboren, auch wie wir Farben wahrnehmen, hängt von unserer genetischen Ausstattung ab. Wir haben nicht alle die gleiche Menge und Zusammensetzung an Farbrezeptor-Zellen. Hier gibt es zum Teil erhebliche Unterschiede. Manchmal führt dies auch zur sogenannten Farbenblindheit, einer Schwäche in der Unterscheidung von Rot und Grün. Das ist deshalb besonders hinderlich, weil dies normalerweise der stärkste Kontrast mit der besten Fernwirkung ist und die Farbkombination daher für viele Verkehrssignale an Land und auf See genutzt wird.
Bereits 1917 hat der japanische Augenarzt Shinobu Ishihara Farbtafeln entwickelt, um die Fähigkeit der Farbunterscheidung bei Rekruten zu testen. Die Tafeln bestehen aus einer Mischung farbiger Punkte. Die damit im Bild dargestellten Symbole sind nur dann zu erkennen, wenn die Testperson die Farben gut unterscheiden kann. Hier sind Frauen erheblich im Vorteil. Vermutlich werden bestimmte Zellen im Auge teilweise auf den weiblichen X-Chromosomen vererbt. Heute werden die Tafeln daher oft dazu verwendet, um bei anonymen Befragungen herauszufinden, ob die Testperson männlich oder weiblich ist. Malerinnen wären hier also theoretisch genetisch im Vorteil. Praktisch dürfte allerdings das geübte Auge die farblichen Nuancen am besten unterscheiden können. Da jeder die Farben, zumindest ein klein wenig, anders sieht, macht es auch keinen Sinn, sich über Farben zu streiten.
Shinobu Ishihara Farbtafel ab 1913
Vom Mischen der Farben
Ein paar Grundregeln sollen Ihnen dabei helfen, frustrierende Umwege beim Mischen der Farben zu vermeiden. Sie kommen schneller zum Ziel, wenn Sie mit den hellen Tönen beginnen. Außerdem hilft es, die Grundbeziehungen zwischen den verschiedenen Farbtönen zu kennen, denn so ist Ihnen schnell klar, welche farbigen Bestandteile weiterhelfen können und welche nicht.
Sichtbare Farben
Der Bereich der Strahlen, den wir als bunte Farben sehen können, ist begrenzt. Er liegt oberhalb der Wellenlängen der kurzwelligen und bräunenden, aber unsichtbaren ultravioletten Strahlung, ab ca. 380 nm, und endet etwa bei 780 nm, unterhalb der wärmenden, aber ebenfalls unsichtbaren Infrarotstrahlen.
Wellenlängen von 380 bis 780 nm sehen wir als bunte Farben
Bunte und unbunte Farben
Als einen bestimmten bunten Farbton wie Gelb oder Grün deuten wir eine genau umgrenzte Wellenlänge des Lichts. Kurzwelliges Licht sehen wir beispielsweise als Blau.
Besonders breit ist der Bereich, im dem eine Farbe von uns als Rot erkannt wird. Er geht von einem Orangerot über Magenta bis zu dunklem Krapprot und umfasst die Wellenlängen von 600 bis 780 nm.
Alles Rot: von 600–780 nm
Oft hört man, Schwarz und Weiß seien keine Farben. Doch wir nehmen sie ja durchaus als farbliche Erscheinungen wahr. In diesem Zusammenhang ist es besser, von unbunten Farben zu sprechen. Das gilt auch für Grau und Braun. Bei diesen Mischfarben sind die Wellenlängen sehr unterschiedlich, also ein ziemliches Durcheinander. Bei Schwarz ist fast kein Licht mehr vorhanden. Bei Weiß ist das Spektrum der Wellenlängen weitgehend vollständig.
Lichtfarben und Objektfarben
In unseren Augen wirken die Farben als Licht auf die Zellen ein. Auch am Bildschirm werden die Farben so erzeugt, also durch farbig leuchtende Punkte. Je mehr Farben hier zusammenkommen, desto heller wird es. Kommen alle Farben zusammen, dann ergibt dies die größte Helligkeit, farblich also Weiß. Daher spricht man bei Lichtfarben auch von einer additiven Mischung aktiver Farben. Die Grundfarben sind hier die gleichen wie die Grundtypen der Zellen im Auge für die Wahrnehmung von Farbe: Rot, Grün und Blau.
Links die additiven Primärfarben des Lichts
Rechts die subtraktiven Primärfarben der Objekte
In der Malerei sind die Grundfarben andere: Gelb, Rot und Blau. Denn hier werden die Farben nicht direkt aus Licht erzeugt. Ein Gegenstand, der kein Licht produziert, wirkt erst dadurch farbig, dass er einen Teil des auf ihn auftreffenden Lichts reflektiert. Handelt es sich um keinen weißen Gegenstand, dann ist das Spektrum des abgegebenen Lichts nicht mehr vollständig. Der Grund dafür ist, dass das Objekt bestimmte Anteile des Lichts regelrecht in sich aufgenommen hat. Welchen Bereich der auftreffenden Strahlung ein Gegenstand absorbiert, ist abhängig von seiner chemischen Zusammensetzung und der Struktur seiner Oberfläche.
Bei bunten Gegenständen teilt sich das auftreffende Licht in einen absorbierten und einen reflektierten Teil. Würde man diese Teile wieder zusammenführen, hätte man dadurch das vollständige Spektrum, also weißes Licht. Wie wir bei den Komplementärfarben noch sehen werden, erscheint ein Objekt dann in der Gegenfarbe der von ihm aufgenommenen Wellenlängen. Ein roter Apfel reflektiert also alle langen Wellen des Lichts, die für uns ein Rot ergeben. Die anderen Anteile (Grün) verschluckt er. Beim grünen Apfel ist es genau umgekehrt.
Bunt wirken Dinge auf uns durch die Differenz von Absorption und Reflexion des auftreffenden Lichts.
Auch wenn es im Alltag für uns anders wirkt: Die Farbe eines Gegenstands oder eines Materials ist also keine seiner typischen Eigenschaften. Charakteristisch sind Struktur und chemische Zusammensetzung. Erst im Zusammenspiel mit dem auftreffenden Licht entsteht die Farbe. Ändert sich das Licht in seinen Wellenlängen, dann bekommt der Gegenstand auch eine andere Farbe.
Subtraktive Mischung
Wie bei Objekten entsteht auch beim Farbmaterial der Malerei die Farbwirkung aus der Differenz von Absorption und Reflexion. Das führt dazu, dass umso mehr Licht abgezogen wird, je mehr unterschiedliches Material wir hinzufügen. Daher spricht man hier auch von einer subtraktiven Mischung.
Je dunkler das Farbmaterial ist, desto mehr Licht wurde also bereits insgesamt abgezogen. Das erklärt auch, warum wir beim Mischen von Farben möglichst hell beginnen sollten. Denn dann haben wir sozusagen noch mehr Licht in Reserve, das sich durch weitere Farben noch abziehen lässt.





























