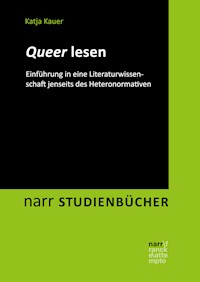Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: narr Studienbücher LITERATUR- UND KULTURWISSENSCHAFT
- Sprache: Deutsch
Literatur, nicht nur die klassische, sondern sehr augenscheinlich auch die der Gegenwart, zeichnet ein buntes Bild von Geschlecht, das mit den herkömmlichen, patriarchalisch geprägten ,Lektürebrillen' nicht richtig erfasst werden kann. Obwohl die Gender Studies im akademischen Diskurs inzwischen eine wichtige Rolle spielen, hinkt eine praktisch orientierte Genderanalyse dem theoretischen Diskurs hinterher. Dieses Studienbuch zeigt anschaulich, wie hilfreich Gender Studies für die literaturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit einzelnen Texten sein können, und nimmt Fragen in den Blick, die die Literatur in Bezug auf geschlechtlich basierte Anerkennungsprozesse stellt. Im Zentrum stehen praktische Lektüretools, die an konkreten gegenwartskulturellen Textbeispielen vorgestellt werden. Sie machen Bedeutungsebenen der Texte sichtbar, die sonst verborgen bleiben, und helfen, scheinbare Aporien und Widersprüche in der Figurierung zu erklären. Das Buch ist die erste Monografie im germanistischen Bereich, die diese Art von Lektüretools entwickelt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Katja Kauer
Feministisch lesen
Eine Einführung mit Lektüretools und Textbeispielen
PD Dr. Katja Kauer ist Literatur- und Kulturwissenschaftlerin mit einem Schwerpunkt auf Gender- und Queer Studies. Sie vertritt im akademischen Jahr 2024/25 zum Teil die Professuren für die Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts am Deutschen Seminar und die Professur für Gender Studies am Englischen Seminar der Universität Tübingen. Einen Schwerpunkt ihrer Arbeit bilden philosophische Fragestellungen in ihren populärkulturellen Zusammenhängen. 2019 ist von ihr das Studienbuch Queer lesen erschienen, 2022 Verzweiflung im 18. Jahrhundert. Derzeit arbeitet sie an der Re-Visitation des Kanons und zum Liebesdiskurs zwischen Früher Neuzeit und Gegenwart.
DOI: https://doi.org/10.24053/9783823395706
© 2024 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
ISSN 2627-0323
ISBN 978-3-8233-8570-7 (Print)
ISBN 978-3-8233-0509-5 (ePub)
Inhalt
Vorwort
Scarborough, 1. August 2023. Es ist ein verregneter Sommertag in Mittelengland, einem ehemaligen ‚viktorianischen Kurort‘, wie es heißt. Hier lässt sich Anne Brontës Grab finden, der Ort liegt somit auf der Karte einer gynozentrischen Literaturgeschichtsschreibung, allerdings waren es nicht die Texte der Brontës, die mich zu dem folgenden Buch inspiriert haben. Nach anstrengenden und zeitraubenden Korrekturarbeiten am Buch, was bekanntlich zu den eher unerfreulichen Aufgaben nach Abschluss eines Manuskripts gehört, gönne ich mir noch den Besuch des Barbie-Films (Regie: Greta Gerwig, USA 2023), der, zumindest in Deutschland, vor zwei Wochen angelaufen ist und den ich bisher noch nicht die Zeit gefunden hatte zu sehen. Einige meiner Freundinnen waren schon drin, ich will ihnen nicht länger nachstehen. Obwohl der Film in Scarborough unter der Woche mehrfach am Tag gezeigt wird, die Stadt nicht besonders groß ist, ist auch diese 17-Uhr-Vorstellung sehr gut besucht. Menschen unterschiedlichen Geschlechts und Alters drängen sich in den Kinosaal. Ich möchte den Besuch des Films nicht empfehlen oder gar für die Lektüre des Buches voraussetzen. Es handelt sich um eine komödiantische Dekonstruktion des Barbie-Mythos. Wem der Feminismus dieses Machwerks fragwürdig erscheint, wird gute Gründe dafür finden. Barbie hat sich zwar von den vor der zweiten Welle der Frauenbewegung als zentral geltenden Eigenschaften wie Fürsorge und Mütterlichkeit emanzipiert, ihr Erfolg beruht aber auf dem Besitz eines schön ausgestalteten Körpers. Sie ist das, was wir eine postfeministische Gestalt nennen könnten, denn sie zeigt sich einerseits als feministischen Idealen verpflichtet, doch anderseits stellt erst einmal nur ihr Äußeres die Hauptquelle ihrer Identität dar, was anti-feministisch anmutet. Dieser sogenannte Postfeminismus, wie er uns seit mehr als 20 Jahren medial begegnet, besteht darin, dass sich Frauen zwar bestimmte Errungenschaften der Frauenbewegung (zum Beispiel ökonomische Autonomie) zu eigen machen konnten, jedoch nur, um ihre gewonnene Autonomie dann an die weibliche Rollenkonformität im Patriarchat (die Rolle des sexuellen Objekts) zu verraten, was als Freiheit, Wahl usw. annonciert wird. Die scheinbare Freiheit einer Barbie, alles zu sein und zu tragen, was sie will, ist genau betrachtet eine völlige Unfreiheit und ein selbstgewähltes Einfrieren auf die Rolle des Beschauungsobjekts im male gaze, obwohl faktisch natürlich vor allem Mädchen sie beschauen und bestaunen, und kaum erwachsene Männer mit ihr spielen. Das Barbie-Universum wird jedoch filmisch so artifiziell und wirklichkeitsfremd ausgestaltet, dass wohl niemand der neoliberalen Utopie von Barbies als Präsidentinnen, Geschäftsfrauen, Wissenschaftlerinnen usw., die alle supersexy aussehen und supererfolgreich sind, einen ernstgemeinten feministischen Gehalt zuschreibt, zumal der Film offen ausspricht, dass jenseits der Spielzeugwelt nicht allen Frauen alles so einfach möglich ist. Der Feminismus ist nicht in Barbies Plastikwelt zu suchen, aber in der Dramaturgie des Filmes findet er sich m. E. dann doch. Denn tatsächlich sehe ich eine Koinzidenz zwischen dem Abschluss von Feministisch lesen und diesem Kinobesuch. Denn auch, wenn es sich nur um einen populären Hollywoodfilm handelt, der Film mitnichten kapitalismuskritisch ist und die Diversität der Figuren zu wünschen übriglässt, sah ich doch einen typischen Frauenfilm – in einem nicht abschätzigen Sinn des Wortes. Ja, ich möchte sagen, Barbie ist ein gynozentrischer Film. Darin geht es nicht um Heterosexualität, um männliche Helden, sondern die Handlung kreist darum, was es heißt, als weiblich gelesen zu werden. Der Film behandelt weibliche Selbstwahrnehmung, Selbstentwürfe, die weibliche Selbstobjektifizierung, den male gaze; im Zentrum stehen homosoziale Beziehungen zwischen Frauen, und die Frage, wie Frauen sich finden und wie sie einander spiegeln. Weder die männlichen Helden noch die heterosexuelle Beziehung bilden einen Fokus. Die weibliche Hauptfigur wird nicht durch das männliche Gegenüber (Ken) definiert, nein im Gegenteil, sie überstrahlt ihren männlichen Partner in jeder Hinsicht. Ken gibt es nur, weil es Barbie gibt, nicht anders herum. Ein Leading Man (ein klassischer Hauptdarsteller) im Hollywoodkino der Gegenwart zu sein, wie es der Darsteller von Ken, Ryan Gosling, zweifellos ist, bedeutet auch, Rollen annehmen zu können, die gängige Männlichkeitskonstrukte ins Lächerliche verkehren und in denen er sich von Schauspielerinnen wie Margot Robbie überstrahlen lässt. Ein Leading Man der Gegenwart muss in der Lage sein, Männerrollen zu spielen, die jeder phallischen Qualität entbehren. Willkommen im Kino des 21. Jahrhunderts! Es geht in diesem Film um eine, so gefährlich diese Attribuierung auch ist, weibliche Weltanschauung, also um etwas, das bisher nicht das Hauptinteresse der medialen Produkte in einer patriarchalen Gesellschaft ausmachte – und nebenbei bemerkt auch nicht das Hauptinteresse germanistischer Literaturrezeption. Mit Barbie wird Weiblichkeit gefeiert, hinterfragt und umgedeutet. Männer und Männlichkeitsbilder sind erfrischenderweise, ich sagte es schon, nur Randerscheinungen. Ein heterosexuelles Happy-End wird zugunsten der weiblichen Selbstfindung völlig ausgespart, aber auch nicht vermisst. Barbie wird sie selbst, nicht Teil eines romantischen heterosexuellen Paares, wohl aber lebendiger Teil einer Frauenfreundschaftsbeziehung. Der Film erweist sich als so publikumswirksam, dass er Besucher*innenrekorde brach. Ich bin nicht so naiv, eine Rezeption meines Bandes zu erwarten, die die Rekorde am wissenschaftlichen Buchmarkt bricht. Wohl aber weiß ich, dass Feministisch lesen demselben Zeitgeist wie der Barbie-Film entstammt. Es besteht der Wunsch danach, sich konkret und kreativ mit bestehenden Weiblichkeitsbildern auseinanderzusetzen, ihre patriarchalische Deformation zu hinterfragen und bestimmte Aspekte von Weiblichkeitsdarstellungen neu und positiv zu lesen. Der Barbie-Film erweist sich als eine neue Lesart einer künstlich geschaffenen Frauenfigur, die wie ein Fetischobjekt aussieht, aber von der durch die Autor*innen des Films mehr erzählt wird und in die mehr hingedeutet werden kann als die Tatsache, dass die Proportionen von Barbiepuppen die Vorstellung von attraktiver Weiblichkeit völlig verzerren können und schier absurd sind. Wohlwollend lässt sich vielleicht sagen, dass die Dramaturgie, den herkömmlichen feministischen Diskursen gemäß, die der zweiten Welle der Frauenbewegung zu verdanken sind, auf ein Consciousness Raising/eine Bewusstseinsbildung zielt, die zum Abbau von Konflikten zwischen Frauen (im Film zum Beispiel ein klassischer Mutter-Tochter-Konflikt) führt. Durch Consciousness Raising werden weibliche Probleme nicht als isoliert und persönlich betrachtet, sondern systematisch, nämlich als Formen von patriarchalischer Unterdrückung behandelt. Feministisches Bewusstsein zu schärfen bedeutete während der zweiten Welle der Frauenbewegung, sich mit den Fragen anderen Frauen zu identifizieren und sich, trotz aller Verschiedenheit unter Frauen, miteinander gegen das Patriarchat zu solidarisieren. Diese Solidarität ist nun nicht mehr ein Zeichen von marginalisierten Gruppen (Feminist*innen, Lesben etc.), sondern in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Die Stärke und Schönheit von weiblich-weiblicher Solidarität ist auch heute noch (oder gerade heute wieder, wenn wir uns die Gegenwartsliteratur anschauen) ein beliebtes Motiv in der „Frauenliteratur“. Diese hat sich von der romantischen Liebesgeschichte zwischen Mann und Frau zusehends emanzipiert, andere Beziehungen und Lebensprojekte werden dort gleichberechtigt verhandelt, andere Frauen werden von der Hauptfigur nicht immer nur als Konkurrentinnen, sondern als wichtige Partnerinnen, Freundinnen, Vorbilder begriffen. Der Wunsch nach feministischen Lesarten und Weltanschauungen, nach einem Hinterfragen postfeministischer Schöntuerei, zeigt mir Barbie, ist eben auch Hollywood nicht mehr fremd, und tatsächlich ließen sich an dem Filmwerk einige Tools, die ich in diesem Band vorstellen werde, erproben. Das, was ich als ‚internalisierte Misogynie‘ und als ‚triple entanglement‘ in den folgenden Kapiteln konzeptualisiere, lässt sich auch dort finden, besonders auffällig wird jedoch das raumgreifende Thema der Homosozialität, weiblich-weibliches Bonding, verhandelt; etwas wie homosoziale Romantik trägt diesen Film – und begeistert dessen Publikum.
Es wäre mir eine große Freude, wenn Feministisch lesen dazu dienen könnte, dass wir Weiblichkeit begeisterter rezipieren, uns kritisch, aber nicht abschätzig der Darstellung von Frauenfiguren in der Gegenwart stellen können und die Widersprüche, die weibliche Figuren offenbaren, besser verstehen. Das Buch soll helfen, uns unserer unconscious bias, unserer unbewussten Vorurteile, die wir über Weiblichkeit erlernt haben, bewusst zu werden, damit wir die Chance ergreifen können, patriarchalische Ressentiments dort aufzudecken und zu kritisieren, wo wir sie nicht vermutet haben.
Ich danke allen, die mich bei der Fertigstellung des Buches unterstützt haben, vor allem den Teilnehmer*innen meiner Lehrveranstaltungen (u. a. in Tübingen, Fribourg), in denen ich seit mehreren Semestern einige Tools an den hier erwähnten literarischen Beispielen, aber auch an anderen Texten, erprobt, gelehrt und weiterentwickelt habe. Die Resonanz auf meine Konzepte hat mich bewogen, sie niederzuschreiben, um sie weiteren Studierenden zugänglich zu machen.
Ich danke dem Narr-Verlag für die erneute Zusammenarbeit und für die Offenheit dem Thema gegenüber. Unter ‚feministisch‘ wird, anders als unter ‚queer‘, nicht unbedingt etwas Zeitgemäßes, gar Innovatives verstanden. Der Begriff ist kein Modewort im akademischen Kontext, feministische Literaturwissenschaft wird in den 1980er Jahren verortet, aber wie hier dargelegt, halte ich feministische Lektüren für ebenso zeitgemäß wie queere, ja mehr noch, ich glaube, dass sich die Kritik am Patriarchat und an der Heteronormativität gegenseitig stützen und beflügeln können und dass besonders die Gegenwartsliteratur zu diesen Leseweisen geradezu herausfordert. Aus diesem Grunde werden an einige Stellen auch Parallelen zu der etwas älteren Publikation anklingen.
Ich bedanke mich bei Arnd Beise, der mir bei der Korrektur des Manuskripts geholfen hat und dessen sachliche Kritik an einigen meiner Thesen sehr dienlich war, sowie den Unterassistentinnen des Fribourger Lehrstuhls, die ebenfalls an den Korrekturarbeiten beteiligt waren.
Nicht zuletzt bedanke ich mich bei meiner Familie, die mich in diesen Sommermonaten (2023) tapfer mit Korrekturarbeiten am Buch geteilt hat.
Katja Kauer
1Einleitung
1.1Sind Gender Studies immer feministisch?
For the master’s tool will never dismantle the master’s house. They may allow us temporarily to beat him at his own game, but they will never enable us to bring about genuine change. And this fact is only threatening to those women who still define the master’s house as their only source of support.
Audre Lorde
Worin unterscheiden sich eine Feministische Kultur- und Literaturwissenschaft von Gender Studies? Seien wir ehrlich, für Studierende und Dozierende, die sich weder mit Gender noch mit Feminismus intensiv beschäftigen, ruft der eine wie der andere Begriff etwas wach, das mit Frauen zu tun hat (und von Frauen betrieben wird). Diese Assoziation ist auch nicht völlig von der Hand zu weisen, denn dem Einzug von Gender Studies in die akademische Welt ging eine feministische Welle voraus, die die „Frauenfrage“ in viele gesellschaftliche Bereiche trug und damit auch in die Wissenschaft. Als sich die Feministische Literaturwissenschaft in den späten 1970er und den 1980er Jahren zu etablieren begann, richtete sie ihr Augenmerk darauf, sich sowohl kritisch mit literarisch hinterlegten Frauenbildern auseinanderzusetzen, als auch darauf, Autorinnen aus der Vergessenheit oder aus den Nischen des minderwertigen Dichtertums zu befreien. Wenig überraschend waren es Frauen, die unter dem Namen ‚Feministische Literaturwissenschaft‘ die Tür für Geschlechterdiskurse in den Philologien öffneten; was nicht bedeutet, dass alle Männer über die feministischen Ambitionen die Nase gerümpft hätten. Emanzipationsansprüche gaben den Grundton in der Feministischen Literaturwissenschaft an; Emanzipation von tradierter Literatur- und Kunstbewertung, mithin eine Befreiung von patriarchalisch vorgeprägten Rastern. Die Genese des Forschungsinteresses aus der zweiten Welle der Frauenbewegung ist unbezweifelbar. Der gesellschaftliche Kampf von Frauen um den ihnen gebührenden Raum, der über den reproduktiven Aufgabenbereich „Kinder, Küche und Kirche“1 hinausging, nährte den Wunsch nach einer Expertise darüber, auf welche Weise die bestehende Kultur Weiblichkeits- und Männlichkeitsbilder tradiert.2 Den radikalen Feministinnen der zweiten Welle der Frauenbewegung galt das bestehende Konzept von Weiblichkeit als eine von Männern produzierte Phantasie, die Frauen zum sexuellen Objekt degradiert habe.3 Auch gemäßigtere Stimmen, wie die der in der amerikanischen Frauenbewegung sehr gefeierten Mittelschichtsfeministin Betty Friedan, stuften die bestehenden Weiblichkeitsvorstellungen als ein Unterdrückungsinstrumentarium ein, das die Energie der Frauen auf ausgediente, gesellschaftlich irrelevante Dinge umlenken würde und ihnen dadurch die Möglichkeit, sich als soziale Subjekte zu behaupten, entzöge.4 Bürgerliche Werte wie Rationalität und Selbstständigkeit seien den Frauen durch die Weiblichkeitsvorgaben miesgemacht worden. Ihr Streben werde im Patriarchat nur auf ihre äußerliche Erscheinung, auf unproduktive Arbeit und Konsum gerichtet. Bereits 1951 [1949] hatte Simone de Beauvoir in dem philosophischen Grundlagenwerk der Frauenbewegung dargelegt, dass die Vereidigung der Frau auf Weiblichkeit ein Mindset produziere, durch das Frauen ihren eigenen Körper nur als Objekt für den Mann empfinden und sich selbst nur als passiv wahrnehmen können. Ihre Sozialisation verhindere, dass Frauen einen vollständigen Subjektstatus erreichen könnten oder dies auch nur anstreben würden.5
Für Kultur- und Literaturwissenschaftlerinnen war eine Untersuchung aus historischer Perspektive zu dem Themenkomplex der gesellschaftlich konstruierten Frauenrollen deshalb geboten. Die erwähnten feministischen Theoretikerinnen der Frauenbewegung stützen ihre philosophischen Analysen, indem sie kulturelle Phänomene betrachteten und literarische Texte zitierten. Die Literatur war auch für die Gesellschaftskritikerinnen bereits ein dankbarer Pool, aus dem sie sich bedienen konnten, um Belege für ihre Thesen zu finden. Die Aufarbeitung der Weiblichkeitsmythen versprach daher auch für Fachwissenschaftlerinnen, die dieses Vorhaben mit literaturwissenschaftlichen Methoden angingen, erkenntnisfördernd zu sein. Wissenschaft ist nie unabhängig von den gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen sie ausgeübt wird. Gleiches gilt jedoch auch für die Bewertung der Wissenschaft. Betrieben Frauen Literaturwissenschaft mit feministischen Ambitionen, konnte dieses Bestreben, aus einem konservativen Blickwinkel betrachtet, als irrelevantes Phänomen, als Nischenwissenschaft abgetan oder als eine künstliche Karriereschmiede von Frauen degradiert werden. Trachteten Frauen durch ihre feministischen Ambitionen nicht nur danach, einen Platz in der Forschung einzunehmen, der nicht schon von Männern besetzt ist bzw. beansprucht wurde? Das sah freilich nicht jede*r so, besonders aus Reihen der Studierenden war ein Bedarf an feministischer Kritik vernehmbar.
Tatsächlich gab es so etwas wie Stars der Feministischen Wissenschaft, die Generationen von Student*innen beeinflusst haben, doch nicht wenige Menschen scheuten davor zurück, sich emphatisch als feministische*r Wissenschaftler*in zu bezeichnen. Einerseits mieden viele Frauen den Begriff, weil das Label ‚Feministin‘ bis weit ins 20. Jahrhundert hinein einen uncharmanten Anstrich hatte, da er die Assoziation von „unweiblichem Auftreten“ eröffnete, andererseits war das Bekenntnis zum Feminismus auch deshalb ein eher unkluger Schachzug, weil das Gebot, dass Wissenschaft geschlechtsneutral zu sein habe, einen Appell enthielt, durch den feministische Bemühungen, die von einem parteiischen Standpunkt aus operieren, lächerlich gemacht werden konnten. Eine Germanistin, die in den 1970er und 1980er Jahren Karriere machen wollte, tat nicht unbedingt gut daran, den Feminismus vor sich herzutragen, zumal sie sich bewusst war, dass sie sich einer Berufungskommission gegenübersehen würde, die hauptsächlich aus Männern bestand. Sachlichkeit, nicht etwa feministisches Engagement galt als Tugend, die eine Lehrstuhlinhaberin aufweisen sollte. Durch die feministische Wissenschaft ist zwar belegt worden, dass Wissenschaft unter patriarchalischen Bedingungen keineswegs so vorurteilsfrei agiert, wie sie vorgibt, nur war es für Menschen schwer, dieser Beweisführung zu folgen, da die Stimmen, die diese Argumente verlauten ließen, als zu parteiisch und vorurteilsbehaftet verworfen worden waren. Die auf Albert Einstein zurückgehende Postkartenweisheit: „Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind“,6 gilt zweifellos auch für patriarchalisch geprägte Denkweisen, z. B. innerhalb der Literaturwissenschaft. Sie konnten kaum von denjenigen als Problem erkannt werden, die sich ihrer befleißigten. Strukturelle Blindheit ist Teil eines jeden Systems. Der Weg des Feminismus, der diese Blindheit anklagte, war holprig und führte nicht geradeswegs ins Ziel allgemeiner wissenschaftlicher Akzeptanz.
Neben der Aufarbeitung von Weiblichkeitsmythen gab es auch andere Stoßrichtungen, die feministisch inspiriert waren und Frauen als Künstlerinnen Anerkennung verschaffen wollten. Die feministischen Forscherinnen setzten sich dafür ein, den Kanon zu erweitern. „Frauenliteratur“, ein Schimpfwort von jeher, müsse von den Bedingungen ihrer Produktion und Rezeption her beurteilt werden, so lautete eine Annahme der Feministischen Literaturwissenschaft. Das führte zu einer, wenn auch recht lautlosen, Wiederentdeckung von Autorinnen vergangener Epochen oder auch zu einer Rehabilitierung von Schriftstellerinnen, die aus der Perspektive der herkömmlichen, androzentrischen Literaturwissenschaft mit dem verächtlichen Label ‚Unterhaltungsautorinnen‘ versehen worden waren, heutzutage jedoch fraglos seminartauglich und reflexionswürdig sind. Einschlägige Publikationen, u. a. von Sigrid Weigel, Silvia Bovenschen und Elisabeth Lenk gingen in den 1970er und 1980er Jahren zum Beispiel der Frage nach, was unter einer weiblichen Ästhetik zu verstehen sei.7 Schreiben Frauen anders als Männer, und wenn ja, wie lässt sich die „Andersheit“ systematisieren? Ihre Thesen räumten mit lächerlichen Biologismen auf und vermochten, einen bestimmten „Mehrwert“ in Texten von Frauen zu verteidigen. Gewiss nicht bei allen, doch bei vielen Texten, ist die geschlechtliche Sozialisation der sie schöpfenden Person nicht unerheblich. Schriftstellerinnen widmeten sich oft anderen Themen als ihre Kollegen und wählten andere Formen der Darstellung. Dies hängt vornehmlich mit ihrem weiblichen Lebenskreis zusammen. Das wissenschaftliche Interesse an diesen Texten kann von den Bedingungen ihrer Produktion nicht völlig abstrahieren. Die produktionsästhetische und die rezeptionsästhetische Seite dieser Texte lässt sich ohne Bezugnahme auf Gender (das soziale Geschlecht) kaum seriös beurteilen. Die misogyne Vermutung, dass eine rührselige Erfolgsautorin des 19. Jahrhunderts wie E. Marlitt (1825–1887) oder eine dem Realismus verpflichtete Schriftstellerin wie Marie von Ebner-Eschenbach (1830–1916) deshalb ihre Eheanbahnungsgeschichten seichter und unkritischer behandelt hätten als es männliche Kollegen wie zum Beispiel Theodor Fontane (1819–1898) getan haben, einfach weil sie als Frauen weniger Talent zum kulturkritischen Blick gehabt hätten, ist im 21. Jahrhundert nicht mehr haltbar. Der geschärfte literaturgeschichtliche Blick stellt schon die Prämisse in Frage, dass Texte von Frauen im Allgemeinen und Texte von Erfolgsautorinnen im Besonderen unkritischer gewesen seien als die ihrer zeitgenössischen Kollegen. War die Darstellung der Tragik einer sich von der gesellschaftlichen Bewertung so abhängig zeigenden Frauenrolle wie in der Geschichte von Effi Briest (erschienen 1896) wirklich einem allein dem Manne vorbehaltenes Terrain, weil nur er das Phänomen rational durchschauen konnte? Oder liegt der Unterschied zwischen Eheanbahnungs- bzw. Ehebruchsgeschichten aus weiblicher und männlicher Feder nicht vielmehr darin, dass das Scheitern an gesellschaftlichen Fesseln durch Frauen einfach anders dargestellt worden war? 1983 konstatiert Sigrid Weigel, dass es für schreibende Frauen im männerdominierten Literaturbetrieb unabdingbar war, von Männern geschaffene Frauenbilder nachzuahmen.8 Die weibliche Perspektive gibt sich nicht durch lautstarken Widerstand gegen das Patriarchat kund. Die Autorinnen sind mit der paradigmatischen Verkettung von ‚Weiblichkeit‘ und ‚Sünde‘ besser vertraut als mit weiblicher Freiheit. Frauen haben die bestehenden Frauenbilder verinnerlicht, jedoch zeigt ihre Literatur, dass, selbst wenn sie sich den Spielregeln des Patriarchats beugen, Autorinnen nicht selten ihre dichtenden Kollegen bei der Darstellung des herrschenden Frauenbildes mit mehr Finesse zu überbieten vermögen. Was in ahistorischer Perspektive als sentimentale Langeweile daherkommt, bot für die zeitgenössischen Leser*innen Identifikationspotential. Den Gräfinnen oder den Mägden, den Giselas9 und Boženas10 konnten die von einem besseren Leben träumenden Frauen nachträumen und sie konnten versuchen, deren in den Romanen vorgeführte Handlungsweisen und deren Ideologiekritik in ihr eigenes, reales Leben zu integrieren. Das Schicksal einer Effi Briest aber gemahnte nur an dunkles Unheil. Sich mit einer unsinnigen Liebelei dem Ehejoch zu entziehen, bot für die kleinbürgerliche Leserin keine sinnvolle Perspektive. Dieses Studienbuch wird auf die weibliche Schreibpraxis und ihre verbürgte Minderwertigkeit noch einmal thematisch im Schlusskapitel zurückkommen, obwohl bereits ein Blick auf die akademische Kanon-Erweiterung, die seit den 1980er Jahren stetig betrieben wurde, empirische Beweise dafür liefert, dass die Feministische Literaturwissenschaft half, blinde Flecken zu beleuchten und so genannte Unterhaltungsautorinnen zu nobilitieren. Studierende in der Gegenwart können sich vermutlich gar nicht vorstellen, warum in einem patriarchalisch orientieren Literaturbetrieb bestimmte, heute fraglos zum Kanon gehörige Texte einst als akademisch unbrauchbar angesehen worden waren. Die bereits in den 1970er Jahren wiederentdeckte, vielgelobte und vor allem bis heute gern gelesene Autorin Irmgard Keun (1905–1982) war gerade, weil sie die weibliche Lebensrealität in der Weimarer Republik so gut einfangen konnte, vor männlichem Chauvinismus nicht gefeit. Kurt Tucholsky beispielsweise goutiert wohl ihren Humor, aber ihm gelingt es nicht, Keuns Debütroman Gilgi – eine von uns (1931) so zu besprechen, als wäre seine Urheberin mit ihm auf Augenhöhe. Den Text bespricht er als den eines „Kleinmädchens“.11 Keuns Heldin Gilgi entscheidet sich gegen ein Leben mit dem Vater ihres Kindes, weil die Vereinbarkeit von Selbstständigkeit und Liebe ihr nicht möglich erscheint. Diesen Freiheitsentwurf hält Tucholsky für „schief“,12 überhaupt sei die Darstellung des Liebesverhältnisses etwas, das Tucholsky als unangemessen abtut. In Anbetracht des Haders, den Tucholsky gegenüber romantischen Liebeskonzepten und Monogamie in seinen eigenen Texten ausbreitet, wundert es umso mehr, dass eine Kollegin in seinen Augen nicht ähnliche Vorbehalte gegenüber dem romantischen Liebesversprechen hat äußern dürfen. Den Widerstreit zwischen romantischer Sehnsucht, die in jeder Schlagermusik erklingt und neusachlicher Subjektivierung, in der Liebe nur als kameradschaftliche Gemeinschaft, nicht realitätsverblendendes Element erlebt werden soll, stellt der Debütroman von Irmgard Keun als Widerstreit in der weiblichen Lebensführung überzeugend dar. Sentimentale Lebensentwürfe haben Frauen wie mit der Muttermilch eingesogen. Die Zeit der Weimarer Republik, in der Frauen das erste Mal in der Geschichte Bürgerrechte genießen, zwingt Keuns Protagonistinnen dazu, sich zu verbieten, diesen alten Zöpfen und Mädchenträumen nachzuhängen. Eine Abwehrstellung gegen eine als unmodern angesehene Gefühlskultur kennzeichnet daher Keuns Heldin, die dann aber doch ihre Gefühlsverweigerung nicht durchhalten kann. Gilgi ist weder naiv, noch ist sie emotional erkaltet. Sie entscheidet sich dafür, ihr Leben in die Hand zu nehmen, aber diese Entscheidung ist keine egoistische. Der Text bringt enormes Verständnis für Gilgis Kämpfe, Krisen und Leidenschaften auf. Die Leserin fühlt mit ihr, identifiziert sich mit ihr. Genau diese Qualität des Romans, ein Identifikationsangebot zu liefern (wie es der Untertitel bereits deutlich macht: „eine von uns“) beförderte die paternalistische Herablassung.
Die Bewertung nach zweierlei Maß, wonach die Heldin aus weiblicher Feder als langweiliger, sentimentaler und kulturell minderwertiger annonciert worden war als die Heldin, die die männliche Imagination hervorgebracht hat und die als aufregender, mutiger, unkonventioneller und kulturkritischer galt, mag heutzutage unsinnig erscheinen, umso unsinniger, wenn wir uns Figuren wie Gilgi vor Augen führen, die Konventionen brechen. Unbestreitbar feierte die Feministische Literaturwissenschaft Erfolge und es gelang ihr, die studentischen Perspektiven auf Texte zu erweitern, jedoch schien schon in den 1990er Jahren das Bedürfnis nach einer Wissenschaft aus einer frauenspezifischen Perspektive bzw. nach einer weiblichen Literaturgeschichte leidlich gestillt zu sein.
1.2Gender Studies als Eindämmung feministischer Diskurse
In den 1990er Jahren begannen daher Studierende und Dozierende das Wort ‚Feminismus‘ zu umgehen, weil es allzu klischeebehaftet und politisch daherkam. Die Beschäftigung mit Geschlechterfragen konnte und sollte damit allerdings nicht aus dem Wissenschaftsbetrieb verbannt werden. Viele Forschungsdesiderate waren durch den feministischen Diskurs erst sichtbar geworden. Man bediente sich jedoch ab den 1990ern des Paradigmas Gender Studies, wenn man diesen Fragen nachging. Das unpersönliche „man“, von feministischen Linguistinnen wie Luise Pusch1 als lächerliches Relikt altväterlich geprägter Sprechweisen angeprangert, ist in diesem Fall kein stilistischer Fehler. Gender Studies wurden gegenüber der Feministischen Literaturwissenschaft nominell vermännlicht, denn nun war eindeutig Männlichkeitsforschung miteinbezogen,2 und tatsächlich wurden diese Studien auch von Männern betrieben.3 Wissenschaftler waren dazu eingeladen, am Genderdiskurs produktiv teilzuhaben, als würde männliche Autorenschaft in diesem Feld den unmerklichen Geruch des „Hexengebräus“, das sich unter dem vorherigen Label verbarg, vertreiben können. In den 1990er Jahren wurde die Feministische Literaturwissenschaft durch das Paradigma der Gender Studies abgelöst. Nicht Frauen, Frauenthemen oder eine weibliche Literaturgeschichte stand im Fokus des Interesses. Die allgemeine Konstruktion von Geschlecht bestimmte den Lehrplan. Obwohl Gender Studies einerseits populär wurden, bleiben sie andererseits bis in das neue Jahrtausend dennoch etwas, das mit Frauen, Frauenforschung und Nischenbildung assoziiert werden konnte. Gender kann jede/r, braucht aber niemand, denn in gewisser Weise seien die Fragen überholt, war ein verbreitetes Vorurteil. Hatte nicht schon Simone de Beauvoir belegt, wie Weiblichkeit produziert wird, was also gibt es dazu noch zu sagen? Die Verbannung des Labels ‚Feminismus‘ konnte nicht alle Skeptiker*innen befrieden, leistet(e) allerdings der Popularisierung des Forschungsfeldes Vorschub. Populäres ist jedoch auch häufig verdächtig. Neben der herkömmlichen Kritik an einem zu starken Fokus auf Geschlecht in der Wissenschaft, erbosten sich auch andere Stimme über Gender Studies, z. B. wegen ihres exkludierenden Jargons. Sahra Wagenknecht, die umstrittene Politikerin, hat 2021 in ihrem populistischen, vieldiskutierten Buch Die Selbstgerechten einigen, sich als „links“ und damit als gesellschaftskritisch bezeichnenden Akteur*innen unterstellt, dass ihr Linkssein zu bloßem „Lifestyle“ verkommen wäre, der sich in Sprachsensibilität statt in Mitgefühl für Minderheiten äußere.4 Sie beklagt sich darüber, dass sich diese Menschen eines moralisierenden Sprachduktus bedienen würden, ohne Empathie für die wirkliche soziale Frage aufzubringen. Dass eine solche Behauptung provoziert, steht außer Frage. Gräben zu ziehen, ist nicht unbedingt sinnvoll, doch würden wir eine solche blasphemische Analogie einmal wagen, könnte auch den Gender Studies ein gewisser selbstverliebter Sprachduktus nachgesagt werden, in dem sich einige Feministinnen nicht mehr wiedererkannten. Genderkritik wäre, so argwöhnisch betrachtet, eine rein akademische Methode, die unter Ausschluss einer breiten Öffentlichkeit betrieben wird und keine gesellschaftspolitische Haltung mehr einschließen würde. Statt durch die geschlechterkritischen Analysen etwas wie Emanzipation oder Patriarchatsdemontage voranzubringen, verkämen Gender Studies zu einem „Lifestyle-Label“. Diese Analogie möchte ich nicht unterstützen. Sie würde letztendlich nur einem Antigenderismus dienen, der aus einer ganz anderen Ecke als der des Feminismus erklingt. Gender Studies haftet allerdings tatsächlich nicht notwendigerweise ein weiblicher Emanzipationsdiskurs, nicht einmal immer eine praktische Orientierung, an, denn Gender Studies traten, zumindest in der Literaturwissenschaft, meist als Theoriediskurs in Erscheinung und seltener als Methodik der Textanalyse. Sowohl aus patriarchalischer als auch aus emphatisch feministischer Perspektive konnte sich des Eindrucks von einer Elfenbeinturm-Wissenschaft und selbstreflexiver Spielerei nicht erwehrt werden. Auf konservativer Seite war die Kritik an Gendertheorie sowieso nie ganz abgerissen, aber leider auch Menschen, für die die „Frauenfrage“ wichtig war, lehnten diese in Teilen ab, weil der gendertheoretische Duktus von der Praxis völlig abgehoben zu sein schien. Judith Butler weist in einem Aufsatz darauf hin, dass die abwertend als ‚Genderismus‘ diskreditierte Gendertheorie immer mehr zum Sündenbock in der Argumentation rechtskonservativer Politik mutiert. Was es gegen Gendertheorie zu sagen gibt, ist: „reaktionäre Hetze, ein Bündel aufwiegelnder Widersprüche und inkohärenter Behauptungen und Anwürfe.“5 Umso dringlicher scheint es geboten, feministische Diskurse und Genderdiskurse in der praktischen Arbeit, in unserem Fall literaturwissenschaftlich, zu verbinden und kreativ in Textanalysen einzuflechten. Ideologisch gefärbter Kritik ist nicht durch Theorie-Debatten beizukommen. Wie sinnvoll Gender als strukturelle Kategorie ist, zeigt sich, wenn mit ihr gearbeitet wird.
In den 1990er Jahren gab eine Publikationsflut, getragen vom Konstruktivismus, in der die entnaturalisierenden Thesen über Geschlecht, die Judith Butler berühmt gemacht haben, wiedergegeben wurden. Nach Butler handelt es sich bei Geschlecht um eine primär kulturelle Konstruktion, deren angenommene Basis Sex (biologisches Geschlecht) nur als ein Effekt des sozialen Geschlechterdiskurses auftritt.
Konstruktivismus ist eine erkenntnistheoretische Position, die die Philosophie des 20. Jahrhundert prägt. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass die Realität und Wahrheit als etwas verstanden wird, das nicht unabhängig vom Individuum und dessen Situierung erkannt werden kann. So sind die Realität und die Wahrheiten stets durch die Wahrnehmenden konstruiert. Auf Geschlecht/Gender bezogen bedeutet dies, dass die Wahrnehmung bestimmter körperlicher Merkmale und bestimmter geschlechtlicher Zuordnungen immer auch dem entspricht, was in der jeweiligen Kultur als männlich oder weiblich zu verstehen erlernt worden ist. Diese Attribute bilden kein eindeutiges Abbild der Natur oder der Biologie, sondern sind immer eine Konstruktion.
In Butlers Theorie war das weibliche Subjekt als solches, das in Solidarität mit anderen weiblichen Subjekten gegen das Patriarchat, über soziale Grenzen hinweg, verbunden durch dieselben, unverbrüchlichen biologischen Anlagen, nicht mehr ahistorisch zu denken. Nicht aus allen Frauen werden Schwestern, naiv wäre es nach Butler zu glauben, dass das Merkmal der Weiblichkeit für jede Frau dasselbe wäre und sich somit jede Frau mit jeder anderen zwangsläufig verbunden sähe Es ist nicht unverständlich, dass Butlers Thesen damals als gleichermaßen inspirierend wie auch verstörend wahrgenommen und tausendfach repliziert und exerziert worden waren. Für das Fach Germanistik sind diese Thesen erst einmal gar nicht so folgenreich. Die Frage nach der Essenz von Weiblichkeit und Männlichkeit stellt sich für Literaturwissenschaftler*innen nicht. Wenn wir mit einer Figur, die beispielsweise ein Kind erwartet, wie Johann Wolfgang Goethes Gretchen (als Gretchentragödie schon im Urfaust enthalten), Gerhard Hauptmanns Rose Berndt (im gleichnamigen Schauspiel 1903 auf die Bühne gebracht), Eduard von Keyserlings Fräulein Rosa Herz (im gleichnamigen naturalistischen Roman von 1890) oder Vicki Baums Helene Willfüer (der Protagonistin von Baums neusachlichen Debütroman Stud. chem. Helene Willfüer, 1928) konfrontiert werden, erfahren wir in all diesen prominenten Beispielen nichts über biologische Prozesse, kaum etwas über körperliche Veränderungen, sondern wir lesen von den sozialen Bedingungen, unter denen diese Frauenfiguren ihre Schwangerschaft erleben, oft auch erleiden. Selbst wenn wir die naturbedingte Basis von Geschlecht nicht in Frage gestellt wissen wollen, auf der Ebene der Literatur wird Geschlecht immer als soziales Geschlecht verhandelt, auch in dem Moment, wenn sie vom „biologisch bedingten Schicksal“ einer Frau erzählt. Im Plot begegnen wir keinem Hormonspiegel, keiner biologischen Wahrheit über einen Körper, sondern der Tragik, die ein unehelich gezeugtes Kind für die Mutter in früheren Zeiten bedeutet hat. Für ein Gretchen des 18. Jahrhunderts ist es noch härter, als ledige Mutter zu gelten, als für eine Helene des 20. Jahrhunderts, weil die Frauenemanzipation inzwischen Fortschritte gemacht hatte. Die literarisch dargestellten Konflikte mit der Schwangerschaft beziehen sich in beiden Fällen jedoch auf die Rolle als Frau. Die Assoziationen, die mit der Zuschreibung weiblicher und männlicher Geschlechtereigenschaften in der Literatur verbunden werden, bleiben stets auf der Ebene der sozialen Rolle. Ob nun Essentialistin oder Konstruktivistin, die Phänomene, die in der Literatur unter den Begriffen ‚männlich‘ und ‚weiblich‘ firmieren, bergen keine intrinsische Assoziation mit Sex, d.h. sie sind von der biologischen Konstitution abgekoppelt.6
Der Erfolg des Labels der Gender Studies war für die feministischen Bestrebungen ein zweischneidiges Schwert. Im Sinne Stephen Greenblatts (1990) konnte dieser Diskurs einerseits als Eindämmung feministischer Zumutungen gelesen werden, obwohl er andererseits stets durch feministisches Interesse gestützt worden war. Doch die Institutionalisierung der Gender Studies ging mit einem Sprachduktus einher, der deutlich machen sollte, dass nun wirklich nicht jede*r etwas zum Thema Gender beitragen kann. War der Feminismus als eine Subversion (Subversion) des herkömmlichen Literaturwissenschaftsbetriebs beschreibbar, weil er auch die persönliche Lektüreerfahrung privilegierte, führten die Gender Studies zu einer Eindämmung/Einhegung feministischer Praxis (Containment), da sie sich wissenschaftlich institutionalisierten und mit Ausschlussmechanismen operierten. Feminismus wurde in den Raum der Gender Studies überführt, und damit in einen überschaubaren Rahmen gefasst. Allerdings führt konsequentes Genderdenken leicht wieder zu feministischer Praxis zurück, da es ungerechtfertigt ist, dass Menschen aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Präferenz Nachteilen ausgesetzt sein sollten, erst recht, wenn Geschlecht kaum viel mehr ist als eine willkürliche, kontingente Zuschreibung.
Ein nicht völlig bestreitbares Vorurteil, das bis zum heutigen Tag etabliert zu sein scheint, besagt, dass Gender Studies vornehmlich von Frauen betrieben werden, da bei ihnen ein größeres Bedürfnis bestünde, Geschlechterklischees kritisch zu hinterfragen. Genderwissenschaft und theoretische Diskurse sind jedoch mitnichten dasselbe wie feministische Praxis. Durch die Etablierung der Gender Studies wurden feministische Fragestellungen theoretisch nobilitiert, die herkömmliche Wissenschaft, die nicht feministisch infiltriert war, behielt jedoch ihre Deutungshoheit. Wissenschaftlerinnen waren aufgerufen, als sachliche Wissenschaftssubjekte Themen, die ehemals dem Dunstkreis des Feminismus entsprangen, ohne Betroffenheitsgestus zu bearbeiten. Eine Genderforscherin war daher auch nicht automatisch eine Feministin. Ihre Stellung im männlich dominierten Wissenschaftsbetrieb prädestinierte sie keinesfalls dafür, im Sinne der zweiten Welle der Frauenbewegung mit anderen Frauen solidarisch zu sein, sondern, im Zweifelsfall, Karriereerwägungen vor feministische Impulse zu stellen und Konkurrenzverhalten auch gegenüber anderen Frauen an den Tag zu legen. Die empirische Tatsache, dass es tatsächlich mehr Forscherinnen als Forscher auf diesem Gebiet gibt und dass scheinbar mehr Studentinnen als Studenten aufgrund eigener Erfahrungen mit Sexismus an diesem Wissenskomplex interessiert sind, gepaart mit der misogynen Voreingenommenheit, Geschlecht sei Frauensache (und damit Geschlechterforschung ebenso), nährte im Sinne der Akzeptanz innerhalb der Gender Studies den Wunsch nach der bereits anfänglich beschriebenen Maskulinisierung und Neutralisierung des Feminismus. Das neue Erstarken einer feministisch interessierten Student*innenschaft ermöglicht es, die Eindämmung (wenn wir diese Metapher akzeptieren wollen) des feministischen Diskurses durch Gender Studies aufzubrechen. Statt Gender studies und Feministische Literaturwissenschaft in Konkurrenz oder als diachrone Entwicklungen zu begreifen, wird dieses Buch die Schwesternschaft beider methodischer Zugänge hervorheben, da beide aus dem Geist geboren sind, die im Patriarchat normierten Lektüren zu hinterfragen.
1.3Fließende Übergänge
Im Alltagsdiskurs werden Begriffe wie ‚Feminismus‘ und ‚Gender‘ oft auch synonym verwendet, gerade dann, wenn die/der Sprecher*in beide Begriffe eher mit despektierlichem Gestus im Munde führt. Für das neue Jahrtausend ist festzuhalten, dass sich nicht nur als weiblich sozialisierte Studierende für Genderfragen interessieren. Die im Bereich der Gender Studies erschienenen Studien zur Männlichkeit finden Nachhall bei Männern, die unwillig sind, sich auf ein bestimmtes maskulines Verhalten festlegen zu lassen. Für das neue Jahrtausend können wir zu Recht neben einem neuen Feminismus auch von einem neuen Maskulinismus reden. Anders als der auf Weiblichkeit bezogene Begriff ‚Feminismus‘ ist ‚Maskulinismus‘ oft in konservativen, mitunter sogar gefährlich chauvinistischen Kontexten verwendet worden, man denke etwa an die Maskulinisten um 1900, die vom „physiologischen Schwachsinn dies Weibes“ ausgehend,1 männliche Überlegenheit gegenüber der ersten Welle der Frauenbewegung zu verteidigen trachteten oder das gesellschaftliche Phänomen des Männlichkeits-Coachings, das nicht selten als Schmiedeeisen misogyner Vorteile dient. Auch der Rechtpopulismus zeigt eine besondere Affinität zum antifeministischen Maskulinismus. Im Rahmen dieser Publikation ist es nicht möglich, das Wort ‚Maskulinismus‘ zu neuen Ehren kommen zu lassen und ins Progressive zu überführen, wohl aber sollten wir festhalten, dass genderkritisches Denken auch von männlichen Studierenden getragen wird.
Gender wird in den meisten Disziplinen in Einführungsveranstaltungen, so etwa in der Literaturwissenschaft, mindestens in einer Sektion vorgestellt. Diese Appetizer nähren bei Student*innen ein wachsendes Bedürfnis nach Seminaren zu Genderthemen. Wenn diese dann aber auf einer rein theoretischen Ebene bleiben, sich also nur in der Lektüre von Sekundärtexten bewegen, führt das zu Enttäuschungen und zur Abkehr von einem Interesse an Gender. Die Literaturwissenschaft lässt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Theorien über Gender und die praktische Anwendung in Form von Textanalysen oft missen. Was eingangs über die Kritiker*innen der Gender studies gesagt wurde, dass ihnen diese viel zu feministisch seien, wird von Befürworter*innen dieser Methode manchmal schmerzlich vermisst. Studierende möchten gern feministisch argumentieren, also Weiblichkeitsklischees als soziale Korsetts analysieren, die die Frauenfiguren auf die eine oder andere Art unfrei erscheinen lassen. Ich bin mir nicht sicher, ob das als neuer Zeitgeist betitelt werden kann, sicher bin ich mir allerdings, dass der Literaturbetrieb zum Erstarken feministischen Bewusstseins geführt hat. Feministische Sujets vieler Texte und die große Präsenz junger Autorinnen haben neue Themen und Blickrichtungen in die Welt gebracht. Auch die sogenannte Popliteratur, hier gerade erst anhand des Romans Soloalbum als „Macho-Genre“ der 1990er Jahre vorgestellt, hat sich seit den 2000er Jahren feminisiert. Seit einigen Jahren ist der Wunsch erkennbar, sowohl scheinbar alte, also bewährte feministische Paradigmen als auch neue, nämlich die des Genderkonstruktivismus, miteinander in Verbindung zu bringen. Eine Modephrase, wie die von den „alten weißen Männern“,2 beinhaltet beides, nämlich Kritik an den Strukturen des Patriarchats als auch das konstruktivistische Wissen, dass „alte weiße Männer“ keine Kategorie ist, die mit biologischem Geschlecht oder gar Alter gleichzusetzen wäre, sondern eine Denkstruktur bezeichnet, die leider auch von als jung und weiblich gelesenen Menschen adaptiert werden kann.
Der Frage, inwiefern Gender als Analysekategorie mit einem Feminismus als kritischer Haltung Hand in Hand gehen kann, lässt sich an folgendem Beispiel zeigen:
Der 1939 veröffentliche Roman des Autors Stefan Zweig Ungeduld des Herzens erzählt die Geschichte eines aus eher einfachen Verhältnissen stammenden Leutnants, der durch Zufall die Bekanntschaft mit der reichen, gehbehinderten Edith macht. Die junge Frau verliebt sich unsterblich in ihn. Aus Mitleid kann er sich der emotionalen Übergriffigkeit der reichen Familie von Kekesfalvas nicht erwehren. Ediths Vater fördert die Bekanntschaft der Tochter mit dem Leutnant, zum einen wegen seiner Vorliebe für das Militär, zum anderen, weil er sein Kind glücklich machen will. Bevor dem aus bescheidenen Verhältnissen stammenden Leutnant Hofmiller die leidenschaftlichen Gefühle Ediths von ihr unmissverständlich offenbart werden, genießt er sein Gastrecht im luxuriösen Haus in vollen Zügen. Der junge Mann, dem eintöniger Militärdienst alltäglich und der nicht ans Wohlleben gewöhnt ist, labt sich am Überfluss und dem traulichen Beisammensein mit der noch kindlichen Edith und deren hübscher Cousine Ilona. Dass Edith es wagt, ihn zu begehren, wird ihn abstoßen; es ist jenseits seiner Vorstellungskraft, dass eine (in der Diegese) als körperlich inadäquat dargestellte Person sich traut, sexuelle Wünsche zu artikulieren. Dieser gewählte Textabschnitt zeigt, dass der 25-Jährige, in jeder Hinsicht als durchschnittlich dargestellte Mann nicht ahnt, was sein tägliches Erscheinen im Schloss für die 17-Jährige, an den Rollstuhl gefesselte Edith bedeutet.
So kam es und nur so, daß ich in den nächsten Wochen die Spätnachmittage und meist auch die Abende bei den Kekesfalvas verbrachte, bald wurden diese freundschaftlichen Plauderstunden schon Gewöhnung und eine nicht ungefährliche Gewöhnung dazu. Aber welche Verlockung auch für einen seit den Knabenjahren von einer Militäranstalt in die andere herumgestoßenen jungen Menschen, unverhofft ein Zuhause zu finden, eine Heimat des Herzens statt kalten Kasernenräume und rauchiger Kameradschaftsstuben! […]
Alles deutete mir liebevoll-sichtbar an, wie selbstverständlich man mich als zur Familie gehörig rechnete; jeder meiner Schwächen und Vorlieben war vertraulicher Vorschub geleistet. Von Zigaretten lag immer just meine Lieblingssorte bereit, ein beliebiges Buch, von dem ich das letzte Mal erwähnt hatte, ich würde es gern einmal lesen, fand sich wie durch Zufall neu und doch schon vorsorglich aufgeschnitten auf dem kleinen Taburett, ein bestimmter Fauteuil gegenüber Ediths Chaiselongue galt unumstößlich als „mein“ Platz – Kleinigkeiten, Nichtigkeiten dies alles gewiß, aber doch solche, die einen fremden Raum wohltuend mit Heimischkeit durchwärmen und den Sinn unmerklich erheitern und erleichtern. […]
Aber noch ein anderes, viel Geheimnisvolleres hatte unbewußt Anteil daran, daß mich das tägliche Beisammensein mit den beiden Mädchen so sehr beschwingte. Seit meiner frühzeitigen Auslieferung an die Militäranstalt, seit zehn, seit fünfzehn Jahren also, lebte ich unausgesetzt in männlicher, in männischer Umgebung. Von morgens bis nachts, von nachts bis früh, im Schlafraum der Militärakademie, in den Zelten der Manöver, in den Stuben, bei Tisch und unterwegs, in der Reitschule und im Lehrzimmer, immer und immer atmete ich im Luftraum nur Dunst des Männlichen um mich, erst Knaben, dann erwachsene Burschen, aber immer Männer, Männer, schon gewöhnt an ihre energischen Gebärden, ihren festen, lauten Gang, ihre gutturalen Stimmen, ihren knastrigen Geruch, ihre Ungeniertheit und manchmal sogar Ordinärheit. Gewiß, ich hatte die meisten meiner Kameraden herzlich gern und durfte wahrhaftig nicht klagen, daß sie es nicht ebenso herzlich meinten. Aber eine letzte Beschwingtheit fehlte dieser Atmosphäre, sie enthielt gleichsam nicht genug Ozon, nicht genug spannende, prickelnde, elektrisierende Kräfte. Und wie unsere prächtige Militärkapelle trotz ihres vorbildlich rhythmischen Schwungs doch immer nur kalte Blechmusik blieb, also hart, körnig und einzig auf Takt eingestellt, weil ihr der zärtlich-sinnliche Streicherton der Violinen fehlte, so entbehrten sogar die famosesten Stunden unserer Kameraderie jenes sordinierenden Fluidums, das immer die Gegenwart oder auch nur Atemnähe von Frauen jeder Geselligkeit beimischt. Schon damals, als wir Vierzehnjährigen je zwei und zwei in unseren verschnürten kleidsamen Kadettenmonturen durch die Stadt promenierten, hatten wir, wenn wir andern jungen Burschen mit Mädchen flirtend oder nachlässig plaudernd begegneten, wirr sehnsüchtig empfunden, daß durch die seminaristische Einkasernierung etwas unserer Jugend gewalttätig entzogen wurde, was unseren Altersgenossen tagtäglich auf Straße, Korso, Eisbahn und im Tanzsaal ganz selbstverständlich zugeteilt war: der unbefangene Umgang mit jungen Mädchen, indessen wir, die Abgesonderten, die Eingegitterten, diesen kurzröckigen Elfen wie zauberischen Wesen nachstarrten, von einem einmaligen Gespräch mit einem Mädchen schon wie von einer Unerreichbarkeit träumend. Solche Entbehrung vergißt sich nicht. Daß späterhin rasche und meist billige Abenteuer mit allerhand gefälligen Weibspersonen sich einstellten, bot keinerlei Ersatz für diese sentimentalen Knabenträume, und ich spürte an der Ungelenkigkeit und Blödigkeit, mit der ich jedesmal (obwohl ich schon mit einem Dutzend Frauen geschlafen) in der Gesellschaft herumstotterte, sobald ich zufällig an ein junges Mädchen geriet, daß mir jene naive und natürliche Unbefangenheit durch allzulange Entbehrungen für allezeit versagt und verdorben war.
Und nun hatte sich plötzlich dies uneingestandene knabenhafte Verlangen, eine Freundschaft statt mit bärtigen, männischen, ungehobelten Kameraden einmal mit jungen Frauen zu erleben, auf die vollkommenste Weise erfüllt. Jeden Nachmittag saß ich, Hahn im Korbe, zwischen den beiden Mädchen; das Helle, das Weibliche ihrer Stimmen tat mir (ich kann es nicht anders ausdrücken) geradezu körperlich wohl, und mit einem kaum zu beschreibenden Glücksgefühl genoß ich zum erstenmal mein eigenes Nichtscheusein mit jungen Mädchen. Denn es steigerte nur das besonders Glückhafte in unserer Beziehung, daß durch eigenartige Umstände jener elektrisch knisternde Kontakt abgeschaltet war, der sich sonst unaufhaltsam bei jedem längeren Zuzweitsein von jungen Leuten verschiedenen Geschlechts ergibt. Völlig fehlte unseren ausdauernden Plauderstunden alles Schwülende, das sonst ein tête-à-tête im Halbdunkel so gefährlich macht. Zuerst freilich – ich gestehe es willig ein – hatten die küßlich vollen Lippen, die fülligen Arme Ilonas, die magyarische Sinnlichkeit, die sich in ihren weichen, schwingenden Bewegungen verriet, mich jungen Menschen auf die angenehmste Art irritiert. Ich mußte einigemal meine Hände in straffer Dressur halten gegen das Verlangen, einmal dies warme, weiche Ding mit den schwarzen, lachenden Augen an mich heranzureißen und ausgiebigst abzuküssen. Aber erstlich vertraute mir Ilona gleich in den Anfangstagen unserer Bekanntschaft an, daß sie seit zwei Jahren einem Notariatskandidaten in Becskeret verlobt sei und nur die Wiederherstellung oder Besserung im Befinden Ediths abwarte, um ihn zu heiraten ich erriet, daß Kekesfalva der armen Verwandten eine Mitgift zugesagt hatte, falls sie bishin ausharre. Und überdies, welcher Roheit, welcher Perfidie hätten wir uns schuldig gemacht, im Rücken dieser rührenden, ohnmächtig an den Rollstuhl gefesselten Gefährtin kleine Küßlichkeiten oder Handgreiflichkeiten ohne rechte Verliebtheit zu versuchen.3
In diesen Zeilen lesen wir eine kulturell erschaffene Zweigeschlechterteilung, die den bürgerlichen Rollen entspricht. Die weibliche Sphäre ist die des Heims, der Behaglichkeit, die männliche entspricht der Arbeitswelt, potenziert ist diese männliche Arbeitswelt als eine rein „männische“, nämlich als die Welt des Militärs. Der Text deckt die den unterschiedlichen Sphären entsprechenden Genderrollen als eingeübten Verhaltenskodex auf. Das raubeinige Auftreten der Kameraden und das überfeinerte Gebaren der Mädchen folgt geschlechterspezifischen Benimmregeln, die sich als Rollen wohlgeordnet aufeinander zu beziehen haben. Die Mädchen sollen den Mann unterhalten, ihr Zweck ist es, ihm Genuss zu verschaffen. Für eine genderorientierte Untersuchung bietet der Text reichlich Potential. Wird die Binärität zwischen Mann und Frau erst einmal als konstruiert entlarvt, wird ebenso schnell auch das natürliche Begehren zwischen nur diesen zwei Geschlechtern in Frage gestellt, so dass als logische Folge queeres Denken angeregt wird, für das der Roman, z. B. in dem Eingeständnis Hofmillers, dass er mal in einen Kameraden verliebt war, sehr anbietet. Die libidinöse Energie zirkuliert im Kontext seines soldatischen Lebens, bei den Mädchen jedoch sollen die sexuellen Affekte eingedämmt bleiben. Tatsächlich sind Hofmillers nachmittägliche Besuche nicht von heterosexuellem Begehren getragen. Gerade die fehlende sexuelle Stimulation genießt er an den Nachmittagen mit Ilona und Edith. Er muss sich nicht als Mann beweisen, was ein eigenes „Nichtscheusein“ mit den beiden jungen Mädchen befördert. Er muss nicht verführen und ist dennoch dem Umfeld des militärischen Drills enthoben. Das, was ihn beglückt, wird als jenes „sordinierende[s] Fluidum, das immer die Gegenwart oder auch nur die Atemnähe von Frauen jeder Geselligkeit beimischt“, bezeichnet. Wenn wir genau definieren wollen, was das weibliche Kolorit eigentlich ausmacht, ist es: Heimischkeit, Bequemlichkeit, Kontemplation. Dies wird im Kontext der Zeit mit Weiblichkeit assoziiert, da Frauen größtenteils vom öffentlichen Leben, von der Arbeitswelt, zumal von der des Militärs ausgeschlossen waren. An Ediths und Ilonas Gesellschaft reizt ihn das Heterosoziale. Die Analogie, die Weiblichkeit zu den Violinen hat, die dem harten Klang der Blechinstrumente einen sanften Ton beifügen, ist offenkundig rein sozial bedingt. Es gibt keine biologische Verbindung von Frauen und Violinenklang, dennoch ist leicht verständlich, was der Erzähler meint, dass nämlich Weiblichkeit dem normalen Leben (dem rhythmischen Grundton), die angenehme, nicht notwendige, aber erhebende Zutat von Geselligkeit (Wohlklang) beimischt.
Für die Disability Studies böte sich der Text ebenso gut an. Nicht nur ist das, was als weiblich und männlich gilt, gesellschaftlich produziert, auch die Ohnmacht Ediths ist keine faktisch gegebene. Ihre Behinderung ist weit weniger in Stein gemeißelt als die dargestellte Tatsache, dass Edith stets durch ihre Umwelt behindert wird. Sie vermag sogar (mit Gehhilfen) zu laufen, aber meist wird sie getragen, geschoben, die Rolle der Kranken ist ihr permanent zugedacht. Sie wird platziert, abgesondert, ihre Beine werden so achtsam verdeckt, dass die Verdeckung eher eine Markierung darstellt, die eine Verkrüppelung suggerieren, welche ansonsten gar nicht augenscheinlich werden würde. Nichts darf die junge Frau selbst in Angriff nehmen. In diesem Text ist Behinderung als Differenzkategorie unverkennbar. Die Sinnlichkeit Ilonas, die ihr zugesprochen wird, offenbart sich nicht durch körperliche Attribute, sondern vielmehr aufgrund des Bedürfnisses sie zu berühren. Ilona ist dem gesellschaftlichen Diskurs nach berührbar, ein besitzbares „Ding“. Edith ist aufgrund ihrer Behinderung nicht fuckable.
Im Wort ‚fuckable‘, das im Alltagsdiskurs bekannt ist, stellt sich die Objektfunktion besser heraus als es in Umschreibungen wie ‚sexuell attraktiv‘ der Fall ist. Das Wort wird in diesem Buch eingedenk dessen verwendet, dass der Objektcharakter der begehrten Person, die das Attribut zugeschrieben bekommt, gegenüber persönlichen Eigenschaften privilegiert wird.
Sie darf überhaupt nur seelische Gelüste hervorrufen, ihr gegenüber besteht ein Begehrensverbot, das folglich auch reziprok für sie selbst gilt, zumal es auch ein Bruch mit der Genderrolle darstellt, dass Edith ihre Gefühle offenbart, bevor sich Hofmiller ihr erklärt hat. Asexuell sein zu müssen, ist eine gesellschaftliche Vorschrift. An vielen Stellen im Text wird Edith auch als hübsch, jung, anziehend beschrieben, jedoch immer nur dann, wenn ihre Behinderung ausgeblendet wird. Die Möglichkeit, sie als begehrenswerte Frau zu sehen, wird nur durch die stetige Präsenz ihrer Gehhilfen unterbunden, die, an eine Ecke gelehnt mahnen, das sitzende, passabel wirkende Mädchen nicht sinnlich zu betrachten. Der Roman beginnt damit, dass Hofmiller eben jene Warnschilder, die Ediths Existenzverbot als sinnliche Frau symbolisieren, übersieht und sie zum Tanz aufgefordert hat. Diese als grober Fauxpas empfundene Aufforderung führt erst zum vertraulichen Umgang zwischen dem Leutnant und der jungen Frau, weil sich Hofmiller am nächsten Tag in aller Form bei Edith dafür entschuldigt. Ihm war es sehr fatal, die Tochter des Hauses vorgeführt bzw. beschämt zu haben. Da er ein recht unsicherer Charakter ist, stellt er mit großer Dankbarkeit fest, dass Edith ihm durch einen Brief seine Tanzaufforderung in Unkenntnis ihrer Lage leichtherzig zu verzeihen gedenkt, wenn er sie weiter mit seiner Gesellschaft zu beehren gedenkt. Seitdem Edith ihren Wunsch nach seiner Gesellschaft artikuliert hat, fühlt sich Hofmiller dem Haus und Edith gegenüber verpflichtet.
Wenn wir uns den Text hinsichtlich seiner Konstruktion von Geschlecht unter die Lupe nehmen, ist eine feministische Lesart (Feminismus verstanden als kritische Analyse der Geschlechter-Ordnung) fast unvermeidbar. Die Trennung zwischen leichten Mädchen („gefälligen Weibspersonen“), mit denen Hofmiller schon ein Duzend mal sexuell verkehrt hat und Frauen, die tatsächlich begehrenswert und liebenswert sind (die „zauberischen Wesen“), beruht auf einer patriarchalischen Scheidelinie, um die Sexualität von Frauen allein in den Raum der Ehe zu verbannen. Alle Frauen, die jenseits des Zivilstandes bzw. des glaubwürdigen Versprechens auf eine Ehe solche sexuellen Handlungen vollziehen, also „gefällig“ sind, gelten als verachtenswert. Für ehrbare Frauen gilt ein Begehrensverbot, sie dürfen auf die Liebe eines Mannes nur antworten, keine Botschaften an Männer aussenden. Niemals können solche liederlichen Frauen zu der Heimat des Herzens werden, nur die verbotenen Lüste beheimaten, die man mit den Kameraden, die man gernhat, nicht (oder nur begrenzt) ausleben darf, die jedoch – das zeigt der Roman auch – für die Herstellung männlicher und militärischer Genderidentität unabdingbar sind. Sexualität ohne emotionales Bekenntnis zu vollziehen, ist wie Reiten und Fechten eine Handlung, mit der die männliche Rolle angenommen und ausgeführt wird. Sie gehört zur performativen Männlichkeit der dargestellten Welt. Die seelische Freundschaft zu dem behinderten Mädchen wird auf Dauer seinem Ruf als Leutnant schaden. Militärische Männer toben sich mit Frauen aus oder heiraten angesehene, attraktive junge Damen. Weibliche Wesen, die in dieser Ökonomie weder als Sexualobjekt noch als potenzielle Ehefrau Platz haben, sind Unpersonen, ihre Identität bietet keinen Resonanzraum für Männlichkeit. Dass Edith am Ende Suizid begeht, ist in gewisser Weise unausweichlich. Ihr Sein wird nicht anerkannt. Solange sie nicht fest auf zwei Beinen steht, kann sie ihre Rolle als Frau nicht ausüben, die im Kontext der Zeit eine Rolle ist, die darin besteht, einen begattbaren Körper bereitzuhalten. Ehrbare Frauen sollten als Ehefrau weniger zum Zweck der Lust als zum Zweck, dem Mann Nachwuchs zu schenken, sexuell fungieren können. Die Rolle der Frau besteht darin, den Mann zu verwöhnen. Als Ehefrau ist sie ihm Heim und Repräsentationsgegenstand, als gefälliges Mädchen ein Lustobjekt. Ilona und Edith sind weder das Eine noch das Andere, aber sie schaffen eine heimische Sphäre, die dem unverheirateten Waisenjungen kurze Zeit ein Zuhause vorspiegeln kann. Die beiden Mädchen werden nicht als Menschen (mit individuellen Eigenschaften) wahrgenommen, der Genuss von Hofmiller besteht darin, die beiden jungen Frauen als Objekte der Unterhaltung (wie die Bücher, Zigaretten) zu betrachten. Besonders wohl fühlt er sich, weil die Objektrolle der Frauen nicht von einem im Raum schwebenden Sexualitätsangebot überschattet ist. Er ist zu nichts Grundsätzlichem verpflichtet, denn auch die reizende Ilona wird durch die Asexualität Ediths zunehmend ent-sexualisiert. Sie gehört einem anderen Mann – und obwohl eben nicht per se unberührbar, ist sie für ihn sexuell tabu. Auch wenn die Mädchen keine Sexual- oder Liebesobjekte für Hofmiller darstellen, so sind sie doch entindividualisierte Objekte; sie stehen für die vermisste, aus dem militärischen Umkreis verdrängte Weiblichkeit. Ihre Stimmen, ihre Themen, ihre Gestalten dienen als überindividuelle Verkörperung weiblicher Eigenschaften, die von ihnen repräsentiert werden, um den Mann zu delektieren. Die Persönlichkeit Ilonas oder Ediths bleibt Hofmiller verschlossen. Es ist die Rolle der hübschen, bereits verlobten Cousine und die Rolle der mitleidserregenden behinderten Freundin, die ihm die unausgefüllten Nachmittagsstunden versüßen. Die Frauen sind für ihn physisch wahrnehmbar, als Stimmen, Gerüche, Körper. Tatsächlich liegt die Tragödie dieses Romans darin, dass die Menschlichkeit Ediths, ihre Psyche (sowohl ihr Gefühlsüberschwang als auch die aus der Perspektive der Zeit ungebührliche Verkörperung weiblicher Hysterie) ihn abstößt, weil Edith dadurch aus der Rolle des (Unterhaltungs-) Objekts fällt, das selbst nichts fordert. Allein die adäquate Genderrolle, die die beiden Mädchen spielen, führt ihn täglich ins Haus: ihre Bestimmung als jungfräuliche, liebreizende, dienende Unterhalterinnen ohne eigene Subjektivität lässt ihn jeden Nachmittag erscheinen. Der Moment, als sich mit der Artikulation des Begehrens auf Seiten Ediths ihre Subjektivität, ihre Eigenständigkeit jenseits ihrer asexuellen Tochterfunktion kundtut, ist der Moment, ab dem Hofmiller keine Begegnung mehr genießen kann, sich jede Zusammenkunft mit Edith in Pflicht und Lästigkeit verwandelt, und er sich wünscht, das Haus nie wieder betreten zu müssen. Obwohl die Heirat mit Edith einen ökonomischen Aufstieg bedeuten würde, oder vielleicht gerade deshalb, ist der Gedanke, Edith zur Frau zu nehmen, für Hofmiller völlig abwegig. Dabei ist nicht der Mangel an aufrichtigem Gefühl seitens des jungen Mannes auschlaggebend, sondern der Mangel Ediths an zeitgenössisch als richtig empfundener Darstellung/Performanz von Weiblichkeit.
Sie zur Frau zu nehmen, käme für ihn einer völligen Entehrung und Entmännlichung gleich.
Unter Performanz von Geschlecht wird die Art und Weise verstanden, wie sich das Geschlecht einer Person herstellt, also der Ausdruck und die Darstellung, durch die jemand als weiblich oder männlich wahrgenommen wird. Eine Kultur kennt immer Darstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit, die als höherwertiger und richtiger erachtet werden. So galten lange Zeit große und kantige Männer als „männlicher“ denn kleine und zarte. Welche Weiblichkeit als die richtige gilt, ändert sich in den zeitlichen Kontexten, immer jedoch hat die weibliche Performanz von Geschlecht, um in einem patriarchalischen Kontext als angemessen zu gelten, eine Objektfunktion für den Mann zu erfüllen. Nicht-binäre Genderperformanzen der Gegenwart vermischen aktiv Ausdrucksformen, die als männlich gelten, mit denen, die als weiblich gelten. Dadurch wird die Konstruiertheit geschlechtlicher Wahrnehmung offengelegt.
Es ist unmöglich über Gender in diesem Text zu sprechen, ohne eine kritische Perspektive einzunehmen, die entweder als queer oder als feministisch bezeichnet werden könnte. Der Text teilt mit, was er ausschließt. In der Behauptung, dass sich „unaufhaltsam bei jedem längeren Zuzweitsein von jungen Leuten verschiedenen Geschlechts“ eine Spannung „ergibt“, impliziert, dass es bei älteren Menschen, Menschen gleichen Geschlechts oder eben bei Menschen, die im Kontext der Zeit (wie durch eine Behinderung) ihr Geschlecht nicht richtig repräsentieren, diese Spannung ausgeschlossen wird. Genau das aber, so erzählt uns der Roman, ist nicht der Fall. Wir erfahren von einer frühen Verliebtheit Hofmillers in einen Kameraden, von einem Ehebund zwischen einem jüngeren Mann mit einer älteren Frau, was zeitgenössisch betrachtet paradox ist, und erkennen schnell die Sehnsucht Ediths. Alle Übertretungen, die beschrieben werden, müssen sofort an gleicher Stelle durch den ethischen Diskurs der Zeit, der dem Ich-Erzähler anhaftet, als sozial inakzeptabel verworfen werden. Er unterwirft sich einer Episteme von Geschlecht, die heute als überholt gelten kann, nämlich der, dass eine Frau im Rollstuhl Begehren versagt bleiben muss. Trotzdem bleiben diese Moralverstöße denkbar und für Edith, ja selbst für Ediths Vater, ist das tabuisierte Bündnis zwischen dem gesunden Leutnant und der kranken Edith eine nicht ganz abwegige Vorstellung. Gender entlarvt sich in diesem Text als eine Konstruktion, die zwar fest in der patriarchalischen Gesellschaft zementiert ist und doch gleichzeitig in ihrer Brüchigkeit und Kontextabhängigkeit offengelegt wird. Diese Interpretation beinhaltet ein Urteil, das eine Kritik an der dargestellten Geschlechterordnung impliziert, insofern sie also auch als feministisch gelten kann. Der Genderdiskurs kann nur aus einer Perspektive beschrieben und untersucht werden, die sich dem patriarchalischen Leitdiskurs widersetzt. Der Roman ist heute nur lesenswert, seine Psychologie erschient nur nachvollziehbar, wenn die Prämisse, dass eine Heirat Hofmillers und Ediths ein Tabu darstellt, nachvollzogen werden kann. Dass davon ausgegangen wird, dass auch heutige Leser*innen das tun, zeigt eine Neuauflage des Romans 2021, die z. B. im literarischen Quartett am 3. Dezember 2021 euphorisch besprochen wurde. Auch im 21. Jahrhundert sind wir durchaus in der Lage, die Gesetze des Patriarchats, die im vorigen Jahrhundert galten, zu verstehen. Viel Altbackenes ist uns verinnerlicht, auch wenn wir intellektuell dazu in der Lage sind, bestimmte patriarchalische Konventionen von uns zu weisen. Das gegenwärtige Lesevergnügen speist sich aber m. E. nicht nur aus Zweigs schriftstellerischem Talent, Gewissensqualen zu skizzieren, sondern auch daraus, dass wir Hofmillers und vor allem Ediths Tragödie nicht als unausweichlich betrachten, weil wir zu den ehernen Gesetzen in eine kritische Distanz treten. Diese Distanz ist eine feministische, ermöglicht wird sie durch einen kritischen Genderblick. Sie eröffnet Raum für soziale Freiheit.
Inspiriert vom Webfeminismus oder gegenwärtigen Debatten zu Genderpolitik, bezeichnen sich heute viele Studentinnen selbstbewusst als Feministinnen. Das F-Wort ist kein Tabu mehr, so dass auch Leseweisen von Texten das Attribut ‚feministisch‘ wieder tragen können, deshalb sollen in diesem Studienbuch einige Lektüretools vorgestellt werden, die als feministisch zu bezeichnen sind, die aber – was noch bedeutsamer ist – ein tieferes Verständnis bestimmter Texte ermöglichen. Die Literatur zeichnet ein buntes Bild von Geschlecht, welches mit den herkömmlichen, patriarchalisch geprägten Lektürebrillen gar nicht richtig erfasst werden kann. Der Begriff der Anerkennung dient in diesem Studienbuch als Bindeglied zwischen der Semantik der feministischen Wissenschaft und der der Gender Studies.