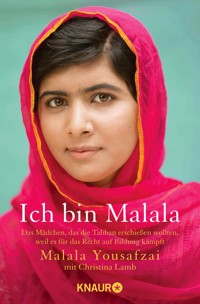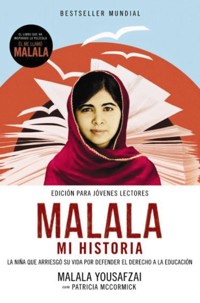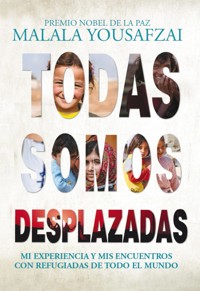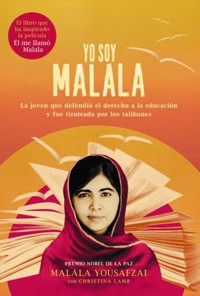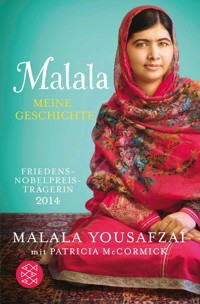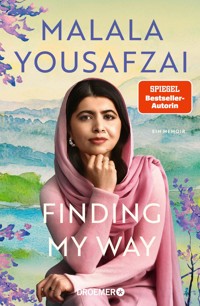
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wie findest du zurück zu dir selbst, wenn deine Welt sich über Nacht ändert? Nach dem Attentat der Taliban auf ihr Leben wurde Malala unvermittelt auf die öffentliche Bühne gestoßen und schnell zur international bekannten Symbolfigur für Mut und Resilienz. Doch fern der Kameras und Menschenmengen brauchte sie Jahre, um ihren Platz in einer ihr nicht vertrauten Welt zu finden. Nun nimmt Malala in Finding My Way ihre Leserinnen und Leser erstmals mit in die Welt hinter den Schlagzeilen – in einem zutiefst verletzlichen und überraschenden Memoir voller Authentizität, Humor und Zärtlichkeit. Finding My Way ist eine Geschichte von Freundschaft und erster Liebe, von Angst und Selbstfindung. Eine Geschichte, die zeigt, wie man sich selbst treu bleibt, wenn alle Welt dir sagen will, wer du bist. Malala zeichnet ihren Weg nach von der einsamen Schülerin in der Highschool über die unbekümmerte Studentin bis hin zu der jungen Frau, die mit ihrer Vergangenheit Frieden geschlossen hat. Sie lässt uns spontan teilhaben an den manchmal chaotischen Momenten ihres Lebens – als sie ihre Prüfungen fast nicht schafft, geghostet wird und die Liebe ihres Lebens kennenlernt. Malala erinnert uns, dass wahre Role Models im Leben niemals vollkommen sind – sondern in erster Linie menschlich. In diesem bewundernswerten Memoir stellt sich Malala der Welt ganz neu vor und zeigt uns, wie sie ihr Leben meisterte als Mensch, dessen finsterste Stunden ihr Leben beinahe für immer geprägt hätten – und wie sie trotzdem für die Freiheit kämpfte, herauszufinden, wer sie wirklich ist. Finding My Way gibt uns einen intimen Einblick in das Leben einer jungen Frau, die ihr Schicksal selbst bestimmt. Das Buch ist ein zutiefst persönliches Zeugnis der Kraft, die Malala brauchte, um ohne Zugeständnisse ganz sie selbst zu werden. »Ihre Sprache ist einfach und doch so fesselnd, dass man das Buch nicht weglegen kann. Am Ende wünscht man sich, Malala noch länger auf ihrem Weg begleiten zu können.« Edda Nieber, Rhein-Neckar-Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 456
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Malala Yousafzai
Finding My Way
Ein Memoir
Aus dem Englischen von Elisabeth Liebl und Katrin Bosshardt
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
DIES IST NICHT DIE GESCHICHTE, DIE IHR MEINT ZU KENNEN.
DIES IST DIE GESCHICHTE, DIE ICH SCHON IMMER ERZÄHLEN WOLLTE.
Nach dem Taliban-Attentat stand Malala von einem Moment auf den anderen in der Öffentlichkeit und wurde zu einem internationalen Symbol für Mut und Resilienz. Doch abseits von Kameras und Menschenmengen brauchte sie Jahre, um ihren Platz in einer ihr unbekannten Welt zu finden.
In »Finding My Way« nimmt sie die Leser*innen erstmals mit in das Leben hinter den Schlagzeilen – in einem zutiefst verletzlichen und augenöffnenden Text voller Authentizität, Humor und Zärtlichkeit. Es ist eine Geschichte von Freundschaft und erster Liebe, von Angst und Selbstfindung. Malala beschreibt ihren Weg von der einsamen Highschool-Schülerin über die unbekümmerte Studentin bis hin zu der jungen Frau, die mit ihrer Vergangenheit Frieden geschlossen hat. Sie nimmt uns mit zu den chaotischen Momenten und erinnert so daran, dass echte Vorbilder nie perfekt sind, sondern menschlich. Ihr Buch ist das zutiefst persönliche Zeugnis der Kraft, die Malala brauchte, um ohne Kompromisse ganz sie selbst zu werden.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Intro
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
Danksagung
Für Abai, Toor Pekai und alle Mädchen aus Shangla
Intro
Ich werde nie wissen, welches Leben für mich bestimmt war. Vielleicht hat jeder Mensch dieses Gefühl und ist neugierig auf die unsichtbaren Weggabelungen im Leben, die falschen Abzweigungen und zufälligen Begegnungen, die schließlich alles verändern. Ich aber fühle mich davon heimgesucht, von dem Abgrund zwischen dem, wie ich mir mein Leben vorgestellt habe, und dem, was daraus geworden ist. Ich werde das Gefühl nicht los, dass mich eine riesige Hand gepackt und aus einer Geschichte in eine ganz andere versetzt hat.
An einem milden Oktobermorgen hat eine Kugel den Lauf meines Lebens verändert, mich abgeschnitten von meiner Heimat, meinen Freundinnen und allem, was mir lieb war, sodass ich in eine mir nicht vertraute Welt taumelte. Mit 15 Jahren hatte ich keine Zeit mehr, herauszufinden, wer ich sein wollte, denn mit einem Mal wollten alle mir sagen, wer oder was ich war. Eine Inspiration, eine Heldin, eine Aktivistin. Aber auch ein Mauerblümchen, ein Sandsack, ein Gehaltsscheck. Für meine Eltern war ich eine gehorsame Tochter. Für meine Freundinnen eine gute Zuhörerin. Sobald ich aber allein war, geriet all das ins Wanken – denn einfach ich selbst zu sein, fiel mir von allem am schwersten.
Meine frühen Zwanziger waren ein einziges Gewirr aus Angst und Unschlüssigkeit, aus unbekümmerten Nächten und nebligen Morgenstunden, aus Freundschaft und erster Liebe. Es war klar, dass es nicht einfach werden würde, in dieser von Wundern erfüllten Zeit des Lebens, in der die Welt unzählige Möglichkeiten bereitzuhalten schien, jenen Weg im Leben zu finden, der für mich richtig war. Ich versuchte, die Erwartungen anderer Leute abzuschütteln und auf meine eigene Stimme zu hören, mir einen Reim darauf zu machen, was ich verloren hatte und wer ich möglicherweise werden konnte. Was ich aber mehr als alles andere wollte, war, in meiner Geschichte einen Sinn zu finden.
1
Wenn du in fünf Minuten aufstehst, wirst du noch rechtzeitig fertig«, verhandelte ich mit mir selbst. Ich überschlug, wie lange ich brauchen würde, um mir die Zähne zu putzen und irgendwelche Klamotten überzuwerfen. Eine halbe Stunde später war ich immer noch im Bett und scrollte auf meinem Handy herum – Infos zur Ausstattung des Wohnheimzimmers, virtuelle Touren auf dem Uni-Campus, Materiallisten. In zwei Tagen würde ich mit der Uni anfangen, und mir schwirrte so einiges im Kopf herum.
»Neue Freundinnen! Keine Eltern! Keine Regeln!« Ich konnte meine Aufregung kaum bezwingen und wippte summend auf den Zehen, während ich mich anzog. Dann stieg ich in den Aufzug, der mich in einen fensterlosen Konferenzraum eines Hotels im Zentrum von Manhattan brachte.
»Sie sind zu spät«, seufzte die PR-Frau. »Und ich will gar nicht erst fragen, ob Sie sich die einzelnen Punkte durchgesehen haben, über die Sie reden sollen.«
Ich lächelte und zuckte mit den Schultern. Ich hatte diesen Sommer vier Kontinente bereist, mit neun Premierministern gesprochen und viele Vorträge gehalten. Nun war ich in New York, wegen einer PR-Aktion für Malalas magischer Stift, ein neu erschienenes Kinderbuch. Sechs Stunden, in denen sich Interview an Interview reihen würde, und dann nachts der Flug nach Hause, nach Birmingham in England. Das hier würde für lange Zeit mein letzter Arbeitstag sein, aber mein Kopf hatte sich schon aus dem Konferenzraum verabschiedet.
Die PR-Frau verließ den Raum, und nur wenige Minuten später kam ein Mädchen herein. Ich wollte sie schon fragen, ob sie sich verlaufen habe, da sah ich den Aufdruck auf ihrem Poloshirt: das Logo einer Zeitschrift und darunter »Kinder-Reporter«.
»Was wolltest du werden, als du noch klein warst?«, fragte sie mich.
»Automechanikerin!«, antwortete ich und fügte hinzu, dass ich immer leidenschaftlich gepuzzelt hätte. Es faszinierte mich herauszufinden, wie man Dinge zusammensetzt.
Der nächste Journalist war schon weit weniger herzig. Er interessierte sich keine Spur für das Kinderbuch, sondern sprach lauter aktuelle Themen an, in der Hoffnung, dass ich irgendetwas Kontroverses äußern würde, was vielleicht ein wenig Brisanz in den ansonsten eher lahmen Nachrichtentag bringen würde. Die meisten seiner Fragen drehten sich um den amerikanischen Präsidenten: »Was würden Sie, als jüngste Nobelpreisträgerin aller Zeiten, dem Präsidenten zum Thema Frauenrechte sagen?« Oder: »Sie haben das Weiße Haus besucht, als Obama Sie eingeladen hat. Würden Sie auch einer Einladung der neuen Regierung folgen?« Ich wusste, wie ich verhindern konnte, dass mein Name in die Schlagzeilen geriet, und schluckte seinen Köder nicht.
Das letzte Interview war für eine Sendung im Frühstücksfernsehen. Die Moderatorin stellte wohlüberlegte Fragen über meine Arbeit und meinen Alltag. Wir waren fast schon am Ende angelangt, als sie sich mit besorgtem Gesicht in meine Richtung beugte.
»Denken Sie jetzt, fünf Jahre nach dem Attentat, immer noch jeden Tag daran?«, wollte sie wissen.
»Das musste ja kommen«, dachte ich. »War ja klar, dass ich diesen Raum nicht verlassen würde, ohne dazu etwas gesagt zu haben.« Ich war über solche Fragen nicht etwa erstaunt. Sie störten mich auch nicht. Ich fand es nur seltsam, wie oft sie mir gestellt wurden. Jener Teil meines Lebens fühlte sich für mich so weit entfernt an. Er lag auch in meiner Erinnerung lange zurück, aber irgendwie schien er sich ständig an mir vorbei in den Vordergrund zu drängen und die Luft zu erfüllen, sobald ich einen Raum betrat.
Ich wuchs in einer abgelegenen Ecke Pakistans auf, an einem Ort namens Mingora. Meine Heimatstadt liegt am Swat-Fluss und ist umgeben von Wäldern, Wiesen voller Wildblumen und gewaltigen, schneebedeckten Gipfeln. Das Leben in unserem Tal war nicht vollkommen – die meisten Familien waren arm, und strenge soziale Normen, besonders für Frauen, verhinderten den Fortschritt. Aber es war ein umwerfend schöner und friedlicher Ort.
Das änderte sich, als ich zehn Jahre alt war. Seltsame Männer mit langen Bärten und Sturmgewehren kamen von den Bergen herunter und übernahmen unsere Stadt. Die Taliban fingen an, Krankenhäuser und Hotels zu bombardieren sowie Musiker, Lehrer und Polizisten auf den Straßen hinzurichten. Mehrmals am Tag erschollen aus dem Radio die neuen Gesetze: Fernsehen und Musik waren verboten, eigentlich jede Unterhaltung, sogar Brettspiele für Kinder. Männer durften sich den Bart nicht mehr rasieren. Und Frauen durften ihr Haus nicht verlassen.
Während Bomben und Gewehrfeuer immer lauter dröhnten, wurde unser Dasein immer enger. Wir lebten mit der ständigen Angst, irgendeine neue Vorschrift zu übertreten, die wir noch nicht kannten. In der Nachbarschaft wurde ein Mann erschossen, weil die Taliban sagten, dass der Saum seiner Hose zu weit hinunterreichte. Eines Tages sah ich meinen fünfjährigen Bruder Atal, wie er im Hof ein großes Loch grub. Ich fragte ihn, was er denn da tue, und er antwortete: »Ich hebe ein Grab aus.«
Ich war elf, als die Taliban anordneten, dass von jenem Tag an in drei Wochen Mädchen nicht mehr zur Schule gehen dürften. Die Angst erfasste mein Herz und hielt es fest. Wenn ich dann trotzdem weiter zur Schule gehen würde, würden sie mich vielleicht umbringen. Bliebe ich zu Hause, dann wäre mein Leben ein für alle Mal vorbei. Selbst in diesem Alter wusste ich, was Frauen ohne Schulbildung in meiner Gemeinschaft erwartete: frühe Verheiratung und mehrere Kinder, noch bevor man 20 wurde; und für den Rest des Lebens war man im Haus des Ehemannes eingesperrt. Eine Zukunft, die absolut nicht meinen Vorstellungen entsprach.
Ich fing an, auf einer Webseite der BBC einen anonymen Blog zu führen, ein Tagebuch, das unser Leben unter der Herrschaft der Terroristen beschrieb. »Unsere Schule hat uns mitgeteilt, dass wir keine Schuluniformen tragen sollten«, schrieb ich damals, »weil uns das zur Zielscheibe machen würde. Und so kamen wir in unseren Lieblingskleidern zur Schule, in Rosa- und Lilatönen. Dann hieß es, wir sollten keine fröhlichen Farben tragen, weil die Taliban das auch nicht mögen.«
Als der Stichtag, ab dem Mädchen nicht mehr zur Schule gehen sollten, näher rückte, wandte ich mich an die Öffentlichkeit. Ich erklärte jedem, der es hören wollte, dass eine Ausbildung mein gutes Recht sei. Ich schwor, dass die Taliban mich nicht vom Lernen abhalten würden, wie viele Schulen sie auch immer auflösen mochten. Ich trat sogar im nationalen Fernsehen auf und forderte, dass unsere politischen Führer für uns eintreten sollten. Die Angst, die ich in den letzten beiden Jahren empfunden hatte, war einer unbändigen Empörung gewichen. Ich konnte nicht zulassen, dass diese Männer mir meine Zukunft raubten.
Schließlich startete die pakistanische Armee eine groß angelegte Militäroperation gegen die Extremisten. Meine Eltern, zwei kleine Brüder und ich flohen, wie Tausende andere Menschen, aus Mingora, wo die Kämpfe ihren Anfang nahmen. Nach ein paar Monaten hatte das Militär die Oberhand gewonnen, und wir kehrten nach Hause zurück. Das Leben normalisierte sich wieder. Aber die Taliban waren eben nicht besiegt, und sie hatten nicht vergessen, dass ich mich ihnen widersetzt hatte.
Als ich 15 war, bestieg ein Attentäter meinen Schulbus und fragte: »Wer ist Malala?« Bevor ich ein Wort sagen konnte, schoss er mir aus nächster Nähe in den Kopf.
Innerhalb eines Augenblicks hatte sich mein ganzes Leben verändert.
Eine Woche später erwachte ich aus dem Koma und fand mich in Birmingham wieder, in einem Traumazentrum, das auf komplexe Gehirnverletzungen spezialisiert ist. Vor den Schüssen hatte ich Pakistan noch nie verlassen. Nun war ich plötzlich von lauter Fremden umgeben. Ich verbrachte die nächsten Monate dort, musste mehrere Operationen über mich ergehen lassen. Und ich musste von Neuem Gehen und Sprechen lernen.
Als meine Geschichte dann um die Welt ging, beschrieben die Leute eine Person, die ich nicht wiedererkannte – ein ernsthaftes, schüchternes Mädchen, ein Mauerblümchen, das sich empörte, als die Taliban ihr die Bücher wegnahmen. Man machte mich zu einer mythischen Heldin, die – tugendhaft und pflichtbewusst – zu Großem ausersehen war.
Manchmal musste ich darüber lachen, so absurd war all das. Als Kind in Mingora hatte ich ständig für Wirbel gesorgt. In der Schule erzählte ich in der einen Mädchenclique das Getratsch weiter, das ich in der anderen aufgeschnappt hatte. Ich riss Witze, über die meine Freundinnen zwar lachten, mir aber gleichzeitig deswegen Vorhaltungen machten. Wenn eine Klassenkameradin bei einer Prüfung besser abschnitt als ich, vergoss ich vollkommen würdelos bittere Tränen, weil ich das für ungerecht hielt. Zu Hause war ich unordentlich und ein Wildfang. Ich guckte die Sendungen mit John Cena – meinem Lieblings-Wrestler – und probierte seine Griffe an meinen jüngeren Brüdern aus. Wenn sie aber zur Gegenwehr ansetzten, lief ich heulend zu meinem Vater. Selbst an meinen vorbildlichsten Tagen war ich nicht die lammfromme Heilige, als die mich nun alle sehen wollten.
Ich lag noch im Krankenhaus, als die ersten Leute auf mich zukamen und meine Geschichte zu Büchern und Filmen verarbeiten wollten. Die Journalist*innen lieferten sich ein Wettrennen für das erste Interview mit mir. Talentagenturen wollten meine Vertretung übernehmen, obwohl ich noch gar nicht wusste, welche Talente ich besaß. »Warum bist du jetzt gleich wieder berühmt?«, fragte mich mein Bruder Atal. Ich sagte ihm, das wüsste ich auch nicht.
Bevor ich überhaupt begreifen konnte, was da vor sich ging, wurde ich schon in ein mir völlig fremdes, unerbetenes Leben hineingestoßen – ich war in aller Welt unterwegs, um Vorträge zu halten und für Fotos zu posieren. Und ich verbrachte den Großteil meiner Zeit mit Erwachsenen. Bei großen Events trat manchmal jemand von hinten an mich heran, packte mich bei den Schultern, riss mich herum und schrie: »Volle Power, Malala! Mach sie fertig!« Für diese Erwachsenen war ich eine Person des öffentlichen Lebens, ein Produkt, das man vermarktet. Den linkischen Teenager neben sich konnten sie nicht sehen, weil sie nur auf die öffentlich sichtbare Malala vorbereitet waren. In ihrem Umkreis nahm ich mich total zurück und wurde tatsächlich zu dem stillen Mädchen, das ich ihrer Ansicht nach immer schon gewesen war.
Und überall, wo ich war, stellte man mir dieselbe Frage: »Was ist dir von dieser Schießerei in Erinnerung geblieben?« Wenn ich dann sagte, dass ich mich an fast gar nichts erinnerte, schienen sie beinahe enttäuscht, als wäre es unhöflich von mir, mich nicht an meine Angst und meinen Schmerz zu erinnern. Als wäre dasSchlimmste, das mir je passiert ist, der interessanteste Teil meines Lebens. Ich fühlte mich wie einer dieser Schmetterlinge, denen man eine Nadel durch den Körper sticht, um ihn unter staubigem Glas für immer und ewig zu konservieren. Das Mädchen aus Fleisch und Blut, das da vor ihnen stand, war nicht so faszinierend wie das Mädchen im Schulbus, die junge Träumerin, die sterben sollte.
»Denkst du jeden Tag an das, was passiert ist?«
Ich blinzelte und sah die Moderatorin aus dem Frühstücksfernsehen an. Es wäre einfach gewesen, ihr zu sagen, was sie und ihr Publikum hören wollten – dass ich manchmal schreckliche Angst hatte oder dass ich mich von meinen Verletzungen vielleicht nie ganz erholen würde. Warum sollte ich das saubere, tragische Narrativ, das die Menschen offensichtlich so sehr in seinen Bann zog, verkomplizieren?
Aber irgendetwas in mir hatte sich verändert. Ich wollte diese Rolle nicht mehr spielen. Ich war bereit dazu, jung und frei zu sein. Mich auf Abenteuer einzulassen und Fehler zu machen. Ein Leben zu haben, das an anderen Orten stattfand als an Flughäfen und in Konferenzräumen. Die Zukunft stand weit offen und wartete auf mich.
»Ich denke überhaupt nicht mehr daran«, antwortete ich. »Mein Leben geht schließlich weiter.«
2
Am Abend vor meiner Abreise an die Universität in Oxford saß ich auf dem Boden und wünschte, die Tür zu meinem Zimmer ließe sich absperren. Das Schloss war schon bei unserem Einzug kaputt gewesen, und ganz egal, wie oft ich meine Eltern über die Jahre gebeten hatte, es reparieren zu lassen, sie hatten meine Bitte einfach immer überhört. Also langte ich unters Bett, zog meine Schmuggelware, die ich dort versteckt hatte, heraus und stopfte alles so schnell wie möglich in meinen Koffer.
Meine Mutter und ich befanden uns seit dem Sommer in einer Art kaltem Krieg, weil sie begonnen hatte, mir vorzuschreiben, was ich an der Uni anziehen sollte. Das war für uns eine ganz neue Dynamik. Jahrelang hatte sie, bevor ich zu Bett ging, die Sachen an den Schrank gehängt, die ich am nächsten Tag anziehen sollte. Wollte ich selbstständig entscheiden, was ich tragen würde, und erschien am nächsten Morgen zum Frühstück in anderen Sachen, als sie ausgesucht hatte, sagte sie immer: »Glaubst du, Allah mag Töchter, die ihrer Mutter nicht gehorchen?« Es schien mir nicht klug, darauf etwas zu erwidern, daher ging ich zurück in mein Zimmer.
Wo immer ich hinging, bestand meine Mutter darauf, dass ich die traditionelle Tracht der Paschtunen trug, jener ethnischen Gruppe, zu der meine Familie gehört. Das hieß, es gab nur ein Outfit – den Shalwar Kamiz. Eine weite Hose, eine zeltartige Tunika und einen Kopfschal. In unserer zutiefst konservativen Kultur muss die Kleidung einer Frau jedes Stückchen Haut oberhalb der Knöchel bedecken. Diese Art Gewand hat keinerlei Fasson, damit sich die weiblichen Konturen nicht abzeichnen können.
Und meine Mutter sammelte den ganzen Sommer über ihre »College Collection« von Shalwar Kamiz für mich. Da war zum Beispiel eine leuchtend pinkfarbene Hose mit Paisleymuster und dazu ein Oberteil mit passenden Bommeln an den Ärmeln. Und ein limettengrünes mit schweren silbernen Perlen. Auffällige Blumenmuster, bei denen einem schwindlig wurde, falls man länger hinschaute. Schwarz, Elfenbeinfarben oder Braun kamen nicht infrage, denn nach Meinung meiner Mutter waren neutrale Farben verschwendeter Stoff.
Ich kann nicht sagen, dass ich damals einen ausgeprägten eigenen Stil gehabt hätte. Aber ich wusste, dass ich nie im Leben mit grell neonfarbenen Klamotten nach Oxford gehen würde. Während meine Mutter also beim Shoppen war, googelte ich »Was trägt man 2017 an der Uni?«. Dann bestellte ich, was ich auf den Bildern sah: Jeans, gestreifte T-Shirts und eine gesteppte Bomberjacke. Die Suche nach »Selena Gomez casual« führte mich zu Oversize-Cardigans und Adidas-Superstar-Sneakern. Voluminöse Strickschals, bedruckte Sweatshirts, ein schwarzes Kleid mit Glockenärmeln und mehrere Paar Ankle-Boots wurden alle sicher versteckt und warteten auf ihr Debüt.
Ich stopfte all meine Neuerwerbungen in den Koffer und legte ein paar Kamiz darüber, falls meine Mutter eine Last-Minute-Inspektion vorhaben sollte. Ich wusste, dass sie früher oder später meinen neuen Look entdecken würde und darüber gar nicht erbaut wäre. Aber dieses Risiko war ich bereit einzugehen.
Für mich waren das nicht nur irgendwelche Outfits – es handelte sich vielmehr um Tarnkleidung. Die Malala, die jeder kannte, die auf der Bühne stand, Autogramme gab und Staatsführern die Hände schüttelte – diese Malala trug Shalwar Kamiz. In Oxford aber wollte ich mich anpassen, wollte einfach nur eine Studentin in Jeans und Sneakern sein. Ich wollte sicherstellen, dass meine Zeit an der Uni nicht genauso ablief wie die Highschool.
Als ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde und in die neunte Klasse einer Mädchenschule in Birmingham kam, nahm ich an, dass ich bald Freundinnen haben würde, die Birmingham-Version meiner Klassenkameradinnen in Mingora. Ich stellte mir vor, wie wir jeden Nachmittag nach Hause bummeln würden, Arm in Arm und über unsere Insiderwitze lachend. Ich nahm an, dass die Mädchen mich schleunigst in den Schultratsch einweihen und mir sagen würden, mit welchen Lehrer*innen man reden konnte und welche streng waren.
Aber die Dinge liefen nicht so, wie ich mir das gedacht hatte. Die meisten Mädchen in meiner neuen Schule kannten sich seit dem Kindergarten und hatten schon vor Jahren kleine Gruppen von zwei oder drei Mädchen gebildet. Sie waren nicht etwa unfreundlich, aber sie hießen mich eben auch nicht willkommen. Beim Mittagessen nahm ich mein Tablett und setzte mich auf den nächsten freien Platz, wobei ich mich nach netten Gesichtern umsah. Wenn niemand mit mir redete, nahm ich mir ein Buch und tat so, als würde ich lesen.
Eines Tages nahm ich all meinen Mut zusammen und stellte den anderen Mädchen eine Frage. Ich beugte mich über den Tisch, zeigte auf meinen Teller und sagte: »Entschuldigt, aber könnt ihr mir sagen, was fish fingers sind?« Die Mädchen sahen verdutzt auf – eine von ihnen sagte: »Na, das ist eben Fisch, was sonst?« Und dann nahmen sie das Gespräch untereinander wieder auf.
Wenn jemand in der Klasse einen Witz erzählte, lachte ich zusammen mit den anderen Mädchen und tat so, als hätte ich ihn verstanden. Dabei verstand ich die ganzen Bezüge überhaupt nicht. In Mingora hatte fast niemand Internet. Wir bekamen immer nur ein fernes Echo der amerikanischen oder britischen Popkultur mit, aber auch nur, wenn es laut genug war, dass es um die Welt ging und schließlich in unserem Tal landete – der Film Titanic, das World Wrestling Entertainment und Taylor Swift. Das wenige, was ich über das Leben in England wusste, stammte aus der Lektüre eines Jane-Austen-Romans. Nach meinem ersten Schultag wurde mir klar, dass das Buch nicht wirklich up to date war.
Manchmal tauchten vor dem Schultor Fotografen auf, die versuchten, von mir einen Schnappschuss zu machen. Ich hasste das und hatte Angst, dass die anderen Mädchen denken könnten, ich sei eingebildet oder falsch. Dabei war es allen egal, dass ich berühmt war. Das zeigte sich schnell recht deutlich, denn ich war einfach nicht cool. Wir alle trugen Uniform, aber der Saum meines Faltenrocks reichte eben bis zu meinen Knöcheln. Der Rock war doppelt so lang wie üblich. Darüber hinaus bestand meine Mutter darauf, dass ich blickdichte schwarze Strumpfhosen trug, selbst im Frühling. Nur damit ja kein Stückchen Bein zu sehen war.
Meine Verletzungen verschlimmerten die Lage noch. Ich war 15 Jahre alt und trug ein Hörgerät. Die Kugel hatte mein linkes Trommelfell zerstört und meinen Gesichtsnerv getroffen, sodass eine Seite meines Gesichts gelähmt war. Ich konnte nicht mehr lächeln. Alles, was ich meinen neuen Klassenkameradinnen zu bieten hatte, war eine unsichere Grimasse. Trotz der Monate, in denen ich das Gehen neu erlernt hatte, bewegte ich mich nur langsam durch die lebhafte Menge der Teenager – ein hoffnungsfroher kleiner Geist, der versuchte, das Land der Lebenden zu erreichen.
»Du bist ja schließlich nicht hier, um Freundschaften zu schließen«, sagte ich mir, nachdem ich das wochenlang vergeblich versucht hatte. »Die Schule ist dazu da, dass du gute Noten bekommst und an die Uni gehen kannst.« Dann sah ich die Anzahl der Punkte, die ich bei den ersten Prüfungen erzielt hatte: 41 Prozent in Englisch, 57 Prozent in Biologie, 63 Prozent in Geografie. Ich war immer eine Top-Schülerin gewesen. Diese Resultate fand ich erschreckend und peinlich.
Die Lehrer*innen in Pakistan legen größten Wert aufs Auswendiglernen. Man musste die zugrunde liegenden Konzepte nicht verstanden haben, solange man wie ein Papagei das Schulbuch hersagen konnte. In meiner neuen Schule wurde kritisches Denken und Analysieren erwartet. Diese Art zu lernen kannte ich nicht. Eine ganze Zeit lang hatte ich nur in Algebra gute Noten, denn die Mathematik schien überall auf der Welt dieselben Antworten zu haben.
Da ich meine schulischen Leistungen unbedingt verbessern wollte, lernte ich jede Nacht viele Stunden lang. Ich las die Bücher, die meine Lehrer uns zur Lektüre aufgaben, und noch vieles mehr, was ich mir selbst zur Pflichtlektüre machte. Wenn ich auf ein Wort stieß, das ich nicht verstand, schlug ich es nach und schrieb die Definition auf ein Post-it-Zettelchen. Bald waren die Wände meines Schlafzimmers voller solcher gelber Quadrate, die in meiner schnörkeligen Handschrift erklärten, was ein »Fassadenkletterer« war, eine »Dämmerung« und ein »versonnener Mensch«.
Meine Noten wurden auf diese Weise ständig besser, meine sozialen Kontakte aber nicht. Ich sah tagsüber häufig auf die Uhr. Wenn ich morgens in die Schule ging, war es in Mingora 12 Uhr mittags. Meine alten Freundinnen saßen nun beim Essen und legten ihre paar Rupien zusammen, um sich Samosas und Mangosaft zu kaufen. Ein paar Stunden später, während ich in der Cafeteria kalte Erbsen über den Teller auf meinem Tablett schob, saßen sie vor dem Fernseher und schauten die neuesten Folgen von Shararat, einem indischen Spin-off von Sabrina – Total verhext!. Vielleicht scheuten die Mädchen in Birmingham auch vor meinem ewig abwesenden Blick zurück, denn ich war in Gedanken immer woanders.
Alle paar Wochen rief ich meine beste Freundin Moniba an und horchte sie über die neuesten Nachrichten und den jüngsten Klatsch aus. »Welcher Bollywood-Song wird momentan im Bus geträllert? Wer hat Ärger in der Schule? Was treiben denn die älteren Mädchen?« Ich wiederholte meine besten Imitationen unserer Mittelschul-Lehrer, nur um sie lachen zu hören.
Aber sie wusste immer sofort im Voraus, wenn etwas nicht stimmte. »Warum erzählst du denn nie von dir selbst?«, wollte sie wissen.
»Pfft, weil alles an meiner Schule einfach langweilig ist«, jammerte ich. »Glaub mir, du würdest am Telefon einschlafen.« Sie sollte nicht mitbekommen, dass ich nicht mehr das fröhlich plaudernde Mädchen war, das sie kannte.
Nach sechs einsamen Monaten beschloss ich, etwas zu unternehmen und alles zu versuchen, um meinem Leben einen Neustart zu verpassen.
Beim Sportfest trug ich mich für den 50-Yard-Lauf ein und kam als Letzte ans Ziel. Ich ließ mich für die Schülervertretung aufstellen und verlor die Wahl. Wenn die beliebten Mädchen einen Flashmob vorschlugen, machte ich, was sie sagten. Ich stand auf meinem Tisch und klatschte einen falschen Takt zu einem Song, den ich noch nie gehört hatte.
Es war alles wirklich genauso peinlich, wie es sich anhört.
Irgendwann hatte ich endlich eine Freundin. Alice hatte sich mit ihrer besten Freundin gestritten, und ich war zur Stelle, um in die Bresche zu springen. Ich klammerte mich an sie in den Fluren und am Mittagstisch, flüsterte ihr Fragen ins Ohr, wenn ich dem Gespräch der anderen Mädchen nicht folgen konnte. Manchmal kam sie zum Abendessen zu uns. Sie stand auf die Pakoras meiner Mutter, und ich genoss es, mich für ein oder zwei Stunden ganz normal zu fühlen. Wenn Alice auf Partys ging, zu denen ich entweder nicht eingeladen war oder nicht gehen durfte, schickte sie mir Fotos, damit ich mich nicht ausgeschlossen fühlte.
So dankbar ich für Alice war, so sehnte ich mich doch danach, wieder zu einer Gruppe von Mädchen zu gehören, von Menschen umgeben zu sein, die mich verstanden und meine Erinnerungen teilten.
Meine Freundinnen aus der Kindheit hatten mich auf eine Weise geprägt, die ich Alice oder anderen Menschen nicht erklären konnte. In der Grundschule standen wir gemeinsam ein schweres Erdbeben durch. Wir klammerten uns im Klassenzimmer aneinander, während der Raum zu tanzen anfing und der Boden unter uns aufbrach. Ein paar Jahre später schwoll der Fluss so sehr an, dass er unser Klassenzimmer überschwemmte. Als das Hochwasser wieder abfloss, war alles gut einen Meter hoch mit Schlamm bedeckt. Der Gestank war furchtbar, aber wir säuberten gemeinsam Böden und Wände.
Die Schule war unsere Welt, der Ort, an dem wir ganz wir selbst und zusammen sein konnten. Wir haben uns gerne um sie gekümmert. Am letzten Tag vor dem Schulverbot der Taliban blieben wir nach dem letzten Läuten noch ganz lange im Hof der Schule und spielten Versteinern oder sangen gemeinsam Lieder. Als dann die Lehrer sagten, dass wir jetzt gehen müssten, umarmten wir uns und weinten. Welche Katastrophen oder Gefahren uns auch drohten, ich fühlte mich immer sicher, wenn wir zusammen waren.
Als das Militär die Taliban vertrieben hatte und wir zurück in die Schule durften, waren wir euphorisch und kamen uns unbesiegbar vor. Bei einem Schulausflug in die Berge standen Moniba und ich unter einem Wasserfall und sangen aus voller Kehle »Love Story«. Später im Jahr reiste unsere Klasse in die Hauptstadt Islamabad. Wir sahen uns ein Theaterstück an, aßen in einem chinesischen Restaurant mit Ente gefüllte Pfannkuchen und sahen mit großen Augen den Frauen nach, die ohne Kopfschal durch die Straßen flanierten. Es war unsere erste Begegnung mit der Welt außerhalb unserer abgelegenen Berge, und wir kamen heim voller wilder Träume für die Zukunft.
Ich dachte, wir würden miteinander an die Uni gehen. Mit 15 hatte ich mich damit noch nicht intensiv beschäftigt, aber ich konnte mir ein Leben ohne meine Freundinnen gar nicht vorstellen. Und nun sollte ich ganz allein nach Oxford, mit einem Koffer voll trendiger Outfits und Träumen von einem weniger einsamen Leben.
3
Am ersten Tag der Orientierungswoche wachte ich auf und ließ meinen Blick über mein schäbiges Reich wandern. Der ausgefranste Teppich, der im Zimmer lag, trug Brandmale, hinterlassen von früheren Studierenden, die darauf ihre Sachen gebügelt hatten. Ein kränkliches Gelb überzog die Wände und blätterte stellenweise ab. Das Waschbecken im zugehörigen Badezimmer war nicht größer als eine Suppenschüssel. Aber all das war mein – ein Ort, an dem niemand mir vorschreiben konnte, wann ich zu Bett gehen oder was ich essen sollte. Ich hatte mich sofort in mein Zimmer verliebt.
Ich griff nach meinem Handy und scrollte durch Instagram, wo andere Studierende bereits ihren morgendlichen Lauf, das Frühstück im Speisesaal oder Bilder von der Buchhandlung gepostet hatten. Da ich nichts verpassen wollte, hüpfte ich aus dem Bett, zog mich an und war schon halb den Flur hinunter, als eine Stimme hinter mir rief: »Warten Sie bitte auf uns!«
»Tut mir leid, Leute«, sagte ich, drehte mich um und marschierte zurück. In dem Zimmer neben mir waren zwei Polizeibeamte der Metropolitan Police untergebracht. Sie gehörten zur Specialist-Protection-Einheit, deren Aufgabe der Schutz von bekannten Persönlichkeiten ist. Als ich nach Großbritannien gekommen war, hatte mich die Regierung informiert, dass mein Leben bedroht sei, und mir Schutz angeboten. Ich war Tausende Kilometer von Pakistan entfernt, aber mein Leben war immer noch in Gefahr, da die Taliban regelmäßig ihren Schwur erneuerten, mich zu töten. Seitdem waren Sicherheitsleute Teil meines Alltags: Sie begleiteten mich zur Schule, holten mich am Ende des Tages ab und bewachten nachts das Haus meiner Eltern.
Einige Wochen bevor ich nach Oxford ging, unterrichteten mich die Polizisten von ihrem Plan. Sie würden nachts in einem Zimmer neben meinem Wache halten und mich in die Seminarräume begleiten. Jeden Weg, den ich nicht fußläufig bewältigen konnte, würde ich in einem kugelsicheren Auto zurücklegen. Wenn ich zu einem Abendessen oder einer Party eingeladen war, würden mich ein paar Herren in mittleren Jahren mit Blazer und Ohrstöpseln begleiten.
»Genau das, was sich jede Studentin wünscht«, dachte ich mir. Ich war dankbar für den Schutz und verstand auch, dass er nötig war, aber ich hoffte so sehr, dass das keine Hürden zwischen mir und den anderen Studierenden schaffen würde.
Mit den Sicherheitsleuten im Schlepptau begab ich mich zum Registrierungszentrum, um meine erste Aufgabe für diesen Tag zu erledigen: ein Foto für meinen Oxforder Studentenausweis zu machen. »Lächle, schau den anderen in die Augen, zeig dich zugänglich!« Seit meiner Ankunft am Tag davor hatte ich mit einigen Studierenden auf meinem Korridor Grüße ausgetauscht, aber ich hatte noch mit niemandem geredet. Jetzt war es an der Zeit, Ernst zu machen mit meinem Wunsch, Menschen kennenzulernen. »Alle haben heute ihren ersten Tag. Es ist nicht wie in der Highschool. Ich muss nicht warten, bis mich jemand anspricht.«
Nachdem ich mir einen Plan des Universitätsgeländes besorgt und meinen Stundenplan abgeholt hatte, entdeckte ich ein anderes Mädchen, das ganz allein herumstand, und ging auf sie zu. Sie war ungefähr so groß wie ich und hatte erdbeerblondes Haar. Sie trug eine Schildpattbrille und lächelte freundlich.
»Hallo, ich bin Malala«, sagte ich und tat mein Bestes, um nett, aber lässig zu klingen.
Das Mädchen machte einen Schritt zurück und sagte kein Wort. »Nicht schon wieder!«, dachte ich.
»Entschuldige! Mein Gehirn hat gerade ausgesetzt«, sprudelte sie hervor. »Ich bin Cora. Schön, dich kennenzulernen.«
»Was studierst du denn, Cora?«
»PPE.«
»Ich auch.« Ich strahlte, hatte ich doch gleich beim ersten Mal jemanden kennengelernt, der dasselbe Hauptfach hatte – Politik, Philosophie und Economics.
Cora und ich gingen gemeinsam zur Freshers’ Fair, einem beinahe karnevalesken Event, bei dem uns Erstsemestern alle möglichen in Oxford angebotenen Freizeitaktivitäten präsentiert wurden. Die riesige Examination Hall bot Platz für Hunderte Stände, an denen engagierte ältere Studenten den Neuen mit den großen Augen ihre Clubs vorstellten. Wir ließen uns von der Menge mittragen und wussten nicht recht, wo wir anfangen sollten.
»Spielst du ein Instrument?«, fragte Cora, als wir an den Ständen für Heavy-Metal-Fans, Liebhaber irischer Folkmusik und eines Jazz-Ensembles namens The Oxford Gargoyles vorbeischlenderten.
»Nein«, antwortete ich. »Ich singe zwar gerne, aber ich würde vor Panik erstarren, wenn ich das vor anderen Leuten machen müsste.«
Wir bogen um die Ecke und standen vor einem Jungen in einem T-Shirt mit dem Aufdruck »Oxford Cheese«. Er bot den Leuten einzelne Häppchen Brie und Gruyère an. »Ein Käseverkostungsclub? So was machen die Leute?«
Cora lachte. »Na ja, eher die vornehmen. Ich stelle mir einen schönen Abend zwar anders vor, aber wenn es ihnen Spaß macht.«
Bei den Ständen der Sportangebote schrieb ich mich gleich für Cricket und Badminton ein, denn diese Spiele hatte ich auf Straßen und Dächern von Mingora oft gespielt. Dann meldete ich mich aus einer Laune heraus auch beim Ruderclub an. Auf dem Weg hierher hatte ich Studierende in kleinen hölzernen Booten gesehen, die auf dem Fluss, der durch die Stadt lief, trieben. Mir schien das eine wunderbar verträumte Art, einen Nachmittag zu verbringen.
Die Frauen von der Islamic Society nannten mich »Sister« und luden mich für einen späteren Wochentag zu Mocktails ein. Dann sah ich mich bei der Christian Union und der Hindu Society um, in der Hoffnung, mehr über die Glaubensformen der religiösen Minderheiten in Pakistan zu erfahren. Ich hatte irgendwo aufgeschnappt, dass die Christen einem Backwaren ins Wohnheim brachten und die Hindus die besten Partys veranstalteten.
Wir hatten noch keine Stunde auf der Erstsemestermesse verbracht, und schon trug ich in meiner geschenkten Tragetasche einen ganzen Packen von Mitgliederbroschüren, Prospekten und Kugelschreibern mit mir herum. Ich hinterließ bei allem, was mich einigermaßen ansprach, meine Kontaktdaten und entrichtete den Mitgliedsbeitrag – ein philosophischer Lektürezirkel, der Filmclub und die Gruppen, die Pakistan und Südostasien vertraten.
Cora hingegen hatte sich nur bei zwei Organisationen angemeldet – bei der Conservative Association und beim Pub-Quiz-Team. »Ich will schon auch Leute kennenlernen«, erklärte sie. »Ich bin bloß nicht besonders sportlich oder musikalisch. Und was immer Speed-Cubing ist, es interessiert mich einfach nicht.«
Wir waren uns einig, dass es wichtig war, sich bei der Oxford Union anzumelden, dem ältesten Debattierclub der Welt. Als Mitglied war man zu den Veranstaltungen zugelassen, bei denen bekannte Politiker*innen, Schriftsteller*innen und Künstler*innen über Themen diskutierten wie: »Celebritys zerstören die Frauenbewegung«, oder: »Demokratien sollten keine Allianzen mit autoritären Regimen eingehen«. Man hatte sogar Zutritt zur geheimen Bibliothek der Union.
Die Schlange zog sich durch den ganzen Flur. Der war so voll, dass man den Stand am Ende fast nicht sehen konnte. Als Cora und ich endlich näher kamen, wurde ein Transparent sichtbar, das die berühmtesten Sprecher*innen der Union zeigte. Ich musterte jedes Gesicht: Albert Einstein, Malcolm X, Queen Elizabeth II., Ronald Reagan und … ich.
»Oh, nein!« Mir drehte sich der Magen um. Ich hatte meinen ersten Besuch bei der Oxford Union vor vier Jahren ganz vergessen. Worüber ich damals gesprochen hatte, wusste ich auch nicht mehr. Ich konnte mich nur an die Gesichter der Studierenden erinnern und daran, dass ich mir so sehr gewünscht hatte, einmal selbst dort unten zu sitzen und nicht auf dem Podium zu stehen. Nun war es so weit, und ich kämpfte gegen den Wunsch an, davonzulaufen. Wie sollte ich je eine normale Studentin werden, wenn mein Teeniegesicht auf der Freshers’ Fair präsentiert wurde? Wenn Cora bemerkt hatte, dass mein Gesicht rot anlief, ließ sie sich das nicht anmerken. Aber ich war sicher, dass sie das Transparent auch gesehen hatte. Ich hielt den Kopf gesenkt, während ich meine Anmeldekarte ausfüllte, und vermied jeden Augenkontakt mit meinem jüngeren Selbst.
Als wir uns umdrehten, um zu gehen, sah ich in der Ecke eine Gruppe Mädchen, die mich anstarrten und untereinander flüsterten. Eine von ihnen kam herüber: »Dürfen wir Selfies mit dir machen?«, fragte sie.
Ich war entsetzt, aber Nein zu sagen, hätte unhöflich gewirkt. Also lächelte ich und sagte Ja.
Sobald das erste Telefon klick machte, merkte ich, dass das ein Fehler war. Andere Studierende hatten es bemerkt, und schon formierte sich eine Schlange. Als sie Cora ihre Telefone in die Hand drückten, um Gruppenfotos zu machen, tat mir das Herz weh. Ich war sicher, dass dies unser erster und letzter gemeinsamer Ausflug sein würde. Warum sollte sie meine Freundin sein wollen, wenn andere Studierende sie beiseiteschoben, um an mich heranzukommen?
Aber Cora lächelte nur, während die Schlange immer länger wurde. »Vielleicht sollte ich mich für den Fotoclub anmelden?«, witzelte sie, als sie dem letzten Selfie-Begeisterten das Telefon zurückgab.
»Es tut mir so leid«, sagte ich und meinte es auch so. Ich wollte nicht, dass Cora dachte, ich sei eine Art Diva, jemand, der erwartet, dass seine Freund*innen im Schatten bleiben, während er sich selbst ins Scheinwerferlicht drängt.
»Ach, das ist schon in Ordnung«, sagte sie. »Aber für dich ist es wahrscheinlich komisch, oder? Wenn Menschen so über dich herfallen?«
Ich lächelte überrascht – es kam selten vor, dass jemand die merkwürdigen Umstände meines Lebens begriff. »Nun, ich bin daran gewöhnt«, antwortete ich. »Aber ich möchte nicht, dass die Leute an der Uni mich anders behandeln. Ich möchte einfach dazugehören, eine ganz normale Studentin sein, weißt du?«
»Ja, natürlich. Aber ich muss dir sagen … als meine Mutter in der Zeitung las, dass du auch PPE studieren und in meinem Jahrgang sein würdest, war sie echt nervig. Sie meinte, ich sollte alles über dich lesen, falls wir uns kennenlernen würden.«
»Ach …« Ich hielt kurz inne. »Und? Hast du?«
»Nein. Ich sagte ihr, es sei doch komisch, an die Uni zu gehen und alles über dich zu wissen. Als wäre ich eine Stalkerin«, meinte Cora und verdrehte die Augen. »Ich dachte, wenn wir miteinander auskommen, könnte ich dich ja selbst fragen.«
Aber Cora fragte mich nie nach den Schüssen oder den Taliban, nach den Prominenten, die ich kennenlernte, oder nach dem Berühmtsein. In unseren ersten Tagen, die wir miteinander auf dem Campus verbrachten, sprachen wir über das Essen in der Mensa, über ihr früheres Leben in Wales, über die Tatsache, dass wir beide kleine Brüder hatten, über die Musik, die wir mochten, oder darüber, ob wir in Oxford mittlerweile andere nette Leute kennengelernt hatten. Manchmal saßen wir nur in meinem Zimmer, scrollten durch die sozialen Medien und sagten gar nichts. Je mehr Zeit ich mit ihr verbrachte, umso entspannter wurde ich.
Meine Gewohnheit, ganz genau darauf zu achten, was ich sagte – geprägt durch Jahre auf Podien und vor der Kamera –, fiel in ihrer Gegenwart mehr und mehr von mir ab. Verglichen mit Cora, schien ich Jahre hinterherzuhinken, denn sie hatte – wie die meisten Studenten –, als sie nach Oxford kam, die ersten Erfahrungen mit Hangover und gebrochenem Herzen bereits hinter sich. Aber sie machte sich nicht über meine Begeisterung für jede Einzelheit des Uni-Lebens lustig, von dem himmlischen Gefühl, einen eigenen Briefkasten zu haben, bis hin zu meiner Verblüffung über die Jungs, die mit nacktem Oberkörper im Park an uns vorbeispurteten. Was immer ich ausprobieren wollte, sie war dabei und bereit, meine Wingwoman zu sein. Irgendwann schleppte ich sie sogar in den Koran-Club mit.
Aber sosehr ich die Aktivitäten am Campus auch genoss, es war mir ebenso wichtig, lange Spaziergänge zu machen oder einfach nur ruhig mit meiner neuen Freundin herumzusitzen. In jenen ersten Tagen gab Cora mir, was ich am meisten brauchte – eine leere Seite, auf der ich ebenjene Geschichte hinterlassen konnte, die ich selbst aussuchen würde.
4
Am Freitag der Orientierungswoche stolperte ich in ein kleines, rechteckiges Büro zwei Stockwerke über der Mensa. »Tut mir leid, ich habe mich verlaufen«, stotterte ich. Zu meinem ersten Termin mit meiner Studienberaterin – der Professorin, die in den kommenden drei Jahren meine Fortschritte überprüfen sollte – fast eine halbe Stunde zu spät zu kommen, war nicht, was ich geplant hatte.
Lara hatte kurzes braunes Haar und trug ein einfaches marineblaues Kleid und kein Make-up. Ich schätzte sie auf etwa Mitte 30. »Dieser erste Termin ist dazu gedacht, dass Sie Ihren Weg finden«, sagte sie und deutete mit der Hand auf einen Stuhl.
Ich hatte den Verdacht, dass es weit mehr als ein Beratungsgespräch brauchen würde, um mich in dieser neuen Welt zurechtzufinden.
Die Universität Oxford, das sind 39 verschiedene Colleges – jedes mit eigener Geschichte, eigenem Charakter und eigenem Campus. Alle 39 aber stehen unter dem Zeichen nur einer Universität. Ich studierte an der Lady Margaret Hall, auch bekannt als LMH. Dieses College lag in einer ruhigen Ecke der Stadt, auf einem etwa fünf Hektar großen Grundstück, das hauptsächlich aus dem Flussufer, aus Wald und Gärten bestand. Ich hatte eine Woche Zeit gehabt, um mich an der LMH zurechtzufinden, und nahm immer noch regelmäßig den falschen Weg, wenn ich allein unterwegs war.
In der uns verbleibenden halben Stunde machte Lara mich mit den akademischen Anforderungen bekannt, die in Oxford gestellt wurden. PPE war ein auf drei Jahre angelegter Studiengang. Ein Studienjahr ist in Oxford in drei achtwöchige »Terms« gegliedert. Es beginnt im Oktober und endet im Juni. Zu Weihnachten und Ostern haben die Erstsemester jeweils fünf Wochen Ferien, wobei man allerdings erwartet, dass sie 20 Stunden pro Ferienwoche ihrem Studium widmen.
»Oxford unterscheidet sich massiv von der Highschool oder dem Collegeleben, wie man es aus amerikanischen Filmen kennt«, erklärte mir Lara. »Hier lernen wir in einzelnen Kursen, nicht in einer Klasse. Und wir erwarten, dass die Studierenden ihren Lernprozess selbst gestalten.«
Lara meinte, ich würde zwei Kurse pro Term belegen. Und meine wöchentliche Vorbereitung für jeden Kurs würde aussehen wie folgt: drei oder vier Bücher lesen, plus diverse wissenschaftliche Aufsätze und Fallstudien; zu einem mir zugeteilten Thema einen Essay von mindestens 2000 Wörtern schreiben; für das Fach Wirtschaft (Economics) musste ich pro Woche ein mathematisches Problem lösen und einen Mini-Essay verfassen. Außerdem würde ich jede Woche ein Tutorial bei meiner Professorin sowie eines mit ein oder zwei anderen Studierenden meines Kurses besuchen.
»In den Tutorials sollen Sie zeigen, was Sie in dieser Woche gelernt haben«, fügte Lara hinzu. »Sie müssen fähig sein, an einer fundierten Diskussion zum Thema teilzunehmen und Ihre Ideen aus dem Essay zu verteidigen. Sehen Sie es als Lernen durch Verhör.« Ich nickte energisch, als könnte ich es gar nicht erwarten, zu meinen intellektuellen »Straftaten« befragt zu werden.
»Außerdem haben Sie noch die Möglichkeit, Vorlesungen zu Ihrem Fach zu besuchen«, fuhr Lara fort. »Diese stehen allen Studierenden Ihres Fachbereichs offen, aus jedem College in Oxford. Das wird zwar nicht verlangt, aber nachdrücklich empfohlen.«
Lara informierte mich, dass man als Undergraduate am Ende des ersten und des dritten Jahres eine Prüfung ablegen müsse. Die Examina nach dem ersten Jahr oder prelims, wie sie auch genannt werden, entscheiden darüber, ob man weiter studieren darf. Die Schlussexamina entscheiden über die Abschlussnote. Prelims, Essays und Tutorials fließen nicht in das Endergebnis ein. Wer die Prüfungen am Ende nicht besteht, verlässt die Universität ohne einen Abschluss.
»Die Studierenden dürfen während der Terms keine Jobs annehmen«, meinte Lara weiterhin. »Sie müssen auf dem Campus anwesend sein und alle Tutorials absolvieren.« Dann faltete sie ihre Hände und musterte mich mit besorgtem Blick. »Ich weiß, dass auch andere Angelegenheiten Ihre Zeit erfordern, Malala. Aber ich hoffe, dass Sie sich den Raum nehmen, den Sie brauchen, um in Oxford Erfolg zu haben.«
Sie richtete sich auf und legte ihre Hände auf den Tisch. »Nun, jetzt wo wir mit den Basics durch sind: Haben Sie Ihre erste Aufgabe für das Fach Wirtschaftswissenschaft mitgebracht? Ich würde gerne sehen, wie weit Sie zu Studienbeginn mit Ihren mathematischen Fähigkeiten sind.«
Ich hatte das Gefühl, ein elektrischer Schlag würde mich treffen. Mein Nacken fing an zu kribbeln, meine Füße und Achselhöhlen ebenfalls. »Was für eine mathematische Aufgabe?«, dachte ich.
Lara sah meinen Gesichtsausdruck. »Wir haben allen PPE-Studierenden im Juni eine Leseliste geschickt und mathematische Aufgaben, die sie vor Beginn des Studiums lösen sollten. Haben Sie sie nicht bekommen?«
Ich konnte nichts weiter sagen als: »Es tut mir leid.« Ich war während der Sommermonate unterwegs gewesen, hatte Vorträge gehalten und an Konferenzen teilgenommen. Die wenige Zeit, die ich freigehabt hatte, verbrachte ich mit Alice und der Auswahl meiner neuen Collegegarderobe. Dass ich Hausaufgaben hatte, war mir irgendwie entgangen.
»Gut«, sagte sie und loggte sich in ihren Computer ein, um mir die Aufgaben zu schicken. »Machen Sie die Mathe-Aufgaben und stecken Sie die Lösung in den Briefkasten vor meinem Büro. Und vielleicht können Sie ja das Wochenende dazu nutzen, Ihren Lektürerückstand aufzuholen.«
Auf den Stufen vor Laras Büro fing ich an, an meinen Nägeln zu kauen, eine nervöse Gewohnheit, die ich eigentlich in der Highschool längst abgelegt hatte. Die Uni war noch nicht losgegangen, und ich war mit meinen Leistungen schon im Rückstand.
Bevor wir Pakistan verließen, hatte ich höchstens eine Handvoll Bücher gelesen, sieben oder acht vielleicht. Die einzelnen Exemplare meiner kleinen Sammlung waren auf verschlungenen Pfaden zu mir gekommen: Eine kurze Geschichte der Zeit hatte ich von einem Freund meines Vaters bekommen. Touristen in einer benachbarten Pension hatten eine zerlesene Version von Stolz und Vorurteil zurückgelassen. Journalist*innen aus den Vereinigten Staaten und Europa hatten mir Oliver Twist und Sofies Welt geschenkt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wo Moniba und ich an die Exemplare der Twilight-Story gekommen waren, nur dass wir sie zusammen lasen und viele Nachmittage damit zubrachten, uns für Vampire auszugeben. Bevor ich nach England kam, hatte ich noch nie einen Buchladen oder eine öffentliche Bibliothek betreten. Für mich waren Bücher wie Glühwürmchen – ich freute mich, wenn ich unerwartet auf sie stieß. Aber man konnte nicht davon ausgehen, dass man sie jederzeit zu Gesicht bekam.
Mein jüngeres Selbst wäre überwältigt gewesen von der Bibliothek auf dem Campus von Lady Margaret Hall – wohin man sich vom geschäftigen Studierendendasein zurückziehen konnte in eine Fantasiewelt mit mehr als 85000 Bänden. Von innen wirkte sie ein bisschen wie ein altes Schiff. Die Bücherregale zogen sich um die oberen und unteren Stockwerke. Eine lange Fensterreihe oben auf der Galerie ließ das Sonnenlicht hereinströmen. Zwischen den Regalreihen hatten die Architekten Studierplätze eingerichtet, mit fest eingebauten Tischen direkt an den Fenstern, sodass man auf die Gärten und den Fluss hinausschauen kann. Als ich die Bibliothek bei meinem Antrittsbesuch zum ersten Mal sah, stellte ich mir vor, dass ich dort Stunden um Stunden zubringen und so viele Bücher lesen würde wie nur möglich.
Nach meinem Termin mit Lara war ich wild entschlossen, einen der Arbeitsplätze zu erobern und nicht mehr aufzustehen, bis ich meine Hausaufgaben für diesen Sommer erledigt hätte. Ich riss die schwere Holztür auf. Eine geradezu unheimliche Stille schlug mir entgegen. Keine anderen Studierenden, keine Servicemitarbeiter. Nur die gescheckte Bibliothekskatze streckte sich in der Sonne aus. »Stille fördert die Konzentration«, sagte ich mir.
Die ersten Aufgaben waren nicht schwer. Ich war in Mathe immer gut gewesen. Aber weiter unten wurde es langsam schwierig. Ich merkte, dass ich länger brauchen würde, als ich gedacht hatte. Ich legte den Stift weg und ließ meinen Blick nach draußen wandern, wo sich hinter den Bäumen ein wunderbar herbstlicher Sonnenuntergang abzeichnete. Ein paar Freunde gingen über den Rasen und plauderten, als würden sie sich schon ewig kennen. Plötzlich fühlte sich die Bibliothek klaustrophob und luftleer an. »Es ist ja erst Freitag. Ich habe übers Wochenende immer noch genug Zeit«, dachte ich. Ich steckte die Bücher und Papiere in meine Tasche und verließ das Schiff.
5
Also, Club Night! Bist du interessiert?«, fragte Cora mich an jenem Abend.
Und ob ich interessiert war. Nicht, weil ich unbedingt etwas trinken oder mich austoben wollte – ich wollte nur einfach sehen, was da abläuft. In der Highschool gingen ein paar Mädchen am Wochenende immer wieder in Clubs. Und sie schilderten das immer auf die gleiche Weise: »Sooooo crazy!« Als könnte der Rest von uns das nie und nimmer begreifen. Die Club Night war der krönende Abschluss der Orientierungswoche, eine Tanzparty außerhalb vom Campus, an einem Ort namens Emporium. Nach den Leuten, die auf Facebook auf Teilnahme geklickt hatten, würde alle Welt da sein.
Meine Neugier wurde nur noch übertroffen von meiner Angst, dort fotografiert zu werden. Die britische Boulevardpresse und pakistanische Journalisten hatten die LMH die ganze Woche über belagert. Sie machten Fotos von mir, wie ich über den Campus ging, und fragten andere Studierende, ob sie mich kennen würden. Ich machte mir deswegen nicht großartig Gedanken, in der Annahme, dass sie das Interesse verlieren würden, wenn sie sahen, dass ich nur so langweilige Dinge trieb wie in die Bibliothek und die Mensa zu gehen. Doch in einen Nachtclub – das war durchaus eine Schlagzeile wert.
Wenn ich das Cora sagte, würde ich ihr leidtun, und sie würde zu Hause bleiben, um mir Gesellschaft zu leisten. »Ach, ich wünschte, ich könnte. Aber ich habe meiner Studienberaterin versprochen, dass ich diese Mathe-Aufgaben mache«, sagte ich. »Aber morgen musst du mir alles ganz genau erzählen.«
Nachdem ich eine halbe Stunde lang versucht hatte, die Mathe-Hausaufgabe zu lösen, gab ich auf und marschierte hinunter in die Bar der LMH, wo es eine Pizza-Party für alle geben sollte, die nicht an der Club Night teilnahmen. Ich stand in einem leeren Raum und überprüfte als Erstes, ob ich überhaupt richtig war. War ich. Natürlich wusste ich nicht, was ich jetzt anfangen sollte, also setzte ich mich an einen der Tische und zuckte regelmäßig zusammen, wenn ich den Blick meiner Sicherheitsleute kreuzte.
Ich überlegte gerade, ob ich gehen sollte, als eine andere Studentin kam und an meinen Tisch trat. Sie trug einen Denim-Latzrock über einem weißen T-Shirt und dazu Sneaker. Und sie lächelte mich an. Sie sah ein bisschen so aus wie die netten älteren Mädchen, die auf Plakaten für Dinge werben, die Kinder eben nicht gerne machen, wie zum Zahnarzt gehen oder in die Sommerschule.
»Du gehst nicht in den Club?«, fragte sie. Und noch bevor ich antworten konnte, meinte sie: »Ich auch nicht. Ich bin Hen. Eigentlich Henrica, aber das nur für meine Mutter.«
»Hallo, ich bin Malala«, sagte ich und musste fast lachen über ihre Offenherzigkeit.
»Schön, dich kennenzulernen. Spielst du Pool oder magst du eher Trivial Pursuit?« Wir einigten uns auf Scrabble, und während wir die Spielsteine übers Brett schoben, hörte Hen keine Minute auf zu reden – über ihre liebsten YouTuber, warum sie Geschichte im Hauptfach studierte, über den Jungen, dem sie nachmittags begegnet war und der es nicht schaffte, die Waschmaschine einzuschalten. Sie schien nicht einmal richtig Luft zu holen, und ich als bereitwillige Zuhörerin nickte und nickte.
Ich bin im Grunde eine extrovertierte Introvertierte, also jemand, der zwar weiß, wie man sich im sozialen Umfeld verhält, aber lieber nicht die erste Geige spielt. Mit Hen musste ich nicht ein Wort sagen. Das allein katapultierte sie auf der Liste meiner potenziellen Freundinnen ganz nach oben.
»Willst du mit mir auf einen Tee in mein Zimmer kommen?«, fragte ich, als wir genug Pizza verdrückt hatten und das Spiel uns zu langweilen begann.
»Geh vor«, meinte Hen nur.
An jenem Abend unterhielten wir uns stundenlang. Ich erfuhr von ihrem Leben in Simbabwe und wie sie im Alter von sieben Jahren nach England gekommen war. Während der Highschool hatte sie in der Nachtschicht bei McDonald’s gearbeitet, um ihre Familie zu unterstützen. Mir klappte die Kinnlade nach unten, als sie mir ihre Lebensziele auflistete: »Erster Abschluss in Oxford. Einen Master in Harvard. Fernsehmoderatorin werden. Und dann meine eigene Talkshow.« Hen war gerade mal 19, aber ich zweifelte kein bisschen, dass sie ihre Träume verwirklichen würde. Und ich wusste auch, dass es uns bestimmt war, Freundinnen zu werden. Ihre Offenheit und Energie gaben mir das Gefühl, dazuzugehören, ohne dass ich überfordert war. Als könnte ich heraussprudeln, was gerade in meinem Kopf vorging, oder einfach gar nichts sagen, und sie würde mich in beiden Fällen verstehen.
Als ich Cora und Hen miteinander bekannt machte, verstanden die zwei sich auf Anhieb, und so waren wir von nun an ein Trio. Ich verbrachte jede freie Minute mit einer von ihnen oder mit beiden – nicht so, wie ich in der Highschool an Alice gehangen hatte, so als wäre sie mein menschlicher Rettungsring.
An meinen neuen Freundinnen liebte ich einfach alles, was ich über sie erfuhr. Cora spielte beim Lernen Film-Soundtracks auf höchster Lautstärke ab. Hen hatte eine ausgefeilte Abendroutine in 17 Schritten, die auf keinen Fall durchbrochen werden durfte. Sie neckten mich, weil ich auch Lebensmittel aß, die ihr Ablaufdatum überschritten hatten, und weil ich mein Zimmer nur dann sauber machte, wenn meine Mutter zu Besuch kam. Wir liehen einander Sachen zum Anziehen und aßen jeden Abend zusammen. Nachdem ich mein Leben mit meinen Brüdern verbracht hatte, war diese Schwesternschaft für mich Neuland, aber eines, dessen Sprache ich bereits zu kennen schien.
Die Mühelosigkeit, mit der meine ersten beiden Freundschaften hier zustande gekommen waren, ermutigte mich, weitere einzugehen. Eines Morgens, als ich am Fluss spazieren ging, begegnete ich Yasmin. In den ersten Wochen an der Uni hatte ich mir angewöhnt, meine wöchentlichen Essays erst am Abend vor der Abgabe anzufangen. Ich trank Unmengen Tee, um wach zu bleiben und den Termin um 8 Uhr früh einzuhalten. Wenn ich tatsächlich früher fertig wurde, belohnte ich mich mit einem kurzen Abstecher ans Wasser, wo ich im Pyjama den Sonnenuntergang genoss.
An einem dieser Tage saß auf meiner Lieblingsbank schon ein Mädchen im Bademantel. »Hattest du auch eine Essaykrise?«, fragte ich. Yasmin und ich trafen uns von da einmal die Woche an dieser Bank und sahen zu, wie das Licht in der Dämmerung immer stärker wurde und sich in den Strudeln im Wasser brach. Dann holten wir uns in der Mensa ein paar heiße Kartoffelpuffer, bevor jede wieder in ihr Bett ging, um sich auszuschlafen. Wir unterhielten uns viel, und so erfuhr ich, wie sie aufgewachsen war: Sie stammte aus dem Iran, war aber als Teenager vor ihrem gewalttätigen Vater nach England geflohen, wo sie die Highschool besuchte. Sie hatte dieselben Probleme wie alle Flüchtlinge – die Sprachbarriere, die Armut, der ganze Papierkram. Aber sie liebte London mit seinen Indiebands, Nudelshops und Krimiserien. Nun studierte sie englische Literatur und hoffte, eines Tages Schriftstellerin zu werden.
Anisa hingegen studierte Finanzwesen und besuchte mit mir das Tutorial zu einem Kurs in Wirtschaftswissenschaften. Ich hatte mich noch nicht mal vorgestellt, als sie mir schon erklärte, dass ich meinen Tee falsch herum rührte. »Von einer Seite zur anderen, ohne mit dem Löffel an die Tasse zu klirren«, meinte sie. »Wenn du ihn rundherum rührst, spritzt du am Ende nur dein T-Shirt voll.«
Anisas Eltern kamen aus Indien und hatten sie in ein britisches Internat geschickt, sobald sie Polo spielen und Tontaubenschießen konnte. Fast immer, wenn ich sie sah, lachte sie, meist auf Kosten anderer, nicht zuletzt auf meine. Zu der Zeit hatte ich schon fünf Jahre in England gelebt, aber es gab noch so vieles, was ich nicht wusste. Wenn ich Fragen stellte wie: »Was ist denn ein Bagel?«, bezeichnete sie mich als »eindeutig vertrottelt« oder als »absoluten Holzkopf«. Meine Topshop-Jeans waren »geschmacklos« und mein Musikgeschmack »muffig«. Meistens hatte ich keine Ahnung, was sie sagen wollte. Ich wusste nur, dass es nicht nett war.
In der Highschool hatte ich mich von Mädchen wie Anisa einfach ferngehalten. Doch als ich ihre Bekanntschaft machte, hatte ich das Gefühl, ich käme mit der Herausforderung, die eine solche Freundin darstellt, gut klar. Manchmal war ihre natürlich herrische Art auch von Vorteil. Wenn ich am Wochenende faul sein und bis 2 Uhr nachmittags im Bett bleiben wollte, stürmte sie in mein Zimmer und sagte: »Steh auf, wir ziehen in zehn Minuten los.« Unsere Ausflüge plante sie bis ins kleinste Detail: Brunch im Jericho Café, Stöbern an den Ständen in der Markthalle, Besuch der Colleges, die wir noch nicht kannten. Und ich war zufrieden damit, einfach ihren Anweisungen zu folgen.