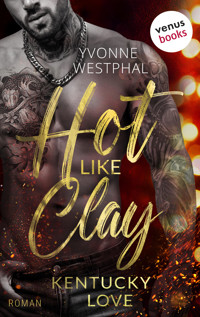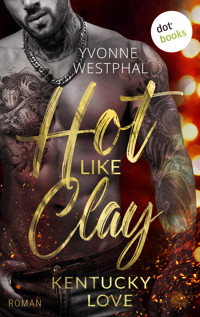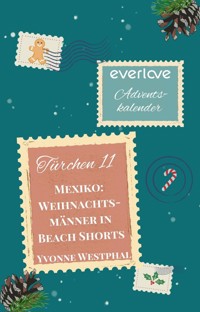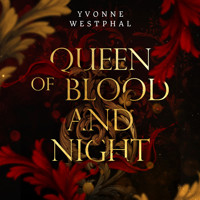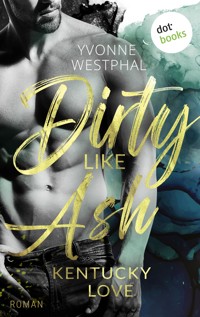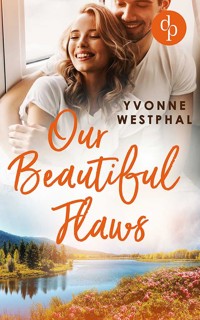4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper Gefühlvoll
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
GÜNSTIGER EINFÜHRUNGSPREIS. NUR FÜR KURZE ZEIT!
Sie ist privilegiert und beliebt. Er ist ein Einzelgänger und mysteriöser Bad Boy – kann ihre Liebe den Widerständen trotzen und auch ein dunkles Geheimnis überstehen? Slowburn-Romance für Fans der Erfolgsserie »Riverdale« und der Bestsellerautorin Colleen Hoover
»Wenn sich niemand mehr traut zu flüstern, muss deine Stimme lauter sein als deine Ängste.«
Das behütete Leben der Cheerleaderin Rebecca findet ein jähes Ende, als ihre Familie im letzten Schuljahr in die Kleinstadt Whitevale Creek ziehen muss. Dort stößt sie an allen Ecken auf Ablehnung, falsche Freunde und schreckliche Gerüchte, die sich um den finsteren und zugleich anziehenden Einzelgänger Tristan ranken. Je näher sich die beiden kommen und je dichter die Mauer aus Schweigen und Geheimnissen wird, desto fester ist Rebecca entschlossen, alle Masken der Stadt einzureißen – auch die von Tristan. Rebecca ahnt nicht, dass die Wahrheit nicht nur Tristan endgültig in den Abgrund stoßen könnte, sondern ihr selbst den Boden unter den Füßen wegreißen würde …
»Ein wunderbares Mut-Mach-Buch. Von mir eine absolute Lese-Empfehlung!« ((Leserstimme auf Netgalley))
»Diese Reise war emotional, spannend, mysteriös und romantisch.« ((Leserstimme auf Netgalley))
»Toller Schreibstil und tolle Geschichte - ich bin richtig abgetaucht nach Whitevale Creek und mochte es auch gar nicht mehr verlassen.« ((Leserstimme auf Netgalley))
»Fire our Souls ist eine großartige, fesselnde Geschichte, die ich in Rekordzeit gelesen habe!! Sie ist von Anfang bis Ende einfach fantastisch!!
Weshalb es von mir hier auch die volle Punktzahl wie auch eine mehr als klare LESEEMPFEHLUNG gibt.« ((Leserstimme auf Netgalley))
»Eine tiefgreifende Geschichte, die eine Tragik aus der Vergangenheit mit in die Zukunft nimmt und den Mut braucht laut ausgesprochen zu werden.« ((Leserstimme auf Netgalley))
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher: www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Fire in our Souls« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2023
Redaktion: Cornelia Franke
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Umschlaggestaltung und Motiv: www.bookcoverstore.com
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Content Note
Playlist
1 Vom Millionär zum Tellerwäscher
2 Sieger weichen nicht zurück, sie nehmen nur Anlauf
3 Ein Schneemann ist wärmer als du
4 Zwischen Schein und Sein liegen nur zwei Buchstaben
5 Rudd über Kopf
6 Möge der echte Cole Rudd sich bitte erheben?
7 Das schwarze Schaf
Tristan
8 Der Exorzismus des Schneemann Rudd
9 Ein Blackout kommt selten von allein
10 Wer in der Käseglocke sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen
11 Willkommen im 21. Jahrhundert
12 Der gefallene Engel
Tristan
13 Ab mit dem Kopf!
14 Ranunkeln, Rotwein und Waffel-Rodeo
15 Einen Milchshake und eine beste Freundin zum Mitnehmen, bitte!
16 Plötzlich Rebellenprinzessin
17 Erfolg liegt übrigens auf der anderen Seite der Komfortzone
18 Schafe im Wolfspelz
19 Zynismus garniert mit Zimtpflaumen und Zuckerengeln
20 Die verdammte Hoffnung
Tristan
21 Kohlrabi ist nichts Essbares und Bananen sind tödlich
22 Feenstaub gibt’s umsonst – das Märchen musst du selber schreiben
23 Wenn Dornröschen im falschen Film aufwacht
24 Wenn die Stimmen im Kopf zu laut sind, bist du zu leise
25 Die schlechteste Idee
Tristan
26 Aller schlimmen Fehler sind drei
27 Und auf einmal stürzt der Boden ein
28 Was dich nicht umbringt, bricht dir das Herz
29 Tausend Gründe dagegen
30 MJR steht nicht für Michael Jackson Revival
Erster Teil: April, 21 Jahre zuvor
Richard
31 Warmduscher haben es auch nicht leicht, okay?
32 Das seltsame Gefühl
Tristan
33 Zuhause ist, wo dein Herz ist
34 Opfer werden nicht nur von Ritualmördern gebracht
Zweiter Teil: März, 19 Jahre zuvor
Richard
35 Mit dem Kopf durch die Wand führt auch (k)ein Weg
36 Vererben sich Arschloch-Gene dominant oder rezessiv?
37 Das Spiel mit dem Feuer
Tristan
38 Warum im Feuer verbrennen, wenn du ein Phönix sein kannst?
39 Das schwarze Loch
Tristan
40 MJR
Letzter Teil: Februar, 18 Jahre zuvor
Richard
41 Wozu ist unsere Stimme gut, wenn wir sie nicht nutzen?
42 Wenn die Vergangenheit zweimal klopft
43 Die stärkste Frau
Tristan
44 Arschlochsein verjährt nicht
Epilog
6 Monate später
Danksagung
Triggerwarnungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Für alle, die ihre Stimme gegen das Unrecht erheben, selbst wenn es wehtut.
Die Welt braucht Heldinnen und Helden wie euch.
Und für meine Nichte Jasmine,
die schon mit acht Monaten fester zubeißen konnte, als meinem Finger lieb war. Mögest du auch als erwachsene Frau stets mehr Biss haben als das Leben.
Liebe Leserin, lieber Leser,
dieser Roman behandelt die Themen Mobbing und sexuelle Gewalt. Es gibt keine explizite Darstellung, aber zu deiner Sicherheit findest du eine Auflistung potenziell triggernder Beschreibungen am Ende des Buchs.
Du bist stärker als du glaubst. Du bist nie allein.
Deine Yvonne
und das PIPER Verlagsteam
Playlist
Wenn du die Stimme deines Herzens nicht mehr hörst, weil die der anderen zu laut sind, mach diese Songs zu deiner Hymne:
"https://spoti.fi/3BxCS5s"
Read All About It, Pt. 3 – Emeli Sandé
This Feeling (feat. Kelsea Ballerini) – The Chainsmokers
Inside of Me – 3 Doors Down
Swan Song (from the Motion Picture »Alita«) – Dua Lipa
Bird Set Free – Sia
Wild & Free – Lena
The Broken – 3 Doors Down
This Is Me (The Reimagined Remix) – Keala Settle, Kesha & Missy Elliott
Unwritten – Natasha Bedingfield
What Do I Know? – Ed Sheeran
Follow the Sun – Xavier Rudd
Bonus Track (für MJR):
I Am – Kid Rock
1 Vom Millionär zum Tellerwäscher
Wir alle werden nackt, mittellos und allein geboren.
Und wir werden auch ohne Kleider, ohne Geld und ohne Freunde sterben …
Das war ein schrecklicher Gedanke. Aber während ich den Blick über meine im Raum verstreuten Designerklamotten gleiten ließ, war er beinahe tröstlich. Denn mein Dad war pleite. Nicht das schönste Geschenk zum achtzehnten Geburtstag, aber ich versuchte, das Positive zu sehen. Was zugegebenermaßen nicht viel war.
Seit die Insolvenz offiziell war, hatte ich drei Dinge gelernt. Erstens: In der High Society von Palm Beach wechselten Frauen, die gestern noch im Poolhaus deiner Eltern Champagner getrunken hatten, heute die Straßenseite, wenn sie deine Mutter kommen sahen. Hashtag Danke für nichts.
Zweitens: Meine Eltern waren definitiv nicht wegen des Geldes zusammen, denn wenn überhaupt möglich, war ihre Beziehung in den letzten Wochen noch inniger geworden. Hashtag Couplegoals.
Und drittens: Es war unmöglich, zwanzig Quadratmeter begehbaren Kleiderschranks in drei Reisekoffer zu quetschen. Hashtag First World Problems.
Ich liebte meine Klamotten. Meine Röcke, Handtaschen und Accessoires – und meine Schuhe, die zugegeben ausgereicht hätten, um eine kleine Boutique zu eröffnen. Aber war es nicht ein ungeschriebenes Gesetz, dass man von Schuhen und Büchern nie genug hatte, selbst wenn die Regale schon aus allen Nähten platzten?
»Brauchst du das hier noch?« Sunny, eine meiner engsten Freundinnen, hielt ein kurzes Strandkleid aus der vorletzten Ralph Lauren-Kollektion in die Höhe, und ich seufzte schwer.
Ich wusste, wie gern sie es sich auslieh. Und nein, bei fünf Grad im Norden von Michigan würde ich es wohl nicht mehr brauchen. »Ich schenke es dir, wenn du magst.«
Sunnys Mund klappte auf. »Wirklich? Oh mein Gott, danke, Becky! – Rebecca«, korrigierte sie schnell, denn ich mochte keine Abkürzungen meines Namens.
Ich lächelte, während sie ihre knallgelben Hotpants herunterließ und das Kleid direkt über ihr Bikini-Oberteil stülpte. Es stand ihr fantastisch. Und es war toll, sie so strahlen zu sehen. Das tat sie leider nicht oft, obwohl wir genau deswegen Cheerleaderinnen waren: um andere Menschen lächeln zu sehen und mit unserer Begeisterung anzustecken. Aber Sunny kämpfte schon seit einer Weile mit ihren eigenen Problemen. Ich selbst wusste erst seit ein paar Wochen, wie sich das anfühlte.
Meine Gedanken glitten wieder zur Insolvenz meines Vaters, als Sunny fragte: »Und das hier? Warte, hattest du das überhaupt schon mal an?«
Sie hob ein paillettenverziertes Top, dass Daddy mir vorletztes Jahr auf der Fashion Week ersteigert hatte. Und das mir wirklich etwas bedeutete, weil es mich an dieses perfekte Wochenende mit meinen Eltern in New York erinnerte. Meine Mom war als Speakerin eines Human Rights-Kongresses dort gewesen und mein Dad hatte währenddessen mit mir die Fashion Week besucht.
Ich öffnete gerade den Mund, als eine schrille Stimme die Spätsommerhitze zerschnitt: »Denk nicht mal dran, Sunnybunny! Das ist ein Unikat von Karl Lagerfeld. Und um da reinzupassen, bräuchtest du sowieso erst mal zwei Monate Diät.«
Als das Lächeln aus Sunnys Gesicht fiel, sank mein eigenes Herz tiefer. Diese Worte stammten von Brittany, unserer Cheerleading-Kapitänin, die hereinstolzierte, als wäre mein Ankleidezimmer ihr Königspalast.
Sunny trägt Kleidergröße S.
Die Erwiderung lag mir auf der Zunge, aber ich wusste, dass Brittany sich dann einfach auf eine andere Beleidigung stürzen würde. Also warf ich Sunny ein aufmunterndes Lächeln zu und hoffte inständig, dass mein Blick sagte: Du siehst toll aus, lass dir nichts einreden!
Es schien nicht zu funktionieren. Sunnys Miene sprach Bände von Schmerz und Frust, aber genau wie ich dachte sie sich lieber ihren Teil, anstatt die offene Konfrontation zu suchen.
»Becky, oh mein Gott! Es ist so traurig, dass du wegziehen musst! Ohne dich wird es nicht dasselbe sein.« Ashley fiel mir wie aus dem Nichts um den Hals und drückte mich so fest, dass mir ganz warm wurde – und das lag nicht nur an der Sommerhitze. Ihr dunkelblonder Zopf peitschte mir ins Gesicht, während ich fest zurückdrückte. Differenzen und ungeliebte Spitznamen hin oder her: Ich würde nichts so sehr vermissen wie das Cheerleading und diese Mädels.
»Ja, es wird echt hart ohne dich«, pflichtete Chloe ihr bei. »Wenn du nicht mehr da bist … wer plant denn dann unsere Choreografien?«
Mein Lächeln verrutschte leicht. Ich blinzelte, unsicher, ob Chloes Worte wirklich so taktlos gemeint waren, wie sie klangen.
»Ja, das war auch mein erster Gedanke«, gab Tiffany zu, während sie einen tannengrünen Rock vom Boden aufhob und sich vor die Hüften hielt, »wenn Becky weg ist: Ciao, Pokal!«
Sie ließ den Rock wieder fallen, so achtlos wie die Worte, die zeitverzögert zu mir durchdrangen … und etwas in mir zerbrachen.
Okay … wow!
Chloe würde meine Choreografien vermissen, nicht mich. Und Tiffanys erster Gedanke hatte dem Pokal gegolten, der in weite Ferne rückte. Nicht der Freundin, die ans andere Ende des Landes zog.
Ich schluckte hart und schaute zu Brittany, weil Brittany immer eine Antwort hatte, wenn man selbst überfragt war. Deswegen war sie der Captain und nicht ich. Doch Brittany schnaubte bloß, während sie über meine farblich sortierten Sandalen strich. »Wir finden schon jemanden. Brauchst du die hier noch? In Michigan soll es kalt sein.«
Der Kloß in meiner Kehle drohte, mich zu ersticken. Früher waren wir beste Freundinnen gewesen. Bis sie mit meinem Ex-Freund Carter geschlafen hatte – während wir noch zusammen gewesen waren. Doch ich verdrängte jeden Gedanken an den hübschesten Jungen Floridas und seine Untreue. Daddy hatte gesagt, es würde ein besserer kommen, und Daddy hatte immer recht.
Endlich brachte ich den Mut auf, das Kinn zu heben. »Alles, was ich nicht mitnehmen kann, schenke ich der Kleiderspende.«
Die Mischung aus Schock, Mitgefühl und Enttäuschung auf ihren Gesichtern brach mir das Herz. Also schob ich hinterher: »Wenn ihr wollt, dürft ihr euch alle ein Teil aussuchen.«
Augenblicklich stürzten sich vier junge Frauen auf meine Klamotten wie Aasgeier auf ein Schlachtfeld. Keine zwei Sekunden später hielt Brittany das Karl Lagerfeld-Top in der Hand.
»Das …« … ist nicht zu verschenken, wollte ich einwenden, aber meine Stimme versagte angesichts ihrer wissenden Miene.
»Im Ernst, Becks, du hattest das noch nie an! Da wirst du es wohl kaum in einem Provinzkaff in Michigan tragen. Bei wie viel noch mal? Minus vier Grad Durchschnittstemperatur?«
»Elf Grad«, korrigierte ich und verdrängte das Frösteln beim Gedanken an den Winter, der mir bevorstand. Dann räusperte ich mich. »Aber darum geht es nicht. Das Top hat mir Daddy geschenkt.«
Brittany breitete vielsagend die Arme aus. »Und was hiervon hat dein Dad dir bitte nicht geschenkt?« Ich sank noch mehr in mich zusammen. Sie hatte recht, schon wieder. »Du könntest deine Freundinnen ruhig öfter an der Ehre teilhaben lassen, dass dein Vater einer der reichsten Männer Floridas ist, findet ihr nicht, Mädels?«
Betretenes Lächeln und unangenehmes Schweigen, während ich Brittany ungläubig anstarrte. Diese Aussage war aus so vielen Gründen ungerecht! Ja, wir hatten Geld. Aber kein Elternpaar an unserer Schule spendete so viel wie meins. Und es war auch nicht so, dass Brittany von ihrem eigenen Geld einkaufte. Aber vor allem … war mein Dad nicht mehr reich. Weil er als Vorstandsvorsitzender des Weltkonzerns Timecorp zurückgetreten war und Privatinsolvenz angemeldet hatte.
Deswegen mussten wir ja wegziehen. Deswegen würden meine Freunde ihren Schulabschluss nächstes Jahr ohne mich feiern. Deswegen stand das Oberteil überhaupt erst zur Debatte.
All das wollte ich Brittany an den Kopf werfen, aber ich wollte nicht streiten. Also hob ich bloß geschlagen die Schultern und … überließ ihr das Oberteil.
Brittany fiel mir strahlend um den Hals, wobei mich ein Hauch von Carters Parfüm umfing. Ich ignorierte die Wunde, die sein Duft aufriss, während ich mit aller Kraft meine Gefühle im Zaum hielt. Ich war unendlich traurig. Und wütend. Auf sie, aber vor allem auf mich selbst, weil ich nichts tat. Weil ich einfach nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte. Ich hatte nie für etwas kämpfen müssen und jetzt wusste ich nicht, wie es ging.
Ich wollte Brittany die Meinung sagen. Aber alles, was ich herausbrachte, war: »Ich glaube, ihr geht jetzt besser. Ich muss meiner Mom beim Packen helfen.«
2 Sieger weichen nicht zurück, sie nehmen nur Anlauf
Whitevale Creek war kalt.
Es war erst Ende August, doch das Taxi wirbelte auf der Landstraße bereits buntes Laub auf. Ich vergrub meine Nase tiefer in dem Rollkragenpullover – der erste, den ich jemals gekauft hatte – und vermisste die Sonne Floridas und Rufus, unseren stets lächelnden Fahrer. Was er jetzt wohl machte? Hatte er anderswo Arbeit gefunden?
Mom streckte die Hand über die Rückbank hinweg aus und drückte meine. Beklommen drückte ich zurück. Ich gehörte zu den Glücklichen, deren Mutter ihre beste Freundin und deren Vater immer noch der strahlende Held aus der Kindheit war.
»Keine Sorge, Engelchen. Du wirst sehen, die Zeit hier vergeht wie im Flug.«
Ich lächelte schwach. Meine Eltern hatten mir nichts erzählt – wohl, um mich nicht mit ihren Problemen zu belasten – aber ich hatte mich eingelesen: Eine Insolvenz löste sich nicht innerhalb von wenigen Monaten auf, erst recht nicht, wenn es sich um einen derart bekannten Mann wie meinen Vater und einen derart bedeutenden Weltkonzern wie Timecorp handelte. Wenigstens lauerten uns hier keine Journalisten auf.
Warum wir uns ausgerechnet in Michigan vor den Medien versteckten, verstand ich zwar nicht, aber ich war positiv überrascht, als wir statt einer Blockhütte im Wald vor einem eleganten Hotel vorfuhren. Ziemlich schick für eine Kleinstadt am Ende der Welt. Fünf Sterne prangten an der Messingtafel neben dem Eingang.
In dieser Sekunde stellte ich erschrocken fest, dass ich mir nie Gedanken darüber gemacht hatte, wie viel ein Fünfsternehotel pro Nacht kostete. Bevor ich fragen konnte, ob wir uns das noch leisten konnten, kam uns ein Portier entgegen – nein, halt! Das war kein Portier.
»Richard. Melody! Wie schön, euch zu sehen.« Der rotbärtige Mittfünfziger herzte meine Eltern. »Und du musst Rebecca sein. Willkommen in Whitevale Creek. Willkommen im White Star Resort Hotel.« Er deutete eine kleine Verbeugung an wie ein Zirkusdirektor bei einer Aufführung. »Ich bin Zachary Blackwood, Bürgermeister dieser schönen Stadt.«
Ich schenkte ihm ein strahlendes Lächeln, als er mir begeistert seinen Arm anbot.
Während Mom uns routiniert eincheckte, scherzten Dad und Zachary Blackwood, als würden sie sich schon ewig kennen. Daddy besaß dieses besondere Talent, dass man sich sofort in seiner Gegenwart wohlfühlte. Eine Unterschrift und drei ausgehändigte Schlüsselkarten später fuhren wir mit Bürgermeister Blackwood im Aufzug nach oben.
In den achten Stock.
In dem es nur eine Tür gab, die mein Vater mit einer der Schlüsselkarten entsperrte.
Nur damit ich das richtig verstand: Wir waren pleite, konnten uns aber die Penthouse-Suite in einem Fünfsternehotel leisten?
In der Tür vollführte der Bürgermeister abermals eine ausladende Geste. »Ich präsentiere: euer Eigentum.«
Zugegeben, man konnte schlechter wohnen. Ich sah mich in meinem neuen Zuhause auf Zeit um und war … erstaunt! Die Suite sah fast aus wie unser Wohnzimmer in Palm Beach – abzüglich des Ausblicks auf die türkisblaue Lagune, natürlich. Aber die Farben waren genauso elegant, die Sofalandschaft genauso geschwungen und die Raumaufteilung genauso luftig. Fast so, als hätte meine Mutter selbst diese Suite eingerichtet.
Ich wollte Mom in eines der Schlafzimmer folgen, als Bürgermeister Blackwood sich zum Gehen wandte und mein Vater wie beiläufig nachsetzte: »Ach, Zachary.« Genau wie Mr Blackwood blieb ich stehen. Mein Vater senkte die Stimme, doch ich hörte seine Worte trotzdem: »Ich wüsste es sehr zu schätzen, wenn die Geschichte nicht an die große Glocke gehängt wird. Wenn nicht um meiner, dann um Rebeccas Willen.«
Zachary Blackwoods graugrüne Augen zuckten kurz zu mir, dann nickte er entschlossen. »Natürlich, Richard.«
»Was soll nicht an die große Glocke gehängt werden?«
Zwei Stunden später, als wir drei wie ein verknotetes Knäuel mit zwei riesigen Pizzakartons auf dem Sofa lagen und einen alten Blockbuster im Free-TV sahen, konnte ich meine Neugierde nicht länger zurückhalten.
Daddy legte sein Pizzastück auf den Karton und wischte sich an einer Stoffserviette des Hotels die Hände sauber. »Du hast mich belauscht?« Er hob grinsend das Kinn, woraufhin ich es ihm spielerisch gleichtat. Ich hatte schon immer unwillkürlich die Mimik und Gestik meines Vaters imitiert und mit der Zeit war es zu einem Ritual geworden. Manchmal kommunizierten wir ausschließlich über immer absurdere Formen gegenseitiger Imitation, bis wir beide in Prusten ausbrachen.
Jetzt allerdings verblasste das Lächeln meines Vaters und ein Ausdruck der Zerrissenheit trat auf sein Gesicht, den ich dort noch nie gesehen hatte.
»Rebecca«, sagte er schließlich. »Du kannst dir nicht vorstellen, wie leid mir das alles tut. Ich kann es kaum ertragen, dass ich dich aus deinem gewohnten Leben reiße. Aber ich würde es mir nie verzeihen, wenn andere dich hier herabwürdigen oder gar verletzen.«
»Daddy …«, begann ich. Ich war achtzehn, er brauchte sich keine Sorgen um mich zu machen.
Er unterbrach mich mit der festen Tonlage des Konzernchefs: »Das werde ich nicht zulassen, Rebecca. Du bist meine Tochter, du bist eine Hall, und niemand hier hat das Recht, über dich zu urteilen, wegen etwas, an dem allein ich die Schuld trage.«
Ich schluckte. Ich hatte nicht gewusst, dass die Leute selbst hier wegen einer Insolvenz tratschen würden. Aber mein Dad hatte immer recht und es schien ihm wirklich wichtig zu sein, also nickte ich. Und kombinierte schnell, damit er stolz auf mich war: »Deswegen wohnen wir in einem Fünf-Sterne-Penthouse siebentausend Kilometer von zu Hause weg?«
Daddy blinzelte überrascht. Dann hoben sich seine Mundwinkel und vertrieben die Schatten von seinem Gesicht. »Genau. Weil wir Halls niemals zurückweichen, sondern nur Anlauf nehmen. Es gibt zu viele Leute, die dich scheitern sehen wollen. Zeig ihnen niemals deine Tränen. Immer nur dein Lächeln.«
Er stupste mein Kinn an und ich nickte eifrig. Das würde ich tun.
Trotzdem bestand ich eine Woche später darauf, selbst zur Schule zu fahren. Mein Dad wollte nicht, dass alle wussten, wie pleite wir wirklich waren. Doch ich wollte nicht, dass meine Mitschüler dachten, ich würde mich für etwas Besseres halten, bloß, weil wir Geld hatten. Gehabt hatten.
Noch weniger wollte mein Dad allerdings, dass ich alleine Auto fuhr – ich hatte zwar einen Führerschein, ihn aber nie gebraucht –, und es kostete mich und meine Mom fast eine Woche Überredungsarbeit, bis ich mich überhaupt hinter ein Lenkrad setzen durfte. Wir hatten einen Gebrauchtwagen gekauft – einen sehr alten Gebrauchtwagen, denn mehr gab unser Insolvenz-Budget nicht her. Immerhin hatten Mom und ich Daddys erste Wahl eines super sicheren, aber superlangweiligen Chevrolet mit einem süßen VW Beetle überstimmt – in Kanariengelb, was vermutlich der Grund für den günstigen Preis war. Cool für uns, oberpeinlich für Dad. Mom hatte ihn angegrinst und gesagt, er müsse ja nicht damit fahren. Dann hatte sie mir feierlich den Schlüssel mit einem Engel-Anhänger und einem gelben Miniatur-Pompon überreicht. Ich war fast in Tränen ausgebrochen, weil die Anhänger so schön waren.
Mein erstes eigenes Auto! Meine erste Autofahrt allein.
Leider stellte ich schnell fest, dass ein Führerschein einen nicht automatisch zu einem guten Autofahrer machte. Vor allem im morgendlichen Berufsverkehr. Unter Zeitdruck.
Rufus, wo bist du?
Mehr schlecht als recht lenkte ich den kanariengelben Beetle auf den Schulparkplatz – auf dem ausnahmslos jeder Fleck Schotter, der breit genug für ein Auto war, auch mit einem besetzt war. Nach zwei erfolglosen Ehrenrunden nahm ich all meinen Mut zusammen und quetschte mich neben einen alten Jeep in eine Parklücke, die eher als Briefmarke durchging. Eigentlich hätte ich den Preis für das beste Einparken des Jahres verdient, dachte ich stolz, während ich mich mit eingezogenem Bauch aus dem Wagen schälte.
Da klingelte es in einiger Entfernung. Panik flutete meinen Körper, ich riss das Handgelenk hoch, um auf die Uhr zu sehen. Nein, nein, nein! Ich würde zu spät kommen, gleich am ersten Tag.
Das heißt, eigentlich war heute der zweite Schultag nach den Sommerferien. Weil ich von einer anderen Schule gewechselt war, hatte ich gestern einen Haufen Tests absolviert, um mein Leistungsniveau zu bestimmen – Fortgeschrittenenkurs in allen Fächern außer Mathematik, Chemie und Physik – und meinen Stundenplan erhalten. Aber da war es nicht annähernd so voll gewesen. Also tat ich, was mein Daddy mir gesagt hatte: Ich nahm Anlauf und rannte los – so gut das mit hohen Absätzen auf Schotter eben ging.
3 Ein Schneemann ist wärmer als du
Atemlos riss ich die Tür zum Klassenraum auf. »Verzeihu–«
Ich hielt perplex inne. Zwei Mädchen saßen plappernd auf dem Lehrerpult, ein Junge lehnte daneben. Von der Fensterbank aus spielte ein Handy Musik, zu der ein Junge und ein Mädchen im Duett sangen. Entweder bedeutete das Klingeln in Whitevale Creek etwas anderes als in Palm Beach oder wir hatten eine Freistunde.
Verwirrt sah ich mich um und erspähte nur einen einzigen freien Platz: in der zweiten Reihe am Fenster. Ich wollte mich gerade in Bewegung setzen – da erfasste mich eine Kältewelle.
Der Typ, der neben dem leeren Stuhl saß, hatte den Kopf gedreht und sah mir direkt in die Augen. Warnend. Abweisend. Sein Blick zwang mich schier, die Lider zu senken. Aber seine grimmige Ausstrahlung war so faszinierend, dass ich nicht wegsehen konnte. Heißes Kribbeln und prickelndes Frösteln kollidierten in meinem Körper.
Ich verstand, warum die anderen seinen Blick mieden. Alles an ihm strahlte Ablehnung aus. Von seiner finsteren Miene bis zu seiner völlig in sich ruhenden Haltung, die langen Beine unter dem Tisch ausgestreckt, die Arme vor der breiten Brust verschränkt. Mein Blick blieb an seinen Lederboots hängen, einer abgetragenen, aber irgendwie coolen Mischung aus Trekking Boots und Bikerstiefel, die nur bis zur Hälfte hochgeschnürt waren und in denen ausgeblichene Bluejeans steckten. Darüber trug er ein schlichtes schwarzes Shirt, unter dem sich eine beeindruckende Brustpartie abzeichnete – zumindest nach dem zu urteilen, was ich sehen konnte, denn er hatte seine kaffeebraune Lederjacke nicht ausgezogen.
Als mein Blick wieder bei seinem Gesicht ankam, hielt ich unwillkürlich den Atem an. Nicht etwa, weil er hässlich war – im Gegenteil. Dieses verwegen abstehende, rabenschwarze Haar schien nur dafür gemacht, mit den Fingern hindurchzufahren, und das kantige Gesicht mit dem dunklen Bartschatten ließ Damon Salvatore aus The Vampire Diaries fast als Engel durchgehen. Nein, erkannte ich: Die anderen mieden seinen Blick, weil seine dunklen Augen jeden, der auch nur in seine Richtung sah, mit nachtschwarzen Dolchen durchbohrten. So wie mich gerade.
Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Also … hob ich die Mundwinkel zu einem unsicheren Lächeln.
Prompt drehte er den Kopf nach vorn und starrte wieder das verwaiste Pult nieder.
Na super. Ein Schneemann war ja nichts gegen meinen neuen Sitznachbarn. Er blieb wie versteinert sitzen, bis ich bei dem Platz neben ihm angekommen war.
»Ist hier noch frei?«
Keine Antwort.
Kam es mir nur so vor oder war es hier zwei Grad kälter? Ich versuchte es noch einmal: »Ähm … hallo? Ich habe dich etwas –«
»Ich habe dich gehört«, unterbrach er mich. Seine Stimme war tief und ernst, aber nicht so finster wie sein Blick. »Der Platz ist nicht besetzt. Ob du dich hierhersetzen solltest, musst du selbst entscheiden. Ich rate davon ab.«
Ich öffnete überrascht den Mund. Mir fiel keine Erwiderung ein, aber um ihm zu beweisen, dass mich seine schroffe Art nicht einschüchterte, ließ ich mich auf den freien Platz fallen.
Ja, hier war es wirklich kalt. Ich lehnte mich vor, um erst sein Profil anzusehen – ein einnehmendes Profil mit einer leicht geknickten Nase und kantigem Kinn –, und dann das geöffnete Fenster hinter ihm.
»Äh … könntest du …?«
»Nein.«
Entschuldige mal? »Du weißt gar nicht, was ich sagen woll–«
»Du wolltest mich fragen, ob ich das Fenster schließen kann.« Wieder war er mir ins Wort gefallen. »Und die Antwort ist ›Nein‹.«
Mir klappte erneut der Mund auf, doch in diesem Augenblick machte jemand anders das Fenster zu und ich beschloss, dass es keinen Zweck hatte. Zumal Mister Schneemann ohnehin schon wieder die Tafel mit seinem Blick einfror.
Endlich legte ich meinen Rucksack ab und schälte mich aus meinem Mantel. Ich fühlte mich beobachtet. Zögerlich sah ich mich nach allen Seiten um, aber niemand schaute in meine Richtung. Zumindest nicht so, dass ich es bemerkte. Irgendwo kicherte ein Mädchen. Über mich?
Aus dem Augenwinkel sah ich, wie Mister Schneemann den Mundwinkel hob. Machte er sich etwa über mich lustig?
Frustriert über meine eigene Unfähigkeit, mit dieser neuen Situation umzugehen, wickelte ich mich aus meinem XXL-Schal. Die Morgenluft in Michigan war schon Anfang September geradezu arktisch. Der Winter würde richtig, richtig schlimm werden.
»Kalt heute«, bemerkte der Schneemann trocken. Sein Tonfall war nicht mehr so eisig und seine Stimme, tief und rau und fast ein bisschen schelmisch, verursachte prompt ein Kribbeln in meinem Bauch. Was auch an der Erleichterung liegen konnte, dass er endlich gewillt schien, ein Gespräch zu führen – und noch dazu mein Frieren verstand.
Begeistert richtete ich mich auf. »Ja, oder?! Ich dachte schon, ich wäre die Einzige, die …« Sein unterkühlter Blick ließ mich innehalten. Langsam begriff ich: »Das war ironisch gemeint, oder?«
Ich fühlte mich schon elend, bevor er antwortete.
»Nein«, sagte er zu meiner Überraschung. »Das war Sarkasmus.«
Ich starrte ihn ungläubig an. »Habe ich dir irgendwas getan?«
»Nein«, wiederholte er schlicht. Wieder machte er sich nicht die Mühe, mich anzusehen. Natürlich nicht.
Allmählich überwog der Frust meine Zurückhaltung: »Würde es dir etwas ausmachen, mich anzusehen, wenn du mit mir redest?«
»Ja.« Diesmal gönnte er mir immerhin einen Seitenblick. Ich blinzelte, weil seine Augen so undurchdringlich tiefdunkelbraun waren. Wie schwarze Seen. »Und du tätest gut daran, jetzt den Mund zu halten. Mr Porter kommt. Sieht nach einem perfekten Tag aus, um unsere gute Zeit mit seiner schlechten Laune zu verschwenden.«
»Ach ja? Und war das jetzt Sarkasmus oder Ironie?« Zumal er selbst nicht der Inbegriff von guter Laune war.
Ich war mächtig stolz auf diese schlagfertige Antwort, doch er zog bloß eine schwarze Augenbraue in die Höhe. Was, wie ich mir widerwillig eingestehen musste, ziemlich attraktiv aussah. Ich ignorierte, wie Bewegung in die Schüler kam, während ich auf seine Antwort wartete. »Hm?«, erinnerte ich ihn, dass wir noch nicht fertig waren.
Er atmete beherrscht ein. »Wenn du es genau wissen willst, war das Zynismus. Aber wenn ich du wäre …«
Er kam nicht dazu, den Satz zu beenden, denn in diesem Augenblick wurde eine Aktentasche so geräuschvoll auf dem Pult abgestellt, dass ich zusammenzuckte. Ich hatte den Lehrer überhaupt nicht reinkommen gehört. Es wurde mucksmäuschenstill in der Klasse.
»Mr Rudd«, mahnte Mr Porter, was dem Schneemann neben mir immerhin einen Nachnamen gab. »Ich begrüße es, dass Sie sich bereits mit Ihrer neuen Mitschülerin bekanntgemacht haben. Aber Sie haben gestern unentschuldigt gefehlt.«
Schneemann Rudd hielt Mr Porters Blick völlig gelassen stand. »Das ist richtig. Meine Entschuldigung liegt auf Ihrem Pult.«
Seine Stimme war ruhig und fest, und seine sparsame Wortwahl machte ihn noch beeindruckender – ganz zu schweigen von diesen schwelenden Augen. Wie dunkle Kohlestücke, die vor langer Zeit verglüht waren, aber immer noch Hitze abstrahlten.
Mir fiel auf, dass ich sein Profil anstarrte wie eine Dreizehnjährige ein Poster ihres Popstar-Schwarms. Schnell richtete ich meine Aufmerksamkeit auf Mr Porter, der sich gegen das Pult gelehnt hatte und den Zettel überflog.
»Soso, Ihre Schwester war krank«, las er wenig überzeugt vor.
»Genau genommen ist sie das immer noch«, konkretisierte Schneemann Rudd, »aber heute kann mein Vater auf sie aufpassen.«
Mr Porter, übrigens ein fast kahlköpfiger älterer Herr im karierten Tweedanzug, musterte Rudd über den Rand seiner eckigen Brille hinweg. »Das kann Ihr Vater sicherlich bestätigen.«
Der Schneemann drehte die Handflächen nach oben. »Tun Sie sich keinen Zwang an.«
Ich hatte selten einen Menschen gesehen, der so gefasst war. Die völlige Ruhe in seiner Stimme löste eine Mischung aus Fluchtreflex und Faszination in mir aus.
Statt einer Erwiderung richtete Mr Porter bloß seine Brille und klappte den Koffer auf. »Rhetorische Stilmittel«, begann er die Stunde. »Wer kann mir ein Beispiel für Ironie nennen?«
Fast synchron mit dem Schneemann schnellte mein Arm in die Höhe, noch bevor ich mir eine Antwort überlegt hatte. Ein engagierter Ersteindruck war das A und O für gute Noten.
Dementsprechend überrumpelt war ich, als Mr Porter mich sofort drannahm. Von der Seite spürte ich den stechenden Blick des Schneemanns. Was mich auf eine Idee brachte: »Ironie ist zum Beispiel, bei warmen Temperaturen zu sagen, dass es kalt sei.«
Ich spürte förmlich, wie die Aura links neben mir noch kühler wurde. Aber das war mir egal, denn jetzt war ich wieder auf Spur: »Ironie ist eine rhetorische Figur, die das Gegenteil von dem ausdrückt, was gemeint ist. Sie kann genutzt werden, um sich von Aussagen zu distanzieren, sie ins Lächerliche zu ziehen oder auf Missstände aufmerksam zu machen. Ironie ist aber – im Gegensatz zum Sarkasmus – nicht beleidigend, sondern meist humorvoll.« Beim letzten Satz warf ich dem Schneemann einen vielsagenden Blick zu, der ihn völlig kaltzulassen schien.
»Sehr gut!«, rief Mr Porter, während irgendjemand hinter uns »Streber« hustete. Ich ignorierte es. »Nicht zu verwechseln mit Sarkasmus. Warum?«, fragte Mr Porter weiter.
Wieder knautschte die Lederjacke links von mir, als der Schneemann und ich gleichzeitig aufzeigten. Da war wohl noch jemand sehr erpicht auf gute Noten. Ich sprach sofort weiter, in der Überzeugung, dass ich immer noch dran war: »Sarkasmus ist kein rhetorisches Stil–«
»– kein Stilmittel auf der syntaktischen Satzebene, sondern eine Intention des Senders auf der semantischen und pragmatischen Ebene«, fiel mir der Schneemann ins Wort und beendete den Satz fast genauso, wie ich es getan hätte. Ich starrte ihn an, während er ungerührt fortfuhr: »Sarkasmus hat also das Ziel, den Empfänger zu verletzen oder zumindest zu verspotten. Dabei kann er sich der Ironie bedienen, muss es aber nicht.«
Als er geendet hatte, warf er mir einen warnenden Blick zu. Hallo?!
»Richtig, Mr Rudd und Miss Hall. Ich würde es allerdings schätzen, wenn Sie warten, bis ich Sie drannehme«, mahnte Mr Porter und ich schnitt dem Schneemann eine besserwisserische Grimasse. »Sie beide«, präzisierte der Lehrer, woraufhin ich betroffen die Lider senkte. Im unbeirrbaren Gesicht des Schneemanns zuckten die Mundwinkel eine Spur nach oben.
Ein anderes Mädchen meldete sich. »Ich dachte, was er erklärt hat, sei Zynismus?« Ihre Tonlage klang geradezu unhöflich abwertend.
»Eine sehr gute Frage, Miss Brown«, lobte Mr Porter. »Wer kann Aufklärung leisten? Mr Rudd selbst?«
Der Schneemann streckte die langen Beine unter dem Tisch aus und sah kurz in die Ferne, als müsste er nach den richtigen Worten suchen, um einem Kleinkind die Kernphysik zu erklären. Als er sprach, war seine Stimme ganz ruhig: »Zynismus hat nichts mit Stilmitteln und Sprache zu tun, sondern ist eine allgemeine Weltanschauung, Nancy. Ein zynischer Mensch wird häufiger sarkastische Bemerkungen machen, aber deswegen ist nicht jeder Sarkasmus zynisch.« Trotz Nancys Tonfall sprach er ohne jede Besserwisserei. Eine Eigenschaft, die ich fast bewundernswert fand.
Wenigstens ist er nicht nur zu mir so kalt, stellte ich fest und schämte mich im selben Moment für meine Erleichterung. Gleichzeitig fragte ich mich, warum er diese Eiswand zwischen sich und der Welt wohl errichtet hatte. Meine Antwort erhielt ich, als Nancy Brown ein Geräusch zwischen Abscheu und Überheblichkeit machte. »Und das Ganze jetzt noch mal für normale Leute ohne Mördergene?«
Mein Herz stolperte. Hatte sie das gerade ernsthaft gesagt? Ich starrte entsetzt geradeaus, traute mich weder, über die Schulter zu ihr zu sehen, noch durch den Vorhang meiner Haare zu dem Schneemann neben mir.
Mördergene?
Was war hier los?
Nach einer quälend endlosen Sekunde drehte sich der Schneemann halb auf seinem Stuhl zu ihr um. Seine Lederjacke knautschte, als er den Arm auf die Lehne stützte, und ich spürte die Eiswelle deutlich, obwohl seine Stimme weitaus gefasster war, als ich erwartet hatte.
»Es wäre zum Beispiel ironisch, dir zu sagen, dass du eine gute Schülerin bist. Es wäre sarkastisch zu sagen, dass du das nicht verstehen musst, weil Sarkasmus Intelligenz voraussetzt. Aber nur ein Zyniker würde beides auch so meinen und dir damit gesellschaftstauglich mitteilen, dass dein IQ bestenfalls Zimmertemperatur hat, Nancy.«
Auf diese Aussage folgte … Stille.
Mir stand buchstäblich der Mund offen, und ich war mir ziemlich sicher, dass ich gerade nicht die einzige Sprachlose im Raum war.
Es dauerte einen Moment, bis die Klasse aus der Starre erwachte. Getuschel setzte ein. Mädchen empörten sich lautstark oder kicherten, Jungs murmelten »Wo er recht hat« und »Ich gebe Rudd nur ungern recht, aber …«.
Mr Porter räusperte sich. »Das war eine gute Demonstration von Zynismus und ich bin sicher, dass wir uns alle einig sind, dass Mr Rudd diese drei Beispiele rein hypothetisch genutzt hat.« Sein mahnender Blick lag auf dem Schneemann, dessen Miene lediglich durch eine leicht gehobene Augenbraue verriet, dass er den Tadel des Lehrers zur Kenntnis nahm.
Ein anderer Typ zeigte auf, einer von denen, die ihm unwillkürlich zugestimmt hatten. »Nicht, dass ich mit Rudd einer Meinung wäre«, schickte er nach allen Seiten vorweg, »aber hat nicht sogar Oscar Wilde gesagt, Zyniker seien lediglich Realisten, die sich trauen, die Wahrheit zu sagen?«
»Das war James Bacon«, korrigierte der Schneemann ruhig, ohne unseren Mitschüler anzusehen. »Oscar Wilde nennt Zynismus die Fähigkeit, etwas so zu betrachten, wie es wirklich ist, und nicht, wie andere es gerne hätten.«
Das Zitat stimmte mich nachdenklich. In der abermals folgenden Stille fragte ich mich, wie viele von uns sich gaben, wie sie wirklich waren, und wie viele lieber so, wie andere sie gerne hätten.
Und ich erkannte, dass ich in die zweite Kategorie fiel: unauffällig, angepasst und im Zweifel zum Wohle der Harmonie einem Konflikt ausweichend. Zum ersten Mal schämte ich mich fast dafür, dass mir die Meinung anderer wichtiger war als meine eigene. Aber alleine der Gedanke, dass mich jemand nicht mögen könnte, schnürte mir die Brust zu. Hätte Nancy vorhin mich so abfällig angesprochen, würde ich heute keinen Bissen mehr an dem Stein in meinem Magen vorbeidrücken können, geschweige denn heute Nacht schlafen.
Ein Teil von mir bewunderte die Menschen, die sich so gaben, wie sie waren: mit all ihren Ecken und Kanten und unpopulären Meinungen. Wie der Schneemann.
Ich könnte das nicht.
4 Zwischen Schein und Sein liegen nur zwei Buchstaben
Zwei Stunden später stellte ich fest, dass die Begegnung mit Schneemann Rudd nur die Spitze des Eisbergs – buchstäblich! – war. Denn: Oh. Mein. Gott! Die Whitevale High war riesig. Und ich war völlig verloren, als ich in der weitläufigen Eingangshalle stand.
Wahre Massen von Schülern strömten an mir vorbei und rempelten mich im Vorbeigehen an. Niemand blieb stehen, um sich zu entschuldigen oder mich auch nur eines Blickes zu würdigen. Das heißt, bis mich die ersten als die Neue erkannten. Entweder kannten sich die Schüler untereinander besser, als ich dachte, oder aber die mediale Berichterstattung hatte Whitevale Creek erreicht.
»Hey, bist du Rebecca Hall?« – »Ist das nicht Rebecca Hall?«
»Dein Dad ist Richard Hall, oder?« – »Stimmt es, dass er mehr Aktien besitzt als Warren Buffett?«
»Sind die Schuhe von Louboutin?«
Ich war komplett überfordert. Natürlich war das Aktien-Portfolio meines Dads nicht annähernd so groß wie das von Warren Buffett, und all meine Designerschuhe hatte ich wegen der Insolvenz abgeben müssen. Beides konnten sie natürlich nicht wissen – und Letzteres durften sie auch nicht wissen, wenn die Insolvenz geheim bleiben sollte. Also tat ich, was ich am besten konnte: Ich lächelte in die Gesichter, die mich umringten.
Als hätte sich ein Scheinwerfer auf mich ausgerichtet, kam der Schülerstrom zum Erliegen. Plötzlich musterte mich jeder von oben bis unten. Ich konnte förmlich spüren, wie sie jedes Detail meiner Erscheinung in sich aufsogen. Von meiner weinroten Strumpfhose über den Wildlederrock und die Satinbluse bis zu meinen dunklen Haaren, die ich heute gelockt trug.
Mein Lächeln verrutschte leicht. Zu viel? Zu teuer? Hielten sie mich für arrogant oder oberflächlich? Fanden sie die Schleifen an meinen Pumps albern?
Ich rief mich zur Ruhe, um nicht in Panik zu verfallen.
»Rebecca Hall? – Macht mal Platz, Leute!«
Eine Schülerin in meinem Alter teilte die Schülermassen wie Moses das Meer. Sie hatte atemberaubend kupferrote Haare, die mit einer riesigen gelben Schleife zusammengebunden waren, trug superknappe Hotpants und stemmte eine Hand in die Hüfte wie ein Supermodel. Das verriet mir zwei Dinge: Erstens, sie war Cheerleaderin bei den Whitevale Wasps – ich war fest entschlossen, ins Team aufgenommen zu werden. Und zweitens: Sie gehörte zu denen, die hier das Sagen hatten.
Lächelnd streckte ich ihr die Hand hin. »Ja, die bin ich. Hi!«
Augenblicklich fiel sie mir um den Hals, als seien wir alte Freundinnen. »Du bist es! Ich hab überall nach dir Ausschau gehalten. Wo warst du denn gestern? Ich bin Victoria, Victoria Blackwood. Cheerleader-Captain, Tochter des Bürgermeisters, Freundin des zukünftig jüngsten Quarterbacks im Superbowl Finale. Du darfst mich Vicky nennen. Oder Vic.«
Ich sah mit großen Augen zu, wie die Worte nur so aus ihr heraussprudelten. Sie hakte sich bei mir unter und zog mich nach rechts zur Treppe, die zu einer Galerie über der Eingangshalle und von dort aus zu den Fluren führte. »Als Erstes musst du lernen: Das da unten ist der Weg für die Loser. Hier oben gehen die coolen Leute.« Ich verzog das Gesicht angesichts dieser Klassentrennung, aber Victoria blubberte bereits weiter: »Mein Vater hat mir schon alles über dich erzählt. Und weil wir Cheerleaderinnen zusammenhalten, habe ich es mir zur persönlichen Aufgabe gemacht, dass du dich hier im Handumdrehen wie zu Hause fühlst. Äh – ist was?«
Ich war stehen geblieben, um einen Blick in die gigantische Mensa jenseits der Glaskuppel neben uns zu werfen.
Victoria zog mich weiter. »Nicht bummeln, Herzchen. Ich muss dich noch den wichtigsten Leuten vorstellen – nein, nicht denen da«, unterbrach sie sich selbst und riss mich mit einem unsanften Schlenker vorbei an einem hellblonden Schlacks und einem etwas fülligeren Mädchen mit babyrosa gefärbten Haaren.
Prompt begann Victoria, mir die Schulhierarchie von Sportlern und Nerds vorzubeten, aber ich war viel zu überwältigt von den mit moderner Kunst bemalten Wänden, an denen Poster von Schulbällen, außerschulischen Aktivitäten, Football-Spielplänen und Sportklubs hingen – und von den unfassbar vielen Jugendlichen auf den Korridoren. Klar, Palm Beach hatte nur neuntausend Einwohner, von denen fast sechzig Prozent im Rentenalter waren, aber der Kulturschock traf mich trotzdem unvorbereitet. Ich ärgerte mich, dass ich nicht von selbst darauf gekommen war.
Es klingelte zur nächsten Stunde und plötzlich brach Victoria in Hektik aus. »Ach du Schande, ich muss Cole noch bei Direktor Wilbury entschuldigen! Du findest dich allein zurecht?«
Äh … nein?
»Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe jetzt Chemie-Grundkurs.«
»Ah! Das ist im C-Trakt, Raum 132. Treppe hoch, links, durch die Glastür rechts und den Gang links bis zum Ende. Bussi!«
Mir schwirrte der Kopf von dieser komplizierten Beschreibung, aber ich nickte tapfer. Und ich fand den Raum tatsächlich allein.
Der Schneemann hatte wohl nicht Chemie im Grundkurs. Irgendwie schade.
»Wir müssen reden.«
Ich zuckte zusammen, als mich nach der Stunde im Flur eine große Hand zur Seite zog, während alle anderen Schüler in die Pause strömten.
Schneemann Rudd!
Er war größer, als ich gedacht hatte. Selbst mit meinen Zehn-Zentimeter-Absätzen blinzelte ich geradewegs auf den Bartschatten an seinem Kinn. Ich trat einen Schritt zurück. Auch, um dem würzig-herben Duft zu entkommen, der von ihm ausging und meine Körperfunktionen kurz durcheinanderbrachte.
Von vorne sah er verwegener aus, fast ein bisschen gefährlich. Unwillkürlich schoss mir Nancys Ausdruck Mördergene durch den Kopf. Ich trat noch einen Schritt zurück, nur um sicher zu sein.
»Hier sind die Regeln. In den Kursen, die wir zusammen haben, darfst du jede zweite Antwort geben und ich bekomme die andere Hälfte. Und du antwortest nie wieder, ohne dran zu sein, verstanden?« Ich konnte ihn bloß anstarren. Er starrte zurück. »Das ist der Punkt, an dem du nickst.«
Schlagartig waren alle Gedanken und Körperfunktionen wieder an ihrem Platz. Hatte der sie noch alle?
»Entschuldigung, ich lasse mir nicht vorschreiben, wie ich mich im Unterricht verhalten soll.«
Ein Muskel zuckte in seinem Gesicht. »Entschuldigung angenommen. Aber ich brauche diese Note und im Gegensatz zu dir kann ich mich nicht darauf ausruhen, dass ich weiblich, reich und hübsch bin und meinem Lehrer schöne Augen mache.«
Schon wieder dieser schockierte Laut in meiner Kehle. Der hatte sie wirklich nicht mehr alle!
»War ja klar, dass ihr Kerle in einer Frau immer nur das hübsche Dummchen seht, das alle Probleme mit ihrem Aussehen und Daddys Geld löst. Euch kommt nicht in den Sinn, dass wir Intelligenz besitzen könnten, oder?«
Ich war selbst ein bisschen überrascht – und ziemlich stolz auf mich –, dass mir das so spontan eingefallen war, und wollte auf dem Absatz umdrehen, um den perfekten Abgang hinzulegen.
Er hielt mich an der Schulter zurück. Perfekter Abgang ruiniert.
»Wenn mich interessiert, was du über mich denkst, wirst du es merken. Bis dahin verlange ich nur, dass du dich an die Vereinbarung hältst.«
Ich starrte auf seine Hand an meinem Oberarm. Sein Griff war fest, aber nicht schmerzhaft. Trotzdem schob ich sie weg. Er ließ nicht los.
»Das ist keine Vereinbarung, das ist Erpressung! Und wenn du mich nicht sofort loslässt, schreie ich die Schule zusammen.«
Er schnaubte verächtlich, nahm jedoch seine Hand von meinem Arm. Sein Blick blieb eisig.
»Beeindruckend, wie du deine Probleme mit deiner Intelligenz löst, anstatt wie ein hübsches Dummchen auf Hilfe von außen zu warten.«
Es dauerte einen Moment, bis ich die sarkastische Verdrehung meiner eigenen Worte und die versteckte Beleidigung begriff, aber da hatte er mich schon stehen lassen. Empört starrte ich ihm nach und wünschte mir, er würde auf dem Linoleumboden ausrutschen. Er tat es nicht.
»Mein herzliches Beileid«, sagte eine rauchig-sinnliche Frauenstimme neben mir. Ich blinzelte auf babyrosa gefärbte Haare, an denen mich Victoria heute Morgen vorbei bugsiert hatte, und dann auf die ausgestreckte Hand der jungen Frau. »Rebecca, richtig?«
Ich zögerte. Sie gehörte zu den Außenseitern hier. Wenn Victoria mich mit ihr sah, wäre ich geliefert. Cheerleading, Adieu!
»Keine Sorge, sind alle schon draußen«, beschwichtigte sie mich, als hätte sie meine Gedanken gelesen. »Siebzehn Grad und Sonne, yaaay. Das lockt alle vor die Tür.«
»Siebzehn Grad«, wiederholte ich gequält, »fast wie ein Januartag in Palm Beach.«
Ihre dunkel umrandeten Lippen verzogen sich zu einem schiefen Lächeln. »Dein Zuhause muss traumhaft sein.«
Mein Heimweh wuchs, als ich nickte. »Ja, Rebecca ist richtig.« Endlich ergriff ich ihre Hand, die sie sogleich freudestrahlend schüttelte.
»Freut mich! Ich bin Sherry.«
»Sherry?« Ich kicherte. Den Namen hatte ich noch nie gehört. »Kurz für Sherlene?«
Sie schnitt eine Grimasse. Fettnäpfchen, hallo! Vielleicht sollte ich mir vornehmen, erst nachzudenken und dann den Mund aufzumachen.
»Nein, ich habe keinen Spitznamen und ich bin verdammt froh darüber, ich hasse diese ganzen Abkürzungen. Einfach nur Sherry.«
Eine Seelenverwandte! Ich wollte ihr gerade sagen, dass ich genauso fühlte, als sich ihr rundes Gesicht aufhellte, weil sich ein Typ zu uns gesellte, in dem ich den blonden Außenseiter von heute Morgen wiedererkannte. Er verstaute einen teuer aussehenden Fotoapparat in seinen Rucksack.
»Sorry, da war ein Eichhörnchen.«
»Du bist mir ein Eichhörnchen!« Sherry prustete, bevor sie ihn zu mir schob: »Und das hier ist Nik.«
Ich gab auch ihm die Hand und schlussfolgerte charmant: »Ich nehme an, auch einfach nur Nik?« Aber ich erlitt schon wieder eine kleine Bruchlandung, als er den Mund verzog.
»Leider nicht. Ist die Abkürzung für Nikodemus. Und ja, ich weiß, was du jetzt denkst. Deswegen Nik.«
»Nikodemus?« Ich hätte gelacht, wenn ich nicht bereits Bekanntschaft mit dem vollkommen ernst gemeinten Sarkasmus von Schneemann Rudd gemacht hätte. »Du willst mich auf den Arm nehmen, richtig?«
»Nein, mein Dad ist ein wenig … eigen. Er steht auf große Namen und alte Werte und so’n Zeug.«
»Sein Dad ist der Schulleiter«, ergänzte Sherry. Mir klappte der Mund auf.
»Dein Dad ist der Schulleiter und trotzdem gehörst du zu den …« Ich schloss eilig den Mund, aber zu spät. Der betroffene Ausdruck huschte bereits über sein Gesicht. Was war eigentlich falsch mit mir? Wieso plapperte ich einfach drauf los, ohne vorher nachzudenken? Das mussten die Nachwirkungen der blitzschnellen Wortgeschosse mit Schneemann Rudd sein. Oder der Überforderung mit der neuen Situation und drölfhundert Mitschülern.
»Zu den Losern«, beendete Sherry meinen Satz spürbar kühler. »Sag es ruhig. War wohl zu viel verlangt, dass das stinkreiche Mädchen aus Palm Beach, das direkt mit Victoria Blackwood abhängt, anders denkt.«
Oh Gott. Jetzt hassten sie mich. »Nein, so meinte ich das nicht!«, versuchte ich zu retten, was noch zu retten war. »Ich meinte …«
Sherry hob die Hände. »Schon gut. Wie gesagt, ich kann’s verstehen. Kleiner Tipp: Wenn du weiterhin mit Victoria oder sonst irgendwem in dieser Stadt befreundet sein willst, solltest du dich nicht mit Rudd abgeben.« Sie zeigte mit dem Daumen in die Richtung, in die der Schneemann verschwunden war.
Das verwirrte mich, doch bevor ich nachfragen konnte, fiel ihr Blick auf einen Punkt hinter mir und ihre Miene verdüsterte sich.
»Wenn man vom Teufel spricht …«
Wer, der Schneemann?
Ich drehte mich um, während Sherry nach Niks Hemdkragen griff. Zu spät.
»Miss Piggy und ihr Welpe!« Nein, diese schrille Stimme gehörte nicht zum Schneemann. Und verglichen mit Victorias Häme war mir Rudds Sarkasmus deutlich lieber. Victoria umklammerte meinen Arm wie ein Schraubstock, ein breites Lächeln auf den roten Lippen. »Wer hat euch erlaubt, Becky zu belästigen?«
Sherry verdrehte die Augen, Nik sah überall hin außer zu Victoria und ich versuchte erfolglos, den beiden ein entschuldigendes Lächeln zuzuwerfen. Sherry erwiderte es finster, bevor sie Nik in die entgegengesetzte Richtung davonzog.
»Komm, Nik. Wenn Rebecca klug ist, wird sie merken, dass in Whitevale Creek nichts ist, wie es scheint. Nihil est ut videtur.«
Stirnrunzelnd wiederholte ich den lateinischen Satz mehrmals, während Victoria mich heillos plappernd durch das Gewirr aus Fluren führte.
»Was meint sie damit?«
»Wie? Ach das!« Victoria machte eine wegwischende Geste. »Das ist nur das Motto ihrer dummen Schülerzeitung.«
»Es gibt eine Schülerzeitung?«
»Ja, aber wer liest die schon? Hier, viel wichtiger: Das Cheerleading-Team! Das hier sind Gwyn – kurz für Gwendolyn; Macy – kurz für Madison; und Theresa, die wir Pixie nennen, weil es keine gute Abkürzung für Theresa gibt«, blubberte Victoria, als wir bei einer Gruppe Mädchen vor den Spinden ankamen. Mir schwirrte der Kopf von den vielen Namen, während sie sich vorbeugte und einer blonden Elfe, einer hoch aufgeschossenen Brünetten und einer afroamerikanischen Schönheit überschwängliche Wangenküsschen verpasste. »Das hier ist Rebecca Hall, kurz Becky!«
»Rebecca«, beharrte ich freundlich und schaffte es endlich, mich aus Victorias Schraubstockgriff zu lösen. »Ich hasse Abkürzungen meines Namens. Aber ich freue mich sehr, euch kennenzulernen.«
Victoria klappte kurz der Mund auf, bevor sich ihr Gesicht wieder zu dem der Grinsekatze verzerrte. »Sie lernt noch«, säuselte sie, als müsste sie sich dafür entschuldigen, dass ich eine eigene Meinung hatte. Ich machte mir eine mentale Notiz, mich mit dem Namen ›Becky‹ anzufreunden, als uns ein Haufen Jungs in College-Jacken entgegenkam.
Pfeifen, johlendes »Vicky, hey!« und »Na, ihr Hübschen, was geht?« übertönten jedes andere Geräusch.
Ich widerstand dem Drang, an Carter zu denken. Was hatte ich jemals an Jungs in Collegejacken gefunden?
»Becky, das hier ist das Football-Team!«, erklärte Victoria überflüssigerweise. »Jungs, das ist Becky.«
Ich winkte pflichtschuldig in die Runde, ohne meinen Ordner loszulassen.
»Hallo Becky, hast du heute Abend schon was vor?« Ein Typ lehnte sich keine zehn Zentimeter vor mir gegen die Wand, die Handfläche dagegengestemmt, wie, um mir den Weg zu versperren. Zu nah. Ich schob mich mit einem entschuldigenden Lächeln unter seinem Arm hindurch und ging auf Abstand.
»Dein Dad ist der Chef von Timecorp, oder?« – »Yo, ist er wirklich der drittreichste Mann der Vereinigten Staaten?«
»Äh, nein?! Das ist Bill Gates – oder Warren Buffett, je nachdem, welchem Index man folgt«, entgegnete Theresa augenrollend. »Liest du keine Wirtschaftsnachrichten, Zac?«
»Ich lese nur den Sportteil.« Der Typ namens Zac ließ grinsend seinen Kaugummi platzen, bevor sein Falkenblick mich fixierte.
Ich strich mir eine Strähne hinters Ohr. Streng genommen war mein Dad aktuell wohl näher am drittärmsten Mann der Vereinigten Staaten.
Ich überlegte gerade, wie ich aus der Sache herauskam, ohne die Insolvenz zu erwähnen – da klingelte Victorias Handy. Eilig ließ sie die Sportler abblitzen. »Verzieht euch, Jungs. Ihr macht sie ganz nervös.«
»Aber wir wollen doch nur spielen!« Sie lachten, dann schob sich das Rudel weiter den Korridor entlang. Ich atmete unmerklich auf.
Victoria flötete übertrieben laut in ihr Handy: »Hey, Baaabe!«
Zwei der Jungs blieben stehen, einer kam sogar zurück. »Yo, ist das Rudd? Sag ihm, wir schaffen es heute erst um halb zehn zu Joe’s Bar! Und sag ihm, wir haben noch keine Begleitung.«
Victoria verdrehte die Augen, während mein Magen einen ungebetenen Salto machte. Rudd? Schneemann Rudd? Ausgerechnet der Typ, in dessen Nähe mir gleichzeitig heiß und kalt wurde, war Victorias Freund?
Kein Wunder, dass Sherry mich davor gewarnt hatte, ihm zu nahe zu kommen, wenn ich mit Victoria befreundet bleiben wollte.
»Nein, Hunter, ich nenne neuerdings meine Mutter Babe«, höhnte Victoria.
Okay, die Ironie war auf jeden Fall da. Verdammt … Hatte sie nicht gesagt, ihr Freund sei Footballer? Das erklärte so einiges. Ha, und ich hatte gedacht, ich wäre über Typen wie Carter hinweg!
Aber Moment mal … wenn der Schneemann der Quarterback war, wieso trug er keine Collegejacke und wurde nicht von allen umschwärmt? Wieso … mieden sie ihn geradezu?
Irgendwas stimmte da nicht.