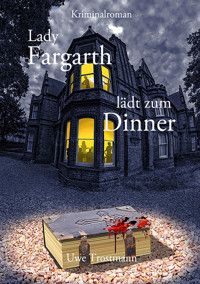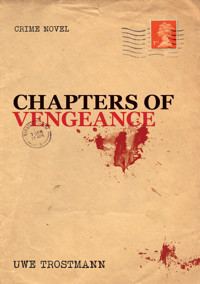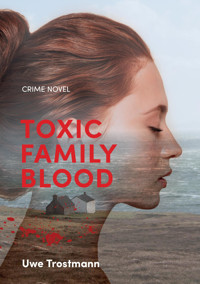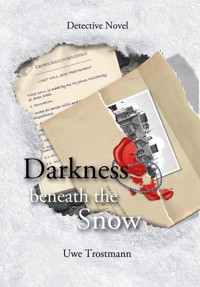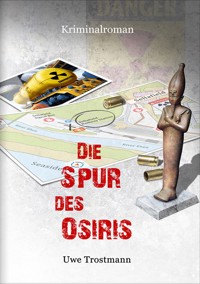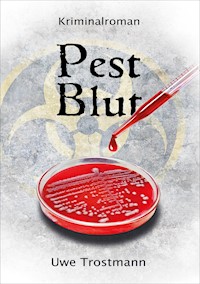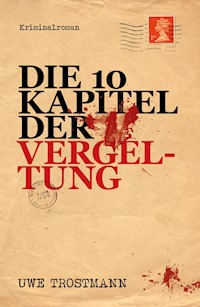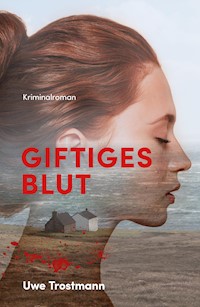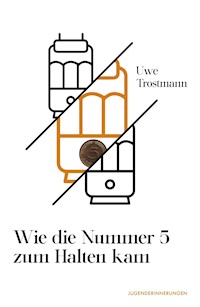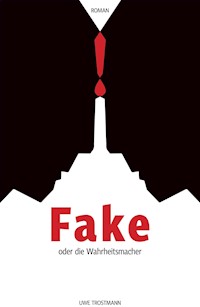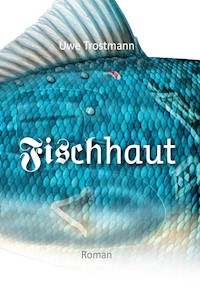
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der junge Heinrich Wilkowsky entzieht sich 1933 durch Eintritt in die Reichswehr seiner Verhaftung. Dort trifft er auf den Kriminalrat Thurnbrück. Das Schicksal führt diese beiden sehr unterschiedlichen Männer immer wieder zusammen und es entwickelt sich eine gegenseitige Abhängigkeit, die bis in die Nachkriegsjahre hineinreicht: Thurnbrück hatte dem Soldaten Wilkowsky das Entkommen aus Stalingrad ermöglicht. Wilkowsky, Zeuge von Erschießungen, wird sich später an nichts erinnern. Heinrich Wilkowsky sucht die Nähe zu den Frauen, aber er denkt erst Jahre nach dem Krieg ernsthaft über eine eigene Familie nach. Frühere Versuche scheitern an seinem starken Freiheitswillen: Er muss ungebunden und unabhängig sein. Er kennt nur sein Glück, sieht nicht den Schmerz, den er vielen Frauen zufügt. Es gelingt ihm immer wieder, in unangenehmen Situationen abzutauchen - wie ein Fisch. Begleiten wir Heinrich Wilkowsky durch eine Zeit, die von Tyrannei, Zerstörung und Wiederaufbau geprägt ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Uwe Trostmann
Fischhaut
Roman
© 2020 Uwe Trostmann
COVER DESIGN: Achim Schulte, www.achimschulte.de
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback: 978-3-7497-9129-3
Hardcover: 978-3-7497-9130-9
e-Book: 978-3-7497-9131-6
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Uwe Trostmann
Fischhaut
Roman
Jeder Roman ist ein Werk der Fiktion. Das gilt auch für „Fischhaut“. Es besteht kein Zusammenhang mit lebenden oder historischen Personen.
Der Autor beschreibt das Leben eines Menschen der versucht, sich aus Abhängigkeiten und kritischen Situationen herauszuhalten.
Mein Dank gilt meiner Lektorin Frau Friederike Schmitz, die sich mit einem ausgeprägten Sprachsinn und großem Engagement dem Text eine Form gegeben hatte.
Mein Dank gilt ebenso meinem Freund Norbert, der mit seinen kritischen und konstruktiven Anmerkungen dieser Geschichte einen guten Rahmen gab.
Erstes Buch
Jagdzeit
Heinrich Wilkowsky rannte durch die dunklen Straßen von Königsberg. Die braunen Schergen waren hinter ihm her. Heinrich hatte Angst. Er wollte nicht erkannt zu werden. Er war sich seiner Sache mit der proletarischen Internationale nicht mehr so sicher, fand immer weniger Gleichgesinnte bei Nachbarn und Bekannten. Die Braunen waren jetzt in der Mehrheit, fühlten sich den Roten überlegen. An einer Straßenkreuzung hatten drei Braunhemden Heinrich erkannt und folgten ihm. Er sprang über Zäune und kletterte über Mauern, bis er sich sicher fühlte. Er war allein unterwegs, doch letztlich konnte er es mit so vielen nicht aufnehmen. Auf die Polizei konnte er schon gar nicht rechnen. Die suchten ihn auch. Heinrich versteckte sich mal hier, mal dort in einem Hauseingang. Doch die braunen Jäger waren zu viele. Überall tauchten sie heute auf, an allen Plätzen, öffentlichen Gebäuden, Theatern und Kinos. Was ist nur los, fragte er sich. Er traute sich nicht nach Hause.
Dann sahen sie ihn erneut; er rannte in den nächsten Hinterhof, kletterte über die Mauer, sprang in den Garten und – stand vor einem der SA-Männer. Der hatte in der einen Hand schon ein Messer und wollte mit seiner Pfeife Verstärkung herbeiholen, als Heinrich ihm das Messer entwendete und zustach. Der SA-Mann brach zusammen, Heinrich rannte zum nächsten Hintereingang und suchte das Treppenhaus. Im Keller fand er einen Wasserhahn, wusch sich die blutverschmierten Hände und reinigte seine Jacke. Dann hörte er die Kommandos, die Polizeisirene und den Krankenwagen. Sie hatten wohl den SA-Mann gefunden. Bald würden sie die Gegend nach ihm absuchen. Sie hatten ihn erkannt, von früheren Schlägereien. Heinrich wagte, durch die Haustür zu gehen, war vorsichtig, um nicht gesehen zu werden.
„Jetzt nicht rennen“, sagte er sich. „Nicht auffallen.“
Er hörte die Straßenbahn hinter sich. Ein Auto fuhr vorbei. Dann sprang er in die Bahn. An der nächsten Kreuzung sah er erst den Hut, dann den braunen Mantel, dann erschien ein Gesicht. Keiner hatte den anderen vorher je gesehen. Die beiden schauten sich an.
Straßenbahn und Auto fuhren weiter. Heinrich hatte jetzt doppelte Angst. Sie suchten ihn, weil er in der Kommunistischen Partei war und weil er einen der ihren niedergestochen hatte. Seine Adresse war bekannt. Er lief durch die verschneiten Straßen seines Viertels. Viele Türen waren verschlossen, die Menschen wussten wohl warum. Die Fenster blieben dunkel, auch wenn er rief. Seine Freunde öffneten nicht ihre Türen. Er wusste nicht, dass viele schon verhaftet waren. So zog er durch die wenig beleuchteten Straßen, immer auf Vorsicht bedacht. Es war kalt, Wolken bedeckten inzwischen den Himmel und bald würde es anfangen zu schneien. Aber er hatte Hunger, denn seit zwei Tagen hatte er beinahe nichts mehr gegessen. Sein Geldbeutel war leer. Morgen würde er sein Arbeitslosengeld abholen.
Heinrich kam an einem Haus vorbei, aus dem ein Fremder kam, etwas verschüchtert, ohne Gruß. Heinrich nutzte die Gelegenheit und huschte hinein. Er stand verschwitzt und verschmutzt vor einer attraktiven Frau und setzte sein schönstes Lächeln auf.
„Guten Abend, ich bin Heinrich.“
„Du hast etwas ausgefressen. Dich jagt die Polizei?“
„Nein, die Braunhemden. Wir prügeln uns seit Jahren, aber jetzt kommen immer mehr.“
„Komm erst mal rein und wasche dich. Du bist wohl schon auf der Straße gelegen. Dein Jackett ist ganz nass.“
„Beim Sprung in einen Garten bin ich in den Schnee gefallen.“
„Ziehe mal deine schmutzigen Sachen aus. Ich weiß, wie man wäscht. Das ist mein Beruf.“
Im Nu stand Heinrich in der Unterhose im Zimmer. Nicht, dass es ihm peinlich war. Er stand ja öfter in der Unterhose, oder ohne, vor einem Mädchen. Nur jetzt war die Situation etwas anders: Er war beinahe nackt, sie nicht. Aber hübsch sieht sie schon aus, dachte er.
Ein gut aussehender Kerl, dachte Mareike. „Hier hast du eine Hose und ein Hemd. Die sind frisch gewaschen. Sie gehören Kunden von mir.“
Heinrich fühlte sich jetzt wohler. Seine Selbstsicherheit kehrte zurück. Breit setzte er sich auf das Sofa, sah in der Vitrine eine Flasche Schnaps und bat um ein Glas.
„Solange du dich hier nicht volllaufen lässt.“
Mareike schenkte ihm ein. Wie viele Männer, so wurde auch er bei Mareike redselig. Er breitete sein gesamtes Leben vor ihr aus.
„Und warum schaffst du es nicht, vernünftig zu arbeiten? So wirst du nie eine Familie gründen.“
Wollte er das? „Wie soll ein Arbeitsloser eine Familie gründen?“
Heinrich merkte, dass sich um ihn herum etwas veränderte. Er merkte es auf der Straße, erkannte aber noch nicht den großen Wandel, der sich anbahnte. Mareike hatte schon eine Ahnung. Wenn Braunhemden sich bei ihr ausgezogen hatten, erzählten die von dem Gewaltigen, das da komme. Es klopften mehr Braunhemden als Rothemden an ihre Tür. Die kamen immer seltener. Und auch wichtige Männer ohne Braunhemd erzählten ihr von dem kommenden Wandel. Und dass alle Nicht-Braunhemden als Feinde anzusehen wären.
Heinrich war 20 Jahre alt. Seit drei Jahren arbeitete er als Tischler-Geselle bei dem einen oder anderen Schreiner. Seine Tische und Stühle kamen allerdings nicht über das Niveau eines Lehrlings des zweiten Jahres hinaus. Er hätte sich mehr Mühe geben können, hatte aber keine Lust dazu. Dafür liebte er es, sich aufzuspielen. Jüngeren Kollegen gegenüber war er gerne der Chef, wenn der Meister nicht im Hause war. Nicht alle Arbeitgeber brachten viel Geduld mit ihm auf, immer wieder wurde er auf die Straße gesetzt. Glücklicherweise fror Heinrich nie lange, noch musste er lange nach einem Bett Ausschau halten. Denn er war ein hübscher Junge mit schwarzen, nach hinten gekämmten Haaren und einem muskulösen Körper – der auch charmant sein konnte. Er wurde sich dieser Fähigkeit immer bewusst, wenn er unter eine warme Decke kriechen wollte, weil er mal wieder ohne Arbeit und ohne Geld dastand. Lange hielten es die Mädchen freilich nicht mit ihm aus. Er wollte befehlen und selber nichts tun. Waschen, putzen, aufräumen, reparieren waren ihm ein Gräuel. Das war etwas für die Frauen! Und auf Frauen sah er hinab. Entweder in seinen Meinungen oder wenn er auf ihnen lag. Heinrich wollte immer oben sein. Verantwortung in einer Beziehung jedoch wollte er nicht übernehmen. Am Arbeitsplatz beschäftigte ihn nicht die zu erledigende Arbeit, sondern das nächste Treffen mit seinen Parteifreunden oder der nächste Ausflug ins Grüne.
Waschen alleine macht nicht glücklich und nicht reich, und so verdiente Mareike an manchen Abenden mit Liebesdiensten das eine oder andere Geldstück hinzu. Ein Kunde, der ihr seine Wäsche gebracht hatte, machte ihr einmal das Angebot. Und das Geld konnte sie gut brauchen, denn sie ging durchaus auch einmal aus, liebte neue schicke Kleider, ging gerne in ein Café an der Promenade oder auch tanzen. Eine Freundin hatte ein entsprechendes Zubrot und ihr davon erzählt. Mareike lernte schnell und ihre Künste sprachen sich bei den Männern herum. Sie machte es erst gelegentlich, dann doch regelmäßig. Hübsch war sie mit ihrer ansprechenden Figur, den großen blauen Augen und den langen blonden Haaren. Ein Zimmer, nicht für die Wäsche, ein Bett, nette dezente Tapete, so empfing sie ihre Freier. Sie sollten sich bei ihr wohlfühlen. Dann kommen sie wieder, dachte Mareike. Außerdem sollte sie diskret sein, riet ihr die Freundin.
Mareike war nicht wählerisch, was die politische Gesinnung ihrer Freier anging. Solange sie nett waren, durften sie wiederkommen. Mareike lernte viel von ihnen. Sie erzählten von ihren Ehen, ihren Berufen und ihren Sorgen. Ein Glas Wein vor und nach dem Akt brachte Entspannung und redselige Männer. Mareike brauchte diese Informationen nicht, sie hörte einfach nur gerne zu. Mit der Zeit sprachen sich ihre Liebeskünste auch in den höheren Kreisen und bei den Einflussreichen herum. Mareike wollte nicht mehr als das und wusch tagsüber die Wäsche ihrer Kunden, trocknete und bügelte sie. Das andere war ihr Zubrot, nicht ihre Bestimmung.
Mareike erzählte Heinrich von den zu erwartenden Veränderungen nichts. Sie war verschwiegen und wollte es auch bleiben. Doch jetzt ahnte sie, in welcher Gefahr sich ihr hübscher Junge befand. Nur er hatte wohl noch keine Ahnung davon. Heinrich sollte das geliehene Hemd und die Hose schonen, denn seine Sachen würden noch die ganze Nacht brauchen, um trocken zu werden. Mareike wärmte Heinrich unter der Decke.
Kriminalrat Sigmund Thurnbrück stieg gegen Abend an der Parteizentrale aus seinem Dienstwagen. Es hatte leicht zu schneien begonnen. Auf dem Weg zum Eingang klappte er den Kragen seines langen braunen Mantels nach oben und schob seinen Hut tiefer ins Gesicht, lief über den Hof und betrat das Gebäude. Hektisches Gerenne von SA- und Gestapo-Leuten in den Korridoren bremste ihn immer wieder auf dem Weg in sein Büro. Er hatte noch nicht seinen Mantel ausgezogen, da wurde er schon von einem SA-Mann angesprochen:
„Herrn Thurnbrück, einer unserer Männer wurde heute von einem Kommunisten-Schwein niedergestochen. Wir wissen auch, dass es der Heinrich Wilkowsky war. Die Kameraden waren hinter ihm her und hatten sich zur Suche aufgeteilt. Als einer in den Hinterhof kam, lag der Kamerad im angrenzenden Garten blutend am Boden und der Wilkowsky kletterte gerade über eine Mauer. Wir haben ihn nicht mehr gekriegt.“
„Und wo war das?“, fragte Thurnbrück.
„Im Hinterhof der Berliner Straße Nummer 15. Wir haben hier ein Bild von dem Wilkowsky.“
Thurnbrück sah sich das Bild an. Das Gesicht kam ihm bekannt vor. War das nicht der Mann, den er in der Straßenbahn gesehen hatte?
Unterschlupf
„Kann ich bei dir bleiben?“, Heinrich saß in seinen gebügelten, sauberen Sachen am Küchentisch und trank den dünnen Kaffee.
„Bei dir gibt es ja sogar Kaffee! Wie machst du das?“
Mareike ging auf seine Frage nicht ein. Auf dem großen Herd machte sie Wasser für die Wäsche heiß. Auf dem Waschbrett hatte sie schon mit dem ersten Schwung des Tages angefangen. Wasserdampf breitete sich im Raum aus. Heinrich stellte befriedigt fest, dass die Sonne sogar in dieses Zimmer schien.
„Meine Mutter wäscht auch für andere Leute. Sie hat aber nicht so viel Platz wie du und muss das in unserer Küche machen“, erzählte er.
Mutter Wilkowsky machte den Haushalt und wusch die Wäsche für die besseren Leute. Eine kräftige, nicht dicke Frau, stand sie tagsüber in der Küche und kochte, wusch, trocknete und bügelte die Wäsche. Die Kinder holten die schmutzigen Teile ab und brachten sie nach dem Waschen wieder zurück. Heinrich hatte nie Lust dazu, und sobald die Gelegenheit günstig war, schickte er seine kleinen Geschwister. Er hasste diese Arbeit. Er hasste es vor allem, dass seine Mutter für die besseren Leute die Schmutzarbeit machen musste. Mehrmals hatten ihm die Kunden das Geld nicht in die Hand gegeben, sondern vor die Füße geworfen, wenn er die Wäsche abholte. Heinrich bedankte sich nicht dafür. Er fühlte sich gedemütigt. Für ihn war das hingeworfene Geld ein Almosen.
„Dafür hat mich der Vater am Abend wieder verprügelt.“
„Hast du Geschwister?“
„Ja, vier. Zwei wohnen noch bei den Eltern. Meine älteste Schwester ist ausgezogen, so wie ich. Dadurch, dass wir weg sind, gibt es mehr Platz. Es war eng bei uns.“
„Und wie kamst du zu den Roten?“
„Es ist doch ungerecht, dass wenige Menschen viel Geld haben und viele andere wenig. Oder Leute wie ich: sehr wenig. Ich mache doch auch meine Arbeit? Warum bekomme ich so wenig Geld dafür? Und jetzt habe ich überhaupt keine Arbeit mehr.“
Mareike hörte zu. Sie fand auch keine Antworten auf Heinrichs Fragen.
Heinrich beschäftigte es, dass viele arm waren, obwohl sie arbeiteten. Und er sah, dass es Menschen gab, die gar nicht arbeiteten und trotzdem reich waren und große Häuser hatten. Für ihn durfte das nicht sein. Mit dieser Einstellung traf er Gleichgesinnte und trat in die Partei ein, deren Mitglieder das Gleiche wollten. Diktatur des Proletariats hörte sich für Heinrich gut an. Dafür war der bereit, auf die Straße zu gehen. Er fühlte sich als Proletarier. War das sein Traum? Gleicher Lohn für alle. Ein Arzt soll nicht mehr verdienen als ein Schreiner. Jeder macht seine Arbeit. Wir brauchen die Revolution! Davon war Heinrich überzeugt. Und so versuchte er mit Demonstrationen und Streiks seinen Traum umzusetzen. Als Sohn eines Brauereikutschers in Königsberg fühlte er sich immer benachteiligt. Der Vater hatte keinen guten Verdienst. Nur die anderen hatten das Geld, stellte er immer wieder fest, wenn er durch die Straßen der Stadt zog.
„Und dann kamen die Braunhemden. Ich kannte diese SA-Schläger von meinen Kneipentouren. Jetzt auf einmal wollten gerade sie für Recht und Ordnung sorgen und den roten Sumpf beseitigen, wie sie sagten. Sie meinten damit uns und unsere Partei. Bei unseren nächtlichen Touren und Besuchen in deren Treffpunkten machten wir unsere schlagkräftige Meinung klar. Bei den Gegenbesuchen flogen, wie zu erwarten, ebenso die Fetzen. Einige Gruppen ließen auch schon einmal eine Bombe hochgehen.“
Heinrich war für die Kommunistische Internationale, die anderen für das National-Soziale.
„Hast du eine Bombe geworfen?“
„Nein, wir hatten keine.“
Mareike Jeschkes wusch viel. Sie wusch Hemden, Unterwäsche, Bettwäsche. Sie tat das seit dem Ende ihrer Schulzeit. Wenn sie überlegte, so hatte sie das auch schon als Kind getan. Wenn ihre Mutter wieder einmal krank war und die Wäsche der Eltern und ihrer drei jüngeren Geschwister gewaschen werden musste, machte das Mareike. Sie macht das gut, sagten die Leute und Mareike dachte über eine eigene kleine Wäscherei nach. Zunächst wusch sie in einem Hinterzimmer der elterlichen Wohnung und verdiente ihr erstes Geld. Nach der Schulzeit mietete sie von ihrem Ersparten eine Wohnung im ersten Stock. Sie achtete darauf, dass diese nicht im ärmsten Viertel lag, denn dorthin kamen keine Kunden. Mareike zog es vom Armenviertel weg.
„Ich bin so näher bei den Kunden“, sagte sie und kaufte sich ein paar Waschzuber für die Küche. Sie hatte genug Platz für ein Wohnzimmer, wo sie auch schlief, und ein Gästezimmer, wie sie es nannte. Die Kunden, meistens Frauen, manchmal auch Männer, erzählten bei ihr gerne aus ihrem Leben, über ihre Sorgen und Ängste. Mareike konnte gut zuhören. Das schätzten die Erzählenden.
Mareike wusste schon als Elfjährige, dass sie später nicht in diesen engen Verhältnissen, in diesen feuchten Wohnungen mit wenig Licht wohnen wollte. Als Austrägerin für Wäsche erlebte sie auch die anderen, besseren Lebensbedingungen. Sie liebte die Menschen und ihre Herzlichkeit in ihrem Quartier. Sie sah aber auch, dass nur die wenigsten hier herauskamen. Mareike wollte raus. Erst unbewusst, dann überlegt setzte sie sich in ihrem Auftreten und ihrer Kleidung von ihren Freunden ab. Die hänselten sie. Das war ihr aber egal. Nach dem Ende ihrer Schulzeit wusch sie erst einmal weiter Wäsche. Das andere würde sich schon ergeben.
„Gestern haben sie dich gejagt. Du hattest Glück! Die Roten haben wir eingesackt, hat mir jemand erzählt. Du solltest auf der Straße sehr vorsichtig sein. Sie kennen dich? Du musst untertauchen.“
„Kann ich erst einmal hierbleiben?“, frage Heinrich.
Mareike gefiel ihm, wenn er auch ahnte, dass sie nicht so einfach herumzukommandieren war. Mareike war selbstständig. Er hätte sie gerne gehabt, aber solche Frauen machten ihm Angst. Trotzdem, wenn er hier untertauchen könnte, so wären seine Probleme fürs Erste gelöst und er hätte einen warmen Platz zum Wohnen. Das andere gäbe sich schon, dachte er.
„Geht nicht. Ich muss hier arbeiten und abends auch. Du hast zurzeit keine Arbeit und sitzt hier nur den ganzen Tag herum.“ Mareike hatte keine Lust, Heinrich durchzufüttern und abends auf die Straße zu schicken, wenn ihre Kunden kamen.
„Ich habe keine Arbeit, wie viele andere auch.“
„Gehst du deine Stütze abholen? Sei vorsichtig. Die Braunhemden kennen dich.“
„Tagsüber verschwinde ich zwischen den vielen Menschen auf der Straße.“
„In den Ämtern und Banken stehen sie aber jetzt überall herum.“ Mehr wollte Mareike dazu noch nicht sagen. Schweißperlen standen ihr auf der Stirn. Es war heiß in der Küche geworden und die Wascherei war anstrengend.
Heinrich merkte, dass er hier nicht schnell zum Ziel kam. Eigentlich hatte dieses Mädchen alles, was er brauchte. Aber dafür musste er etwas tun.
„Dann gehe ich mal mein Geld holen und guck mal, was meine Wohnung macht.“
Eine wichtige Entscheidung
Es hatte aufgehört zu schneien und der Tag versprach schön zu werden. Ein paar Wolken zogen am Himmel entlang, die Sonne war angenehm warm und Heinrich nahm seinen Weg, um sein Arbeitslosengeld abzuholen. Es war ruhiger auf den Straßen geworden. Die Horden der SA-Leute waren jetzt kaum zu sehen. Heinrich bewegte sich vorsichtig in Richtung Innenstadt. Immer wieder blieb er möglichst unauffällig an einem Schaufenster stehen und blickte sich vorsichtig um. An einem Zeitungsstand nahm eine Schlagzeile seine Aufmerksamkeit in Anspruch: Roter Mob ersticht SA-Mann. Weiterlesen konnte er nicht, andere Passanten interessierten sich ebenfalls für die Zeitungen. Er lief weiter. War er gemeint? War er erkannt worden? Langsam kam er zu der Erkenntnis, dass er von hier verschwinden sollte. Ihm fiel jetzt wieder der Grund seines Weges in die Stadt ein: das Arbeitslosengeld.
Arbeitslosengeld wird mir nicht mehr lange zustehen. Dann kann ich nur noch zur Arbeiterwohlfahrt gehen, überlegte er. Eine Arbeitsstelle zu finden war illusorisch. Zu viele Fabriken und Handwerksbetriebe hatten dicht gemacht. Die Weltwirtschaftskrise war angekommen, viele Millionen Menschen waren arbeitslos. Und die Menschen rannten denjenigen Politikern nach, die am meisten versprachen: Arbeit, Sicherheit und politische Gerechtigkeit für den verlorenen Krieg. Auf seinem Weg durch die Stadt fielen ihm die vielen Braunhemden und Polizei vor den öffentlichen Gebäuden auf. Er stellte sich in die Schlange der wartenden Arbeitslosen. Auf der Straße war ein Verkehr wie immer, stellte er fest. Autos und Pferdefuhrwerke wetteiferten ums beste Vorwärtskommen. Aber irgendetwas war anders. Die Gespräche der Wartenden drehen sich nur um eins:
„Alles wird besser mit der neuen Regierung. Und auch das Land wird sichererer. Endlich mal einer, der den anderen sagt, wo es langgeht.“ Ein Herr mit Mantel und Hut sprach laut seine Meinung aus.
„Die anderen haben den Krieg angefangen, nicht wir. Wir sollen aber dafür bezahlen.“
Das ist auch ein Anhänger von diesem Hitler; Heinrich hielt sich mit seiner Meinung zurück. Er wollte kein Aufsehen erregen. Langsam gelangte die Schlange ins Innere des Gebäudes, in dem die Arbeitslosigkeit verwaltet wurde. Plötzlich ein Getümmel vor dem Schalter, der schon in Sichtweite war. Ein Braunhemd neben dem Schalter zog einen Mann mit Gewalt aus der Schlange, prügelte auf ihn ein und schrie: „Du Kommunistensau bekommst kein Geld. Hau ab!“
Heinrich kannte den Geschlagenen nicht. Ihm wurde es aber mulmig und er entfernte sich unauffällig auf die Straße zurück. Ihn zog es zu seinen Freunden, er wollte reden, verstehen, was hier los war. Aber zu dieser Tageszeit war das kaum möglich.
Warum dieser Aufruhr? Warum konnten sich die Braunhemden heute so aufspielen? Was war passiert? Heinrich sah keinen seiner Freunde. Hielten sich alle versteckt? Das war wohl auch das Beste. Die jagen uns, dachte er niedergeschlagen. Schon gestern Abend hatte er niemanden zu Hause angetroffen. Ihm war klar, dass er sich nicht den ganzen Tag auf der Straße aufhalten sollte. Sein Weg führte ihn in Richtung seiner kleinen Wohnung, einer Dachmansarde in einem Hinterhofgebäude. Im Sommer wurde es hier oft unerträglich heiß, jetzt im Winter sehr, sehr kalt. Deshalb hielt er sich auch kaum dort auf. Wenn es wieder einmal frostig war, übernachtete er manchmal auf der Bank in seiner Stammkneipe oder er hatte Glück und fand sich in einem anderen Bett wieder.
Es war ruhig im Mietsgebäude, zu ruhig. Die Kinder waren in der Schule. Aus einigen offenen Fenstern hörte er vereinzelt Sprachfetzen. Aus einer Werkstatt hörte er gar nichts mehr. Hier hatten einmal zehn Klempner gearbeitet, aber jetzt war die Firma pleite, wie viele andere auch. Die Wirtschaftskrise hatte auch hier ihre Spuren hinterlassen. Heinrich ging die Holztreppe zu seiner Wohnung hinauf. Die Wohnungstür war angelehnt. Er schloss sie immer ab. Langsam öffnete er die Tür. Seine Wohnung war durchsucht worden. Er fand die Schubladen seines einzigen Schrankes herausgezogen und den Inhalt zerwühlt. Die Bettsachen lagen auf dem Boden. Einbrecher? Von seinen spärlichen Sachen fehlte nichts.
Die suchen mich, weil ich den SA-Mann niedergestochen habe. Der hat aber als Erster das Messer gezogen!, ging ihm sofort durch den Kopf.
Eine Nachbarin, eine alte Frau, klopfte an die offene Tür. Sie sah ängstlich aus.
„Sie sind es. Endlich. Die haben Sie gesucht. Die Leute haben die Tür Ihrer Wohnung aufgebrochen und alles durchsucht! Nach einer Stunde waren sie wieder weg.“
„Wer war das?“ Heinrich bekam ein mulmiges Gefühl in der Magengegend.
„Es waren SA-Leute. Sie hatten Schlagstöcke dabei. Ich soll ihnen sagen, wenn Sie zurückkommen. Herr Heinrich, Sie sollten nicht mehr hierherkommen.“
„Ich bleibe bis heute Abend. Bitte sagen Sie ihnen nichts.“
Die Nachbarin schloss die Tür hinter sich. Er hörte, wie sie langsam die Holztreppe hinunterlief. Heinrich hoffte, dass niemand kommen würde.
Er sah sich in seiner kleinen Wohnung um. Eigentlich war das keine Wohnung, sondern nur ein kaltes Zimmer mit einem Abstellraum. Die Heizung bestand aus dem gemauerten Hauskamin, der sich an einer Wand in die Höhe zog. Im Winter konnte man sich die Hände daran wärmen, den Raum erwärmte er allerdings nicht. Das war auch der Grund, warum Heinrich im Winter meist nicht hier war. Die Bretter, festgenagelt unterhalb der Dachziegel, schützten nicht vor der Kälte. Und es konnte hier in Königsberg wirklich kalt werden. Am Morgen war das Wasser in der Waschschüssel gefroren. An der einzigen geraden Wand stand ein alter Kleiderschrank. Als er vor einem Jahr hier eingezogen war, hatte er sich noch vorgenommen, die Türen zu reparieren. Er kannte sich damit aus, nahm es dann aber, wie es war, und kümmerte sich nicht mehr darum. Die einzige Toilette im Haus befand sich zwei Stockwerke tiefer. Sie wurde von den meisten Bewohnern des Hauses benutzt. Auch das Wasser für seine Waschschüssel musste er dort holen.
Heinrich machte es sich in seinem Zimmer so angenehm, wie es noch ging. Die Sonne schien durch das Fenster und auf das Dach und erwärmte den kleinen Raum ein wenig.
Es kann hier richtig schön sein, wenn die Sonne scheint; ich war nur sehr selten hier, dachte er. Er packte seine wenigen Sachen in seinen einzigen Koffer. Um vor Überraschungen gefeit zu sein, ließ er die Eingangstür ein wenig offen und verbrachte die Zeit bis zur Dunkelheit hauptsächlich damit, auf seinem Bett zu liegen oder aus dem Dachfenster zu sehen und sein Gesicht von der Sonne wärmen zu lassen.
Klein und friedlich sehen die Stadt und ihre Menschen von hier oben aus, dachte er. Was ist wohl aus meinen Geschwistern geworden? Ich habe sie schon Monate nicht gesehen.
Heinrich wurde während des Ersten Weltkrieges geboren. Sie waren vier Brüder und eine Schwester, Hermann, Johann, Fritz und Heinrich und Clara. Clara war die Älteste. Heinrich war der Zweitälteste. Die Wohnung war, wie alle in ihrem Viertel, eng, klein, feucht und dunkel. Hier wohnten keine Leute mit hohem Einkommen. Eng standen die vierstöckigen Mietshäuser zusammen. Nur im Sommer erwärmte die Sonne die Gasse ein wenig, doch in den Wohnungen, besonders in den unteren, war von der Sonne selten etwas zu sehen. Die Wände waren feucht, auch wenn Vater und Mutter den Küchenherd oft zum Glühen brachten. Es war der einzige Ofen in der Zweizimmer-Wohnung. Der Weg zur Toilette führte durch den Innenhof. Mit einem Eimer Wasser in der Hand pflegten sie diesen Gang zu tun. Die Buben schliefen in einem Zimmer, das so klein war, dass ein Dreistockbett aufgestellt werden musste. Heinrich nahm mit einer Matratze auf dem Fußboden neben dem Kleiderschrank vorlieb – oder musste vorliebnehmen. Wollte jemand Kleider aus dem Schrank nehmen, musste jedes Mal die Matratze hochgeklappt werden, sehr zu Heinrichs Ärger. Die Schwester schlief auf einer Bank in der Küche, die tagsüber die Sitzgelegenheit der Familie war. Auf dem Kohleherd kochte die Mutter, machte ihre Wäsche und erwärmte das Wasser im Winter für die wöchentliche große Badeprozedur. Sie stellte die Kinder, eines nach dem anderen, in den Waschzuber und schrubbte sie ab. Im Sommer fiel das Baden aus, da sprangen die Kinder in den Pregel, den Fluss, der nicht weit von ihnen entfernt seinen Weg durch Königsberg zum Meer suchte. Die Mutter kochte, was gerade auf dem Markt billig zu haben war. Manchmal brachte der Vater altes Fleisch von einer Gastwirtschaft mit, die er mit Bier versorgt hatte. Hungern mussten sie selten. Der Vater wurde wegen der Zahl seiner Kinder auch nicht in den großen Krieg eingezogen. Später nannte man diesen Krieg den Ersten Weltkrieg. Zu der Zeit gab es noch einen Kaiser, den die meisten von ihnen aber zum Teufel wünschten. Heinrich sah, wie Kaiser, Könige und Grafen in Saus und Braus lebten. Vater und Mutter schufteten, Geld blieb aber kaum für notwendige Anschaffungen oder für das Alter übrig.
Eine Gruppe von sechs SA-Leuten brachte ihn wieder in die Gegenwart zurück. Sie marschierten geradewegs auf das Haus zu, in dem Heinrich wohnte. Er zog schnell seinen Kopf ein. Blitzschnell dachte er an eine Flucht über das Dach. Vorsichtig spähte er aus dem Fenster, bereit, seinen Koffer zu ergreifen. Die SA-Leute marschierten mit lautem Palaver am Haus vorbei. Trotzdem spürte Heinrich hier oben weiterhin die Gefahr. Er durfte nicht mehr lange bleiben. Als es dunkel wurde, packte er seine restlichen Sachen in den Koffer und verschwand in den Straßen der Stadt. Seine kleine Wohnung würde er wohl nicht mehr wiedersehen. Sein Koffer war jetzt hinderlich, aber wo sollte er ihn lassen? All seine Habseligkeiten, Kleider und Zeugnisse waren darin. Die Braunhemden würden wahrscheinlich auch zu seinen Eltern kommen. Bei ihnen konnte er ihn nicht lassen.
Vorsichtig lief er mit seinem Koffer durch die spärlich beleuchteten Straßen. Unauffällig wollte er bleiben – nur nicht erkannt werden. Schon von Weitem bemerkte er, dass etwas beim Haus der Parteizentrale der KP nicht stimmte. Polizei und Braunhemden beherrschten die Szene. Heinrich blieb stehen, als ihn im selben Moment jemand in einen Hauseingang zog. Es war sein Parteifreund Stefan.
„Bist du wahnsinnig, hier aufzukreuzen! Die lochen dich sofort ein. Unsere Partei ist gestern verboten worden und sämtliche Genossen werden verhaftet.“
„Woher weißt du das?“
„Liest du keine Zeitung?“
„Habe kein Geld dafür. Bekomme noch nicht einmal meine Stütze.“
„Hast du wirklich nichts mitgekriegt? Alle Leute reden doch darüber. Es gibt nur noch wenige Parteien.“
„Da habe ich Glück gehabt, dass sie mich gestern nicht geschnappt haben. Ich konnte die Nacht über untertauchen. Meine Wohnung ist durchsucht worden.“
„Wir haben noch unser Versteck. Gehen wir dort hin.“
Im Schutz der Dunkelheit und durch enge Gassen liefen Heinrich und Stefan zum Versteck. Hier in einem alten Verwaltungsgebäude im Industriegebiet zwischen Lagern und Kränen trafen sich die Freunde immer, bevor sie in die Schlacht mit den Braunhemden zogen. Die Luft war rein, ein paar Genossen hatten sich schon eingefunden. Zwei standen Wache.
Heinrich traf auf eine Runde, in der heftig diskutiert wurde. Er erfuhr, wie die Situation wirklich war. Ihnen drohte das, was den anderen schon geschehen war. Es wurde berichtet, dass einige nicht nur eingekerkert, sondern auch erschossen wurden, wegen ihrer angeblichen Weigerung, sich festnehmen zu lassen. Von der Polizei könnten sie keine Hilfe erwarten, war die einhellige Meinung. Die schaute nur zu oder machte sogar gemeinsame Sache mit den Braunen. Sie sprachen über einen aktiven Widerstand mit Waffen, auch über die Möglichkeit auszuwandern. Andere gaben sich der Hoffnung hin, dass alles gar nicht so schlimm wäre und sich wieder beruhigen würde. Heinrich dachte jetzt an sich selbst, nicht an die anderen. Auf einem Tisch lagen ein paar Zeitungen. Sie waren zerlesen und durcheinander. Er nahm sich eine Seite nach der anderen vor. Er konnte nichts über einen erstochenen SA-Mann finden.
„Das sind doch alles Zeitungen von den letzten Tagen. Keine von heute“, stellte er fest.
„Es gibt nur noch die Parteiblätter der Braunen“, gab einer der Anwesenden zur Antwort. „Alle anderen wurden gestern dicht gemacht.“
„Ich muss etwas tun, sonst schnappen sie mich. Aber ins Ausland? Nach Amerika? Nach Russland? Das kommt für mich nicht in Frage. In den Untergrund und mit Schusswaffen kämpfen? Da lebst du nicht lange.“
Heinrich überlegte zum ersten Mal in seinem Leben, dass er etwas Wichtiges entscheiden musste. Er spürte, dass es jetzt Zeit war unterzutauchen. Nur über das Wie war er sich noch nicht im Klaren. Sich zu verstecken, war nicht seine Sache. Er nahm seinen Koffer und ging in die kalte Nacht hinaus. Er drehte den Kragen seiner Jacke nach oben und zog sich die Mütze tiefer ins Gesicht. Sein Ziel war Mareike.
Mareike war an diesem Abend noch mit der Wäsche und nicht mit der Haut ihrer Besitzer beschäftigt. Heinrich durfte hereinkommen. Er stellte seinen Koffer ab und betrachtete die vielen braunen Hemden auf der Leine.
„Wäschst du nur noch für die?“ Sein Ton war vorwurfsvoll.
„Mach mit bitte keine Vorschriften. Ich muss mein Geld verdienen. Hat man dir deines gegeben?“
„Hatte keine Chance. Musste mich den ganzen Tag über verstecken.“ Er erzählte von seinen Erlebnissen.
„Hast du gar nichts gegessen? Ich mache dir ein paar Brote. Und etwas Suppe ist auch noch da.“
Heinrich spürte jetzt den Hunger. Auf seiner Flucht durch die Straßen hatte er ihn vergessen.
„Du kannst dich in Sicherheit bringen. Gehe zur Reichswehr. Dort gibt es noch keine Braunhemden.“ Mareike rührte im Topf die Suppe.
„Woher weißt du das?“
„In meinem Beruf höre ich viel.“
Die Zeiten hatten sich geändert. Jetzt nach Jahren erkannte Heinrich, dass nicht er mit seiner Kommunistischen Partei bei der Bevölkerung ankam. Es waren die anderen, die das Rennen machten. Die versprachen, Ruhe und Ordnung ins Land zu bringen, und ihr Anführer Adolf Hitler stellte Arbeit für jeden in Aussicht. Schlimm für Heinrich: Die Mehrheit des Volkes wählte Hitler. Das Volk hatte nichts dagegen, alle Andersdenkenden wegzuschließen. Für Heinrich war nur eines klar: Er musste verschwinden. Am nächsten Tag war die Sonne noch nicht aufgegangen, da konnte man ihn mit seinem Koffer in Richtung des Musterungsbüros schleichen sehen.
Krieg im Sandkasten
„Schütze Wilkowsky, nehmen Sie endlich Haltung an!“ Der Schmutz rieselte von Heinrichs Uniform. Der Schleifer hatte sie durch Sumpf und Morast, unter Stacheldrahtzäune und über Hindernisse gejagt. Heinrich und seine Kameraden waren müde und hofften, dass sie endlich in die Kaserne zurückdürften. Er blinzelte hinter seinem Helm hervor. Es war Sommer geworden. Er liebte diese Zeit, wenn die Luft warm und hell, der Boden trocken und das Wasser in den Seen und Flüssen angenehm warm geworden war. Als Kinder waren sie aus Königsberg hinausgerannt, in die Wälder, entlang der Flüsse und Seen, und wenn sie Lust dazu hatten, sprangen sie hinein. Er sollte zu Hause auf die Geschwister aufpassen, der Mutter helfen, aber er rannte lieber weg, auch wenn am Abend Mutter und Vater mit ihm schimpften und es auch mal Prügel vom Vater gab, je nachdem, wie er aufgelegt war.
Heinrich Wilkowsky hatte sich gerade noch rechtzeitig freiwillig zum Militärdienst gemeldet und war in die Reichswehr eingetreten. Dieser Schritt war seine Versicherung, dass er von den Nazis weder zusammengeschlagen noch in ein KZ gesteckt wurde. Bis zu jenem Tag, als die Nazis klarstellten, wer die neuen Herren in Lande waren, war Heinrich Mitglied der Kommunistischen Partei gewesen. Die Kommunistische Partei hatte er hinter sich gelassen. Keine Politik mehr, hatte er sich geschworen. Ein Bett und Essen waren ihm hier, bei der Reichswehr, sicher. Dass er gehorchen musste, nahm er in Kauf.
Er nahm Haltung an.
„Durchzählen“, schnauzte der Schleifer und war erst zufrieden, als alle seine Rekruten wieder in Reih und Glied standen.
„Abtreten und zurück in die Kaserne.“ Heinrich entspannte sich, die Gesichtszüge wurden weicher. Er und seine Kameraden liefen zurück zu ihren Baracken. Es war schon später Nachmittag, die Sonne schien aber noch viele Stunden an den Sommertagen hier in Ostpreußen. Er nutzte gerne diese Zeit und fuhr mit dem Rad in die nahe gelegenen Wälder, legte sich an einem der zahllosen Seen auf die Wiese und träumte.
Es war Abend geworden. Heinrich lag auf seinem Bett in der Kaserne und dachte über seine Situation nach.
Die Idee, beim Militär abzutauchen, war gut. Keiner suchte ihn hier. Leider hatten nur wenige ehemalige Genossen die gleiche Idee gehabt, sie waren wie vom Erdboden verschwunden, tot oder im Gefängnis, erzählte man sich. Die wenigen Linken, die auch zum Militär gegangen waren und sich kannten, sprachen miteinander, aber nur hinter vorgehaltener Hand. Sie wollten ihre Vergangenheit nicht an die große Glocke hängen.
Heinrichs Grundausbildung war beinahe beendet. Er hatte sich bei den Pionieren beworben. Vielleicht brauchten sie Schreiner. Und er hatte Erfahrung im Bau von kleinen Booten. Über den Ernstfall machte er sich keine Gedanken. Der letzte große Krieg war noch nicht so lange vorbei. Warum sollte schon wieder ein neuer kommen?
Heinrich hatte seinen Platz bei den Pionieren bekommen. Der neue Ort seines militärischen Verstecks lag fernab der Städte in den Weiten Ostpreußens. Er hatte erreicht, was er wollte. Um ihn herum gab es die Natur, die er so liebte, er hatte sein bescheidenes Einkommen, Wäsche und Essen. Die Aussichten waren gut, dass die nächsten Jahre ihm ein ruhiges Leben bescheren würden. Nur ein Problem war nicht gelöst: Es gab zu wenig Frauen in der Umgebung. Nur am Wochenende konnte er Ausflüge in die weiter entfernte Stadt unternehmen. Und einmal im Jahr machte er sich auf, seine Eltern und Geschwister in Königsberg zu besuchen. Aber schon nach wenigen Nächten verließ er die enge elterliche Wohnung wieder. Vater Wilkowsky zeigte zwar einen gewissen Stolz auf seinen Sohn, kommandierte ihn allerdings sofort wieder herum. Das brauchte Heinrich nun überhaupt nicht.
Vater Otto Wilkowsky war streng. Ein athletischer Mann mit Schnauzbart, so stand neben seiner resolut aussehenden Frau Charlotte bei einem der ersten Fotografen. Stolz zeigte er sich in seiner Kutscheruniform mit seiner Familie. Sohn Heinrich wird das Foto in spätere Generationen hinüberretten. Diese Bilder waren in der damaligen Zeit außerordentlich teuer. Dennoch hatte sich Vater Wilkowsky zu dieser Ausgabe durchgerungen. Mit der Peitsche trieb er seine Brauereipferde durch die Stadt. Mit der Peitsche regelte er Probleme innerhalb der Familie. Das Nichtbefolgen seiner Anweisungen wurde mit Prügel betraft. Die Mutter handelte ähnlich. Ohrfeigen von ihr waren an der Tagesordnung. Heinrich bekam beinahe täglich den Gürtel oder die Gerte zu spüren. Der Vater kam mit seinem Bierwagen viel herum und hörte von den Verfehlungen seines Sohnes. Falls er nichts gehört hatte, so prügelte er dennoch, denn die Wahrscheinlichkeit einer Verfehlung war seiner Meinung nach immer gegeben. Heinrich entwickelte ein dickes Fell. Seine Wut ließ er an seinen Geschwistern aus. Er schrie sie an, wenn etwas nicht so war, wie er es wollte. Spielte einer seiner Brüder auf seiner Matratze, bekam er Schläge. Er stellte somit klar, wer das Sagen bei den Geschwistern hatte. Diese verbündeten sich gegen ihren großen Bruder, was den wenig kümmerte, denn sie verloren meistens. Seinem Vater gegenüber buckelte Heinrich, ebenso bei Behörden und Polizei. Vor seiner Mutter zeigte er Respekt, denn sie hatte eine strenge Hand. Vielen anderen Frauen gegenüber war er respektlos.
Nach einem weiteren Jahr wurde Heinrich Feldwebel. Jetzt war er in seinem Element und durfte die jungen Rekruten bis zur Erschöpfung durch den Sumpf jagen. Stolz, mit durchgedrücktem Rücken und langgezogenem Hals marschierte er voraus, immer der Straße entlang. Er fand Befriedigung darin: Er bekam klare Anweisungen, die er verstand und ausführen konnte, und gab klare Befehle. Heinrich machte alles, was seine Vorgesetzten von ihm verlangten. Sie hatten eine gute Meinung von ihm. Er wurde der ideale Soldat. Er hielt er sich aber auch geschickt zurück, musste nie der Erste sein, der sich für eine freiwillige Aufgabe meldete. Er tat das gerade so oft, dass es nicht auffiel. Er stellte keine Fragen, zweifelte keinen Befehl an. Seinen Geltungsdrang ließ er an den Rekruten aus.
Der Führer der Nationalsozialistischen Partei Adolf Hitler hatte sich inzwischen zum Führer aller Deutschen erhoben. Er hatte sie nicht gefragt, bekam aber die Unterstützung von den meisten, zumindest von denen, die zu seinen Veranstaltungen gingen oder in seine Partei eintraten. Die Sache mit der proletarischen Revolution war, zumindest in seinem Land, den roten Menschen von den braunen ausgetrieben worden. Für Heinrich war damit die proletarische Sache gestorben. Mehr ängstlich als einsichtig, kam er zu dem Schluss:
„Es ist gefährlich, sich zu sehr an eine politische Sache zu binden. Nie wieder werde ich das tun. Das gilt auch für braune oder sonstige Führer, die das Blaue vom Himmel versprechen. Ich glaube nur noch an das, was ich sehe.“
Die Agitatoren der braunen Partei, ausgesandt von ihrem Führer, tauchten jetzt auch bei der Reichswehr, die sich jetzt Wehrmacht nannte, auf. Heinrich fühlte sich von nun an nicht mehr sicher. Sie erzählten etwas vom neuen Nationalstaat, von dem starken Volk und den noch stärkeren Soldaten. Heinrich hörte sich das an, dachte an die schöne Natur um sich herum und stellte keine Fragen.
„Ich brauche kein Parteibuch. Ich habe mein Soldbuch“, antwortete er einmal auf die Frage nach seiner Parteizugehörigkeit. Alles andere behielt er für sich.
Heinrich widmete seine Arbeitszeit den Pionierfahrzeugen. Brücken zu bauen für nachfolgende Militärverbände und Nachschub waren die Aufgaben. Er spornte seine Einheit an. Immer schneller wurden die Brücken gebaut. Das war Heinrichs Verdienst. Bei Manövern war seine Gruppe immer an vorderster Linie und die schnellste. Seine Stimme, militärisch gedrillt, schallte durch die Kaserne, über die Landstraße und das Gelände. Gefürchtet bei den Rekruten, sorgten sein Stechschritt und seine Stimme für die gebührende Disziplin. Dafür bekam Heinrich extra Urlaub, den er in manch fremdem Bett verbrachte. Nach Königsberg ging er nur selten; man kannte ihn dort. Er war sich nicht sicher, ob ihn die Uniform vor Fragen nach seiner Vergangenheit schützen würde. Er blieb in der Provinz.
Und er entdeckte ein neues Talent an sich: Er wurde sparsam. Damit hatte er zum ersten Mal Geld in der Tasche. In der Provinz war vieles billiger.
Heinrich gefiel dieses Leben. Er brauchte sich nicht um viel zu kümmern. Essen musste er nicht einkaufen, geschweige denn kochen, seine Wäsche nicht waschen. So zog er mit seiner Kompanie durch die Lande und übte an den unterschiedlichsten Orten, Brücken auf- und abzubauen. Bald nannten die Offiziere dieses Spiel Manöver. Über die Jahre wurden sie immer mehr Soldaten, marschierten immer öfter und länger. Vermehrt kam neues Kriegsspielzeug wie Panzer und Kanonen hinzu und auch Kampfflugzeuge durften wieder bei den Manövern dabei sein. Viele dieser Waffen waren dem Militär nach Ende des Ersten Weltkriegs verboten worden. Der Nationale Führer setzte sich über dieses Verbot hinweg. Er benannte die Reichswehr in Wehrmacht um. Heinrich gefiel dieses Kriegsspiel. Ein gewisser Stolz schwang mit, wenn er den Rekruten davon erzählte. Er dachte nicht an den Ernstfall. Er dachte nicht, dass dies Teil einer riesigen Vorbereitung sein könnte. Er ahnte nichts von den Plänen des Nationalen Führers. Heinrich kümmerte sich nicht mehr um die große Politik und deren Redner. Dass die Sprecher sich in Ekstase redeten und die Zuhörer frenetischen Beifall spendeten, nahm er am Radio gelassen zur Kenntnis. In seiner Freizeit ergötzte er sich an Familienromanen. Für die Zeitung interessierte er sich weniger.
Die Geheimpolizei des Nationalen Führers tauchte jetzt auch in der Wehrmacht auf. Das machte Heinrich Angst. Ihre Meinungen waren ihm egal. Es war die Vergangenheit, die ihn nicht losließ. Die Männer trugen lange braune Ledermäntel, ließen sich auch von den Offizieren nicht beirren und sagten, dass die Soldaten an den Nationalen Führer glauben sollten und für ihn durch alle Feuer zu gehen hätten. Sie wollten, dass jeder die richtige Einstellung hätte. Dazu führten sie mit jedem ein Gespräch und horchten alle aus, wie ein Arzt seine Patienten abhört. Sie sollten gesund im Sinne der Ideologie sein. Heinrich fürchtete sich vor diesem Gespräch. Sein Name eilte ihm wohl voraus. Seine politische Vergangenheit stand wohl auf irgendwelchen Karteikarten.
„Was ist Ihnen wichtiger, die Kommunistische Weltrevolution oder der nationale Gedanke?“ Thurnbrück genoss seine Macht und ließ Heinrich zappeln. Heinrich riskierte nichts und antwortete:
„Ich bin Soldat und kämpfe für mein Land.“
Der Fragende im langen Ledermantel stellte klar, dass für Heinrich die Kommunistische Weltrevolution hoffentlich vorbei sei. Heinrich stimmte dem zu, weil es auch seiner jetzigen Einstellung entsprach.
Wenn der das von der Kommunistischen Partei weiß, weiß der wahrscheinlich noch viel mehr über mich, überlegte er. Die Gedanken schwirrten ihm durch den Kopf. Es bebte in ihm. Für einen Außenstehenden sah er ruhig aus.
„Noch ein Wort, bevor ich Sie entlasse.“ Thurnbrück sah Heinrich mit einer Mischung von Grinsen und Ernst an: „Auch wenn jemand einen umgebracht hat, so kann er doch seine Taten wiedergutmachen.“
Heinrichs Gesichtszüge entgleisten. Er hatte sich aber sofort wieder unter Kontrolle. Er war sich jetzt sicher, dass der Mann, den er damals von der Straßenbahn aus im Auto gesehen hatte, Thurnbrück war.
„Sie können jetzt in Ihre Baracke zurückgehen.“ Damit war die Befragung beendet. Heinrich verließ das Zimmer. Er hatte Haltung bewahrt. Seine Uniform war durchgeschwitzt. Thurnbrück beobachtete ihn wohlwollend, wie er in gerader Haltung über den Kasernenhof marschierte.