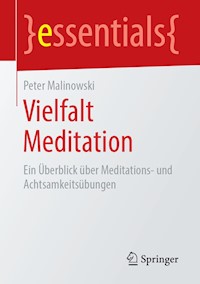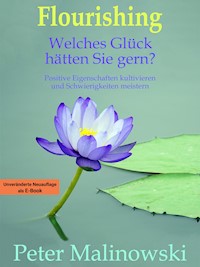
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der neue Glückstrend heißt »Flourishing«, zu Deutsch »Aufblühen«. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Entfaltung menschlichen Potenzials und danach, was ein erfülltes Leben ausmacht. »Flourishing« bedeutet, dass eine Balance zwischen guten und schlechten Gefühlen herrscht. Die Idee ist, positive Qualitäten wie Glück und Zufriedenheit zu kultivieren, um geistig fit zu bleiben. Dabei werden vielfältige Möglichkeiten beschrieben, sich selbst zum »Erblühen« zu bringen. Der international renommierte Psychologe und Achtsamkeitslehrer Dr. Peter Malinowski zeigt in diesem Buch, was sich hinter »Flourishing« verbirgt und wie man es gewinnbringend für sich und andere nutzen kann. Er schlägt dabei gekonnt die Brücke zwischen traditionellem Wissen des Buddhismus und den neuesten Erkenntnissen der Psychologie und Neurowissenschaft. Seine leicht verständlichen Ausführungen illustriert er mit praktischen Übungen und Geschichten. Verknüpfung uralten Wissens mit den modernen Erkenntnissen der Positiven Psychologie und der Neurowissenschaft. Mit wirkungsvollen Übungen zur praktischen Anwendung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Flourishing: Welches Glück hätten Sie gern?
TitelseiteBildnachweisVorwort zur NeuauflageDankeEinleitungTeil 1: Flourishing Kapitel 1: Leben, Freiheit und das Streben nach Glück Kapitel 2: Menschenbilder Kapitel 3: Positive Psychologie Kapitel 4: Was ist Flourishing? Kapitel 5: Welches Glück hätten Sie gern? Kapitel 6: Aufblühen oder Welken Teil 2: Wege zum erfüllten Leben Kapitel 7: Meditation Kapitel 8: Das Verwirklichen menschlicher Qualitäten Kapitel 9: Die eigene Zukunft gestalten Kapitel 10: Schwierigkeiten meistern Kapitel 11: In die Zukunft schauen GlossarLiteratur Ausgewählte Literatur Quellennachweise und weiterführende Literatur Über den AutorImpressumFlourishing
Welches Glück hätten Sie gern?
Positive Eigenschaften kultivieren und Schwierigkeiten meistern
Peter Malinowski
Bildnachweis
Umschlagbild von Jaesung An; Pixabay https://pixabay.com/users/ajs1980518-11074902/
Vorwort zur Neuauflage
Seitdem die erste Auflage dieses Buches vergriffen ist, werde ich immer wieder gefragt, ob es das Buch noch irgendwo zu kaufen gibt. Weil sich dies so häufig wiederholte, habe ich mich entschieden, das Buch in unveränderter Form wieder zur Verfügung zu stellen. Die grundlegenden Aussagen, die philosophisch-psychologischen Hintergründe und insbesondere auch die praktische Ausrichtung stimmen weiterhin. Es sind jedoch mittlerweile mehr als zwölf Jahre seit der Fertigstellung des Buches vergangen. Die wissenschaftliche Forschung in der Positiven Psychologie hat an einigen Stellen noch mehr Details nachgewiesen, sodass einige der Aussagen mittlerweile noch klarer unterstützt werden. Soweit ich mir bewusst bin, sind bisher aber keine neuen Erkenntnisse erwachsen, die meinen Aussagen grundlegend widersprechen würden. Daher denke ich, dass es noch immer gerechtfertigt ist, dass dieses Buch zur Verfügung steht.
Achtsamkeit, Mitgefühl und Vertrauen in grundlegende menschliche Qualitäten sind weiterhin von Bedeutung. Ich hoffe, dass das Buch daher weiterhin nützlich ist.
Liverpool, im Januar 2023
Danke
Für Lili
weil gemeinsam unser Leben erblüht
shoulder to shoulder and back to back
Mit Dank
an alle von denen ich lernen durfte und darf;
von den ersten wackligen Schritten
bis zu den unbegrenzten Qualitäten des Geistes;
insbesondere an meine Lehrer
Hannah Nydahl,
Lama Ole Nydahl
und
S.H. der 17. Karmapa Trinley Thaye Dorje
Einleitung
Die befreiende Kraft des Augenblicks
Nach dreistündigem Anstieg, der nicht nur körperlich anstrengend war, sondern ebenso ein Höchstmaß an Konzentration erforderte, erreichen wir die Bergspitze und ein atemberaubendes Panorama eröffnet sich vor uns – eine Weite und Schönheit, die uns alles vergessen lässt: die pastellenen Töne der kahlen Berggipfel getragen von dem lebendig satten Grün der Täler tief unten, kristallklare Luft und ein beständiger Wind, der die schweißnasse Stirn kühlt; der eigene Blick in fast unendlicher Ferne einen Ruhepunkt findend.
Sicherlich kennt jeder von uns solch erfüllende Momente des bloßen Seins, des nackten Gewahr-Seins, in denen die normale innere Geschäftigkeit zur Ruhe kommt und Erleber und Erlebtes zu einer Einheit verschmelzen. In einem derartigen Moment zeigt sich die Kraft des Augenblicks, ein Erleben, dass geprägt ist von der Intensität der Erfahrung, in der Erwartungen, Hoffnungen und Befürchtungen keinen Platz haben, ein Moment, in dem man, für kurze Zeit, sich selbst vergisst.
Auch wenn Sie kein Liebhaber der Berge sind, kennen Sie sicherlich ähnliche Situationen: Momente völliger Offenheit und Verliebtheit, in denen nur das Glück des Partners eine Rolle spielt; Momente, in denen elterliches Glück und die Liebe für das neugeborene Kind aufwallen und jede Sorge oder geistige Einengung für eine Weile auflösen; ein tiefroter Sonnenuntergang über dem fernen Horizont des offenen Ozeans.
Ob wir uns im freien Fall befinden, bevor sich der Fallschirm öffnet, wir uns mit nur wenigen Fingern in der Felswand festkrallen, oder uns bei romantischem Kerzenschein in den Augen des Gegenübers verlieren, all diese Situationen haben eins gemeinsam: die Erfahrung unermesslichen Reichtums durchdringt uns, wenn wir uns selbst vergessen! Wenn, wie beim Fallschirmspringen, die Intensität der Erfahrung zu groß ist, um an Einkaufsliste oder Überziehungskredit zu denken, wenn unser Gefühl von Verbundenheit jenseits von mein und dein geht, passiert etwas Ungewöhnliches und Überwältigendes: Ein Meer (oder Mehr) an Reichtum wird erfahren.
Sie mögen sagen, „Schön und gut, solche Momente mag es geben – aber letztendlich ist das weit entfernt von meinem Alltagsleben.“ Ich wage zu widersprechen: Verlagern wir den Blick von den verschiedenen Inhalten und Bedingungen derartig erfüllter Momente auf die ihnen zugrunde liegenden Gemeinsamkeiten, so wird ein allgemeines Muster deutlich. Diese Augenblicke der Erfüllung teilen eines miteinander: unsere gewohnheitsmäßigen Gedanken und Vorstellungen treten in den Hintergrund und die volle Kraft der Erfahrung kommt zum Vorschein. Diese Momente ohne Zwar und Falls, ohne Wenn und Aber zeigen uns, dass es möglich ist, einen derartigen Reichtum zu erfahren. Und die beste Botschaft ist: Sie müssen dafür keinen schweren Berganstieg bewältigen und sich auch nicht in viertausend Metern Höhe aus einem funktionierenden Flugzeug werfen! Was diese Momente zum Durchschimmern bringen, ist ein Schatz inneren Reichtums, der in jedem von uns ruht und nur darauf wartet, entdeckt und geborgen zu werden.
Dass unterschiedlich gestrickte Personen unter unterschiedlichen Bedingungen und in unterschiedlichen Situationen derart erfüllende Erfahrungen haben, macht deutlich, dass diese letztendlich nicht von bestimmten Situationen abhängen. Ob wir derartige Momente erleben, hängt vielmehr davon ab, wie sehr wir feste Gewohnheiten und Vorstellungen loslassen können, wie sehr wir uns davon lösen können, etwas sein und darstellen zu müssen, bestimmten Erwartungen zu entsprechen oder unsere eigenen Erwartungen in die Welt und auf unsere Mitmenschen zu projizieren.
Wenn dem so ist, dann geht es, praktisch gesehen, offensichtlich darum, ob sich derartige Erlebnisse kultivieren lassen. Was können wir tun, um mehr Erfüllung zu erfahren? Die Antwort auf diese Frage ist fast ein Paradoxon: Sie werden sicherlich sofort erkannt haben, dass uns eine starke Erwartung solcher Erfahrungen aus dem Reichtum des Augenblicks katapultiert, oder sogar von vornherein verhindert, derartige Erfahrungen zu erleben. Es ähnelt dem Versuch, unseren Gegenüber zu mehr Spontaneität zu bewegen: Die Aufforderung „Sei doch spontan!“ hat, wenn überhaupt, den umgekehrten Effekt! Ebenso ist es schwierig, auf Befehl einzuschlafen. Wenn wir erwarten, einen Zustand frei von Erwartung zu erleben, haben wir also ein Problem. Trotzdem ist es natürlich möglich, spontan zu sein und die meisten Mitmenschen sind auch in der Lage einzuschlafen. Spontaneität zeigt sich ganz spontan, wenn wir uns in einer gegebenen Situation zu Hause fühlen und wir schlafen ein, wenn das nötige Maß an Ruhe, Dunkelheit, Müdigkeit und ein Ruheplatz zusammen kommen. Wenn die richtigen Bedingungen vorhanden sind, ist es also möglich, Zustände, die schwer direkt erzeugt werden können, zu erfahren.
Wie aber kommen wir nun an die Erfahrung von unbedingtem Reichtum und Erfüllung heran? Mein buddhistischer Lehrer, Lama Ole Nydahl, vergleicht die Situation manchmal mit dem Versuch, unser eigenes Glück um einen runden Tisch zu jagen. Wir rennen und rennen, können das Glück jedoch nie so recht erhaschen oder gar festalten. Bleiben wir aber stehen, springt uns das Glück in den Rücken.
Der wichtigste Punkt ist hier Vertrauen! Nur wenn wir wirklich vertrauen können, dass grundlegend positive Qualitäten in unserem Geist ruhen, werden wir es wagen völlig loszulassen, frei von Erwartungen und Befürchtungen für eine Weile innezuhalten.
Was von dem Buch zu erwarten ist
Und damit sind wir mitten im Thema, Flourishing. Können wir uns damit anfreunden, dass es tatsächlich grundlegend gute menschliche Qualitäten gibt, die als Potenzial in unserem Geist liegen, dann bleibt eigentlich nur die Frage, wie wir dahin kommen können, sie auch zu erfahren und zu verwirklichen, sie zum Erblühen zu bringen und unserem Leben tiefste Erfüllung und uns selbst wahres Glück zu bescheren.
Welches Glück hätten Sie gern?
Und wie der Titel des Buches schon nahelegt, haben wir die Wahl. Irgendwie versuchen wir ja alle, Glück zu erreichen. Doch suchen wir es dort, wo wahre Erfüllung zu finden ist? Sind wir überzeugt, dass es etwas Lohnenswertes zu erreichen gibt? Und richten wir unser Leben danach aus, dies auch zu erreichen? Oder vertagen wir es eher, weil vorerst „wichtigere“ Dinge anstehen? Was ist unsere Vorstellung von Glück? Ist es etwas, was einem unvorhergesehen in den Schoß fällt, wie ein Sechser im Lotto, etwas das vielleicht Einer unter Tausend findet? Zerrinnt es zwischen den Fingern, gerade wenn wir glauben, es gefunden zu haben? Oder liegen wir gar daneben, überhaupt nach Glück zu streben? Mein Wunsch ist, mit Ihnen etwas genauer hin zu schauen, welches Glück wir eigentlich meinen und was wir dafür tun können.
Positive Eigenschaften kultivieren und Schwierigkeiten meistern
Praktisch gesehen geht es genau darum: wie können wir positive Eigenschaften, seien es Vertrauen, Liebe, Mitgefühl, Dankbarkeit, Verzeihen oder Solidarität, um nur ein paar Beispiele zu nennen, kultivieren? Und wie helfen uns diese Eigenschaften, Schwierigkeiten zu meistern – Meister unseres eigenen Lebens zu sein, die Kunst des guten Lebens zu verwirklichen und Lebenskünstler im wahrsten Sinne des Wortes zu sein?
Ich möchte Sie mit diesem Buch einladen, die Möglichkeiten zur Entfaltung unseres menschlichen Potenzials zu erforschen, zu untersuchen, was ein erfülltes Leben ausmacht und wie wir dies erreichen können. Ich möchte mit Ihnen meine tiefe Überzeugung teilen, dass wir tatsächlich die Wahl haben, dass wir die Hauptdarsteller in unserem Leben sind und es in der Hand haben, wie glücklich wir sind, wie lebenswert unser Leben ist. In meinem eigenen Leben vereine ich seit vielen Jahren die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus Psychologie und Neurowissenschaften mit uralten buddhistischen Weisheiten. Und ich finde es begeisternd, dass in den letzten Jahren das Thema Flourishing zu einem neuen Trend geworden ist. Mit diesem Buch möchte ich aber auch dazu beitragen, dass es mehr als ein kurzlebiger Trend wird, der kurz aufflackert und dann erlischt. Mir scheint, wir Psychologen sind an einem Punkt angekommen, an dem wir genau die richtigen Fragen stellen können. Was sagt die Psychologie zur Entwicklung menschlicher Eigenschaften? Was passiert da im Gehirn und wie erklären sich die verschiedenen Prozesse aus neurowissenschaftlicher Sicht? Welche bewährten Methoden aus der Psychologie und aus der buddhistischen Schatzkiste können uns helfen, unseren inneren Reichtum zu entdecken und wie lassen sie sich sinnvoll in unseren Alltag integrieren? Beim Versuch der Beantwortung solcher Fragen schlage ich die Brücke zwischen dem traditionellen Wissen des Buddhismus und den neuesten Erkenntnissen der Psychologie und der Neurowissenschaften.
Der erste Teil des Buches führt in die psychologischen Hintergründe ein, gibt einen Überblick über unterschiedliche Verständnisweisen von Glück und erklärt, welche Rolle sie für Flourishing spielen können. Die zweite Hälfte des Buches wird dann viel praktischer. Auf der Grundlage des vorher entwickelten Verständnisses werden wir uns hier gangbare Wege anschauen, wie sich ein Zustand von Flourishing in unseren gelebten Alltag umsetzen lässt. Dabei werden wir auch sehen, dass Flourishing viel mehr ist als nur ein persönlich erfahrenes Wohlbefinden, und dass soziales Flourishing von besonderer Bedeutung ist. Das letzte Kapitel fasst dann alles in ein paar Ratschlägen zur praktischen Umsetzung zusammen.
Teil 1: Flourishing
Kapitel 1: Leben, Freiheit und das Streben nach Glück
Meine persönliche Geschichte mit dem Thema Flourishing und damit auch die Geschichte dieses Buches beginnt im Juni 2009 in Philadelphia – dem Geburtsort der Vereinigten Staaten von Amerika. Hier trat der Begriff Flourishing bewusst in mein Leben. Zweihundertdreiunddreißig Jahre früher, im Jahre 1776, versammelten sich an gleichem Ort Vertreter der dreizehn Kolonien des Kontinents, die unter der Herrschaft des englischen Königshauses standen. Nach mehrjährigem Ringen waren sie entschlossen, die Unabhängigkeit von der Englischen Krone zu erklären. Noch heute wird am 4. Juli, dem Independence Day, dem Unterschreiben und Verkünden dieser Unabhängigkeitserklärung gedacht.
Ich war jedoch nicht nach Philadelphia gekommen, um auf ausgetretenen Pfaden US-amerikanischer Geschichte zu wandeln. Ich war hier, um am Ersten Weltkongress der Positiven Psychologie teilzunehmen. Daher war es dann auch völlig ungeplant, dass der erste Ort, den ich bei meiner Ankunft in Philadelphia wirklich bewusst in mich aufnahm, der Garten der Unabhängigkeit und die Independence Hall war; ein Ort an dem, im wahrsten Sinne des Wortes, Geschichte geschrieben wurde und diese Geschichte noch immer zu atmen schien. An diesem Ort hatten die Vorväter der USA Leben, Freiheit und das Streben nach Glück in ihrer Unabhängigkeitserklärung zu unveräußerlichen Rechten aller Menschen erklärt.
Hier stand ich nun, mehr als zweihundert Jahre später! Während mich die Nachmittagssonne wärmte, wurde mir die Bedeutung dieses Ortes bewusst und ein Schauer der Ehrfurcht und Dankbarkeit lief mir über den Rücken. Für einen Moment trat mir der Wunsch nach Freiheit, Glück und einem selbstbestimmten Leben, für den so viele Menschen gekämpft haben und gestorben sind, so deutlich vor Augen wie selten. War es Zufall, dass sich ausgerechnet an diesem Ort Wissenschaftler und praktizierende Psychologen aus aller Welt trafen, um sich über das Streben nach Glück, eines der zentralen Themen der Positiven Psychologie, auszutauschen?
So war ich kurz nach meiner Ankunft in ganz unerwarteter Weise in das Thema des Kongresses eingetaucht und voller Freude und Erwartung genoss ich dann die Gelegenheit, mit Kollegen zu diskutieren, was ein glückliches und erfülltes Leben ausmacht und in welcher Weise wissenschaftliche Erkenntnisse und deren Anwendung dem Streben nach Glück zuträglich sein können.
Der Kongress mit etwa tausendfünfhundert Teilnehmern aus aller Welt bot reichhaltige Möglichkeit zu Austausch mit gleichgesinnten Kollegen und viele begeisternde Ansätze erweckten mein Interesse. In all der Vielfalt gab es jedoch ein Thema, das mich seitdem nicht mehr loslässt. Hier traf ich zum ersten Mal im psychologischen Umfeld auf den Begriff Flourishing, zu Deutsch »Aufblühen«. Verschiedene Forscher, allen voran Barbara Fredrickson, Felicia Huppert und Corey Keyes, fassen unter diesem Begriff die verschiedenen Aspekte zusammen, die ein erfülltes, lebenswertes Leben ausmachen, definieren es als eine neue Währung der Positiven Psychologie. Mir wurde deutlich, dass diese recht junge Disziplin einen wichtigen Entwicklungsschritt vollzog. Nachdem sie sich in den gut zehn Jahren ihres Bestehens vorrangig mit Glück und Wohlbefinden beschäftigt hat und Begrenzungen der sogenannten Glücksforschung immer deutlicher wurden, verspricht Flourishing eine deutliche Erweiterung. Es geht nicht nur um persönliches, individuelles Glück sondern um Wachstum und Erfüllung, um die Entfaltung unser Fähigkeiten und um unsere Beziehung zu unserer Umwelt, unseren Beitrag zur Gesellschaft. Es geht darum, wie wir, eingebettet in unser soziales Umfeld, eine wirkliche, tiefe Lebensfreude finden und teilen können, ein wirklich lebenswertes Leben schaffen – ein deutlicher Unterschied zu dem oftmals eher vordergründigen Streben nach kurzlebigem Glück und angenehmen Erfahrungen.
Ist auch diese Erweiterung und Vertiefung des Ansatzes der Positiven Psychologie an sich schon spannend und vielversprechend, so regte die Vorstellung des Aufblühens bei mir noch weitere Assoziationen, die deutlich über die eigentliche Thematik des Kongresses hinausgingen. Ich war auch zu dem Kongress gekommen, um meine eigene Arbeit zu der positiven Wirkung von Meditations- und Achtsamkeitsübungen darzustellen und fand nun im Flourishing einen geeigneten Rahmen für die Weiterentwicklung meiner Ideen und Erkenntnisse. Das Bild, das dem Begriff seine Kraft verleiht, war mir zudem sehr vertraut. Im Buddhismus wird die voll entfaltete, aufgeblühte Lotusblüte als Symbol für die unbeeinträchtigte, ungetrübte Natur des Geistes gesehen, aus der sich ein ungeahnter geistiger Reichtum entfalten kann.
In einem Moment wurde mir klar, dass das Thema Flourishing in sich die Möglichkeit bot, die zwei recht verschiedenen Zugangsweisen der Psychologie und der buddhistischen Meditationspraxis in engere Verbindung zu bringen. Im ersten Moment mag dies vielleicht wie eine recht akademische Einsicht anmuten – es ist jedoch viel mehr als das und ich möchte Sie dazu einladen, dies gemeinsam mit mir zu entdecken.
Seit etwa zweiundzwanzig Jahren beschäftige ich mich mit dem Buddhismus und bin bestrebt, die tiefgründigen Methoden und damit verbundenen Einsichten, in mein Leben zu integrieren. Seit ebenfalls etwa zweiundzwanzig Jahren beschäftigte ich mich mit Psychologie, von meinem Diplomstudium in Braunschweig bis zu meiner heutigen Dozententätigkeit an der Liverpool John Moores University. Obwohl ich als Dozent in Psychologie immer mehr Gelegenheiten habe, Erkenntnisse aus Psychologie und Buddhismus in Lehre, Forschung und Mitarbeiterfortbildung zu verbinden, bietet die Idee des Flourishing eine neue integrative Dimension.
Diese neue Dimension, in der die neuesten Erkenntnisse der Psychologie mit den über Jahrtausende erprobten Mitteln des Buddhismus Hand in Hand gehen, ist faszinierend und vielversprechend. Sie eröffnet einen praktischen Ansatz, der sowohl in Wissenschaft als auch tiefgründiger Erfahrung in der Erforschung des Geistes durch Meditation verwurzelt ist und macht ihn leicht zugänglich. Zudem scheint diese Entwicklung eine Aussage Lama Ole Nydahls, des bereits erwähnten bekannten dänischen buddhistischen Meisters, der rund um die Welt einen praktisch lebbaren Buddhismus zugänglich macht, zu bestätigen. Dazu befragt, was er von der Verbindung von Wissenschaft und Buddhismus hält, sagt er häufig: Je besser die Wissenschaft werde, umso buddhistischer werde sie auch. Mit dem Umschwenken auf Flourishing scheint sich dies zumindest für die Positive Psychologie zu bewahrheiten. Ein richtungsweisendes Beispiel bietet die Forscherin Barbara Fredrickson, die buddhistisch inspirierte Mitgefühlsmeditation als Methode zum Flourishing empfiehlt. Wie wir später im Detail sehen werden, konnte sie in einer umfangreichen Studie nachweisen, dass diese Meditation zu einer deutlich messbaren Zunahme an Wohlbefinden führt.
Während die Positiven Psychologie nach wie vor hauptsächlich darauf ausgerichtet ist, die rechte Mischung aus äußeren und inneren Bedingungen zu bestimmen, die Voraussetzung für Lebenszufriedenheit und ein erfülltes Leben sind, geht es mir um noch viel mehr. Es geht darum einen Weg aufzuzeigen, der zu einer wirklichen, verlässlichen inneren Zufriedenheit führt, die nicht in dem Moment zerrinnt, wenn sich innere und äußere Zustände verändern. Das ist das wirklich Besondere, was ich Ihnen mit diesem Buch ans Herz legen und gerne mit Ihnen teilen möchte.
Aus der Tiefe des buddhistischen Schatzes schöpfend geht es bei weitem über die bisher vorhandenen Ansätze der Positiven Psychologie hinaus. Im Mittelpunkt steht jetzt die Entfaltung menschlichen Potenzials und die Frage, was ein erfüllendes Leben ausmacht, ein Leben, das nicht nur frei von geistigen Störungen ist, sondern in dem ein hohes Maß an menschlichen Qualitäten verwirklicht ist. Seit mehr als zweieinhalbtausend Jahren werden buddhistische Meditationsübungen verwendet, um genau dies zu erreichen, alle geistigen Fähigkeiten zu entwickeln, den inneren Reichtum zu entdecken. Diese Mittel haben regelmäßig glückliche Menschen mit erfülltem Leben hervorgebracht, selbst unter einfachsten oder gar widrigsten Bedingungen. Jeder, der schon mal in den Himalayaländern gereist ist und mit der tibetisch-buddhistischen Kultur in Berührung gekommen ist, wird dies bestätigen können!
Die neuesten Befunde aus Hirnforschung und Psychologie weisen dabei immer deutlicher in die gleiche Richtung. Regelmäßige Meditation scheint eine Vielzahl – teilweise sogar erstaunlichen – messbaren positiven Auswirkungen zu haben. Wenn wir von wirklich umfassenden wissenschaftlichen Erklärungen zur Wirkung von Meditationspraxis auch noch weit entfernt sind, ist eins jedoch schon sehr deutlich: In diesem Forschungsgebiet tut sich was! Langsam, aber sicher beginnen die westlichen Wissenschaften zu erkennen, welche Kraft in der Mischung aktueller psychologischer Ansätze mit überlieferten, lang bewährten buddhistischen Methoden liegt. Und zunehmend wird dies mit empirischen Daten untermauert.
Diese Entwicklung macht auch deutlich, dass diese alten Methoden, die fast tausend Jahre lang in den Höhlen und Tälern Tibets bewahrt wurden, selbst in unserer hoch technologisierten Kultur eine Bedeutung finden. Buddhistische Einsichten und westliche Wissenschaften beißen sich kaum.
Kapitel 2: Menschenbilder
Ein Leben in Deutschland, dem Land mit dem fünfthöchsten Bruttoinlandsprodukt der Welt: Er/sie ist berufstätig, lebt wie knapp dreißig Prozent der deutschen Bevölkerung in einer kinderlosen Partnerschaft, ist nicht (noch nicht?) depressiv und schaut durchschnittlich etwa dreieinhalb Stunden pro Tag Fernsehen. Wir Deutschen sind zwar nicht so zufrieden wie die Dänen, die laut Gallupp-Studien die Nationalität mit der höchsten Lebenszufriedenheit sind, zeigen uns aber im Durchschnitt immer noch zufriedener als Bewohner dreiundneunzig anderer Länder, die in diesen Studien untersucht wurden. An siebenunddreißigster Stelle liegend ist das durchschnittliche Wohlbefinden in Deutschland nur wenig geringer als in Kasachstan und auch Länder wie Kolumbien, Trinidad & Tobago und Panama liegen nur wenige Plätze vor Deutschland. Obwohl materieller Reichtum und wirtschaftliche Sicherheit für unsere Zufriedenheit eine Rolle spielen, ist das offenbar nicht alles.
Die Flourishing-Forschung fragt nun: Was gibt es sonst noch? Was macht ein wirklich erfülltes Leben aus? Was sind die Ursachen und Bedingungen für ein erfülltes, glückliches Leben und wie können wir es erblühen lassen?
In der Positiven Psychologie erfreut sich dieser Zugang seit wenigen Jahren zunehmender Beliebtheit, denn er betrachtet jenseits der Untersuchung von kurzlebigen Glückszuständen ein ganzes Potpourri an menschlichen Eigenschaften, Fähigkeiten und Aktivitäten, die zu dem Gefühl, oder besser der Gewissheit, beitragen, ein erfülltes, wirklich lebenswertes Leben zu leben.
Als relativ neue psychologische Strömung hat sich die Positive Psychologie ja zum Ziel gesetzt, ein grundlegendes Ungleichgewicht in der wissenschaftlichen Psychologie auszugleichen. Mindestens seit Ende des Zweiten Weltkrieges beschäftigt sich die Psychologie – von der Sozialpsychologie bis zur Klinischer Psychologie – fast ausschließlich mit Konflikten, Defiziten und Störungen, wie sie wissenschaftlich erklärt und auf dieser Grundlage auch überwunden werden können. Das ist an sich natürlich ein sehr wichtiger, lohnender und lobenswerter Ansatz. Leiden zu verringern, ist zweifellos eine zentrale Aufgabe der Psychologie wie der Medizin. Doch vernachlässigen wir dabei all die guten Dinge unseres Lebens und Erlebens, dann übersehen wir etwas Grundlegendes!
Die Psychologie versteht sich als die Wissenschaft von der Seele, oder etwas neutraler ausgedrückt: als die Wissenschaft vom Geist. Noch näher an der ursprünglichen altgriechischen Begriffsherkunft kann Psychologie als die Lehre vom Atem – im Sinne von „Lebensprinzip“ – verstanden werden. Heutzutage verwendet man wohl am ehesten die Definition, dass sich die Psychologie als die Lehre oder Wissenschaft von Erleben und Verhalten versteht. Aber egal wie wir Psychologie nun genau definieren, ob als Lehre des Lebensprinzips, als Lehre vom Erleben und Verhalten oder vom Geist – wenn sich diese Wissenschaft ausschließlich mit dem beschäftigt, was nicht funktioniert, nur mit Fehlfunktionen, Konflikten, Schwierigkeiten und verschiedenen Formen geistigen Leidens, so fehlt wohl etwas. Die Möglichkeiten unseres Geistes, unseres Erlebens und Verhaltens wären bestimmt nicht vollends erfasst. Es ist dann auch nicht verwunderlich, wenn sich durch eine solche Defizitorientierung ein Menschenbild einschleicht, das etwas Schlagseite hat und uns Menschen als eher fehlerhaft und schwach darstellt.
Die Frage, wie sich derartige, defizitorientierte Menschenbilder ausbilden konnten, welche sozialen und kulturellen Einflüsse dabei eine Rolle spielten und wie sich dies bis in die heutige Zeit auswirkt, ist an sich sehr spannend und aufschlussreich, würde uns hier aber zu sehr von unserem eigentlichen Thema abbringen. Deutlich ist jedoch in jedem Fall, dass die psychologischen Menschenbilder, die insbesondere in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts richtungsweisend waren, zu einer Zeit in der die wissenschaftliche Psychologie einen enormen Aufschwung erfuhr, nicht besonders schmeichelhaft sind. Sigmund Freuds psychoanalytische Triebtheorie beschreibt uns Menschen als von verschiedenen angeborenen Grundbedürfnissen gejagt, die uns in einen ständigen Spannungszustand versetzen, da sie mit den Anforderungen unserer gelebten Wirklichkeit in Einklang gebracht werden müssen. Unser bewusstes Ich ist somit ständig unseren unbewussten Bedürfnissen ausgesetzt und bemüht sich, diese in angemessene, sozial akzeptable Bahnen lenken.
Nicht viel schmeichelhafter ist die zweite Hauptrichtung, der Behaviorismus, der sich in dem Versuch, sich von psychoanalytischen Vorstellungen abzugrenzen, Wissenschaftlichkeit auf die Fahnen geschrieben hat. Der Anglizismus (Behaviorismus bedeutet in etwa „Verhaltenslehre“), deutet schon darauf hin, dass sich dieses Menschenbild in den USA entwickelte. In seiner von Burrhus F. Skinner formulierten Extremform schließt Behaviorismus jegliche Beschäftigung mit inneren, geistigen Prozessen aus und stützt sich allein auf das Studieren der Zusammenhänge zwischen Reizen und dem beobachtbaren Verhalten, das darauf folgt. Verschiedene Lernprozesse führen zur Ausbildung von Reiz-Reaktions-Mustern, die erklären, warum wir uns in einer bestimmten Weise verhalten.
Obwohl diese beiden psychologischen Menschenbilder miteinander wettstritten und in ihren Radikalformen den von außen nicht beobachtbaren psychischen Prozessen entweder sehr viel Bedeutung beimaßen oder diese völlig ablehnten, hatten sie eins gemeinsam: Der Mensch wurde als fehlerbehaftetes oder bestenfalls neutrales Wesen verstanden, das entweder durch Kontrolle der inneren Triebe in Schach gehalten oder durch die rechten Reiz-Reaktions-Kombinationen in Form gebracht werden solle.
Die skizzenhafte Darstellung dieser beiden sehr einflussreichen Menschenbilder ist natürlich übertrieben vereinfacht und recht einseitig. Sie vernachlässigt all die guten, teils revolutionären Impulse, all die nützlichen Einsichten und all die erfolgreichen psychotherapeutischen Situationen, von denen eine Vielzahl an Menschen profitiert haben. All dies konnte sich nur auf Grundlage der Pionierarbeit großer Geister wie Freud und Skinner entwickeln.
Nichtsdestotrotz bleibt festzuhalten, dass weder psychodynamische noch behavioristische Ansätze viel über grundlegend gute menschliche Eigenschaften zu sagen hatten. Dementsprechend war auch das Bild der Psychologie in der Öffentlichkeit nicht besonders positiv.
Ich erinnere mich gut an Situationen, in denen Gesprächspartner etwas betreten reagierten, wenn unsere Unterhaltung darauf kam, dass ich Psychologie studieren würde. Ein gewisses Unbehagen war häufig deutlich zu spüren – so als fühlten sich meine Gegenüber beobachtet, durchleuchtet oder gar durchschaut. Häufig war dies von der Frage begleitet, ob ich denn nun erklären würde, was mit ihnen falsch sei – oder sogar, welche Kindheitstraumen sie zu dem gemacht haben, was sie jetzt sind. Nicht ein einziges Mal in meiner mehr als zwanzigjährigen psychologischen „Karriere“ wurde ich gebeten, etwas über die psychologischen Stärken meines Gegenübers zu sagen, zu erklären was in seinem Leben gut funktioniert oder warum derjenige so glücklich ist. Dies war offensichtlich nicht das Fachgebiet eines Psychologen. Und meine ganz starke Vermutung ist, dass es meinen psychologischen Kollegen nicht viel anders ging. Das gute Leben, menschliche Stärken und Erfüllung – das waren sicherlich keine Themenbereiche unserer Zunft.
Zugegebenermaßen waren menschliche Schwierigkeiten und Probleme auch für mich lange Zeit der ausschlaggebende Antrieb. Meine Entscheidung Psychologie zu studieren, war von dem Leiden motiviert, das ich in meinem direkten Umfeld, in der Gesellschaft allgemein und durch die Medien vermittelt auch weltweit wahrnahm. Nach ein paar Jahren jugendlicher Orientierungssuche wurde mir deutlich, dass wir eigentlich alle nach einem glücklichen, zufriedenen Leben streben, dies aber selten erlangen und, schlimmer noch, für uns selbst und andere häufig mehr Schwierigkeiten als Glück produzieren. Mit der Einsicht, dass die Gründe dafür geistiger Natur sind, war meine Entscheidung dann auch schon gefallen. Ich wollte Psychologie studieren, um geistige Prozesse besser zu verstehen und damit zur Verringerung des Leidens meiner Mitmenschen beitragen zu können.
Als Psychologe entdeckte ich allerdings bald etwas optimistischere Aussichten. Etwas im Schatten von Freuds Psychoanalyse und Skinners Behaviorismus regte sich eine dritte psychologische Zugangsweise, am deutlichsten vertreten von zwei weiteren großen Geistern des zwanzigsten Jahrhunderts, Abraham Maslow und Carl Rogers, die als Begründer der Humanistischen Psychologie gelten. Maslow wurde besonders bekannt durch die von ihm beschriebene Bedürfnishierarchie (siehe Abbildung 1), die menschliches Streben vom Befriedigen grundlegendster Lebensbedürfnisse bis hin zur spirituellen Verwirklichung aufzeichnet und den menschlichen Drang zur Selbstverwirklichung deutlich formuliert.
Rogers wird als Begründer der Humanistischen Psychotherapie in Form von Gesprächspsychotherapie oder auch Klientenzentrierter Psychotherapie verstanden. Beide zeichneten ein deutlich wohlwollenderes Menschenbild, getragen von einem grundlegenden Vertrauen in menschliche Qualitäten. Rogers sprach von Lebenskraft (force of life), einer grundlegenden Neigung zur Verwirklichung der innewohnenden menschlichen Eigenschaften. Als Idealzustand postulierte Rogers das wahre Selbst, ein Ziel das erreicht wäre, wenn all unsere Entwicklungsneigungen in bestmöglicher Weise verwirklicht wären.
Heute werden Maslow, Rogers und die Humanistische Psychologie, die sie vertreten, als Vorboten der Positiven Psychologie verstanden, der Begriff Positive Psychologie selbst wird Maslow zugeschrieben.
Abbildung 1:Maslows Hierarchie der Bedürfnisse oder auch Bedürfnispyramide.
Maslow ging von fünf Bedürfnisebenen aus, die wir versuchen zu befriedigen, wobei höhere Bedürfnisse erst in Angriff genommen werden, wenn die darunter liegenden erfüllt sind.
Kapitel 3: Positive Psychologie
Die offizielle Taufe der Positiven Psychologie musste jedoch noch etwa fünfzig Jahre, bis 1998, warten. Als damaliger Präsident der Amerikanischen Psychologischen Gesellschaft (American Psychological Association) rief Martin Seligman eine Initiative ins Leben, die diesem Zugang seinen Namen gab. Gemeinsam mit Mihály Csikszentmihályi, der insbesondere durch seine Forschung zur Flow-Erfahrung bekannt wurde, war Seligman zu dem Schluss gekommen, dass sich die wissenschaftliche Psychologie zu sehr der Pathologie, dem Erforschen und Behandeln psychischer Krankheitsbilder, verschrieben habe. Positive Anteile der menschlichen Erfahrung würden viel zu wenig Beachtung finden. Ihr Anliegen war daher, diesem Zustand einen neuen Impuls entgegenzusetzen. Die Positive Psychologie war als Sammelbecken all der wissenschaftlichen Ansätze gedacht, die sich mit dem „guten Leben“ beschäftigen, mit menschlichen Stärken, mit Potenzial und Fähigkeiten.
Seligman beschreibt gerne seinen eigenen Erleuchtungsmoment, als in ihm selbst die Einsicht in die Bedeutung menschlicher Stärken erwachte. Diese Geschichte wurde als die „Nikki Story“ bekannt, und da immer wieder auf sie Bezug genommen wird, möchte ich Sie Ihnen hier auch nicht vorenthalten.
Seligman stellt sich selbst als einen ausgesprochenen Nörgler dar, jemanden der nie Zeit hat, stets aufgabenorientiert ist und kaum zu einem Small-Talk in der Lage ist. Demgegenüber sei seine Familie, seine Frau und seine Kinder, sehr lebendig, fröhlich und Mitmenschen gegenüber sehr aufgeschlossen. Eines Tages jätete er, in üblich ernsthafter Weise, im Garten Unkraut. Seine kleine Tochter, Nikki, half ihm dabei, singend, tanzend und das Unkraut in die Luft werfend. Seligman war als ernsthafter Nörgler davon natürlich irritiert und schrie Nikki an. Daraufhin verschwandt sie für ein paar Minuten, kam dann aber zurück und stellte ihn zur Rede. Sie fragte, ob er sich daran erinnere, wie weinerlich und wehleidig sie bis zu ihrem fünften Geburtstag gewesen sei. Jeden Tag hätte sie gejammert und gewimmert. An ihrem fünften Geburtstag hätte sie dann jedoch entschieden, damit aufzuhören. Dies sei das Schwerste gewesen, was sie jemals getan habe. Aber wenn sie, Nikki, dazu in der Lage sei, mit dem Jammern aufzuhören, dann könne er auch damit aufhören, so eine Kratzbürste zu sein!
In diesem Moment kamen Seligman zwei Einsichten. Zum einen, dass Kinder aufzuziehen nicht bedeutet, ihre Fehler und Schwächen zu korrigieren und all das, was mit ihnen verkehrt zu laufen scheint, irgendwie geradezubiegen. Vielmehr ginge es darum, ihre Stärken zu erkennen und zu fördern. Bei Nikki waren diese Stärken unter anderem der rege Wunsch, sich selbst zu verbessern sowie ihre Kraft, ihren Vater zur Rede zu stellen und Gleiches von ihm zu fordern.
In seiner zweiten Einsicht drückt sich das Selbstverständnis der Positiven Psychologie aus. Würden wir, in gewohnter defizitorientierter Weise, Nikki einfach als ein Mädchen beschreiben, das nicht jammert und nicht weinerlich ist, würden wir meilenweit danebenliegen. Überhaupt jemanden nur anhand der Schwächen und Mängel, die er haben oder nicht haben mag, zu beschreiben, würde bedeuten, nur die eine Seite der Medaille zu beachten. All das, was das Leben lebenswert macht, was zum Gelingen beiträgt oder uns Widrigkeiten überwinden lässt, eben die „gute“ Hälfte, bliebe außen vor.
Kurz gesagt, um diese zweite Hälfte, um die andere Seite der Medaille, geht es der Positiven Psychologie, um die sich Seligman in der Folgezeit verdient machte.
Wie manche Kritiker der Positiven Psychologie mögen Sie sich fragen, ob die Ausrichtung auf das gute Leben nicht etwas naiv, überoptimistisch oder einseitig ist, oder es mögen sich gar Erinnerungen an den Modetrend des Positiven Denkens regen. Würde die Positive Psychologie propagieren, sich ausschließlich mit den positiven Seiten des Lebens zu beschäftigen, würde ich einer solchen Einschätzung zustimmen. Positive Psychologie ist jedoch etwas grundlegend anderes als Positives Denken, bei dem wir versuchen, alles Erlebte rosarot anzumalen oder schönzudenken. Und wenn wir es nur richtig machen, so die Erfolgstrainer und Glücksgurus, kommt mit Sicherheit persönlicher Erfolg dabei heraus. Vielen Dank! So funktioniert es sicherlich nicht – leidvolle Erfahrungen werden durch bloßes Schönreden nicht beseitigt. Würde mir jemand in einer schwierigen Lebenssituation mit Schönreden und Positivem Denken ankommen, würde ich ihn sicherlich sonst wo hinschicken. Derartig oberflächliche Westentaschenpsychologie kann mir getrost gestohlen bleiben.
Das Anliegen der Positiven Psychologie ist jedoch keinesfalls Anstrengungen und Erfolge der bisher vorherrschenden, vorwiegend problemorientierten Psychologie zu schmälern. Eine Vielzahl psychischer Störungen lassen sich mittlerweile gut behandeln und sicherlich sind Menschen mit solchen Schwierigkeiten heute in besseren Händen als noch vor fünfzig oder sechzig Jahren. Doch die Frage nach Stärken, Fähigkeiten, nach Wachstum und Erfüllung bleibt trotzdem relevant.
Als Ergänzung zu den bisherigen Hauptströmungen der Psychologie hat die Positive Psychologie etwas Wichtiges beizutragen. Die Frage, ob es möglich ist, aus schwierigen Lebenssituation zu lernen und die Frage, welche persönlichen Qualitäten es Menschen erlauben, aus solchen Situationen sogar mit mehr Kraft hervorzugehen, beschönigt unsere Situation nicht. Vielmehr ermöglicht sie uns, besser zu verstehen, welche menschlichen Eigenschaften dabei helfen können. So können wir uns auf Schwierigkeiten vorbereiten, Strategien und Vorgangsweisen entwickeln und sogar an Krisen wachsen. Ganz dem Motto folgend, dass Vorbeugen besser ist als Heilen, kann ein klares Verständnis dieser Zusammenhänge dazu führen, frühzeitig – und hoffentlich rechtzeitig – die menschlichen Qualitäten zu stärken, die diese Widerstandskraft und Resilienz in uns wecken. Die weitere gute Botschaft ist, dass die Eigenschaften mit dem größten Resilienzpotential sich an sich gut anfühlen und auch, wenn wir nicht in Schwierigkeiten stecken, von Bedeutung sind. Ein gutes, wissenschaftlich abgesichertes Verständnis von echtem Wohlergehen hilft also in beiden Fällen: wenn es uns schon recht gut geht ebenso wie in schwierigen Situationen.