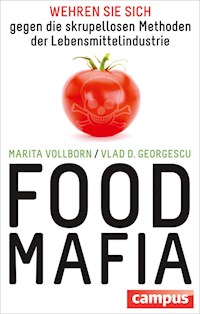Marita Vollborn, Vlad D. Georgescu
Food-Mafia
Wehren Sie sich gegen die skrupellosen Methoden der Lebensmittelindustrie
Campus Verlag Frankfurt/New York
Über das Buch
Die Lebensmittelindustrie betrügt uns nach Strich und Faden. Doch die wahren Ausmaße der mafiösen Strukturen hinter unserem Essen sind uns Verbrauchern noch gar nicht bewusst. Marita Vollborn und Vlad Georgescu decken auf, woher unser Essen kommt und welche Risiken es birgt. Sie geben fundierte Hintergrundinformationen und zeigen, wie wir uns als Verbraucher wehren können und die Kontrolle über unser Essen zurückerhalten.
Über die Autoren
Marita Vollborn und Vlad D. Georgescu sind Buchautoren sowie freie Wissenschafts- und Medizinjournalisten. Beide kennen die Nahrungsmittelindustrie und ihre Produkte gut: Marita Vollborn war als Lebensmitteltechnologin für einen internationalen Konzern tätig, Vlad Georgescu beschäftigte sich als Chemiker mit Schadstoffen und Belastungssubstanzen.
Inhalt
Nahrungsmittel als Geschäft
1 Unersättliche Konzerne
Verbraucherschutz ade
Lebensmitteleinzelhandel – der Lotse in den Abgrund
Die Landwirtschaft in den Fängen des Agrobusiness
2 Nanofood – Verbraucher als Versuchskaninchen
Nanopartikel gefährden die Plazenta
Krebsrisiko – Nanomaterialien außer Kontrolle
Schneller alt dank Nanofood?
Nanopartikel als potenzielle Umweltkiller
Klonfood – so what?
3 Ethik ade – wie Fleischproduktion wirklich funktioniert
Huhn
Ente und Gans
Pute
Mastschwein
Milchkuh
4 Pflanzenbau abstrus
Soja, Reis und Baumwolle als Geschäftsmodell
Gentech-Kartoffel außer Kontrolle
Massives Bienensterben gefährdet die Menschheit
5 Außer Kontrolle – die fehlende Lebensmittelüberwachung
Quecksilberbelastung im Fisch – und keiner bekommt es mit
Null Ahnung – Dioxin als ständige Gefahr
Bio – und gut?
Es geht auch anders – trotz Mangel an Kontrolleuren
6 Die Milch macht’s
Mythos Molke
Milch – Fluch oder Segen?
Milch-ABC nach Verarbeitungsformen
7 Wie können wir uns wehren?
Anders denken – Zukunft braucht Wandel
Anders leben
Anmerkungen
Register
Nahrungsmittel als Geschäft
»Wer die Nahrungsmittelversorgung kontrolliert, kontrolliert die Menschen. Wer die Energie kontrolliert, kontrolliert die Kontinente. Wer das Geld kontrolliert, der beherrscht die Welt.« Henry Kissinger
Die Lebensmittelindustrie bereits im Titel eines Buches mit dem Begriff Mafia in Verbindung zu bringen mag auf den ersten Blick überzogen erscheinen. Und tatsächlich geht es hier nicht um die klassischen Mechanismen der Organisierten Kriminalität. Steckten sie hinter den von uns beschriebenen Machenschaften, könnten wir uns als Verbraucher wohl eher zurücklehnen – bestünde doch die Hoffnung auf funktionierende staatliche Strukturen, die helfen würden, die unlauteren und illegalen Geschäfte zu torpedieren und zu unterbinden.
So aber verbirgt sich hinter der Food-Mafia ein perfides Netzwerk aus Unternehmensvertretern, Lobbyisten, Funktionären und gewogenen Volksvertretern, das mittlerweile weite Teile der Landwirtschafts- und Ernährungspolitik umsponnen hat. Ob Nanofood, Klonfleisch oder die faktisch fehlende Lebensmittelkontrolle, die Food-Mafia bestimmt ohne unser Wissen, was wir essen sollen und was nicht. Dabei nimmt sie die Gesundheitsrisiken der Konsumenten willentlich in Kauf. Und anders als die Akteure der Organisierten Kriminalität tritt die Food-Mafia als Club der Saubermänner in Erscheinung – mit dem Ziel, private und Konzerninteressen mit allen Mitteln durchzusetzen. Denn es geht um sehr viel Geld.
Die deutsche Ernährungsindustrie ist mit einem Umsatz von 175,23 Milliarden Euro in 20131 der viertgrößte deutsche Gewerbezweig nach der Automobilindustrie, dem Maschinenbau und der chemischen Industrie. Wachstumstreiber ist mit einem Anteil von 30 Prozent2 das Exportgeschäft; Deutschland ist der drittgrößte Lebensmittelexporteur |7|am Weltmarkt. Unisono erklären Wirtschaftskapitäne und Spitzenpolitiker Wachstum und Export als Stabilisatoren eines konkurrenzstarken Deutschland. Was sie verschweigen, sind die immensen volkswirtschaftlichen Gesamtkosten und die problematischen Auswirkungen der derzeitigen Agrarproduktion, die unaufhaltsam steigen. So muss die EU, allein um ihren Viehbestand zu ernähren, Unmengen an Soja importieren: Sie nimmt damit in anderen Teilen der Welt rund 35 Millionen Hektar in Anspruch, was ungefähr der Fläche Deutschlands entspricht.3 Der hohe Ressourcenverbrauch der Landwirtschaft auch innerhalb der EU-Länder, die Verschmutzung der Umwelt, die industrielle Tierproduktion mit ihren krankheitsanfälligen Hochleistungsrassen und dem massiven Medikamenteneinsatz lassen die gesellschaftlichen Kosten klettern – Kosten, die, wie die Agrarsubventionen, der Steuerzahler zu decken hat. Und doch hat sich die Politik, eigentlich zuständig für den Erhalt von Werten, für den Schutz sozialer und kultureller Standards, für eine Risikominimierung und für Strategien, die eine langfristige Sicherung der Lebensgrundlagen verspricht, sowohl auf deutscher als auch auf europäischer Ebene in großen Teilen den Interessen der landwirtschaftlichen Großunternehmen und der Ernährungsindustrie verschrieben.
Kaum ein anderer Bereich dokumentiert das Versagen der Politik zum Nachteil der Verbraucher derart augenfällig wie das transatlantische Freihandelsabkommen (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP), das durchaus geeignet ist, demokratische Strukturen auszuhebeln und gewohnte Qualitätsstandards von Lebensmitteln zu minimieren.
Copy & Paste galt nicht nur ehemaligen hochrangigen deutschen Politikern als probates Mittel bei der Erstellung ihrer Dissertationen – Anträge von EU-Abgeordneten entsprechen teils im Wortlaut Lobbypapieren von Firmen und Verbänden.4 Das Übernehmen ganzer Textpassagen in spätere Gesetzestexte garantiert multinational agierenden Unternehmen das Ausräumen etwaiger Unwägbarkeiten und rückt sie dem Ziel der Gewinnmaximierung um jeden Preis ein ganzes Stück näher. Solche Gesetze, die Privatinteressen zu juristischen Verbindlichkeiten festzurren, betreffen mehr als 505 Millionen EU-Bürger und schaden dem so gerne beschworenen Bild einer demokratisch regierten Europäischen Union. |8|
Nicht nur in Deutschland und Europa, auch weltweit fordert die unfaire Ausgestaltung der EU-Agrarpolitik mit ihrem Fokus auf die Steigerung der Produktivität und des Exports zahlreiche Opfer. Subventionen werden ineffektiv verteilt – das Gemeinwohl und der Umweltschutz spielen nur eine untergeordnete Rolle. Hohe Zuschüsse erhalten nach wie vor besonders jene Betriebe, die aufgrund ihrer Größe, ihres Technisierungsgrades oder ihrer Spezialisierung auch ohne Beihilfen überleben könnten; bestehende Ungleichgewichte werden somit nicht ausgeglichen, sondern verstärkt. Darüber hinaus stören subventionierte Exporte die Weltmärkte. So verschärfen sich die Probleme, die mit dieser einseitigen ökonomischen Ausrichtung der eigentlich multifaktoriellen Landwirtschaft verbunden sind:5 Das Höfesterben setzt sich unvermindert fort, das Einkommen eines europäischen Landwirts beträgt durchschnittlich nur noch 33 Prozent des eines Arbeiters6, die Beschäftigungszahlen in der Landwirtschaft schwinden so kontinuierlich wie die Erzeugerpreise für Agrarprodukte, die Massentierhaltung fordert ihren Tribut, Umweltprobleme wie das Schrumpfen der Artenvielfalt, die mangelnde Qualität von Oberflächengewässern und der Rückgang der Bodenfruchtbarkeit nehmen zu, Verbraucherinteressen nehmen Schaden, und statt Hunger und Armut in der Welt zu bekämpfen, zerstört die Agrarpolitik der EU die Existenz zahlreicher Bauern in den Entwicklungsländern, weil diese ihre Erzeugnisse nicht zu jenen Preisen der aus Steuermitteln finanzierten europäischen Dumpingprodukte anbieten können.
Natürlich stellt sich bei all dem die Frage, inwiefern es gerechtfertigt ist, den Ernährungssektor mit derart hohen steuerfinanzierten Summen zu subventionieren, zumal nicht deutlich wird, welche gesellschaftliche Leistungen er erbringt. Allein 2013 vergab die EU insgesamt 6,2 Milliarden Euro Direktzahlungen, darunter wiederum an umstrittene Firmen wie den Chemieriesen BASF, die Energiekonzerne Eon und RWE sowie den Panzerbauer Rheinmetall.7 Und wieder kassierten die Größten am meisten: die Agrargenossenschaft Rhönperle (Thüringen) etwa drei Millionen Euro, ebenso wie einer der großen deutschen Eierproduzenten, der Spreenhagener Vermehrungsbetrieb für Legehennen. Außerdem durften sich Zuckergigant Südzucker über mehr als zwei Millionen Euro und das Deutsche Milchkontor, stärkster deutscher Mol|9|kereikonzern, über 700000 Euro freuen.8 Zwei Prozent aller Betriebe verwöhnte die EU mit 30 Prozent der Gesamtsumme; drei Viertel aller Subventionsempfänger mussten sich mit erheblich weniger zufrieden geben – etwa 290 Euro pro Hektar.9 Nicht mehr als »eine Art Hartz IV für Bauern«10 sind die Subventionen für kleinere Betriebe. Die Einführung einer Obergrenze für die Flächengröße, ab der keine EU-Mittel mehr gewährt werden, lehnte die EU ab, sodass vor allem Besitzer großer Flächen mit über tausend Hektar profitierten. Doch welchen Beitrag leisten die Nutznießer der Steuermittel zur Lösung der anstehenden gesellschaftlichen Probleme, an denen sie überdies eine Mitverantwortung tragen? Und: Bekommen die Verbraucher im Gegenzug die Art von Landwirtschaft und Lebensmittelerzeugung, die sie wollen?
Angst, Verunsicherung und Täuschung sind die Mittel, die die Interessenvertreter des Agrobusiness nutzen, um ihre Ziele der Profitmaximierung und der Rechtfertigung des bestehenden Systems durchzusetzen. Sie suggerieren Verbrauchern, dass nur die aktuelle Lebensmittelerzeugung mit ihrer zweifelhaften Wachstums-Vigilanz den Lebensstandard halten und weiter steigern kann. Andernfalls drohten Preisanstieg, Versorgungsnot und, infolge der nachlassenden Wirtschaftsleistung Deutschlands, Einkommens- oder gar Arbeitsplatzverlust. In Anbetracht solcher Szenarien fügen sich viele Konsumenten und nehmen in Kauf, was sie im Gros doch ablehnen. Findige Marketingstrategen der Agrar- und Lebensmittelindustrie haben längst einen Weg gefunden, diese Ambivalenz im Sinne der Unternehmen aufzulösen. In Fernsehspots und Hochglanzanzeigen malen sie das Bild der perfekten Idylle, um ihre industriell erzeugten Produkte an den Mann oder die Frau zu bekommen: Da weiden glückliche Milchkühe auf kräutersatten Blumenwiesen, rühren Dorfschönheiten in fruchtstrotzenden Joghurtcremes oder werkeln putzige grüne Zwerge zwischen Wäldern an knallgrünen Erbsenschoten; die Zusatzbezeichnung »Land« für Milchprodukte, Wurst oder Käse hat Hochkonjunktur. Diese Strategie der Irreführung wird politisch nicht nur geduldet, sondern auch unterstützt. So erlaubt die beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) angesiedelte staatliche Lebensmittelbuch-Kommission, in der neben Vertretern aus der Lebensmittelüberwachung, aus Wissenschaft und Verbraucherorganisationen auch solche aus der Lebens|10|mittelbranche sitzen, derartige Produktbezeichnungen. Entsprechend dürfen nach wie vor Teeverpackungen mit Mirabellen oder Birnen bedruckt werden, obwohl sie nicht die Spur dieser Früchte enthalten, darf Zitronenlimonade so heißen, auch wenn sie keine Zitrone enthält, und darf »Alaska-Seelachs« lediglich aus gefärbtem Lachs-Ersatz bestehen.11
Zahlreiche, vor allem konservative und liberale Politiker fühlen sich nach wie vor den finanzstärksten und einflussreichsten Unternehmen und Verbänden verpflichtet: unter anderem dem Deutschen Raiffeisenverband (DRV) und dem Deutschen Bauernverband (DBV). Damit sichern sie sich nicht nur einen erklecklichen Nebenverdienst, sondern verschaffen der Agrarindustrie Gehör und Einfluss auf höchster politischer Ebene. Ohnehin ist der Deutsche Raiffeisenverband (DRV) auf dem besten Wege, den gleichen massiven politischen wie wirtschaftlichen Einfluss zu gewinnen wie sein Pendant in Österreich schon heute besitzt, wo er bereits demokratiegefährdende Strukturen aufweist.
Die Ernährungswirtschaft fürchtet zu Recht den Konsumenten als Wolf im Schafspelz: Er hat die Macht, eine Agrarwende herbeizuführen und die Industrie zum Einlenken zu bewegen. Daher ist dieses Buch auch ein Buch für engagierte Menschen: Wir zeigen Beispiele, wie man sich gegen die Food-Mafia wehrt – und warum es wichtig ist, über die Änderung seines Kaufverhaltens hinaus für einen Wandel in der Lebensmittelproduktion zu kämpfen.|11||12|
1 Unersättliche Konzerne
Wer George Orwells Roman 1984 kennt, der dürfte sich angesichts der fortschreitenden Oligopolbildung in der Lebensmittelbranche an den »Großen Bruder« erinnert fühlen. Allerdings ist im Gegensatz zu Orwells erdachten Auswüchsen einer Schicksal spielenden gesellschaftspolitischen Allmacht unsere heutige Welt durch mehr oder weniger freiwillige Realitäten gekennzeichnet, die wohl auch der Schriftsteller nie für möglich gehalten hätte: auf der einen Seite die bis zu einer wirtschaftlichen Exekutive wuchernde Präsenz global agierender Konzerne, auf der anderen Seite der zu Wachstumshörigkeit erzogene Konsument, der seinem Kauflaster freudig durch Schnäppchenjagden frönt und weder die Entscheidungen seiner gewählten Volksvertreter noch jene der Wirtschaftsbosse und Verbandsfunktionäre infrage stellt. Denn längst geht es nicht mehr nur um einzelne Unternehmen, deren Geschäftspraktiken fragwürdig sind, sondern um Monopolisten, die in einem weltweiten Netzwerk von Tochterunternehmen und Beteiligungen versponnen sind und sich über alle Branchengrenzen hinweg einverleiben, was Maximalprofite verspricht, ohne je für die negativen Begleiterscheinungen dieser ressourcenfeindlichen Expansion zur Rechenschaft gezogen, geschweige denn zur Kasse gebeten zu werden.
Die enorme Markenvielfalt in den Supermarktregalen täuscht darüber hinweg, dass die gesamte Nahrungsmittelkette längst ein Opfer der Monopolisierung geworden ist. Eine Studie der OECD kam bereits 2003 zu dem Schluss, dass in Zukunft »nur vier oder fünf Supermarktketten … international tätig sein« und »20 bis 25 multinationale Unternehmen … den Lebensmittelsektor weltweit dominieren« werden.12
[Bild vergrößern]
Tabelle 1: Weltmarktanteil der zehn größten Konzerne
Quelle: Susanne Gura, »Agropoly. Die Macht der Konzerne über die Lebensmittelproduktion«, Hirschluch, 15.10.2011
Beherrschen einige wenige Unternehmen den Markt, schränkt das auch die freie Wahl der Verbraucher ein: Weil er keine Unterschiede innerhalb der Produktgruppen feststellen kann, wird er auch nicht nach bestimmten Kriterien wie Herstellungsmethoden, Zutaten, Umwelt- |13|oder Tierwohlaspekten auswählen können. Verschleiern gehört zu einer der wesentlichen Strategien der Branche. Obwohl sie das Gegenteil beteuern, haben die Konzerne keinerlei Interesse an gut informierten Konsumenten. Schließlich verdienen sie ihr Geld mit dem Versprechen der Gaumenfreuden ohne Reue und ohne negative Folgen: Pro Jahr setzen beispielsweise allein Nestlé, Unilever, Danone, Friesland/Campina und der Fleischkonzern Vion zusammen 140 Milliarden Euro um.13 Oxfam, ein Verbund aus verschiedenen Hilfs- und Entwicklungsorganisationen, der sich für eine gerechtere Welt ohne Armut einsetzt, errechnete für die zehn weltgrößten Lebensmittel- und Getränkehersteller14 Einnahmen von zusammen mehr als 1,1 Milliarde Euro pro Tag. So kann sich Coca Cola rühmen, dass in jeder Sekunde 19400 Softdrinks konsumiert werden.15
Die Politik macht sich immer häufiger zum Büttel der Großindustrie, ob durch entsprechende Entscheidungen oder durch die freigiebige Vergabe von Subventionen. Beispielsweise zählen zu den größten Profiteuren von Exportsubventionen Zucker-, Milch-, Fleisch- und andere Lebensmittelkonzerne wie Vion (6,7 Millionen Euro), Südzucker (35 Mil|14|lionen Euro), August Storck (3,3 Millionen Euro), Tönnies-Fleisch (2,7 Millionen Euro), Nordmilch (1,8 Millionen Euro), Kraft Foods (250000 Euro), Zott und Nestlé (je 250000 Euro) sowie das unter anderem in der Verwertung pflanzlicher und tierischer Restprodukte tätige Familiengroßunternehmen Rethmann (2,6 Millionen).16 Statt die Millionen an Steuergeldern Millionären zu schenken, könnte sich die Politik für eine grundlegende Umverteilung von Agrarsubventionen einsetzen, um die Landwirtschaft umweltfreundlicher und die Tierhaltung artgemäßer zu gestalten und dafür zu sorgen, dass Bauernhöfe mit vielen Arbeitsplätzen überlebensfähig bleiben.
Ohnehin bewegen sich Lebensmittelkonzerne oft auf moralisch wie ethisch dünnem Eis. Immer wieder werden sie von Verbraucherschützern wegen ihrer aggressiven Werbung gerügt oder aufgerufen, sich mehr und ehrlicher um gesundheitliche Aspekte in der Nahrung zu kümmern. Der Grat zwischen Übertreibung und Irreführung ist oft sehr schmal; besonders umstritten sind gesundheitsbezogene Werbeaussagen und das Umgarnen von Kindern. Vor allem die rapide Ausbreitung von Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Schlaganfall, bestimmten Krebsarten und Herzkrankheiten, die eine starke ernährungsphysiologische Komponente haben, bereitet Medizinern zunehmend Sorgen und belastet die Gesundheitssysteme. Grund genug für ein internationales Wissenschaftlerteam, die Zusammenhänge zwischen Konsum und Krankheit zu untersuchen. Jüngsten Schätzungen zufolge starben 2010 34,5 Millionen Menschen an nichtübertragbaren Krankheiten, bis 2010 könnten es bereits 50 Millionen Tote sein. In ihren Ergebnissen, die sie im renommierten medizinischen Fachblatt The Lancet veröffentlichten, kommen die Forscher zu dem Schluss, dass internationale Lebensmittelkonzerne mit ihren Produkten als maßgebliche treibende Faktoren für diese Epidemie mitverantwortlich sind, während sie gleichzeitig vom steigenden Verbrauch dieser ungesunden Nahrungsmittel profitieren. Die Lebensmittelindustrie als »Menschen-Mäster«? Das Urteil der Forscher ist eindeutig: Die Konzerne untergraben systematisch die Gesundheitspolitik und wenden die gleichen Methoden an wie die Tabakindustrie.17 Sie erklären die bisherige Strategie der Selbstverpflichtung und Aufklärung für gescheitert. Auch mit den Großkonzernen über Obergrenzen von Zucker, Fett und Salz in ihren |15|Produkten zu verhandeln halten sie für sinnlos: »Eine Selbstverpflichtung ist, als würden Sie Einbrecher damit beauftragen, ein Türschloss einzubauen«, schreiben sie.18
Als es 2010 darum ging, europaweit Produkte hinsichtlich ihres Zucker-, Fett- und Salzgehalts mithilfe einer Lebensmittel-Ampel klar zu kennzeichnen, setzte sich die Industrie durch. Das EU-Parlament knickte ein und votierte gegen die Ampel, obwohl es sich dabei um ein leicht verständliches System handelte: Grün sollte dem Verbraucher zeigen, dass wenig Zucker, Fett oder Salz enthalten sind, gelb sollte für einen mittleren und rot für einen hohen Gehalt stehen. 2009 hatten die gesetzlichen Krankenkassen die Bundesregierung und die zuständigen EU-Parlamentarier in einem Brief aufgefordert, sich für das Ampel-System stark zu machen: »Die Intransparenz über die Zusammensetzung eines ständig wachsenden Lebensmittelangebots und die hinzukommenden irreführenden Werbeversprechen der Hersteller konterkarieren unser Engagement für einen gesunden Lebensstil«, schrieben sie in einem offenen Brief.19 Als wirkungsvoller als eine Gesundheitsreform schätzte die Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) die Lebensmittel-Ampel ein. Sie hatte Eltern nach ihrem Wissen über Getränke befragt und festgestellt, dass nur knapp ein Viertel den Zuckergehalt von Cola und anderen Softdrinks korrekt beurteilte. Auch wünschten sich mehr als 90 Prozent aller Eltern eine einfache Kennzeichnung, um auf den ersten Blick erkennen zu können, was gut für ihre Sprösslinge ist. Allein in Deutschland verursachen ernährungsbedingte Krankheiten 70 Milliarden Euro pro Jahr, gab die AOK zu bedenken. Wenige Monate nach den Krankenkassen ersuchten auch der deutsche Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte sowie die Vereinigung der europäischen Kinderärzte bei den Politikern um ihren Einsatz im Dienste der Gesundheit: »Wir bitten Sie dringend, nicht nur die Interessen der Nahrungsmittelindustrie zu unterstützen.«20 Doch umsonst – die Konzerne trugen den Sieg davon. Wieder einmal hatte sich für sie der massive monetäre Einsatz gerechnet: Eine Milliarde Euro hatte die Branche nach eigenen Angaben in den Feldzug gegen die Ampel gesteckt. Die Fraktionen von CDU/CSU und FDP hatten die Argumente der Industrie sowohl in den internen Verhandlungen als auch in den Ausschusssitzungen permanent wiederholt21; die Berichterstatterin Renate Sommer (CDU/EVP) hatte die Ar|16|gumentationslinie der Industrie fast im Wortlaut übernommen.22 Das verwundert nicht weiter, betrachtet man die Front an Lobbyisten, die in Brüssel für die Sache ihrer Brötchengeber kämpft: 15000 bis 30000 Mann zählt das Lobby-Heer, was bedeutet, dass auf einen EU-Parlamentarier zwischen 20 und 40 Lobbyisten kommen.23 Siebzig Prozent davon vertreten die Interessen von Unternehmen und Wirtschaftsverbänden. Sie bezahlen nicht nur professionelle Lobbyagenturen dafür, in die Politik einzugreifen, kritisiert der gemeinnützige Verein LobbyControl, auch genießen sie privilegierte Zugänge zu den Kommissaren, beeinflussen Richtlinien, bevor diese überhaupt entstanden sind, und überhäufen die Abgeordneten mit ihren Änderungsanträgen für Gesetzesvorlagen. Zu den bewährten Mitteln zählen neben der Inanspruchnahme spezialisierter Anwaltskanzleien die sogenannten »Denkfabriken« (»Think Tanks«), Institutionen also, die durch Erforschung und Bewerbung bestimmter Konzepte und Strategien Einfluss auf die Meinungsbildung nehmen. Solche »Denkfabriken«, die als Stiftung, Verein, GmbH oder informelle Gruppe organisiert sein können, beschäftigen helle Köpfe: Fachleute aus den jeweiligen Bereichen, darüber hinaus Werbe- und Kommunikationsprofis. Eine bekannte »Denkfabrik« der Lebensmittelindustrie auf europäischer Ebene ist zum Beispiel das European Food Information Council.24 Für die ehemalige Bundesverfassungsrichterin Christine Hohmann-Dennhardt ist besonders das Subtile am Lobbyismus kennzeichnend: Sich die Gunst von Politikern und Journalisten zu erkaufen gehöre ebenso dazu, wie einzelne Experten bis hin zu ganzen Kommissionen zu stellen. Dass der in barer Münze veräußerte Sachverstand von Eigeninteresse geleitet ist oder dass das staatliche Interesse mit dem privaten Interesse von Unternehmen gleichgesetzt wird, führten dazu, dass es immer undurchsichtiger werde, wer eigentlich der Urheber welcher Gesetzesentwürfe ist.25
Wenn es ums große Geldverdienen geht, greifen Konzerne mitunter auch zu gesetzeswidrigen Praktiken. Nur selten werden solche Methoden publik – und falls doch, handelt es sich meist um Insiderinformationen. So geschehen 2011 und 2013, als Großunternehmen der Lebensmittelbranche Preisabsprachen getroffen hatten und erwischt wurden. 2011 hatten dem Bundeskartellamt zufolge Dr. Oetker, Kraft und Unilever durch einen unzulässigen Informationsaustausch den |17|Wettbewerb unter anderem bei Süßwaren, Speiseeis und Tiefkühlpizza beeinträchtigt: Über Jahre hinweg hatten sich Firmenvertreter in einem regelmäßig stattfindenden Gesprächskreis getroffen, um sich gegenseitig über den Stand und den Verlauf von Verhandlungen mit großen Einzelhändlern auszutauschen. Dabei seien auch beabsichtigte Preiserhöhungen zur Sprache gekommen – Grund für das Kartellamt, Bußgelder in Höhe von 38 Millionen Euro zu verhängen. Als Kronzeuge trat der Süßwarenhersteller Mars auf.26 Im Zuge der Ermittlungen wurden die Kartellwächter offenbar noch bei anderen Firmen fündig, denn zwei Jahre später verhängte die Behörde Bußgelder in Höhe von 60 Millionen Euro gegen elf weitere Unternehmen, darunter die großen Süßwarenhersteller Nestlé (»Kitkat«, »Lion«), Kraft Foods (»Milka«, »Toblerone«), Haribo und Ritter Sport sowie gegen Mitglieder des Arbeitskreises Konditionenvereinigung des Bundesverbandes der Deutschen Süßwarenindustrie. »Statt einer unternehmerischen Lösung entschied man sich … für ein illegales Vorgehen«, kommentierte das Kartellamt die Preisabsprachen.27
Es gibt nichts, das man nicht kaufen kann – am allerwenigsten Meinung. Das machten die Lebensmittelgiganten 2012 in den USA vor, als sie Agrarkonzerne ins Boot holten, um gegen die Kennzeichnung von Gentech-Zutaten in den USA zu Felde zu ziehen. Während die Gegner lediglich mit einem Budget von acht Millionen US-Dollar aufwarten konnten, ließen es sich Nestlé, Coca Cola, PepsiCo, Monsanto, BASF, Bayer und andere rund 40 Millionen US-Dollar kosten, die Bevölkerung vor einer Kennzeichnung des Genfood zu warnen: Die Lebensmittel würden erheblich teurer werden, weil die Verbraucher den höheren Aufwand für eine Trennung von gentechnisch veränderten und konventionellen Nahrungsmitteln bezahlen müssten – und das, obgleich die Produkte völlig unbedenklich wären.28 Die aggressive Medienkampagne brachte in Kalifornien den erhofften, wenn auch knapp errungenen Erfolg. Dort stimmten 47 Prozent der Bevölkerung für eine Kennzeichnung, 53 Prozent sprachen sich dagegen aus. Nichtsdestotrotz einigten sich ein halbes Jahr später Republikaner und Demokraten im Bundesstaat Connecticut darauf, eine Gentech-Kennzeichnung einzuführen. Allerdings wird das Gesetz nur dann in Kraft treten, wenn noch mindestens vier andere Bundesstaaten ein ähnliches Gesetz er|18|lassen – eine Hintertüre für die Unternehmen also und für die Politiker eine Möglichkeit, dennoch ihr Gesicht zu wahren. Denn Umfragen in den USA zufolge sind 72 Prozent der Bürger für eine Kennzeichnung29, ein klares Votum gegen Gentech im Essen. Falls das Gesetz umgesetzt werden sollte, wäre Connecticut der erste US-Bundesstaat, der auf Produkten mit gentechnisch veränderten Zutaten den Zusatz »Produced with Genetic Engineering« vorschreiben würde. Im November 2013 schließlich folgte eine Abstimmung im US-Bundesstaat Washington nach ähnlichem Muster wie zuvor schon in Kalifornien und Connecticut. Bis wenige Tage vor dem Entscheid hatten die Befürworter der Label it-Initiative vorn gelegen, doch die Geldwelle von Monsanto, DuPont Pioneer, Dow AgroScience, Bayer CropScience und anderen überrollte die Argumente der Gegner: 22 Millionen US-Dollar hatten die Konzerne in die Anti-Label-Kampagne gepumpt; acht Millionen konnten die Fürsprecher aufbringen. Hätten die Konzerne unterlegen, wäre wohl eine USA-weite, verpflichtende Kennzeichnung unausweichlich gewesen.30
Die Volksentscheide in den USA zeichnen ein ganz anderes Bild, als es europäische Medien gerne kolportieren: Ganz offensichtlich ist ein großer Teil der amerikanischen Verbraucher nämlich keineswegs eine tumbe Masse konsumsüchtiger Schwergewichtler, sondern durchaus kritischen Denkens fähig und nicht gewillt, sich von Nahrungsmittel- und Agrokonzernen Kaufentscheidungen diktieren zu lassen. Das Thema ist stark ins Bewusstsein der amerikanischen Esser gerückt und lässt sich nicht mehr ignorieren. Es ist durchaus denkbar, dass andere Supermarktketten nachziehen, nachdem die weltweit größte Öko-Kette Whole Foods angekündigt hatte, bis 2018 eine Gentech-Kennzeichnung für ihr gesamtes Sortiment einzufordern.
Die Saatgut- und Food-Multis setzen alles daran, Konsumenten die Augen zu verbinden und über die Gefahren der Gentechnik den Mantel des Schweigens zu decken (siehe Kapitel 4). Ihr Etappensieg in den USA kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass ihnen überall auf der Welt ein scharfer Gegenwind entgegenbläst. Dass dieser nicht nur an ihrem Sauberkeits-Image rüttelt, sondern auch an ihrer Omnipotenz zweifeln lässt, zeigen schon die mächtigen Allianzen, derer sich die Konzerne bedienen müssen, um gegen »Verbrauchers Wille« vorzugehen. Heute sind es 64 Länder, für die sie ihre Export-Lebensmittel mit |19|einem entsprechenden Label kennzeichnen müssen, falls sie gentechnisch veränderte Zutaten enthalten – und morgen?
Verbraucherschutz ade
Transatlantisches Freihandelsabkommen: Konzerninteresse contra Verbraucherrechte
Öffentlichkeit unerwünscht: Schon das sollte skeptisch stimmen. Hinter verschlossenen Türen verhandeln allein Privilegierte über das Transatlantisches Freihandelsabkommen (Transatlantic Trade and Investement Partnership, TTIP) zwischen der EU und den USA. Sechzig Experten sollen zu den Gesprächsrunden in Brüssel geladen sein. Wer diese Leute sind und nach welchen Kriterien sie ausgesucht wurden, erfährt offiziell niemand. »Wir wissen aus internen Dokumenten der Europäischen Kommission, dass sie sich in der wichtigen Phase der Verhandlungsvorbereitung fast ausschließlich mit Konzernen und ihren Lobbygruppen getroffen hat«, sagt Pia Eberhard von der Gruppe Corporate Europe Observatory,31 die sich die Überwachung von Lobbyisten zum Ziel gemacht hat. Geheimniskrämerei ist oberstes Gebot. Einem Beschluss32 der EU-Kommission zufolge sind alle Verhandlungsleitlinien »EU-restricted«, was bedeutet, dass nur oberste Bundes- und Landesbehörden darauf zugreifen dürfen.33 Ausgeschlossen hat der Rat auch, dass die Öffentlichkeit informiert werden darf. Nur wenn er sich eines anderen besinnt und einstimmig für die Veröffentlichung votiert, können Bürger wie Parteimitglieder oder Wissenschaftler Kenntnis erhalten.34 Eine solche Entscheidung lässt allerdings bislang auf sich warten, und auch die Bundesregierung, die sich durchaus für Transparenz einsetzen könnte, scheint keinerlei Interesse daran zu haben, sich in die Karten schauen zu lassen. Öffentlich gibt sich die EU als Verteidigerin Europas, erkennt aber ihren Bürgern Mündigkeit ab. Ein solches Vorgehen belastet das Vertrauen der Bevölkerung sowohl in die Regierungen als auch in die EU, erweckt es doch den Eindruck einer Hinterzimmerpolitik, die sich den Argumenten von Lobbyisten öffnet, jenen der NGOs |20|und Bürgern aber verschließt. Stattdessen werden Bekenntnisse allgemeiner Natur und Durchhalteparolen verbreitet: Propaganda, die das Ganze in keinem besseren Licht erscheinen lässt. So wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht müde, vor einem Scheitern des TTIP zu warnen.35 »Ein solches Freihandelsabkommen wäre ein Riesenschritt nach vorne, der auch Wachstum in allen Bereichen fördern und neue Arbeitsplätze schaffen würde«, wird sie auf den Seiten der Bundesregierung zitiert36, »Deshalb haben wir uns vorgenommen, diese Verhandlungen schnell zu beginnen und auch sehr ambitioniert zu führen.« Das TTIP soll die größte Freihandelszone der Welt schaffen. Der Handel zwischen den Staaten soll erleichtert werden, indem Zölle und andere Hemmnisse abgebaut werden. Was kaum kommuniziert wird: Bereits heute sind die Zölle mit 2,8 Prozent für den Industriesektor37 und für andere Bereiche mit durchschnittlich rund vier Prozent ohnehin niedrig. Worum es in erster Linie geht, sollte nachdenklich stimmen, denn zur Disposition stehen vor allem die Standards im Verbraucher-, Umwelt- und Datenschutz, zur Produktsicherheit und zu Arbeitnehmerrechten.
Die Befürworter und Unterstützer des TTIP berufen sich auf Studien, wie sie die Bertelsmann Stiftung beim Münchner ifo-Institut in Auftrag gegeben hat. Professor Gabriel Felbermayr, Hauptautor der Studie, geht von einer Verdoppelung des Handelsvolumens zwischen den USA und Europa aus. Gleichzeitig ist von einem Anstieg des Pro-Kopf-Einkommens die Rede: 4,95 Prozent in Europa und 13,4 Prozent in den USA sollen es sein. Die Studie »Abbau der Hindernisse für den transatlantischen Handel« des Londoner Centre for Economic Policy Research (CEPR) bläst ins gleiche Horn. Es prophezeit ein kontinuierliches Wirtschaftswachstum von rund 0,5 Prozent (65 Milliarden Euro) pro Jahr, und ihre Schlussfolgerung dürfte den Regierungen der hoch verschuldeten Euro-Zone besonders wohl in den Ohren klingen. Denn das Plus an Wachstum würde laut CEPR zustande kommen, ohne die öffentlichen Ausgaben und Kreditnahmen zu erhöhen: ein Konjunkturschub ganz ohne zusätzliche Steuergelder und Schulden also. Damit nicht genug. Käme das TTIP zustande, würden zwei Millionen neue Arbeitsplätze entstehen, behauptet die Bertelsmann Stiftung; das verfügbare Einkommen einer vierköpfigen Familie würde sich um durchschnittlich 545 Euro jährlich erhöhen, ergänzt die Europäische Kommission.38|21|
Die Zahlen klingen derart gut, dass man geneigt ist, den Silberstreif am Horizont der überschuldeten Euro-Zone tatsächlich als gegeben hinzunehmen. Doch bei näherer Betrachtung macht sich Ernüchterung breit. Denn sowohl Institute als auch EU streichen nur die optimistischen Prognosen heraus – und das lässt Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit aufkommen. Optimistisch bedeutet in diesem Zusammenhang ein Szenario des harmonischen Gleichklangs auf allen Ebenen: Sämtliche Zölle zwischen EU und USA müssten fallen, es käme zu einer weitgehenden Angleichung von Produkt-, Arbeits-, Verbraucherschutz- und Umweltstandards, und die Auswirkungen dieser Veränderungen müssten sehr groß sein. Schon ein mittleres Szenario relativiert den Wachstumseffekt. Er würde dann 0,1 Prozent betragen – nicht jährlich, sondern in einem Zeitraum von zehn Jahren. Ähnliches gilt für den von Bertelsmann verkündeten Arbeitsplatzsegen. In einem vorsichtigen Szenario geht die Studie von einem Rückgang der Arbeitslosenquote in Deutschland um 0,11 Prozent aus – wiederum nicht jährlich, sondern insgesamt. Eine recht bescheidene Aussicht. Selbst ein Plus von zwei Millionen Arbeitsplätzen erscheint angesichts der Bevölkerungszahl einer zukünftigen transatlantischen Freihandelszone von 312 Millionen US-Bürgern und 504 Millionen Europäern marginal. Auch deckt sich die Behauptung, ein erleichterter Handel wirke sich positiv auf die Zahl der Arbeitnehmer aus, nicht mit den Erfahrungen aus früheren Handelsabkommen. Mehr Handel bedeutet nicht automatisch mehr Stellen, sondern nur, dass es zu einer stärkeren Arbeitsteilung und damit zu einer höheren Effizienz kommt. In diesem Fall könne nur eine stärkere Nachfrage mehr Beschäftigung bewirken, meint Professor Christoph Scherrer, Leiter des Fachgebiets Globalisierung und Politik an der Universität Kassel. Scherrer sorgt sich um die zukünftigen Arbeitsbedingungen in Deutschland, falls die Standards an jene in den USA angepasst würden. Beschäftigte in den USA haben weniger Rechte und verdienen weniger; ein Betriebsrätesystem wie in Deutschland lehnen die Amerikaner ab. Scherrer hält sogar Arbeitsplatzverluste für möglich, wenn deutsche Firmen das amerikanische Prinzip übernehmen oder in die USA abwandern und dort produzieren würden.39
Bertelsmann muss sich daher den Vorwurf gefallen lassen, im Eigeninteresse zu argumentieren. Indem der Konzern die unrealistischen, |22|aber vielversprechenden Zahlen aus den Untersuchungen filtert und präsentiert, verfolgt er klare Ziele: »Als eines der größten Medienimperien Europas liegt Bertelsmann vor allem der stärkere Schutz geistigen Eigentums am Herzen, der durch das Abkommen erreicht werden soll.«40 Schönfärberei hinsichtlich Beschäftigungszuwachs und Wirtschaftswachstum kennen die Europäer indes schon aus politischen Sonntagsreden. Sie sollen vor allem eines bewirken: die Bürger gefügig machen. Doch das geplante Freihandelsabkommen birgt enorme Risiken – für jeden Einzelnen wie für die Demokratie.
Die Veränderungen betreffen rund 850 Millionen Menschen, und wer in erster Linie profitiert, ist unschwer zu erraten. Die britisch-amerikanische Firma FTI Consulting etwa (im Jahr 2013 bei der Begleitung von Fusionen und Übernahmen die Nummer eins in Europa) beziffert das Gewinnplus für die Automobilindustrie in der Freihandelszone auf zwölf Milliarden Euro pro Jahr, das der Chemieindustrie auf sieben Milliarden Euro. Schon an dritter Stelle folgt die Nahrungsmittelindustrie mit einem geschätzten Gewinnplus von fünf Milliarden Euro.41 Kleine und mittlere Unternehmen, die bereits heute der zunehmenden Konzentration und Marktmacht der multinationalen Giganten kaum etwas entgegenzusetzen haben, würden noch mehr durch Preisdrückerei und Knebelverträge in die Abhängigkeit getrieben werden können. Zum Beispiel dürften für die Milchbauern und Schweinemäster schwere Zeiten anbrechen (siehe Kapitel 3 und Kapitel 6); die bäuerliche Landwirtschaft würde noch mehr hinter der industriemäßigen Pflanzen- und Tierproduktion zurückstecken müssen, und die Nahrungsmittelindustrie würde ihren aggressiven Expansionskurs fortsetzen – mit all seinen negativen Folgen.
Weil die Prämisse in einer Erleichterung des Warenverkehrs liegt, ist zu erwarten, dass sich eine Harmonisierung der Standards an den Interessen der Konzerne und Finanzinvestoren orientiert. Der wirtschaftsfreundlichste Standard jedoch ist jener, der am niedrigsten liegt – das Freihandelsabkommen würde Europa somit als riesigen Absatzmarkt für Produkte mit Qualitätsstandards des kleinsten gemeinsamen Nenners erschließen. Noch gilt in der Europäischen Union das Vorsorgeprinzip: Wo es wissenschaftliche Unsicherheiten gibt, sollen Risiken vermieden werden.42 In den USA ist das Gegenteil der Fall. Hier dür|23|fen Firmen so lange ihr Produkt vertreiben, bis ein Risiko zweifelsfrei festgestellt ist. Das erklärt beispielsweise, warum Produkte der Grünen Gentechnologie so weit verbreitet sind. In einem Mammutanteil amerikanischer Nahrungsmittel, die Soja oder Mais enthalten, stecken gentechnisch veränderte Bestandteile: 90 Prozent aller in den USA angebauten Sorten sind GVO – Gentechnisch veränderte Organismen. Damit nicht genug. Mit einem gleichen Anteil von 90 Prozent ist Monsanto uneingeschränkter Herrscher über sämtliche transgene Pflanzen weltweit. Dass der Konzern die globale Landwirtschaft unter seine Kontrolle zu bringen versucht, ist ein offenes Geheimnis. Wie weit er es damit bereits gebracht hat, zeigt die personelle Verquickung von Politik und Wirtschaft in den USA. So galt Monsanto unter Kritikern schon in den 2000er Jahren als »ein Pensionat für ehemalige Clinton-Mitarbeiter«43 und hält seine Türen seit je für ehemals hochrangige Beamte offen. Zum Beispiel war William D. Rückelhaus zunächst Verwaltungsleiter der behördlichen Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelzulassungsbehörde der USA, Food and Drug Administration (FDA) und dann Vorstandsmitglied bei Monsanto, und auch für Linda J. Fischer hatte es offensichtlich nichts Anrüchiges, als stellvertretende Direktorin der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde Environmental Protection Agency (EPA) zu arbeiten, um dann den Posten als Vizepräsidentin der Öffentlichkeitsarbeit bei Monsanto anzunehmen.44 Die Liste ließe sich weiter fortführen, gipfelt aber in einem (vorläufigen) Höhepunkt, als im März 2013 der US-Kongress und der US-Senat ein Gesetzespaket zur Lebensmittelsicherheit verabschiedeten. Enthalten war der »Monsanto Protection Act«, ein Zusatz zum Übergangshaushaltsgesetz45, der es Monsanto erlauben sollte, sich über sämtliche Entscheidungen amerikanischer Gerichte hinwegzusetzen: eine Generalerlaubnis für den Anbau, Verkauf und die experimentelle Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen also. Das offensichtlich von Monsanto für Monsanto geschriebene Gesetz wurde von Präsident Barack Obama unterzeichnet, schockierte aber Fachleute wie Kritiker derart, dass eine Welle der Empörung losbrach. Im September 2013 schließlich passierte das Gesetzespaket für weitere drei Monate den US-Kongress, jedoch verweigerte der US-Senat seine Zustimmung und strich den »Monsanto Protection Act« komplett.46 Der Druck der Gentech-Lobby mit Monsanto, Bayer Crop-|24|Science, BASF, Syngenta, DuPont und Dow Chemical als Vorhut und der nachgelagerten Lebensmittelindustrie mit Nestlé, Unilever, Coca Cola, PepsiCo, Danone & Co auf die Politik ist enorm groß und droht, das Freihandelsabkommen im Sinne der Konzerne zu gestalten. Sie wollen vor allem eines: Produkte der Grünen Gentechnik in den europäischen Markt pressen.
Kommt das Freihandelsabkommen nach dem Gusto der Agrar- und Lebensmittelindustrie zustande, opfert Deutschland die Konsumentenrechte auf dem Altar der Profitgier und ignoriert den Widerstand der Bevölkerung. So könnten nicht nur Genfood und Klonfood die europäischen Supermarktregale füllen, sondern der Weg wäre auch frei für Zusatzstoffe in Lebensmitteln, die in den USA zugelassen, aber hierzulande verboten sind. Geradezu klassisch sind die Beispiele des zum Zwecke der Desinfektion in Chlor gebadeten Hühnerfleischs und das Wachstumshormone enthaltende Kotelett oder Steak, die im Zuge des Freihandelsabkommens in Europas Supermärkten landen könnten. Zumindest was Letzteres betrifft, hat EU-Handelskommissar Karel de Gucht im Frühjahr 2014 eingelenkt. Die EU wolle Hormonfleisch vom Freihandelsabkommen ausnehmen; TTIP solle »kein Unterbietungsabkommen«47 werden. Ob er Wort hält und ob es sich dabei um das einzige Zugeständnis an den Verbraucherschutz handeln wird, ist ungewiss. Fest steht, dass die EU-Standards in vielen Bereichen strenger sind als die amerikanischen, was eine Verschlechterung des Schutzes von Mensch und Umwelt zur Folge hätte.48 Zur Disposition stehen außerdem nationale Regelungen nicht nur für Lebensmittel, sondern auch für Pharmazeutika, Nanotechnik, Medizinprodukte, für den Datenverkehr, den Finanzmarkt und E-Commerce. Denkbar ist, dass sich die EU und die USA auf eine »gegenseitige Anerkennung« verständigen: Solange US-amerikanische Produkte den Standards der USA entsprechen, dürfen sie in Europa vertrieben werden. Für europäische Produkte gilt im Umkehrschluss, dass sie, wenn sie im amerikanischen Binnenmarkt angeboten werden, europäische Standards erfüllen müssen. Was zunächst unbürokratisch wirkt, hat sowohl für Konsumenten als auch für Produzenten einen Haken. »Verbraucher könnten sich … bei Lebensmitteln nicht auf einheitliche Hygiene- und Sicherheitsstandards verlassen …«, schreibt der Bundesverband der Verbraucherzentrale, und |25|»Produzenten, für die strenge heimische Regeln gelten, könnten Wettbewerbsnachteile erleiden«49.
Beim Freihandelsabkommen geht es jedoch nicht nur um »entgrenzten« Freihandel, Arbeitsplätze und ungleiche Chancen, um Chlorhähnchen, Klonfleisch oder gentechnisch veränderte Maisflocken im Müsli. Es geht um die Zukunft der Demokratie. Die »neue Weltwirtschaftsordnung«, wie sie von der EU beschworen wird, kostet vor allem eines: Mitbestimmung. Wo Staaten mit international agierenden Konzernen ohne Kontrolle und Mitsprache kollaborieren, ist der Schritt zur kapitalistischen Selbstverwaltung nicht mehr weit. Eine kapitalistische Selbstverwaltung wiederum hebelt die Demokratie aus, schreibt der Philosoph Werner Rügemer, und nicht nur der Sozialstaat und die Sozialpartnerschaft werden abgebaut, sondern auch der Rechtsstaat.50
Dass Rügemer mit seiner These nicht weit von der Realität entfernt ist, zeigt das im Rahmen des Freihandelsabkommens geplante »Investor-Staat-Schiedsgerichtsverfahren« (Investor-State-Dispute-Settlement, ISDS). Hierbei handelt es sich um eine Art paralleles Rechtssystem, das mit unserem bekannten nicht mehr viel gemein hat. Das ISDS soll der Streitschlichtung zwischen Investoren und Staat dienen. Sobald sich ein Investor benachteiligt fühlt (zum Beispiel, wenn ein Staat neue Standards zum Schutz der Verbraucher oder der Umwelt festlegt), kann er den Staat verklagen. Dieses ad hoc eingerichtete Sondertribunal besteht beispielsweise aus einem Abgesandten des betroffenen Staates, einem Vertreter des Unternehmens und einer Person, auf die sich beide Parteien einigen. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und spezialisierte Anwaltskanzleien unterstützen aus nachvollziehbaren Gründen ein ISDS. Anfechtbar sind die Urteile des Gremiums nicht mehr – eine Berufung ist nicht zulässig.51 Hintergrund ist der sogenannte Investitionsschutz für Unternehmen, der vor einer sogenannten indirekten Enteignung schützen soll. So lässt sich faktisch als »indirekte Enteignung« alles interpretieren, was die Gewinne oder die Gewinnerwartungen eines Konzerns negativ beeinträchtigen könnte. Wenn also ein Unternehmen seine potenziellen oder vermuteten Gewinne geschmälert sieht, kann es vor ein Schiedsgericht ziehen, um seine massiven Schadenersatzforderungen durchzusetzen. Jede Maßnahme, jede Verordnung, jedes Gesetz eines |26|Staates, das dem Firmeninteresse zuwiderläuft, könnte zu einem Rechtsstreit führen.
Weit hergeholt ist diese Befürchtung nicht, denn solche Tribunale gibt es bereits. Fünfzehn Rechtsanwaltskanzleien haben sich auf derlei Streitigkeiten spezialisiert, es geht bereits heute um Streitwerte von 14 Milliarden US-Dollar.52 Nur zwei Beispiele: Im Rahmen des Freihandelsabkommens NAFTA zwischen den USA, Kanada und Mexico hatte die US-Firma Lone Pine eine Probebohrungslizenz in einer kanadischen Provinz erworben. Zwischenzeitlich erließ die betroffene Provinz aber ein Moratorium gegen das Fracking von Schiefergas und Öl. Lone Pine hat daraufhin den kanadischen Staat vor einem internationalen Schiedsgericht verklagt und fordert nun eine Entschädigung von 250 Millionen US-Dollar für den zu erwartenden Gewinnausfall.53 Deutschland hat ähnliche Erfahrungen gemacht, als der schwedische Stromkonzern 2012 die Bundesregierung beim Internationalen Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (ICSID), Washington, auf 3,5 Milliarden Euro Schadenersatz verklagte, weil diese aufgrund des Atomausstiegs darauf gedrungen hatte, die Atomkraftwerke Krümmel und Brunsbüttel abzustellen. Ähnliches ist in jedem anderen Wirtschaftssektor denkbar. So könnte ein US-amerikanisches Lebensmittelunternehmen den deutschen Staat verklagen, wenn die Behörden den Verkauf seiner Fertiggerichte aussetzen, um die Bevölkerung vor umstrittenen Zusatzstoffen zu schützen. Wenn milliardenschwere multinationale Unternehmen gegen hoch verschuldete Staaten klagen, ist der Sieger unschwer auszumachen. Die Kosten tragen selbstverständlich die Steuerzahler.
»Investor-Staat-Schiedsgerichtsverfahren« schränken die Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit von Staaten stark ein, und das aus mehreren Gründen. Zum einen agieren sie außerhalb der staatlichen Gerichtssysteme und über sie hinweg – die ordentliche Gerichtsbarkeit wird quasi ausgeschaltet. Zum anderen sind sie extrem anfällig für Korruption, sie sind nicht kontrollierbar, und die Gefahr ist groß, dass sich die Global Player geradezu ermächtigt fühlen, bisher geltende Gesetze zu übertreten. Sollten sich ISDS durchsetzen, bedeutet das eine rechtliche Stärkung der Großkonzerne gegenüber den Rechten von Staaten und jenen der Bevölkerung. |27|
Damit nicht genug. Die EU und die USA planen auch, »Stakeholdern«54 ein verbindliches Mitspracherecht bei der Erstellung von Gesetzesentwürfen noch vor dem Beginn des Gesetzgebungsprozesses zu erlauben. Die Nichtregierungsorganisation Corporate Europe Observatory hatte entsprechende Dokumente veröffentlicht.55 Solche Konsultationsprozesse geben Konzernen die Möglichkeit, schon vorab unliebsame Regelungen zu streichen. Zwar können sich theoretisch auch NGOs, Bürger-, Umwelt- und Verbraucherschutzinitiativen zu Wort melden. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus, wie die starke Lobbyaktivität in Brüssel heute schon zeigt, und die Zahl der Lobbyisten übersteigt jene der Parlamentarier um ein Vielfaches.
Im Zuge der Verhandlungen geht es offensichtlich auch um die Auslagerung des Verbraucherschutzes an eine für die Verhandlungspartner diesseits und jenseits des Atlantiks zuständige Behörde: eine transatlantische Superbehörde, an die unliebsame Verbraucherschutzfragen abgeschoben werden können, befürchten Kritiker56. Demnach könnten US-Handelskammer und EU-Kommission in einen Dialog treten, noch bevor es künftig zu Verordnungen oder Richtlinien käme, um »Handelshindernisse« erst gar nicht entstehen zu lassen. Sollten sie sich nicht einigen können, werden die betreffenden Themen an die besagte Superbehörde weitergeleitet, den »Regulativen Rat«. Dieses Delegieren würde es ermöglichen, die strittigen Fragen so lange aufzuschieben, bis das Abkommen unterschrieben ist. Wenn das erst einmal der Fall sei, gebe es kein Zurück mehr – der Verbraucherschutz wäre faktisch über Bord geworfen.57
Lebensmitteleinzelhandel – der Lotse in den Abgrund
Das Aldi-Prinzip der ersten Stunde ist legendär: ein kleines Warenangebot zum niedrigen Preis. Nachdem die Aldi-Brüder Karl und Theo 1945 den elterlichen Betrieb übernommen hatten, bauten sie den Handel kontinuierlich aus. Sie gelten als Begründer der Discount-Supermärkte in Deutschland (Albrecht-Diskont) – ein Siegeszug des Billigpreissortiments, das Karl und Theo im Laufe der Jahrzehnte mit einem |28|von Forbes geschätzten Vermögen von 18,2 Milliarden beziehungsweise 16,7 Milliarden US-Dollar zu den zwei reichsten Deutschen machte. Mit seinen rund 2500 Filialen im Bereich Aldi Nord, seinen 1800 Filialen im Bereich Aldi Süd, den etwa 8000 Filialen in Europa und 1500 in Australien und den USA sowie den zahlreichen Tochterunternehmen hat es der Konzern auf Platz vier der Top 10 im deutschen Lebensmittelhandel gebracht (siehe Tabelle 2).
[Bild vergrößern]
Tabelle 2: Top 10 Lebensmittelhandel in Deutschland 2013
Quelle: TradeDimensions März 2013
Vielen gilt Aldi als Deutscher Meister, wenn es darum geht, möglichst viel Ware auf möglichst wenig Platz möglichst schnell zu verhökern. Nicht nur in Deutschland, weltweit greift diese Strategie. Land für Land fügt der geheimnisumwitterte Handelsriese seinem Imperium zu. Dabei ist und bleibt der Konzern eine Blackbox: Ebenso wenig wie seit eh über die Firmengründer bekannt ist, informiert Aldi über Umsatz und Gewinn oder äußern sich Geschäftspartner, und ebenso stillschweigend arbeiten in der Regel Kassierer, Einkaufschefs und Geschäftsführer. Inzwischen ist Aldi im deutschen Sprachraum zum Synonym für billiges Einkaufen geworden, aber auch für einen rüden Umgang mit Mitarbeitern, für Mobbing, Misshandlung und Überwachung, für die Tolerierung von Ausbeutung in der Rohstoffgewinnung und für Umweltzerstörung. Dass Aldi keinerlei Faible für Betriebsräte hat, ist ohnehin ein offenes Geheimnis. Aldi Süd gilt faktisch als betriebsratsfreie Zone. Immer wieder berichten Medien über geschasste Mitarbeiter, die versucht hatten, sich zu organisieren.58 Als die Süddeutsche Zeitung 2004 einen Artikel darüber veröffentlichte, wie Mitarbeiter in einer Aldi-Filiale im Münchener Süden einen Betriebsrat wählen wollten, strafte der Konzern die Zeitung, indem er keine Anzeigen mehr schaltete. Der Süddeutschen entgingen damit Einnahmen von 1,5 Millionen Euro.59 In seinem Buch Aldi – einfach billig hatte Andreas Straub, Ex-Manager der Bezirksebene, über die Rücksichtslosigkeit seines ehemaligen Arbeitgebers im Umgang mit dem Personal berichtet. Die Reaktion des Konzerns folgte auf dem Fuße. »Im Unternehmen herrscht weder ein System von Einschüchterung, Kontrolle und Misstrauen, noch werden langjährige Mitarbeiter entlassen und durch günstigere ersetzt«, konterte eine Sprecherin von Aldi Süd nach Erscheinen des Buches.60
Ungeachtet dessen ist die Liebe der Deutschen zum ungekrönten |29|Schnäppchen-König ungebrochen, wie es scheint. Das jedenfalls legt die Benchmarkstudie Fanfocus des Mainzer Marktforschungsinstituts forum! vom November 2013 nahe. Demnach zählen sich 31 Prozent der Aldi-Süd-Kunden beziehungsweise 24 Prozent der Aldi-Nord-Kunden zu Fans der Discounter-Gruppe, mehr als bei jedem anderen Lebensmittelhändler. Aldi-Hauptkonkurrent Lidl kam den Befragungen zufolge auf eine relativ geringe Fanquote von 20 Prozent. Das SB-Warenhaus Kaufland (Fanquote: 23 Prozent) und die Supermarktkette Penny (23 Prozent) können dagegen beinahe mithalten. Mit 15 Prozent weit abgeschlagen ist Vollsortimenter Rewe.61 Offensichtlich vergisst und verzeiht so mancher deutsche Verbraucher schnell, wenn Problematisches den eigenen Alltag nicht tangiert: Beim Einkauf zählt für diese Konsumentengruppe weder Lebensmittelskandal noch Moral, sondern allein der Preis. |30|
Dabei forciert jeder Cent, der unreflektiert in die Kassen des Handels wandert, eine fatale Entwicklung, die sich am Ende auf das Leben aller auswirkt. Denn eine ähnliche Dynamik, wie sie in den anderen Sektoren der Nahrungsmittelkette zu beobachten ist, vollzieht sich auch im Handel: Das ungebremste Profitstreben zerstört nicht nur Kultur und Lebensstile, führt zu niedrigen Löhnen, zu einer Minimalisierung von Arbeitnehmerrechten und zur Preisgabe von Werten wie einer gesunden Umwelt und der für die jeweilige Region typischen lokalen, territorialen, wirtschaftlichen und sozialen Gefüge (siehe Kapitel 3), sondern auch zu einer Monopolisierung, die keinerlei Wettbewerb mehr zulässt. Nach Ansicht des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA) ist die Handelsbranche einer der Bereiche mit der stärksten Konzentration. In jedem Mitgliedsstaat wird der Markt von nur drei bis fünf Unternehmen kontrolliert, bei denen es sich oftmals um multinationale Konzerne handelt.62
Während früher ungezählte Tante-Emma-Läden jeden Stadtteil, jedes Dorf mit Waren des täglichen Bedarfs versorgten, kontrollieren heutzutage zwischen Flensburg und Sonthofen gewaltige Einkaufskonzerne den Markt. Das spiegelt sich auch in Zahlen wider: Weniger als ein Prozent der gesamten Versorgungskette machen kleine Läden aus. Das Sterben der kleinen und mittleren Lebensmittelgeschäfte hat epidemische Ausmaße: Zwischen 1990 und 1997 ließen etwa 22000 ihre Rollläden herunter, und bis zum Jahr 2005 machten jeden Tag sieben Läden dicht, errechnete das Frankfurter Marktforschungsinstitut Nielsen.63
Mit der Konzentration großer Konzerne und der Marktliberalisierung, die es zusätzlich ausländischen Handelsgiganten erlaubte, ihre Absatzmärkte gen Europa auszuweiten, mutierte auch der Lebensmittelhandel. Waren die Händler vordem abhängig von den Herstellern, haben sich die Machtverhältnisse inzwischen umgekehrt. Sehr viele Produzenten buhlen um die Gunst einiger weniger Handelsunternehmen. In Deutschland haben vier Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel mit 85 Prozent Marktanteil das Sagen, davon kontrollieren allein Edeka und Rewe etwa 60 Prozent. Ihnen steht ein heterogenes Heer an Herstellern gegenüber, rund 6000 Produzenten, von kleinen und mittelständischen bis hin zu Global Playern.64 Unlautere Praktiken sind europaweit an der Tagesordnung, unter anderem: |31|
erpresserisches Geschäftsgebaren,
Preise, die unter jenen liegen, mit denen die Erzeuger ihre Waren herstellen,
Preise, die zulasten des Erzeugers erst zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt werden, und
schmiergeldähnliche Zahlungen.65
Immer wieder lässt das Bundeskartellamt Geschäftsräume von Handels- und Lebensmittelunternehmen untersuchen, weil es Hinweise auf Verstöße gegen geltendes Recht gibt. 2009 hatte das Kartellamt gegen die Kaffeeröster Melitta, Tchibo und Dallmayr wegen illegaler Preisabsprachen bei der Belieferung des Einzelhandels Strafgelder in Höhe von knapp 160 Millionen Euro verhängt; Kraft Foods (Jacobs Kaffee) war um ein Bußgeld herumgekommen, weil das Unternehmen mit den Fahndern zusammengearbeitet hatte. 2010 deckte das Kartellamt weitere verbotene Preisabsprachen bei der Belieferung von Großverbrauchern auf – Melitta, Tchibo und Kraft Foods sollten 30 Millionen Euro zahlen. Ein Jahr später ahndete das Kartellamt das gleiche Vergehen mit neun Millionen Euro gegen zwei Hersteller von Instant-Cappuccino: Kraft Foods und Krüger. Diesmal kam Melitta ungeschoren davon, weil sich das Unternehmen selbst angezeigt hatte.66 Im gleichen Jahr organisierten die Fahnder Razzien bei Rewe, Edeka, Lidl, Metro und anderen. 2013 schließlich mahnte das Bundeskartellamt den größten deutschen Lebensmittelhändler Edeka ab. Bei der Übernahme des Discounters Plus im Jahr 2009 hatte Edeka Sonderkonditionen von rund 500 Lieferanten aus unterschiedlichen Warenbereichen gefordert: günstige Bezugskonditionen und längere Zahlungsziele, die harmlos klingenden, aber gesetzeswidrigen sogenannten »Hochzeitsrabatte«: Forderungen ohne Gegenleistung also. Außerdem hatte Edeka von den Lieferanten die Zahlung von Geldbeträgen unter Titeln wie »Synergiebonus«, »Partnerschaftsvergütung« oder »Sortimentserweiterungsbonus« verlangt.67 Solche Geschäftspraktiken sind ein Ausdruck für die Nachfragemacht der Handelskonzerne, die sie missbräuchlich gegenüber ihren Lieferanten ausnutzen. Doch nicht nur die Lieferanten sind die Geschädigten, sondern auch die kleineren Handelsunternehmen – sie können mit dem Handelsgoliath kaum mehr mithalten. |32|
Mit sozialer Marktwirtschaft und fairem Handel hat das schon lange nichts mehr zu tun. Das baulich begrenzte Platzangebot in den Filialen und eine wachsende Menge an (vermeintlichen) Produktneuerungen verschärfen den Ton zwischen Händlern und Lieferanten noch. Listungsgebühren in Millionenhöhe sind die Regel, um überhaupt einen Platz im Regal zu ergattern. Auch ist es gang und gäbe, für privilegierte Plätze zu bezahlen: Will man sein Produkt zwischen all den anderen perfekt positioniert sehen, lässt man sich das etwas kosten. Unter welchem Posten auch immer diese fragwürdigen Vereinbarungen auftauchen (ob als Werbekostenzuschuss, Provision, Aktionsrabatt oder Rückvergütung) – an die große Glocke werden sie nicht gehängt: In der Regel wissen die Vertriebsleiter, seltener auch die Marktleiter Bescheid. Perfide ist dieses Vorgehen für den Verbraucher, der sich im Netz eines perfekten Marketings verfängt und den Blick für die Realität verliert. Denn das künstliche Hervorheben und ausufernde Bewerben eines Produkts soll manipulieren: »Positionierung ist nicht das, was man mit einem Produkt tut, sondern was man mit der Gedankenwelt des potenziellen Käufers tut. Das heißt, ein Produkt wird in der Gedankenwelt des potenziellen Käufers positioniert«, schreiben Philip Kotler und Friedhelm Bliemel in ihrem Buch Marketing-Management.68
Handelsunternehmen sind dreist, wenn es darum geht, bei den Herstellern immer neue Quellen anzuzapfen. Mancher erhebt einen »Europa-Bonus«, auch wenn die Waren des betreffenden Produzenten gar nicht in Europa verkauft werden. Andere ersinnen Zuschläge, wie beispielsweise einen Abendzuschlag infolge der Verlängerung der Ladenöffnungszeiten. Oder es werden Bettelbriefe zu Jubiläen aller Art verschickt, in denen man mit der festen finanziellen Unterstützung seiner Handelspartner rechnet. So geschehen 1997, als sich Edeka-Chef Horst Neuhaus zum 90. Geburtstag seines Unternehmens von seinen Handelspartnern eine besondere monetäre Zuwendung wünschte: »einen einmaligen Betrag von 50000 Mark«, wie es in dem Schreiben hieß, dem auch gleich Spendenzettel beigefügt waren.69
Der Platz im Regal ist hart umkämpft – und gewinnen können diesen Kampf nur die Großen auf nationaler wie internationaler Ebene. Der US-amerikanische Gigant Walmart ist unangefochtener Spitzenreiter und diktiert seinen Lieferanten alles – vom Preis bis zur Verpackung. Er |33|kann Einnahmen vorweisen, die über dem Bruttosozialprodukt Österreichs liegen (408 Milliarden US-Dollar, Stand 2010). Platz zwei bis vier belegen die US-amerikanische Großhandelskette Cosco (89 Milliarden US-Dollar), der US-Konzern Kroger, mit 82 Milliarden US-Dollar die weltgrößte Lebensmittel-Supermarktkette, das größte Einzelhandelsunternehmen Europas, der französische Handelskonzern Carrefour (79 Milliarden Euro), und die größte britische Handelskette Tesco (61 Milliarden Pfund Sterling).70 Platz sieben des Welt-Rankings nimmt die Düsseldorfer Metro AG ein. Sie betreibt mit ihren vielen Vertriebslinien (zum Beispiel Media Markt, real, Metro) mehr als 2200 Standorte in 32 Ländern der Welt und hat 2013 46 Milliarden Euro umgesetzt.
Größter Verbund im deutschen Einzelhandel ist seit der Übernahme von Spar die Edeka-Gruppe mit einem jährlichen Umsatz von rund 46 Milliarden Euro (Stand 2011). 2005 übernahm Edeka auch den Discounter Netto und eröffnete sich damit den Eintritt ins Niedrigpreissegment. Noch kurz zuvor hatte das Unternehmen einen Joghurt von Müller Milch aus dem Sortiment gestrichen, nachdem dieser bei Discountern für die Hälfte zu haben war. Zur Begründung hieß es damals, Edeka bevorzuge Ware, »die nicht beim Discounter verramscht« werde.71 Die Edeka-Gruppe ist Eigentum von Genossenschaften, in denen sich selbstständige Einzelhändler zusammengeschlossen haben.
Jahrzehntelang hatte sich das Marketing der großen Einzelhandelsunternehmen fast ausschließlich auf den Verkaufspreis fokussiert – das Preis-Leistungs-Verhältnis spielte keine Rolle. Das hatte Folgen: Die Lebensmittelproduzenten tauschten aus Kostengründen natürliche Inhaltsstoffe gegen Ersatzstoffe aus, was letztlich zu Qualitätseinbußen führte. Verbraucher, die durchaus bereit waren, für qualitativ hochwertigere Produkte tiefer in die Tasche zu greifen, hatten dadurch keine Wahlmöglichkeit mehr, weil sie solche Nahrungsmittel nicht mehr im Sortiment finden konnten.
Die »Aldisierung« des Landes, die Hatz nach Billigem, hat Deutschland verändert. Marktbeherrschendes Phänomen sind noch immer Rabattschlachten, Sonderaktionen und preisaggressive Werbung – Maßnahmen, die in einem übersättigten Markt der Kaufunlust der Konsumenten entgegenwirken und dem zunehmenden Konkurrenzdruck der Discounter, die sich Stück für Stück Marktanteile einverleiben, begegnen sollen. |34|»Aldisierung« oder, allgemeiner, »Discountisierung der Gesellschaft«72 ist ein Schlagwort geworden, das nicht nur den Hang selbst einkommensstärkerer Käuferschichten zum Billigprodukt meint, sondern auch die damit verbundenen gesellschaftlichen Auswirkungen problematischer Art einschließt: die Verödung der Innenstädte, die Veränderung der Beschäftigungsstruktur hin zu Niedriglohn, ungelernten Tätigkeiten und Arbeitslosigkeit, die sich ausbreitende »Servicewüste« in Deutschland und die Akzeptanz einer Kultur, die vom Hamsterrad »Konsum – Wegwerfen – Konsum« angetrieben wird. Deutschland ist Kampfzone geworden; der Drei-Fronten-Krieg, der zwischen Herstellern und Handelskonzernen genauso wie zwischen den Herstellern und zwischen den Händlern untereinander tobt, ist um einen neuen Käufertypus entbrannt. Marktforscher beobachten, dass Verbraucher polarisiert einkaufen: Sie sparen an einer Stelle, um an anderer für teure Markenprodukte mehr Geld auszugeben. »Smart Shopping« nennen Fachleute das beliebige Kombinieren von Markenartikeln mit billigen No-Name-Produkten.
Im Interesse dieses »hybriden Käufers«73, dessen Konsummaxime sich mit der Bezeichnung »Aldi & Audi«74 schnittig charakterisieren lässt, hat sich die Etablierung von Handelsmarken als erfolgreiche Strategie erwiesen. Handelsmarken umfassen einzelne Produkte oder Produktreihen, die Eigentum des jeweiligen Handelsunternehmens sind, und die auch nur im eigenen Vertriebssystem abgesetzt werden. Aldi war der Vorreiter in Sachen Verbreitung und Akzeptanz von Handelsmarken. Mit der Behauptung, Qualität müsse nicht viel kosten, schaffte es der Konzern, den Weg für Handelsmarken zu ebnen und die Vorbehalte der Verbraucher zu zerstreuen. Untersuchungen von Stiftung Warentest und Ökotest, die den Eigenmarken keine schlechtere Qualität im Vergleich zu ausgewählten Markenartikeln bescheinigten, stützten diese Botschaft noch. Einer Umfrage des Instituts Allensbach zufolge meint gut ein Drittel der Deutschen ohnehin, der Kauf von Markenartikeln lohne sich nicht.75 Sie halten Handelsmarken und Markenartikel für gleichwertig – ja teilweise sogar identisch: Bekannte Hersteller, so ihre Überzeugung, produzierten diese ohnehin. Damit liegen sie nicht ganz falsch. So wird beispielsweise die ja!-Konfitüre bei Rewe von Zentis hergestellt, die Gut & Günstig-Sahne bei Edeka von Hansano/Arla Foods, Basta-Gewürze bei Norma von Ostmann und die »Scholetta |35|Schoko Miniküsse« bei Aldi vom Süßwarenkonzern August Storck. Heute machen Handelsmarken etwa 40 Prozent des Umsatzes im deutschen Lebensmitteleinzelhandel aus. Die Verbreitung von Handelsmarken ist für die Produzenten ein zweischneidiges Schwert. Einerseits können sie ihre Linien voll auslasten und sichern sich damit ein zweites Standbein.76 Andererseits rauben die oft nur kopierten Billig-Pendants den Herstellermarken deutliche Marktanteile. Denn die Handelsketten haben entdeckt, dass ihr Vorstoß ins Premiumsegment Käufers Liebäugeln mit Gourmetprodukten entgegenkommt: In Zeiten der Krise mag so mancher Verbraucher vor größeren Anschaffungen zurückschrecken, sich alltägliche kulinarische Höhepunkte zum erträglichen Preis aber gönnen, glaubt das rheingold Institut für Marktanalysen.77 Gewinner und Verlierer sind schon heute auszumachen. Während sich wohl niemand vorstellen kann, dass Produkte von Coca Cola oder PepsiCo, Unilever, Mars oder Nestlé aus den Regalen verschwinden werden, wird es jene treffen, die zwar qualitativ mithalten können, aber aus kleineren Firmen stammen – der Trend der Oligopolbildung, der Machtkonzentration, wird sich noch verstärken: Kleinen und mittelständischen Unternehmen droht eine düstere Zukunft, und die Kluft zwischen oben und unten wird sich verbreitern.
Die Dominanz einer Handvoll oligopolistischer Unternehmen macht es Lieferanten unmöglich, Verträge auf Augenhöhe abzuschließen, kritisiert auch der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA). Besondere Sorge bereitet dem Ausschuss die Übermacht der großen Einzelhandelsunternehmen in den postkommunistischen Ländern Mittel- und Osteuropas, wo fast ausschließlich ausländische Einzelhandelsunternehmen den Markt beherrschen, die überdies vor allem Beziehungen zu eigenen Lieferanten aus ihren Heimatländern unterhalten. Besorgniserregend ist dieser Umstand vor allem deshalb, weil der gesamte Agrar- und Lebensmittelsektor der betreffenden Länder bereits im Untergang begriffen ist. Laut EWSA haben die Regierungen dieser Staaten den Exodus bereits zur »nationalen Frage« erhoben.78 Er verlangt daher von der Europäischen Kommission, Gesetze zu erlassen, die europaweit einen unverfälschten Wettbewerb fördern.
2012 forderte das EU-Parlament den Lebensmittelhandel in einer Resolution zu mehr Fairness auf und dazu, seine Nachfragemacht durch |36|eine freiwillige Vereinbarung zu begrenzen. Nicht nur müssten umstrittene Praktiken definiert und kontrolliert, sondern sie sollten auch geahndet werden. Andernfalls drohte die Mehrheit der Abgeordneten mit gesetzlich festgelegten Preisgrenzen, stellte Vorschriften zur Sortimentsgestaltung und sogar eine Festlegung der Gewinnhöchstmargen in Aussicht.79 Bislang hatten immer Lösungsansätze Priorität, die auf einen Konsens aller Beteiligten zielten: Man setzte auf Freiwilligkeit und Einsicht. Doch es ist geradezu absurd anzunehmen, dass die Branche zur Selbstregulierung fähig ist. Denn schon der Blick auf die bisherige Entwicklung belegt den Irrweg der Konsenshypothese. Für die im Agrar- und Lebensmittelsektor tätigen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) verschlechtert sich seit Jahren das wirtschaftliche Klima. Auch verschärfen sich die Arbeitsbedingungen und das Arbeitsklima für die Beschäftigten. Immer mehr Arbeitsplätze fallen weg: Zum Beispiel gingen in den Jahren 1992 bis 1997 in der deutschen Ernährungsindustrie 50000 Jobs verloren80, allein 2004 waren es 18000. Und während sich die Gewinne in den Händen einiger weniger maximieren, werden die gesellschaftlichen Schäden dezentralisiert. Die Selbstregulierung im Lebensmittelhandel funktioniert schon längst nicht mehr – Verhaltenskodizes sind selten das Papier wert, auf dem sie stehen. Der Glaube an ein ernst gemeintes Einlenken vonseiten des Handels setzt daher eine gute Portion Naivität voraus. Denn private Selbstregulierungsgremien verfolgen nicht in erster Linie Gemeinwohlinteressen, sondern Eigeninteressen.81
Die Landwirtschaft in den Fängen des Agrobusiness
Raiffeisen: vom Bauernfreund zum Bauernfeind?
Hunger war der Auslöser, eine soziale Idee bildete die Basis: Schon während der Hungersnot 1846 hatte der Weyersbuscher Bürgermeister Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818–1888) Brot für die Armen backen lassen und ein Jahr später einen Brotverein ins Leben gerufen. Raiffeisen hatte stets ein offenes Ohr für das Leid der Landbevölkerung, das sich durch Missernten noch vergrößerte. Um den Bauern aus der Ab|37|hängigkeit von Wucherern zu helfen, gründete er den Flammersfelder Hülfsverein, in dem die Landwirte Geld ansparen, günstig Vieh kaufen und landwirtschaftliches Gerät leihen konnten. Raiffeisen widmete sich sein ganzes Leben dem Aufbau seiner Genossenschaft. Was ihn trieb, waren Hilfsbereitschaft und Philanthropie. Er schrieb: »Wir betonen … ausdrücklich die christliche Nächstenliebe, welche in der Gottesliebe und in der Christenpflicht wurzelt, daraus ihre Nahrung zieht und, je mehr geübt, umso kräftiger, umso nachhaltiger wird.«82 Nach dem Leitspruch »Einer für alle, alle für einen« gewährte die aus mindestens sieben unbemittelten Bauern bestehende dörfliche Genossenschaft sogenannte Grüne Kredite: Der Bauer konnte Saatgut und Dünger mit der späteren Ernte bezahlen. Das Geld für Darlehen lieferten die Spareinlagen wohlhabender Bürger und niedrig verzinsliche Anleihen zur Kapitalbeschaffung.83 Seit 1935 ist das pferdeköpfige Giebelkreuz als Markenzeichen der Genossenschaft gebräuchlich.
Eine einzigartige wirtschaftliche Erfolgsgeschichte hatte ihren Anfang genommen. Während die Zahl der Bauernhöfe stetig schwand, stieg jene der Mitglieder dagegen an. Aus kleinen Selbsthilfegruppen verarmter Bauern wurde im Laufe von nur hundert Jahren eines der einflussreichsten und wirtschaftlich stärksten Firmengeflechte Europas. Weltweit tragen rund 330000 Firmen den Zusatz »Raiffeisen« in ihrem Namen. Grund für den triumphalen Einzug in alle Bereiche des täglichen Lebens waren die permanenten Expansionsbestrebungen der Genossenschaften; zentralisierte Machtgefüge und Monopolisierung ließen ein Imperium heranwachsen, dessen Triebfeder das Streben nach Maximalprofit ist. Nicht zuletzt deshalb treten zunehmend Kritiker auf den Plan: Sie bemängeln nicht nur die Abhängigkeit der Bauern vom »Giebelkreuz-Konzern« mangels Alternative, sondern auch dessen zunehmenden Einfluss auf die Politik.
Zu welchen Auswüchsen das führen kann, zeigt ein Blick über die Ländergrenze Deutschlands hinweg nach Österreich. Dort ist der Raiffeisenkonzern zu einem Dominator herangewachsen, der inzwischen demokratiegefährdende Strukturen aufweist. Nicht nur Bürger und renitente Bauern, auch Politiker warnen eindringlich vor der Gier des »Giebelkreuz-Kraken«84. Derzeit hält Raiffeisen Österreich rund 740 maßgebliche Unternehmensbeteiligungen. Lutz Holzinger und Cle|38|mens Staudinger haben in ihrem Schwarzbuch Raiffeisen die vielfältigen Verflechtungen von Raiffeisen Österreich dargestellt:
Lagerhausgenossenschaften kontrollieren zwei Drittel der Ernte der wichtigsten Feldfrüchte.
Über Tochterunternehmen beherrscht der Konzern zu 100 Prozent die Zuckerwirtschaft vom Saatgut bis zur Verarbeitung und kann damit den Preis bestimmen.
Die Raiffeisenmolkereigruppe hat 95 Prozent Marktanteil bei Frischmilch, 95 Prozent bei Butter, 85 Prozent bei Schnittkäse.
Im Mühlen- (und damit Mehl-)sektor steht der Konzern an vierter Stelle in Europa.
Raiffeisen hält große Anteile an Lebensmittelunternehmen, z. B. Efko (Gemüse), Landhof/Loidl (Wurstwaren), Cerny (Fisch und Salinen) Austria (Salz).
Der Konzern hat ein flächendeckendes Netzwerk aus Banken aufgebaut. Fast jeder zweite Österreicher ist Kunde bei einer der rund 550 Raiffeisenbanken. Zusätzlich erleichtern Raiffeisen-Landesbanken in den Landeshauptstädten und die Raiffeisen Zentralbank RZB, die unlängst mit der Raiffeisen Bank International RBI fusioniert ist, verschiedene Transaktionen.
Zur Sicherung seines Einflussbereichs hält Raiffeisen zahlreiche Anteile an Medien. Im Print-Bereich ist der Konzern u. a. beteiligt an der Tageszeitung Kurier und an der Verlagsgruppe News (z. B. mit den Zeitschriften News, Profil, Trend, Format, TV-Media). Die Finanzierung der Tageszeitung Österreich wird hauptsächlich von der Raiffeisen-Landesbank Niederösterreich getragen. Mit 40 Prozent ist Raiffeisen am ORS (Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG) beteiligt, einem ORF-Tochterunternehmen, und hält darüber hinaus Anteile bei Sat.1, der Nachrichtenagentur APA, bei »Krone Hit Radio« und anderen.
Raiffeisen hat 50 Prozent der Anteile an EPA-Media inne, die 45000 Plakatwände besitzt und damit größter Plakatvertreiber Österreichs ist. Auch auf dem Immobilienmarkt ist Raiffeisen aktiv. Der Konzern vermittelt Immobilien (Raiffeisen-Immobilien-Vermittlungs Ges.m.b.H) und baut Häuser (Raiffeisen evolution, Eigenwerbung: »Wir sind die |39|wertvollste Wohnbaumarke Östereichs«). Ein anderes Geschäftsfeld des umtriebigen Konzerns ist das Glücksspiel. Über eine Beteiligungsgesellschaft hält Raiffeisen ein Drittel der Aktien der Casinos Austria AG.
Auch Versicherungen werden von Raiffeisen vertrieben. Die Raiffeisen Versicherung AG ist ein Bankenversicherer und hundertprozentige Tochter der UNIQA Versicherungen. Von UNIQA wiederum ist die Raiffeisenbankengruppe einer der Hauptaktionäre. Zum Privatkundengeschäft zählen unter anderem Kfz- und Sachversicherungen sowie Lebens- und Unfallversicherungen.85
An Raiffeisen führt in Österreich kein Weg vorbei – der Konzern ist inzwischen die größte Unternehmensgruppe im Land. Keine Regierung kommt ohne die Nähe zu Raiffeisen aus.862013 sollte Michaela Steinacker Wirtschaftsministerin werden. Sie agierte bis dahin als Geschäftsleiterin der Raiffeisen Holding Niederösterreich-Wien; bei der Holding laufen sämtliche Bank-, Industrie- und Medienbeteiligungen zusammen. Heute ist sie als Generalbevollmächtigte und Beiratsvorsitzende für Immobilien der Raiffeisen evolution project development GmbH tätig und sitzt im Österreichischen Nationalrat als Abgeordnete.
Schon die ehemaligen Finanzminister Josef Riegler und Josef Pröll entstammten dem Raiffeisen-Umfeld. Zu den erfolgreichsten und politisch einflussreichsten Raiffeisen-Gefolgsleuten zählt auch Michael Höllerer, der das Bankenwesen bei Raiffeisen erlernte und später politisch aktiv wurde. Im Bundesministerium für Finanzen (BMF) war er maßgeblich an der Ausarbeitung eines Gesetzes zur Neuordnung der Bankenaufsicht beteiligt. 2002 wechselte er in die neu geschaffene Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA): »Der Raiffeisen-Banker schreibt die Gesetze für die Kontrolle und wird dann selbst Kontrolleur«, kommentierten die Wirtschaftsnachrichten.872006 kehrte er für zwei Jahre in den Schoß des Konzerns zurück und wurde Vorstandssekretär bei der Raiffeisen Zentralbank (RZB). Im Zuge der Bankenkrise bat ihn schließlich Finanzminister Josef Pröll, Neffe des Ministerpräsidenten Niederösterreichs, Erwin Pröll, ins Kabinett. Das Ziel: Schadensbegrenzung für die Banken. Das Konzept zur Teilverstaatlichung der maroden Österreichischen Volksbanken (ÖVAG), an denen im Übrigen auch Raiffeisen beteiligt ist, wird Michael Höllerer zugeschrieben. Eine Milliarde Euro kostete allein dieses Unterfangen die österreichischen Steuerzah|40|ler. Hinzu kamen weitere Milliardenbeiträge aus Steuergeldern für die Skandal-Bank Hypo Alpe Adria sowie die Raiffeisen Zentralbank. Auch nach Ablösung des Finanzministers Josef Pröll durch seine Nachfolgerin Maria Fekter – die eine ähnliche Politik wie Wolfgang Schäuble (CDU) betreibt – diente Höllerer dem Staat als oberster Bankenexperte: Er war zuständig für den Kapitalmarkt, für Finanzmärkte, Beteiligungen und internationale Finanzinstitutionen.88
Das Beispiel zeigt die Dimension des massiven Einflusses. Weniger spektakulär, aber trotzdem nicht weniger einflussreich, sind Raiffeisen-Vertreter auf andere Weise politisch aktiv. Sie agieren als Räte in den Landwirtschaftskammern, stellen sieben Nationalräte, drei Bundesräte und eine EU-Abgeordnete. »Wer zahlt, schafft an«, urteilt Buchautor Clemens Staudinger in einem Interview mit news.at und erinnerte daran, dass Raiffeisen die Kandidatur Erwin Prölls zum Bundespräsidenten finanziell nicht unterstützen wollte – Pröll kandidierte nicht und reagiert »heute noch verschnupft«.89 Als News am 24. Juni 2013 diesen erstaunlich kritischen Beitrag veröffentlichte, rief das offenbar umgehend die Konzernwächter auf den Plan. Innerhalb weniger Stunden war der Text nicht mehr auffindbar, wurde aber über den Medien-Watch-Blog »Kobuk«, der von Studenten der Lehrveranstaltung »Multimedia-Journalismus« am Publizistikinstitut der Universität Wien ins Leben gerufen wurde, konserviert und weiter verbreitet. Eine Intervention des Konzerns (immerhin ist Raiffeisen zu 25,3 Prozent Eigner am News Verlag) durch die Hintertür ist denkbar, was eine Bemerkung des Raiffeisen-Chefs Erwin Hameseder im Monatsmagazin Datum