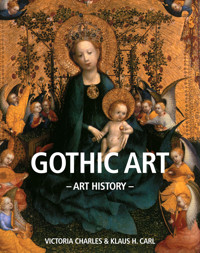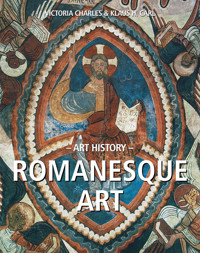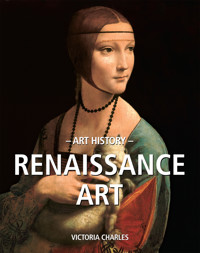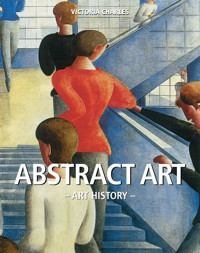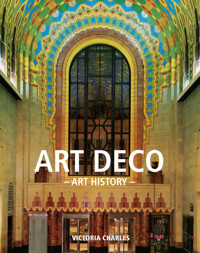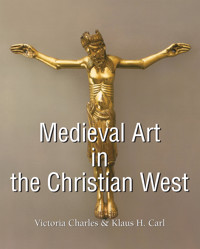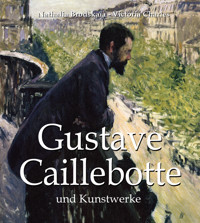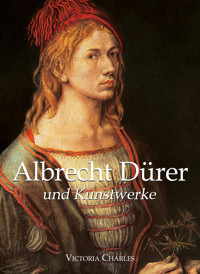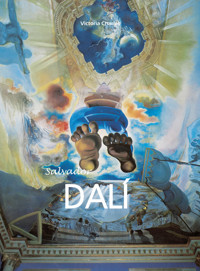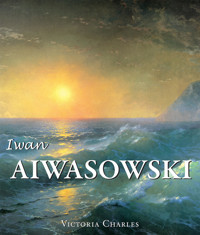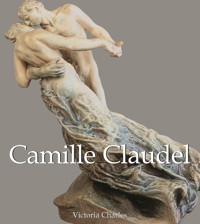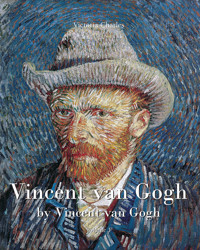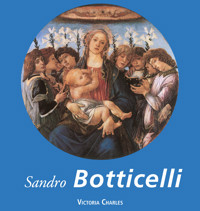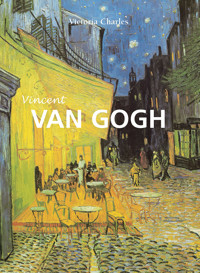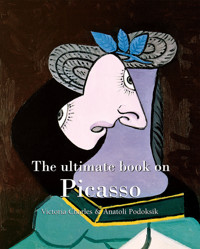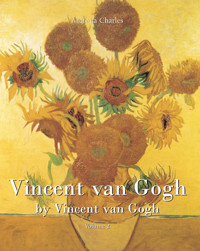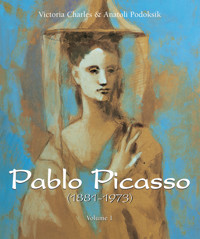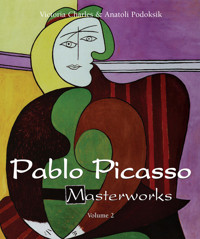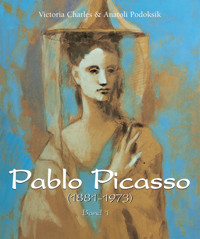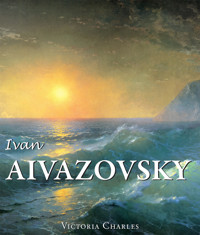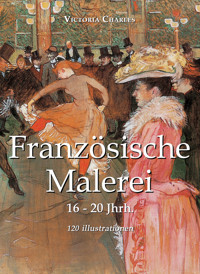
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Parkstone International
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Einfluss der Werke französischer Maler zieht sich durch alle Stilrichtungen und viele von ihnen sind zu Klassikern von Weltruhm geworden. Dieses Buch gibt einen Überblick über die französischen Meilensteine der Stillleben, der Portraits und der Landschaftsmalerei, indem es Künstler wie Poussin, Clouet, Moreau, Millet, Courbet, Signac und Rouault umschließt. Sein handliches Format macht diese Mega Square Ausgabe zu einem idealen Geschenk für jeden Kunstliebhaber.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 73
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Victoria Charles
Französische
Malerei
16 - 20 Jhrh.
© 2014 Parkstone Press International, New York, USA
© 2014 Confidential Concepts, worldwide, USA
© Image-Barwww.image-bar.com
© 2006 Sirrocco, London (deutsche Fassung)
© 2006 Confidential Concepts, worldwide, USA
© 2006 Balthasar Balthus Estate, Artists Rights Society, New York, USA / ADAGP, Paris
© 2006 Pierre Bonnard Estate, Artists Rights Society, New York, USA / ADAGP, Paris
© 2006 Georges Braque Estate, Artists Rights Society, New York, USA / ADAGP, Paris
© 2006 Bernard Buffet Estate, Artists Rights Society, New York, USA / ADAGP, Paris
© 2006 Maurice Denis Estate, Artists Rights Society, New York, USA / ADAGP, Paris
© 2006 André Derain Estate, Artists Rights Society, New York, USA / ADAGP, Paris
© 2006 Marcel Duchamp Estate, Artists Rights Society, New York, USA / ADAGP, Paris
© 2006 Raoul Dufy Estate, Artists Rights Society, New York, USA / ADAGP, Paris
© 2006 Jean-Louis Forain Estate, Artists Rights Society, New York, USA / ADAGP, Paris
© 2006 Marie Laurencin Estate, Artists Rights Society, New York, USA / ADAGP, Paris
© 2006 Fernand Léger Estate, Artists Rights Society, New York, USA / ADAGP, Paris
© 2006 Albert Marquet Estate, Artists Rights Society, New York, USA / ADAGP, Paris
© 2006 Henri Matisse, Les Héritiers Matisse, Artists Rights Society, New York, USA / ADAGP, Paris
© 2006 Francis Picabia Estate, Artists Rights Society, New York, USA / ADAGP, Paris
© 2006 Georges Rouault Estate, Artists Rights Society, New York, USA / ADAGP, Paris
© 2006 Paul Signac Estate, Artists Rights Society, New York, USA / ADAGP, Paris
© 2006 Edouard Vuillard Estate, Artists Rights Society, New York, USA / ADAGP, Paris
Alle Rechte vorbehalten.
Das vorliegende Werk darf nicht, auch nicht in Auszügen, ohne die Genehmigung des Inhabers der weltweiten Rechte reproduziert werden. Soweit nicht anders vermerkt, gehört das Copyright der Arbeiten den jeweiligen Fotografen, den betreffenden Künstlern selbst oder ihren Rechtsnachfolgern. Trotz intensiver Nachforschungen war es aber nicht in jedem Fall möglich, die Eigentumsrechte festzustellen. Gegebenenfalls bitten wir um Benachrichtigung.
ISBN: 978-1-78160-850-0
Inhalt
Im Zeichen des Glaubens
Mythologie und Literatur
Historische Taten
Die Schlachten
Gesichter und Charaktere
Die Alltagsdarstellung
Galante Szenenund vornehme Gesellschaft
Interieure
Die Landschaft
Die Sprache der Gegenstände
Die Tiermalerei
Exotik
Der Akt
Allegorien
Abbildungsverzeichnis
Die jungen Frauen am Meer
Pierre Puvis de Chavannes, 1879. Öl auf Leinwand, 205 x 154,3 cm, Musée d’Orsay, Paris
Vorwort
“Für einen Maler gibt es nichts Schwierigeres, als eine Rose zu malen, denn dazu mu? er zuerst alle Rosen vergessen, die jemals gemalt worden sind.“
— Henri Matisse
Maria mit Kind
Jean Fouquet, ca. 1450. Öl auf Holz, 91 x 81 cm. Royal Museum of Fine Arts, Antwerpen
Im Zeichen des Glaubens
Es ist bezeichnend, dass die frühen Werke der französischen Malerei heute in der ganzen Welt verstreut sind. Nach einer ausgedehnten, bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts dauernden Pause in der historischen Kunstentwicklung eröffnete sich in den fest gefügten, großformatigen und kräftig modellierten Kompositionen des Caravaggisten Valentin die Perspektive des kommenden Jahrhunderts, das der französischen Kunst neuen Ruhm einbringen sollte. Gleich dem Italiener Caravaggio (1571 bis 1610) will Valentin durch eine spezifisch naturalistische Behandlung der heiligen Stoffe den Betrachter von der Wahrhaftigkeit des Geschehens überzeugen.
Gewiss ist dieser Naturalismus mit seiner forcierten Hell-Dunkelwirkung von einer eher rhetorischen Natur, die ihn von den späteren Tendenzen dieser Art (z.B. des 19. Jahrhunderts) grundsätzlich unterscheidet. Offenbar dient der markante Hell-Dunkelkontrast in Valentins Verleugnung des Petrus nicht nur Modellierungszwecken, denn das ausdrucksvolle Gebärdenspiel und der heftige Gegensatz von Licht und Schatten ergeben zusammen ein wichtiges Element der Bildaussage: das Hell und Dunkel stehen einander gegenüber wie die in der Seele des Apostels streitenden Furcht und Glaube.
Den nationalen Geist in seiner höchsten Form zu verkörpern, war einem anderen beschieden - dem aus Villers-en-Vexin, einem kleinen Ort in der Normandie stammenden Nicolas Poussin (1594 bis 1665). Sein Weg zu den Höhen der Kunst war schwer und mühsam, aber seine Leistungen übertreffen die seiner namhaften Zeitgenossen Simon Vouet (1590 bis 1649), Philippe de Champaigne (1602 bis 1674), Sébastien Bourdon (1616 bis 1671), Eustache Le Sueur (1617 bis 1655) und Charles Lebrun (1619 bis 1690), deren Ruhm neben dem seinigen verblasst. Höchst empfänglich für alles, was seine Erfahrung bereichern konnte, hat Poussin ein Werk geschaffen, das die Summe der aufgenommenen Einflüsse zweifellos überragt.
Doch wenn er davon spricht, dass er auf dem Wege zur Vollkommenheit nichts verschmäht hätte, ist das ganz wörtlich zu verstehen, und im wissenschaftlichen Schrifttum wird auch immer wieder nachdrücklich darauf hingewiesen, dass Poussin nicht das Alte einfach nachgebildet, sondern ein selbstständiges Kunstsystem geschaffen hat. Eine der wichtigsten Quellen, aus denen Poussin den Stoff für seine Werke schöpfte, war die Heilige Schrift. In seinen Darstellungen der Stoffe aus dem Alten und dem Neuen Testament wusste er ihnen eine echte Idealität zu verleihen. Unter seinem Pinsel entstanden groß und edel wirkende Darstellungen. In diesem Sinn verstand Poussin wie kein anderer die Vorzüge der antiken Kunst zu schätzen, zu begreifen und sich anzueignen.
Auf dem Wege zu seinem Stil hat Poussin verschiedene Entwicklungsstufen durchgemacht. Das Meisterwerk seiner Spätzeit, Ruhe auf der Flucht nach Ägypten, (1655/1657) wird überwiegend deshalb oft unterschätzt, weil seine Farbgestaltung auf eine etwas abstrakte Kombination lokaler Farben beschränkt ist. Indes handelt es sich bei diesem Gemälde um eine meisterliche, vollendete Komposition, bei der um der höheren, plastischen Ganzheit willen rein malerische Mittel zum Teil geopfert wurden. Größe und Ruhe - das ist es, was die dargestellte Szene vor allem charakterisiert. Gelassen und verlang-samt sind die Bewegungen Marias und Josefs, die im Schatten eines Tempels Rast halten, um Hunger und Durst zu stillen, und die gleiche Gelassenheit kennzeichnet auch die Bewegungen der daneben stehenden Frauen und des knienden Knaben. Die heilige Familie ist durch ihre zentrale Lage hervorgehoben, die durch die vertikalen Dominanten des Tempels und des Obelisken im Hintergrund noch mehr akzentuiert wird, ihre Umrisse und die Horizontalen der im Hintergrund dargestellten Prozession bilden die Achsen des kompositorischen Bildgerüsts. Alle Linien des Gemäldes sind aufeinander abgestimmt, der Bildrhythmus ist der harmonischen Gesamtwirkung untergeordnet. Unter den Nachfolgern Poussins gibt es sehr unter-schiedliche Künstler.
Verleugnung des Petrus
Valentin de Boulogne, frühes 17. Jh. Öl auf Leinwand, 119 x 172 cm. Puschkin Museum der Bildenden Künste, Moskau
Christus am Kreuz
Charles Lebrun, 1637. Öl auf Leinwand, 52 x 41 cm. Puschkin Museum der Bildenden Künste, Moskau
Bü?ende Magdalena
Georges de la Tour, 1640-1645. Öl auf Leinwand, 128 x 94 cm. Musée du Louvre, Paris
Rube auf der Flucht nach Ägypten
Nicolas Poussin, 1655-1657. Öl auf Leinwand, 105 x 145 cm. Ermitage, St. Petersburg
Einer der treuesten unter ihnen, Sébastien Bourdon, entwickelte seine Nachahmungs-fähigkeiten in einem solchen Ausmaß, dass er auf einen flüchtigen Blick hin sich gänzlich in sein Vorbild zu verwandeln scheint und vom nachgeahmten Meister kaum zu unterscheiden ist. Trotz des nach wie vor spürbaren Einflusses der alten venezianischen Schule war die französische Malkunst des 18. Jahrhunderts im Großen und Ganzen durch das Überwiegen französisch-flämischer anstatt französischitalienischer Verbindungen gekennzeichnet. In diesem Sinne kann festgestellt werden, dass der Sensualismus über den Rationalismus den Sieg davongetragen hatte. Hinsichtlich der religiösen Malerei sind zwei Wesenszüge besonders hervorzuheben: zum einen wird, was eine Änderung der Stilistik bewirkt, in ihr dem intim-sinnlichen Rechnung getragen, und zum anderen wird in dem Repertoire dieser Gemäldegattung erotisch und sensualistisch gefärbten Stoffen der Vorzug gegeben. An der Wandlung der Kunstgattungen kann man die Veränderungen in der geistigen Atmosphäre verfolgen. In dem Maße, wie die konsolidierende Kraft der Religion abnimmt, verliert sie die Fähigkeit, der Kunst als Quelle der Inspiration zu dienen. Selbst eine hervorragende, mit einem tiefen, nach einem malerischen Ausdruck verlangenden religiösen Gefühl begabte Künstlerpersönlichkeit kann in diesem Fall an dem historischen Entwicklungsgang nichts ändern.
Im 19. Jahrhundert erlebte die religiöse Kunst einen deutlichen, sich vor allem im Verlust der stilistischen Integrität ausdrückenden Niedergang; die Züge des Genres werden verwischt. Die Stoffe aus der Heiligen Schrift werden auf unterschied-lichste Weise behandelt, die verschiedenen Gestaltungsarten variieren von einem ausgearteten Klassizismus bis zum trostlos erdgebundenen Naturalismus. Die Bildsprache bekommt eine falsche Tonlage: man erhält den Eindruck einer akademischen Kälte, die Malerei wirkt entweder glatt und manieriert oder schal und alltäglich.
Der Geist, der die Gemäldegattung beseelt hatte, schien sich erschöpft zu haben, so dass er nunmehr in die Nachahmung anderer Gattungen verfällt. Jean Auguste Dominique Ingres (1780 bis 1867), der sich hartnäckig weigerte, mit seiner Zeit Schritt zu halten, schuf Madonnenbilder im edlen Stil der alten Malkunst. Am Ende des 19. Jahrhunderts machte Maurice Denis (1870 bis 1943), ein gläubiger Katholik und Theoretiker der religiösen Kunst, den Versuch, die verloren gegangenen Möglichkeiten der Bildgattung mit Martha und Maria aufs Neue zum Leben zu erwecken doch seine wichtigsten Leistungen auf diesem Gebiet gehören bereits dem 20. Jahrhundert an.