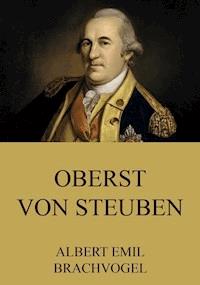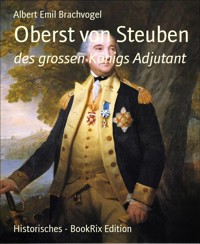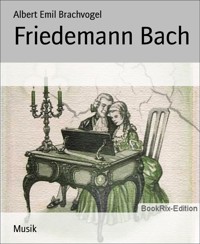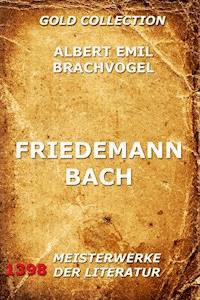
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wilhelm Friedemann Bach war ein deutscher Komponist aus der Familie Bach. Um das Leben des zwiespältigen Originalgenies im Sinne seiner Zeit legte sich bald nach seinem Tod ein Kranz romantischer Legenden. So werden ihm "sein roher Sinn, sein starrer Künstlerstolz, seine ungeheure Zerstreutheit und sein mürrisches zanksüchtiges Wesen, das im Trunke, dem er ergeben war, alle Rechte jeder Bürgerlichkeit und Ordnung verletzt" nachgesagt. Dieses Bild spiegelt sich auch in Albert Emil Brachvogels Roman Wilhelm Friedemann Bach von 1858. (aus wikipedia.de)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Friedemann Bach
Albert Emil Brachvogel
Inhalt:
Albert Emil Brachvogel – Biografie und Bibliografie
Friedemann Bach
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Kapitel XXII
Kapitel XXIII
Friedemann Bach, A. Brachvogel
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN:9783849604776
www.jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Vladislav Gansovsky - Fotolia.com
Albert Emil Brachvogel – Biografie und Bibliografie
Dramat. Dichter und Romanschriftsteller, geb. 29. April 1824 in Breslau, gest. 27. Nov. 1878 in Berlin, besuchte das Magdalenen-Gymnasium seiner Vaterstadt, wollte Schauspieler werden, besaß jedoch kein Talent, studierte in Breslau, lebte später in einem Dörfchen des Riesengebirges, dann, nach Verlust seines Vermögens, seit 1854 in Berlin, wo er Sekretär des Krollschen Theaters wurde und den Grund zu seiner Bühnenerfahrung legte. Nach dem Falliment der damaligen Direktion fand B. eine Anstellung im telegraphischen Bureau der »Nationalzeitung«, gab sie jedoch 1855 auf und lebte von nun an in freier literarischer Tätigkeit in Berlin, bis er 1870 nach Weißenfels übersiedelte. Später wendete er sich wieder nach Berlin zurück. B. vereinigte mit der Neigung zum Grellen und Phantastischen ein starkes theatralisches Talent, das sich in seinem dramatischen Hauptwerk »Narziß« (Leipz. 1857; 7. Aufl., Jena 1891) glänzend bewährte. Dagegen blieben ihm bei den folgenden Dramen: »Adalbert vom Babanberge« (1858), »Mons de Caus« (1859), »Der Usurpator« (1860), »Prinzessin Montpensier« (1865), »Der Sohn des Wucherers« (1863), »Die Harfenschule« (1869) und »Hogarth« (1870) gleich große Erfolge versagt. Brachvogels Romane beginnen meist mit phantasievollen Anläufen, mischen aber ungesunde Elemente und wirr abschweifende Betrachtungen ein und entbehren der künstlerischen Durchführung. Sein bester Roman ist »Friedemann Bach« (Berl. 1858, 5. Aufl. 1898); ihm folgten: »Benoni« (Leipz. 1860); »Der Trödler« (das. 1862); »Ein neuer Falstaff« (das. 1863); »Schubart und seine Zeitgenossen« (das. 1864); »Beaumarchais« (das. 1865); »William Hogarth« (Berl. 1866); »Hamlet« (Bresl. 1867); »Der blaue Kavalier« (das. 1868); »Der deutsche Michael« (das. 1868; 3. Aufl., Berl. 1895) u. a. B. schrieb außerdem: »Lieder und lyrische Dichtungen« (Berl. 1861; 2. Aufl., Leipz. 1869); verschiedene Novellen, drei »Theatralische Studien« (Jena 1863) und die »Geschichte des königlichen Theaters zu Berlin« (Berl. 1877–78, 2 Bde.), Seine »Gesammelten Romane, Novellen und Dramen« gab Max Ring heraus (Jena 1879–83, 10 Bde.).
Friedemann Bach
Kapitel I
Wer, von Halle kommend, den nördlichen Teil des lieben Thüringens betritt und das helle, regsame Weimar grüßt, hat kaum einen Begriff von der Stille und Abschlossenheit, in der das Bethlehem deutscher Poesie zu Anfang des 18. Jahrhunderts lag. Die wenigen Wege, die in die träumerische, von duftenden Matten durchzogene Talmulde führten, waren kläglich, und wenn unser aufkeimendes Geschlecht eine Fahrt nach Paris, London oder gar Amerika für eine halbe Bagatelle hält, so war doch damals eine Reise von wenigen Tagen ein gar bedenkliches Ding, das sehr lange erwogen und ohne die äußerste, peinliche Vorsicht und Vorbereitung kaum unternommen wurde, von den unverhältnismäßig hohen Kosten gar nicht zu reden.
In jenen Zeiten der idyllischen Selbstgenügsamkeit waren auch die geistigen Verkehrsmittel, das Zusammenströmen, Verschmelzen und Ausdehnen der Ideen durch Wort und Schrift noch höchst lückenhaft; daher kam es, daß einer ein sehr großer Mann sein konnte und doch weniger gekannt war als heutzutage ein Schneider, der seine Ware in jeder Zeitungsnummer lobpreisen darf.
Auch Weimar barg zu jener Zeit einen solchen Schatz, einen Künstler, dessen ewig junge Schöpfungen schon damals bewundert, aber von den wenigsten gewürdigt und begriffen, von der Masse indessen ignoriert wurden. Hier und da kannten ihn wohl einige der Besten seiner Zeit und flochten ihm den Lorbeer, doch kein Zeitungsartikel erhob sein Verdienst; auch die große Kunst der Reklame war noch nicht geboren, und -- wäre sie schon erfunden gewesen, der schlichte Meister im engen Häuschen zu Weimar, dort bei der Kirche, der hätte sich ihrer geschämt.
An einem reizenden Sommermorgen des Jahres 1717 kam auf schweißbedecktem Gaule ein Reiter die sogenannte große Straße, die von Sachsen herauf über Weimar nach Eisenach führte, einhergesprengt. Die Schöße seines zeisiggelben Rockes, der Busch seines ungeheuren, barettartigen Hutes fegten die Luft, und die unförmlichen Reiterstiefel kasteiten die Flanken seines Pferdes. Mit dem weißen Stabe, dem silbernen Wappen auf der Brust und dem Federmeer auf dem Haupte mußte man ihn für einen Herold halten, und wiewohl diese Gattung sehr werter deutscher Reichswürdenträger mit dem Dreißigjährigen Kriege schlafen gegangen war, schien er doch seinem Aus- sehen nach ein Glied dieser alten Gilde zu repräsentieren. Es war ein Kurier des Kurfürsten von Sachsen, August des Starken, an den Organisten Johann Sebastian Bach, der zum Staunen der guten Weimaraner vor jenem gebrech- lichen, von einem Gärtchen umschlossenen Hause abstieg, auf dessen Stelle später das Haus erbaut wurde, in dem Herder gelebt und gedichtet hat.
Mit der behaglichen Würde eines Mannes, der sich einer wichtigen, aber gewohnten Pflicht entledigt, schwang sich der Bote von seinem erschöpften Tier, band es bedächtig an und trat, nachdem er einen Moment seine dampfenden Weichen betrachtet hatte, in das Gärtchen ein. Alles war still, nur eine Löhnerin begoß die Beete, und in einer Geißblattlaube, die dicht am Eingang des Hauses stand, saß ein dreizehnjähriger Knabe und schrieb emsig auf einer Schiefertafel. Seine Arbeit schien ihn so ganz in Anspruch zu nehmen, daß sein Auge sich nicht vor dem Nahenden erhob. Auf der hohen Stirn, die fast zu breit und ausgebildet erschien für die dreizehn Sommer des Kleinen, perlte der Schweiß, - der Schweiß der Arbeit, wie er nur dem rastlos Strebenden eigen zu sein pflegt. Es lag überhaupt etwas Eigenes in dem Buben. Er war geistig frühreif; an jeglicher Bewegung, der Klarheit seines Auges, der straffen Haltung seines Körpers sah man, daß er sich schon jetzt seines Zweckes bewußt war, daß ihm der Gedanke, was er wohl wolle und könne, keine Skrupel mehr machte. In diesem dreizehnjährigen Buben hatte sich die qualvolle Arbeit der Jünglingsjahre, das Feststellen seiner Lebensziele bereits abgetan. Dieser sinnige Ernst, diese gedankenvolle, gewissermaßen eigensinnige Überzeugung seines Selbst, die in der schon ausgeprägten Plastik eines Kopfes lag, der auf dem schwächlichen Körper eines Kindes ruhte, verlieh ihm etvas Groteskes, fast Komisches, eine Art dünkelhafter Pathetik, in der ein weltkluger Beobachter den Keim zum tragischen Weh eines großen, unbefriedigten Strebens und Lebens woraussehen mochte.
Zweifelsohne lag diese Beobachtung dem kurfürstlichen Sendling fern; denn ungeduldig über die achtungslose Stille, fragte er: »Junge, gehörst du ins Haus?«
Langsam erhob der Knabe das Haupt, legte den Stift auf die Tafel und fragte: »Was will Er?«
»Das geht dich nichts an, dummer Junge! Ich will wissen, ob hier der Konzertmeister Sebastian Bach wohnt.«
»Das ist mein Vater; also geht mich das wohl an, weiß Er? -- Er kann jetzt ohnedem nicht mit ihm reden, er komponiert.«
»Das geht mich nichts an!« Und ungesäumt schickte der Würdenträger sich an, die steinernen Stufen zu ersteigen und die Tür zu öffnen, als der Kleine mit beiden Händen die Klinke erfaßte, sie in die Höhe drückte und den Mann so drohend ansah, daß er, verblüfft über diese Keckheit, einen Schritt zurücktrat.
»Weiß Er, was Komponieren ist? -- Das ist eine heilige Arbeit! So erhaben, wie wenn der Pfarrer sein göttlich Amt verrichtet; und wie Er den Pfarrer nicht stören darf in der Predigt, so darf Er auch meinen Vater nicht stören! Er mag wollen, was Er will: Er muß warten, bis der Vater vom Schreibtisch aufsteht!«
»Hm! -- Was das für eine Wirtschaft ist! -- Sendet mich der Herr Volumier her im Auftrag des allerdurchlauchtigsten Kurfürsten, soll den Brief abgeben und Antwort bringen, und muß wie ein Maulaffe hier an der Tür stehen, die mir so ein Bengel vor der Nase zuhält!«
»Haltet einmal, Mann!« sagte der Knabe. »Wenn Ihr einen Brief von Meister Volumier an meinen Vater bringt, so gebt ihn her. Ich warte an der Tür, bis er fertig ist; dann soll er ihn gleich lesen. Geht indes nur ruhig Eures Weges, in einer Stunde habt Ihr Antwort. Ein Trinkgeld kriegt Ihr auch, gebt nur her!«
Die letzte Bemerkung schien, trotz des Bewußtseins seiner Würde, Eindruck auf den Kurier zu machen; auch überlegte er, der Bach müsse doch wohl eine vornehme Person sein, da er, der sonst nur an Gesandte und Fürsten geschickt wurde, an ihn eine Sendung habe, und überdies flößte ihm das sichere Wesen des Kleinen, das Wort »komponieren« und der Vergleich mit dem Prediger solche Achtung ein, daß er langsam den Brief aus der breiten ledernen Tasche zog, die das kursächsische Wappen trug. Während er dem Knaben das Schreiben übergab, sagte er nicht ohne Ängstlichkeit: »Du scheinst mir ein vernünftiger Junge zu sein ... da ist's! Daß du's ja aber auch gleich abgibst! So du's verlierst, kriegst du so viel Hiebe, daß du dein lebelang genug hast. In einer Stunde komme ich nach der Antwort!« Damit entfernte er sich und bemerkte den verwunderten Blick des Knaben nicht, der das Wort »Prügel« ebensowenig zu begreifen schien wie den Verdacht, er könne den Brief seinem Vater nicht abgeben.
Der Kleine betrat das Haus, eilte durch den engen Flur in die Küche und hielt den Brief einer stattlichen Frau in mittleren Jahren von vollen, mit Gesundheit gesättigten Formen entgegen, die augenscheinlich beschäftigt war, der Dienstmagd beim Kochen zur Hand zu gehen.
»Liebe Mutter, da ist ein Brief von Herrn Volumier aus Dresden, ein Bote vom Hofe hat ihn gebracht. Ich hab' ihn auf eine Stunde wiederbestellt, da soll er sich Antwort holen und ein Trinkgeld.«
Die Gattin Bachs wischte die Hände sorgfältig an der Schürze ab und besah den fünfmal gesiegelten Brief nicht ohne Neugier. »Das dürfte was Wichtiges sein, Friede! — Trag ihn 'nauf, und wenn der Vater aufhört, sieh, daß er ihn gleich liest. Und sag mir's!«
Der Knabe nickte zustimmend, nahm das Schreiben wieder an sich, schlich auf den Zehen die ziemlich schmale Treppe, die nach dem Dachstübchen führte, hinauf und faßte an einer kleinen Tür Posto, hinter der für ihn der Inbegriff alles Schönen und Edlen, alles Glückes auf Erden verborgen lag: denn hinter dieser Tür saß lautlos am Pulte sein Vater, der große Bach, und schrieb an einer Motette.
Er war eine markige Gestalt in den dreißiger Jahren, die da in einem alten baumwollenen, oft geflickten Schlafrock in engen Stübchen saß, durch dessen offenes Fenster der fröhliche Morgenstrahl fiel, und die, von Büchern und Noten umgeben, ernst und still arbeitete. Die Ruhe wurde durch nichts unterbrochen, — nur jetzt... durch einen plötzlich aufjauchzenden Finkenschlag, der aus dem Wipfel der Linde herübertönte. Und den mußte Sebastian gerade gut gebrauchen können; denn lächelnd hob er sein Haupt, über seine ernsten stillen Mienen flatterte es wie ein Jubel und eine Rührung, seine Lippen öffneten und schlossen sich, als ob er eben seinem Gotte inwendig eine Antwort gegeben habe. Und dann schrieb er. Er schrieb, und die Noten wallten und wogten und türmten sich auf, flatterten zusammen und umschlangen sich, und eine Stimme hob sich nach der andern und wiederholte den Sang und brauste und schwoll im Chor und dehnte sich aus zu den Wolken in einem riesigen, seligen Halleluja.
Unvermittelt brach er ab; hielt ein, obwohl noch ein gutes Dutzend Takte an der Motette fehlten. Er wußte: sein Ältester steht wieder an der Tür, sein Friedemann, der ihm mehr wert ist als alle Motetten der Welt. Über alle Wonne des Vollendens geht die Vaterfreude, und so soll der Friedemann. der dreizehnjährige Junge, die Komposition vollenden!
Sebastian Bach sah lächelnd nach der Türe und hustete, und herein schlüpfte ehrfurchtsvoll der Knabe, in der Hand den Brief. »Bist du wohl fertig, lieber Vater?«
»Nein, Friedemann. Aber setze dich her, löse die Fuge auf und mach' den Schluß!«
Glühende Röte schoß über Stirn und Wangen Friedemanns, in seine Augen stiegen Tränen, und indem er zitternd die Feder nahm, küßte er die gütige Hand des Vaters. Dabei fiel der Brief zur Erde.
»Was hast du da, Friedemann?«
»Herr Volumier hat den Brief mit einem kurfürstlichen Boten geschickt. In einer Weile will er Antwort,« sagte hastig der Knabe, reichte dem Vater den aufgehobenen Brief hin und eilte mit ungestümer Hast an seine Arbeit.
»Ach, die Mutter wollte ja, ich sollt's ihr sagen, wenn du aufhörtest,« erinnerte sich der Knabe und erhob sich noch einmal.
»Laß nur, ich werd' die Mutter selber rufen,« und die Tür öffnend, rief Sebastian: »Frau, komm doch herauf!«
Während der Knabe wie vererzt an der Arbeit saß und Sebastian das Schreiben durchlas, war Dorothea Bach rasch eingetreten; auf des Gatten Schulter gelehnt, sah sie in den Brief. »Was will denn der Volumier, Bastian? Der schreibt solche Krillhaken, daß man kein Wort erkennen kann. -- Was gibt's denn Neues in Dresden?«
»Hör nur zu,« sagte Bach, »ich will's dir vorlesen: Herzlieber Meister Sebastian! -- Vor allen Dingen schönsten Gruß von mir und meiner Frau. Gesund sind wir alle, und was die Neuigkeiten bei uns anbelangt, so gibt's Witze hier genug und Anekdoten, -- man darf sie halt nur nicht so aufs Papier setzen. Aber in Dresden, bei einem Gläslein Punsch, wenn wir allein sind ...?!
Kurz und gut, damit Ihr wisset, warum ich Euch einen Expressen schicke, höret folgende Geschichte:
Der Franzose Marchand ist nach Dresden gekommen, hat sich hinter die Denhof gesteckt und ihr die Schürze gestrichen, und so ist er zu einem Konzert bei Hofe gekommen. Es ist richtig, der Kerl hat Schmalz in den Fingern, er appliziert die Sätze ganz meisterhaft und hat so einen weichen Druck der Klaves beim Adagio und macht das Crescendo verzweifelt gut, aber - hol mich der oder jener - Ihr macht's auch so! Von den Sachen aber, die er spielt, laßt mich nur ja still sein. Da ist kein Salz und kein Schmalz drin, seine Gedanken sind flach und leer und ohne Kraft. So ein altes süßes Genudel und Gedudel, wißt Ihr! Aber die Schürzen bei Hofe finden es schön, und - staunt nur! - der Allerdurchlauchtigste hat sich breit schlagen lassen und bietet dem Kerl eine Unsumme, er soll nur bleiben als Hofkomponist und weiß nicht was. Daß uns Dresdener Musiker das ärgert, könnt Ihr Euch denken! Die Allergnädigste Frau sieht auch scheel dazu, und wo sie den Schürzen eins aufflicken kann, freut sie sich herzlich. Da hab' ich denn ein paar Worte von Euch wiederum fallen lassen, und das kam ihr gerade gelegen. So hat sie nun neulich den Marchand bei Tafel vor dem Serenissimus schlecht gemacht und gesagt, Ihr könntet viel mehr als der Franzose. Darüber hat sich ein Streit erhoben. Der Allerdurchlauchtigste ließ mich rufen und fragte mich um meine Meinung. Ich sagte, ich wollte beweisen, daß, wenn Marchand mit Euch eine Art musikalischen Zweikampf machte, der Franzose den Spieß wegschmeißen müßte. - So soll ich Euch denn hierdurch im Namen des Allerdurchlauchtigsten einladen, auf eine Woche nach Dresden zu kommen und mit dem Marchand um die Wette zu spielen. Sperret Euch nur nicht und kommt; man kann nicht wissen, was es für Folgen hat.
Grüßet Eure Frau Liebste schön; und sie soll keine Geschichten machen und Euch reisen lassen!
Nun bin ich mit meinem Auftrag fertig und erspar' mir alles andere aufs mündliche. - Also, günstige Antwort!
Gott segne Euch und die Euren, das wünscht Euer alter Volumier.«
Es entstand eine Pause, während der nur die leise Bewegung der Feder Friedemanns hörbar war.
»Das ist eine schöne Geschichte!« sagte die Bachin. »Sollst so mir nichts dir nichts reisen? Und bis nach Dresden? -- Mein Gott, wer soll denn so rasch alles herrichten?«
»Ja, aber hin werd' ich wohl müssen, Schatz, sonst denken sie, ich hab' Angst vor dem Parlewu. Und das geht doch nicht!«
»Ja freilich, freilich! Das seh' ich ein. -- Aber ich seh' auch ein, daß Volumier den Marchand los sein will, und da ist der ehrliche Bach gut genug dazu, wenn die Dummköpfe nicht können. Wenn aber einer für dich was tun soll, damit du nach Dresden kämest und eine Stelle beim Kurfürsten kriegtest, da ist kein Mensch zu Hause.«
Bach lachte:»Natürlich! das wäre auch zu viel verlangt! Sieh, Frau, beim Handwerk hört die Freundschaft auf. Sie werden sich doch nicht den Marchand vom Halse schaffen, damit ihnen der Bach das Spiel verdirbt! Was schadet's denn auch? Ob ich in Dresden sitze oder hier: kann ich denn da mehr werden als der Sebastian Bach? Na, willst du mit?«
»Wo denkst du hin! Ich bleib' bei den Kindern, und« -- setzte sie leiser hinzu -- »du weißt, ich muß mich jetzt mit dem Fahren in Obacht nehmen. Nimm dir nur den Friedemann mit! Du machst dem Jungen eine Freude und bist nicht allein. Heute abend sprechen wir weiter. Ich muß gleich dazu tun, daß du reisen kannst.«
Damit eilte die Bachin hinab, und an den Geräuschen im Hause konnte man erkennen, daß die Reisevorbereitungen bereits im Gange waren.
Vater und Sohn blieben allein. Sebastian Bach betrachtete mit innerer Genugtuung den Knaben, der mit fliegenden Pulsen die letzte Note hinschrieb, dann einen langen Blick auf die Arbeit warf, die Hand noch einmal zögernd nach der Feder streckte, dann aber, rasch den Vater anschauend, doch aufstand.
Lächelnd trat der Vater ans Pult. »Du wolltest wohl was ändern? Man muß nie gleich nach der Arbeit verbessern. Was steht, das steht!« Damit setzte er sich und prüfte die Arbeit. -- »Was hast du denn ändern wollen?« fragte Sebastian plötzlich.
»Ich dachte, da wäre eine schlechte Ausweichung, es müßte halt einen besseren Übergang geben.«
»Ich weiß keinen, der besser paßt. Du siehst also, daß man in der ersten Hitze nicht gleich drauflosstreichen soll. Als ich so alt war wie du, habe ich mir auch immer Fehler hineingebessert. Na, ich bin aber zufrieden. Der Schluß ist ganz im Sinne des Übrigen geschrieben. Du wirst ein braver Musiker werden, wenn du so fortmachst, Friedemann.« Und er zog den seligen Knaben auf seinen Schoß, und Friedemann, seine Arme um des Vaters Hals schlingend, preßte sein glühendes Gesicht an dessen Brust.
»Na, laß es jetzt nur gut sein,« sagte Bach hastig nach einer Weile, »ich muß auf eine Woche nach Dresden an den Hof zu Meister Volumier; die Mutter kann nicht mit wegen der Geschwister, da sollst du mich begleiten.«
Lauter Jubel war Friedemanns Antwort. Was Wunder, daß sich in seiner Seele von den Meistern in Dresden, von der Hofkapelle, der Kammermusik und der glänzenden Oper, die Kurfürst August damals hielt, Vorstellungen gebildet hatten, vor denen die Märchen aus Tausendundeiner Nacht verblassen mußten.
Dies wußte der alte Bach sehr wohl, und den Knaben mit einigen leichten Aufträgen fortschickend, überließ er ihn sich selbst und seinen phantastischen Träumen ...
Einige Tage später verließ Sebastian Bach mit Friedemann das stille Weimar. Einen letzten Gruß noch, ehe das heimische Dach ihren Blicken entschwand, sandten Gatte und Sohn der daheimbleibenden Bachin zu; sie hatte, das jüngste ihrer Kinder, Bernhard, auf dem Arm, genug zu tun, um den wilden Christoph zurückzuhalten, während der dreijährige Emanuel laut weinend dem Vater nachschrie, weil er meinte, der komme nicht wieder.
Die Einfachheit und Ruhe, die fast nie gestörte Gleichförmigkeit einer kleinen Stadt wie Weimar, eines Hauses wie des Bachschen, bildete den schreiendsten Gegensatz zu dem wirren Treiben der Residenz Dresden, zu dem vielfarbigen Wechsel der Begebenheiten am Hofe Kurfürst Augusts des Starken.
Weimar hatte sich während der letzten dreißig Jahre wenig verändert, und Hof und Stadt lebten in einem patriarchalischen Gleichmaß der Tage. Weder Staats- noch Skandalaffären, weder üppige Pracht noch drohende Wetter der Zukunft hatten die Bewohner dieses Ländchens beunruhigt. Weimarisch Thüringen war einfältig, genügsam und anspruchslos; Elend und Mangel waren aber auch noch fremde Gäste in diesen friedlichen Tälern. Man war zufrieden und glücklich in Genügsamkeit. In Dresden und Sachsen indessen hatten die letzten dreißig Jahre tiefe Spuren ihres Daseins hinterlassen, -- und wenn Weimar einem einfachen, ehrlichen und genügsam tätigen Landmanne glich, so war Dresden der üppige, arbeitsscheue Abenteurer, der hirnlose Schuldenmacher, der, ohne eigene Kraft, ohne Mittel, lediglich durch Aufwand den Kredit erkaufte, um größeren Aufwand zu treiben.
Ludwig XIV., von seiner Zeit der Große genannt, hatte das blendende Menuett des Jahrhunderts eröffnet. »L'etat c'est moi!«, das war die Formel, der Lehrsatz, die Devise, die Ludwig auf das Banner der Zeit, den Kampfschild der Ausschließlichkeit geschrieben hatte. »Der Staat bin ich!«, das war die eherne Waffe, mit der die absolutistisch gewordene Autorität alles bekämpfte, was ihr vom Mittelalter her noch im Wege lag. Und in diesem Fürsten sahen alle Höfe, selbst die feindlichen, ihr Ideal. Der nie geahnte Glanz, den er um sich zu verbreiten wußte, war zu verführerisch, um nicht in Wien, Dresden und Petersburg begierig nachgeahmt zu werden. Es lag im ganzen Prinzip dieser Art von Regierung, gegen das eigentliche moralische Wesen der Herrschaft sich ignorant zu erweisen, von königlichen Pflichten nichts zu wissen, in allen den Dingen fördernd und bildend zu wirken, die zum individuellen Bedürfnis und Gelüst des Herrschers dienen mochten, hingegen allem mit eisernem Drucke entgegenzutreten, was diesen persönlichen Bedürfnissen widerstrebte. In jene Zeit fällt die Ausbildung des Militärwesens als eines Mittels zur Befestigung der Allmacht, in jene Zeit fällt der ausgesuchte Glanz und die Ermunterung der Industrie, soweit sie eben Luxus schuf, fiel das Ausbeuten und Großsäugen der Künste zum Nutzen der Höfe.
Unter allen gekrönten Nacheiferern des großen Ludwig war aber keiner bedeutender und konsequenter als Kurfürst August der Starke von Sachsen, König von Polen. Nächst Paris galt Dresden für den elegantesten Hof, und alles, was nach französischer Schablone zugestutzt war, wurde gangbare Münze im Herzen Deutschlands.
August der Starke war ein von der Natur mit allen Geistes- und Körpergaben reich ausgestatteter Monarch, dessen ganze Charakteranlagen, Anschauungen und Neigungen mit dem Geist Ludwigs XIV. ungemeine Ähnlichkeit hatten; aber der große Unterschied zwischen beiden war, daß August doch ein derbsinnlicheres Naturell hatte, daß seiner ganzen Erziehung das schärfere geistige Element, die tiefere Bildung abging, die die Jesuiten Ludwig verliehen hatten. August war ihm mehr in allen äußeren, materiellen Be- ziehungen des Lebens und Herrschens ähnlich. Der andere gewichtige Grund der Unähnlichkeit beider lag darin, daß eben Sachsen nicht Frankreich war. Das Bedürfnis des verschwenderischen, heißhungrigen Paris stand zu der Produktions- und Zahlungfähigkeit Frankreichs in ganz anderem Verhältnis als das Bedürfnis des Dresdener Hofes zur Opferfähigkeit Sachsens. Ludwig konnte alles, was er wollte; er war um die Mittel kaum verlegen, mit denen er etwas erreichen mochte, und die Größe seines Landes, das ihm eine fast tausendjährige Geschichte als Sockel seiner Taten geben konnte, imponierte der Welt weit mehr als das winzige Sachsen, dessen Existenz im Vergleich zu jenem Lande von gestern war. August wollte viel und konnte im ganzen doch wenig; und da er, von Eitelkeit und Stolz geblendet, nur das äußere glänzende Gewand des französischen Regimes zu erreichen strebte, versagten ihm die Kräfte, fehlten die Mittel, den inneren realen Glanz und Halt nachzuahmen, den Ludwigs höherer Geist dem Lande schaffte und der tiefer eingriff als das äußere Lappenwerk, das über seinem Katafalk zusammenfiel.
Die Weltlage im Jahre 1717 war für Sachsen unangenehm genug. Polen, dessen erledigte Krone August der Starke 1696 auf dem Reichstage zu Warschau durch das Wahlkomitee sächsischer Truppen gewonnen hatte, war ihm eine ewige Quelle des Ärgers, der Ausgaben und Unruhen gewesen, ohne daß er behaupten konnte, ein Volk, das seinem Arme so fern lag, wirklich zu regieren. Dieses Polen, das er besaß und nicht besaß, das ihn solche Summen kostete (man machte den Witz, er trage Sachsen nach Polen), das ihm den furchtbaren Jammer des Schwedenkrieges und ein ziemlich abhängiges Verhältnis zu Rußland eintrug: er mochte und konnte es nicht lassen! Und als das Slawentum unter Ledekusky sich abermals siegreich gegen ihn erhoben und alle Geldausgaben, alle blutigen Opfer des Schwedenkrieges dadurch vergeblich gemacht hatte, als das sächsische Heer auf allen Punkten geschlagen worden war, mußte er endlich froh sein, daß die Republik unter Vermittlung Peters von Rußland mit ihm Frieden schloß. Jener Mann, der es liebte, bei entsprechenden Gelegenheiten seine enorme Kraft zu zeigen und einen Pokal mit dem Druck seiner Faust wie Papier zusammenzubiegen, mußte sich nun zu den dunklen Schleichwegen der Intrige verstehen und das Maulwurfstalent verdächtiger Agenten in Bewegung setzen, um von jenem dünnen Königsreif noch zu halten, was möglich war. Versprechungen, Bestechung und der wollüstige Luxus, die üppige Weichlichkeit seines Hofes, in dessen Netze er die Elite des polnischen Adels zog, das waren die Mittel, die ihm den Königstitel und eine Schattengewalt erhielten, die freilich jeder neue Reichstag wieder fraglich machen konnte.
Die Kriegskosten, die der Schweden- und Polenkrieg August verursacht hatten, waren schon mehr als zuviel für Sachsen, und doch beanspruchten Augusts Liebschaften vom Lande zwanzig Millonen, und zwar zu einer Zeit, in der das Geld so schwer wie heute flüssig war.
Der schonungslos selbstsüchtige Wille, den die Autorität damals zur Befriedigung ihrer Lüste und Marotten als Recht beanspruchte, riß Tausende in schuldloses Verderben, er wirkte, von hoher Stelle als Dogma gelehrt, tief und ätzend auf die Familien und drückte sich mit dämonischem Siegel auf Unterricht und Erziehung, Sitte und Anschauung der Zeit ...
Wer hätte aber wohl so bittere Gedanken haben sollen, wenn er, wie Bach, in das Tor Dresdens einfuhr? Durch Augusts Geschmack und Beispiel hatte die Residenz ein höchst majestätisches Ansehen erhalten. Eine gediegene, obwohl pomphaft steife Würde strahlte von den dunklen Mauern der Häuser und Paläste, zwischen denen sich geschäftige Handelsleute, Handwerker und Lakaien drängten, während das Elend in Winkelgassen und Gruben gedrängt wurde, die nur von Polizeidienern und Bettelvögten einen flüchtigen Besuch empfingen.
Der Wagen hielt, und freudestrahlend empfing Volumier den alten, hochverehrten Freund, streichelte Friedemann die Wangen und führte beide hinauf in das trauliche Stübchen, wo der Imbiß harrte, während Diener und Magd das Gepäck in Empfang nahmen.
Was hatten die Freunde nicht alles einander mitzuteilen! Ernstes und Drolliges, Kunstgespräche und Hofgeschichten, alles kam an die Reihe, aber keine Note wurde gespielt; Bach war von den Stößen der ehrwürdigen Landkutsche, die ihn hergebracht, doch sehr ermüdet. Volumier teilte ihm nur noch rasch mit, daß der Kurfürst -- oder der König, wie er am Hofe genannt wurde -— von Bachs Ankunft wisse, daß man Marchands Spiel am nächsten Tage an einem neutralen Ort unbemerkt hören könne und dann zum Kampf geschritten werden solle.
Als Bach mit Friedemann endlich das Schlafzimmer betreten hatte und sich auszog, sagte er: »Hör' einmal, Friede, ich muß dir noch ein paar Lehren geben, ehe du ins Bett steigst. Merk gut auf, sonst kannst du mir leicht Feinde machen, wenn du unvorsichtig bist. Du hast, denk' ich, im Hause deines Vaters nur gute Musik gehört. Du bist, ich weiß es, mit sehr hohen Meinungen von den Dresdener Meistern hergefahren, und ich habe dich dabei belassen; denn nur, was man selbst erfährt, glaubt man. Morgen kommen wir in den Trubel und unter die Leute, ich sag' dir aber im voraus: du wirst mordsschlechte Musik in Dresden hören!«
»Das hab' ich mir von dem Marchand gleich gedacht, lieber Vater.«
»Nein, nein! Nicht allein der Marchand, -- in ganz Dresden hörst du keine gescheite Musik.«
»Von Volumier auch nicht?« fragte Friedemann erschrocken.
»Nein, auch nicht! Du wirst's wohl selber hören, aber ich sag's dir nur, damit du dir nichts merken läßt, und wenn du gefragt wirst, fein artig alles gerade sein läßt, -- oder lieber sagst, du verstehst es nicht.«
»Aber dann bin ich dumm, Vater?«
»Laß das die Leute lieber denken, als daß sie dich für einen naseweisen Jungen halten; denn daß du recht hast, glaubt dir doch keiner. Wenn sie dich spielen hören, werden sie schon sehen, ob du dumm bist oder nicht.«
»Aber, lieber Vater, machen wir denn in Weimar allein nur gute Stücke?«
»Das weiß ich nicht, mein Junge. Du wirst hier aber keine hören. Der Künstler, mein Sohn, er leiste, was er wolle, muß billig sein und die Schwächen seiner Genossen übersehen; denn das wahrhaft Gute ist selten, und ein Wort genügt, um dir Feinde zu machen. Nur was du selber schaffst, muß gut, und was du selber lehrst, muß richtig sein! Wer dich nicht mißachtet oder verfolgt, den mußt du gelten lassen, -- und ist er jämmerlich, ist er's für sich!«
»Aber, lieber Vater, Herr Volumier ist beim Kurfürsten? Und macht schlechte Musik? Und du bist bloß in Weimar...«
»Still, still, Friedemann! Der Herr Kurfürst ist halt eben -- ein Kurfürst und kein Musiker; er versteht's nicht besser. Beschlaf dir's und denke an das, was dir dein Vater gesagt hat, eh' du den Mund auftust! Die Reise soll eine Probe für dich sein; denn wem die Kunst das Leben ist, des Leben ist eine große Kunst. Die aber sollst du erst noch lernen. -- Morgen ist deine erste Lektion im Leben. Gute Nacht!«
Kapitel II
Bach und sein Sohn hatten Volumier und was sonst noch von Musikern in Dresden war, gehört, sie hatten auch, wie versprochen, bei der Gräfin Königsmarck, Propstin von Quedlinburg, dem Spiel Marchands in einem Nebenzimmer gelauscht: es war, wie Friedemann mit des Vaters beliebtem Ausdruck meinte, ein verdammtes »Gemansche«. Weder Sebastian noch der Knabe waren jedoch vorderhand dahin zu bringen gewesen, eine Taste anzurühren; überhaupt hatte Friedemann, der Lehren des Vaters eingedenk, sich sehr zurückhaltend bewiesen.
Monsieur Marchand, der an einem der folgenden Abende bei der Gräfin Denhof in Gegenwart des Kurfürsten gespielt hatte und gerade mit liebenswürdiger Glätte die Lobsprüche der Anwesenden einerntete, empfing plötzlich ein großes versiegeltes Schreiben in französischer Sprache:
»Ew. Wohlgeboren!
Der Unterzeichnete Sebastian Bach, Organist zu Weimar, welcher, Euer Wohlgeboren weltberühmtes Renommée als Klaviervirtuose kennend, begierig ist, Dero Fertigkeit im Vortrag als auch in der Stegreifkomposition zu bewundern, ist eigens deswegen aus Weimar hierhergekommen. Da er nun auch etwas Weniges die Musika praktizieret und wohl wissen möchte, inwieweit die französische der deutschen Kunst überlegen ist, bittet er Euch um die Ehre eines musikalischen Wettstreites, indem er sich erbietet, jedes Thema, so Ihr ihm aufgeben werdet, zu variieren oder zu fugieren, in zwei oder mehreren Stimmen, versieht sich von Euch auch einer gleichen Bereitwilligkeit und bittet, Zeit und Ort des Kampfes zu bestimmen.
Achtungsvoll Sebastian Bach.«
Der Franzose erbleichte und mußte sich zusammennehmen, damit das Papier seiner Hand nicht entglitt. August der Starke, der wohl wußte, was der Brief enthielt, verlangte dennoch die Ursache zu wissen, durch die Marchand außer Fassung gebracht worden war. Diesem blieb nichts übrig, als den Brief zu zeigen, und August, sich ganz erstaunt stellend, fand den Antrag höchst naiv und pikant; er be- stimmte einen Tag und das Haus des Grafen von Fleming zum Kampfe. Wohl oder übel mußte der Franzose nun annehmen.
Marchand hatte längst von Bach gehört; es waren ihm auch einige seiner Fugen zu Gesicht gekommen und, so eitel er auch war, ein Blick auf dieselben hatte ihm genügt, um zu wissen, was er von seinem Gegner zu erwarten hatte. Er war zudem Diplomat genug, um einzusehen, daß das alles ein angelegter Plan war, durch den die ihm mit hohem Gehalt vor kurzem angebotene Stelle eines sächsischen Hofkomponisten keineswegs mehr die ausgemachte Sache blieb, als die sie ihm vor dem letzten Besuch bei der Den- hof erscheinen mußte. Sein Entschluß war indessen gefaßt, und kaltblütig ging er der Entscheidung entgegen.
Heute war der Tag ...
Marschall Graf von Fleming hatte den Hof zu einer Soiree geladen, zu der auch die ganze königliche Familie erscheinen wollte. Die Galawagen rasselten die Pirnaische Gasse ent- lang und die Rampe des Palais empor; dort setzten sie ihren kostbaren, brillantenbesäten Inhalt ab, der sich wie ein Strom durch die orangeduftenden Vorhallen in die er- leuchteten Säle ergoß mit ihren steifen, überladenen Ver- goldungen, ihren Teppichen, Bronzen und Vasen im Wider- schein von Hunderten von Spiegeln. Was nur immer der Luxus und die Mode damaliger Zeit ersinnen konnte, war aufgeboten worden, um die Soiree aufs glänzendste, der Ehre würdig zu gestalten, die dem Hause Fleming durch den Besuch Augusts widerfahren sollte. Mit lauter Stimme kündigte der Zeremonienmeister die Namen der Gäste am Eingange des ersten Salons an, in den man trat, um von hier aus mehrere prächtige Galerien zu durchschreiten, in denen zahlreiche Gruppen von Kavalieren in weißer Perücke und mit schwarzem Schnurrbart flüsternd umherstanden.
Der Musiksaal, das Ziel der Gäste, strahlte mit seinen Lüstern und Girandolen, seinem weißrötlichen Marmorstuck und seiner schweren Vergoldung im Glanze zahlreicher Wachskerzen. Er war von ansehnlicher Höhe und Weite und, zur Förderung der Akustik, in einem regelmäßigen Achteck erbaut. Links vom Eintretenden befanden sich drei hohe Fenster, in jedem Wandfelde eins, deren vergoldete Läden und rotdamastene Vorhänge dicht geschlossen waren. Dem Eingang gegenüber lag eine reich vergoldete. geöffnete Tür, die den Anblick des Speisesaals freiließ; dieser trug eine besonders aus Paris verschriebene himmelblau mit Silber garnierte Atlastapete. Dem Mittelfenster gegenüber befand sich der Eingang zu einer Gemäldegalerie; und hier stand, das Feld des Kampfes bezeichnend, ein Pianoforte von Schröters neuester Bauart. In den beiden Zwischenwänden, die von den Türen abgeteilt wurden, waren in roter Nische auf schwarzen Marmorsäulen die Büsten Augusts des Starken und Ludwigs XIV. aufgestellt. Schwer vergoldete Sessel, rings an den Wänden gruppiert, waren bereits von den Gästen eingenommen worden, während drei Diwans mit schwellenden Kissen, dem Instrument gegenüber, noch auf den König, die Königin und den Kurprinzen warteten.
Welch eine stolze Versammlung alles dessen, was Sachsen an Reichem, Schönem, Vornehmem und Berühmtem bot! Welche Fülle strahlender und froher Gesichter!
War es nicht gerade, als wüßten diese Leute nicht, was eine Träne ist? Als wäre unter ihnen der Schmerz ein Fremdling?... Wie das lacht und schwatzt und lustig ist, als sei die Ewigkeit ein Traum und das Glück eine gefesselte Magd! Und doch! Und doch tanzt dieses ganze Geschlecht auf seinem Grabe, und doch ist so manches Lächeln erlogen, und doch schlägt unter seidenen Gewändern oft ein gemartertes, wimmerndes Herz, windet sich unter Ordenssternen ein falsches, treuloses und gequältes Gewissen ...
Der, dem das militärische Kleid so gut steht, ist der Oberstleutnant von Spiegel, eine ritterliche Gestalt mit flammendem Blick -- und doch nur ein dienstwilliger Sklave, der mit dem Abhub vorlieb nimmt, den ihm sein Herr aus Übersättigung gelassen; er wurde mit Fatima, einer orientalischen Schönheit, die von den Preußen bei Ofens Erstürmung zum Beutestück gemacht und später Flemings Kusine, der Frau von Brebentau, geschenkt worden war, beglückt, nachdem sie das Herz Augusts gerührt hatte. Eifrig unterhält er sich mit der Gräfin Haugwitz, die, in meergrünem Moiré, mit schwarzen Spitzen und der dreifachen Perlenschnur, recht schwärmerisch dreinblickt, wie eine gekränkte Unschuld, eine verkannte Seele; sie ist melancholisch geworden, die Gute, seitdem sie Frau Hofmarschallin ist, und als man sie noch Fräulein von Kessel nannte und sie Augusts diamantene Rosen an der Brust trug, war sie selbstbewußter. Nicht weit von dieser untergegangenen Sonne ruht auf schwellendem Sessel eine Dame in gelbem Atlas mit eitlem Unterkleid aus Silberzindel, ein sieghaft aufgehendes Gestirn: das blendend schöne Fräulein von Dieskau, die größte Meisterin in der Unschuldskoketterie, so dumm sie sonst auch sein mag. Nachlässig mit der Hand auf dem Arm des ernsten, biederen Gouverneurs von Dresden, General von Klenzel, trommelnd, erzählt sie ihm eine jener geheimen Anekdoten, die bei Hofe nicht allzu selten sind.
In der Mitte des Saales, seine Gäste empfangend, steht der Minister und Feldmarschall Graf von Fleming neben seiner Gemahlin. Er ist sich des Einflusses bewußt, den er auf den König durch seine Freundin und Schülerin, die Komtesse von Denhof, ausübt, jenes schöne Weib, das, strahlend in rotem Damast und besät mit Spitzen und Rubinen, am Arm der Mutter zu ihm tritt; er hat die Gräfin, nachdem er die allverhaßte Kosel gestürzt, zur Gebieterin über Augusts Herz gemacht und hofft, durch sie dauernder als alle anderen den König zu fesseln. Sein Herz hebt sich bei dem Stolz des heutigen Tages, an dem er den Hof zum erstenmal empfängt, an dem er als Mäzen des allseits bewunderten Marchand glaubt träumen zu dürfen, ein kleiner Ríchelieu zu werden.
Links vom Eingang in den Saal stehen, in ein angeregtes Gespräch vertieft, der Oberkämmerer von Vitzthum, der sich noch nie in Regierungsgeschäfte gemischt und sich bislang in der Gunst Augusts gehalten halt, und der Baron Hektor von Klettenberg, Kammerherr und Schloßhauptmann von Senftenberg, ein schmächtiges, in schwarzen Atlas gekleidetes Männchen von teufelsmäßig verschmitztem Profil; er ist geheimer Adept des Königs, der für die von ihm geübte Kunst des Goldmachens so lange die ungeheuersten Summen verlaborieren wird, bis August, trotz allen Aberglaubens und aller Habsucht, die Augen aufgehen und er ihm den Kopf abschlagen läßt.
Die Unterhaltung der beiden wird von einem kleinen, falstaffdicken Kerl, dem Hofnarren und königlichen Hoftaschenspieler Josef Fröhlich, und dem immer melancholischen Baron Schmiedel gespannt verfolgt. In silbergrauen Taft gekleidet, einen Flor am Arm, mit blassem, verhärmtem Gesicht ist er ein Mensch, der alle Dinge von der Grabesseite ansieht; aber in der ständigen Luft französischen Esprits brauchte man seinen ewigen Schmerz ebenso zur Belustigung wie die sächsische Pöbelkomik und den plumpen Humor seines heiteren Gegenteils. Nie wird es der Baron versäumen, am Morgen nach dem Tage, an dem ein Günst- ling oder eine Mätresse gefallen ist, seine Kondolenzkarte mit dickem Trauerrand an dieses neueste Opfer Augusts zu senden.
Dicht bei dem Platze der königlichen Familie, alle Blicke auf sich lenkend, sitzt die interessanteste Frau der Zeit, die Gräfin Königsmarck, Propstin von Quedlinburg, angetan mit einem schwarzseidenen, mit Spitzen verbrämten Kleid, das fast wie ein Trauerkostüm wirkt; sie unterhält sich mit dem Kabinettsminister Graf Heinrich von Hoymb, dem geschiedenen Gemahl der Kosel, dem ewigen Ränkeschmied, und mit dem Hofmarschall von Haugwitz.
Aurora von Königsmarck, die trotz ihrer vorgerückten Jahre noch nicht den Reiz der Jugend verloren hatte, war nicht nur die schönste, sondern auch die geistreichste und achtungswerteste von Augusts Liebschaften. Sie hatte eine tiefe und wahre Neigung für ihn, die seine Treue weit überdauerte; und sie war uneigennützig genug, ihm auch dann noch eine ergebene Freundin, eine opferfähige Dienerin zu sein, als sie ihre Zukunft in Quedlinburg gesichert wußte und sich von ihm auf immer gemieden sah. Ihre Neigung war um so reiner und besser geworden, als sie fern von Wünschen und Plänen war. Vor Antritt ihrer Propstei hatte sie sich mit der Königin versöhnt, die, durch Auroras rührende Liebe, Verehrung und Reue besiegt, sich in ihre wohlwollende Gönnerin verwandelt hatte. Und da auch August den hohen Wert dieser Frau, zu spät vielleicht, erkannte und es gern sah. wenn sie am Hof erschien, so rechnete man sie wieder zur königlichen Familie.
In diesem einzigen Saale war außer dem still lächelnden Sebastian Bach, der, ans Klavier gelehnt, neben Volumier stand und die Gruppen beobachtete, nicht eine Person, deren Herz und Hirn unbeschwert und nicht beunruhigt gewesen wäre. Das war der Hof Augusts des Starken, der mit Ludwig von Frankreich um die Ehre buhlte, der glänzendste, geistreichste und gesittetste Repräsentant der Kronen Europas zu sein.
Die Versammlung war nicht nur heute, sondern immer in zwei Heerlager, zwei Parteien geteilt, deren stiller, äußerlich wenig sichtbarer Kampf in der heutigen Soiree am deutlichsten durch den bevorstehenden Wettstreit Bachs und Marchands ausgesprochen war. Auf der einen Seite stand, freilich in der Minderzahl, die alte Autorität mit ihrem Glauben, ihrer Einfachheit und ihrem Ernst; sie war's, die auf die Kirche, den altehrwürdigen Ritus, den geistlichen Stil in der Musik, auf deutsches Wesen und die Ehrbarkeit der Väter hielt. Zu ihrer Fahne standen die Königin, ihre Favoritin, die alte Oberhofmeisterin, Gräfin von Kollowrat, General von Klenzel, Fürstenberg, die innerlicher gewordene Aurora von Königsmarck und noch ein Bruchteil älterer Hofdamen und Kavaliere, die die Gewohnheiten der Väter zumindest bequem fanden. Dieser spezifisch kirchlichen Partei gegenüber machte sich siegreich der Egoismus in französischen Kleidern breit, siegreich als Idee, siegreich als Praxis; doppelt siegreich, weil er neu und von der Mehrzahl unterstützt war. In diesem Lager, dem der Kurfürst selbst angehörte, gaben nächst ihm Fleming und die Denhof, Spiegel, Hofmarschall von Haugwitz, Hoymb und Klettenberg den Ton an. Frau von Haugwitz, die hoffte, noch einmal die verlorene Gewalt wiederzuerlangen, und die Gräfin Dieskau, die eben dabei war, sie zu erringen, schlossen sich an, weil sie wußten, daß dies ein bequemer Weg zum Herzen des Gebieters sei. Die eigentlich Indifferenten dabei waren Vitzthum, wie in allen Dingen bereitwillig zu jedem Geschäft und Freund mit jedermann, und der Kurprinz, dessen einzige Leidenschaft die Jagd war. Der junge polnische Adel war an sich schon für das Franzosentum eingenommen, weil es seinem leichten Blut zusagte. Der Page Sulkowsky, verarmter Nachkomme eines polnischen Fürstengeschlechts, und von Brühl, der Leibpage des Königs, hielten sich sehr zurück; beide, der eine ganz Ohr für den Prinzen, der andere ganz Auge für August II., waren noch Komparsen bei diesem Schauspiel.
Der Kampf Bachs mit Marchand war nur ein Seitenstück zu dem Kampf der Hofparteien, und Volumiers Schicksal war abhängig von seinem Ausgange. Daher war bei der Gesellschft begreiflicherweise auch von nichts weiter als diesem bevorstehenden Ereignis die Rede. -- Bereits hatte Marchand in violettem Hofkostüm die Nebengalerie betreten, mit Herrn von Fleming einige Worte gewechselt und sich ins Ankleidezimmer des Marschalls zurückgezogen, um sich -- wie er sagte -- nicht eher als nötig mit seinem Gegner zu amalgamieren, als der König, die Königin Eberhardine am Arm, mit seinem gnädigsten Lächeln in den Saal trat. Hinter ihm folgte, in einfachem Militärrock, der Kurprinz, der die alte Gräfin Kollowrat führte, eine majestätische, immer noch schöne Frau. Den Schluß bildeten Sulkowsky, Brühl und der Kammerdiener Hennicke. -- Marschall Fleming und Vitzthum eilten, die Herrschaften zu empfangen.
»Nun, lieber Fleming, Sie wollen uns also heute einen seltenen Genuß bereiten: wir sollen dem Turnier der beiden Meister französischer und deutscher Musik beiwohnen. Fürwahr, ich weiß noch nicht, wie ich mich gegen Sie revanchieren soll.«
»Durch dero Allerhöchst fernere Gnade, Majestät,«antwortete der wonnestrahlende Fleming.
»Auch unsere liebe Denhof hat sehr bedeutenden Anteil an der Schöpfung dieses Festes, wie ich mir sagen ließ?« Und einer jener elektrischen Blitze schoß aus den Augen des Königs auf die Gräfin nieder, die sich lächelnd verbeugte.
August der Starke schritt langsam weiter, nickte listig der mit seltener Geschicklichkeit errötenden Dieskau zu und wandte sich, indem er einen kalten Blick über die lauernde, bleiche Haugwitz schlüpfen ließ, an Klettenberg: »Wie weit sind Sie mit der letzten Prozedur? Ist die Mischung geglückt?«
»Fast, Majestät! Das Amalgam muß in Quantität oder Qualität zu stark gewesen sein, die Retorte sprang. Ich muß es noch einmal mit schwächerem Zusatz beginnen.«
»Mein Gott, wie langweilig und kostspielig das ist! Gibt es kein einfacheres Verfahren?« rief der Herrscher.
»Das Verfahren ist eben das Geheimnis, Majestät! Wer es erst hat, ist Herr der Welt! Daß sich kleinere Quanta des kostbaren Metalls liefern lassen, davon haben Majestät Allerhöchst selbst sich überzeugt; aber die Mischung in solcher Progression herzustellen, daß sie eine so grenzenlose Ausbeute gibt, wie wir wünschen, ist das Werk vieler Jahre.«
»Leider!«seufzte der Fürst. »Vitzthum, weisen Sie Klettenberg neue dreihundert Dukaten an!«
In demselben Augenblick hatte die Königin, die bis dahin, kalt nach allen Seiten grüßend, schwieg, Aurora von Königsmarck gesehen, die gesenkten Hauptes seitwärts in ihrer Nähe stand. »Was macht Moritz?« flüsterte sie leise und streckte ihr die Hand entgegen, »ich hörte, er sei ernstlich krank.«
Die Propstin küßte die Hand der Königin, auf die verstohlen eine Träne fiel: »Ich danke Eurer Majestät für die huldvolle Gnade. Der Himmel hat ihn mir erhalten, damit ich nie vergesse, wie demütig ich für die Huld meiner Königin sein soll!«
Ein krampfhafter Druck von der Hand der Königin, ein warmer, verzeihender Trostesblick aus ihren Augen war die Antwort. Gemeinsames Leid hatte die beiden Frauen zu Freundinnen gemacht.
Der König, der inzwischen mit Haugwitz und Fürstenberg einige leichte Scherzworte gewechselt, trotzdem aber Auroras leise Antwort gehört und verstanden hatte, biß sich auf die Lippen, bot schnell der Königin den Arm und geleitete sie zu den Plätzen der königlichen Familie.
»Sind die beiden Musikmeister bereit?« fragte er Fleming.
»Ja, Euer Majestät, und warten auf Allerhöchsten Befehl.«
»Stellen Sie mir den Bach aus Weimar vor!«
Fleming verbeugte sich, eilte zum Klavier und kam in wenigen Augenblicken mit Sebastian Bach, der einen einfachen, schwarzen Rock und den Hut im Arm trug, zurück. Hinter beiden folgte Volumier mit ängstlich bekümmertem Gesicht. Aller Blicke wandten sich auf die Gruppe.
»Das ist Bach, Euer Majestät,« sagte vorstellend Fleming mit etwas mitleidigem Lächeln.
»Er hat sich also angemaßt, dem Marchand eine Herausforderung zu einem musikalischen Wettstreit zu schicken?«
»Jawohl, Euer Majestät! Ich hab' aber nicht gemeint, daß ich mich vor Eurer Majestät damit großtun wolle.«
»Ah, und jetzt wird Ihm bange? Er hat sich wahrscheinlich zu viel vorgesetzt?«
»Nein, bange ist mir nicht, Majestät. Die deutsche Kunst braucht sich nicht zu fürchten vor der französischen.«
»So, so! Wollen sehen! Es scheint aber nicht, daß die deutsche Kunst soviel einbringt wie die französische,« und der König warf einen Blick auf das schlichte, unmoderne Gewand Sebastians.
»Da haben Eure Majestät recht. Daraus muß sich aber der Künstler nichts machen. Wer nach dem Guten strebt, soll sich vorher sagen, daß der Flitterkram und das Blendwerk, das die Sinne kitzelt und seicht ist, schneller Eingang findet und besser bezahlt wird als das ernste, ehrliche Streben. Wer das nicht vorher überlegt, muß nicht erst anfangen, Majestät!«
Alles war erschrocken über die beispiellos kecke Antwort des Organisten, und Volumier zupfte erbleichend Sebastian am Schoß. August runzelte die Stirn, seine Wangen überflog ein leichtes Rot, und er sah mit einem jener Blicke, die schon manchen Höfling zagen gemacht, auf ihn nieder. Als aber Sebastians klares, ruhiges Auge die stille Drohung so ruhig aushielt, lächelte der König.
»Nun spiele Er! -— Fleming, lassen Sie Marchand rufen!«
Der König ließ sich nieder, die Versammlung nahm Platz, und Bach stand neben Volumier am Instrument, indes Fleming selbst nach dem Ankleidezimmer eilte, um den französischen Meister einzuführen.
Es herrschte eine lautlose Stille, in der jedermanns Beklemmung und Neugierde wuchs. Der König war augenscheinlich nicht in der besten Laune. Sei es, daß Klettenbergs wieder nutzlose Versuche oder Bachs Benehmen ihn verletzt, sei es, daß er unangenehme Herzensregungen bei Auroras Worten empfunden hatte: genug, jeder fühlte, daß der Unterliegende bei diesem Wettstreit keine beneidenswerte Rolle spielen würde. Schon sandte Gräfin Denhof ein mitleidiges Lächeln zu Bach hinüber, und Baron von Schmiedel sagte zu Fürstenberg: »Ich werde heute abend eine Kondolenzkarte schreiben.« -— Da entstand bei der Galerie eine seltsame Bewegung, und Fleming, bleich und außer Fassung, schwankte auf den König zu.
»Was haben Sie, Fleming?«
»Majestät, ich bin sprachlos vor Entsetzen! Vor einer Viertelstunde war Marchand noch hier — in meinem Toilettenzimmer — und nun ... ist er fort!«
»Fort?« Und der König erhob sich gereizt. Dunkle Röte überzog sein Gesicht. »Fort? Nein, Sie irren wohl! Es wird ihm unwohl geworden sein. Er hat vielleicht in der Eile seine Noten vergessen. Volumier und Vitzthum, eilen Sie in seine Wohnung und sehen Sie, was der Mann macht!«
Damit wandte sich der Fürst zur Königin und Propstin Königsmarck und ging in leichte Konversation über.
Man stand in Gruppen umher und besprach den ominösen Zwischenfall. Fleming stand allein und suchte sich durch ein Zeichen mit der Denhof zu verständigen, die, wie er, in Ängsten war, sich zu kompromittieren. Er sah sie starr an, zuckte unmerklich mit den Achseln, und die schöne Gräfin verbarg hinter dem Fächer zwei Tränen der Wut und Enttäuschung. Der alte General von Klenzel aber trat mit richtigem Taktgefühl zu Bach und fragte ihn in liebenswürdigster Weise nach seinen Verhältnissen ...
Nach Verlauf einer Viertelstunde, in der es schien, als habe August bereits den ganzen Vorfall vergessen, kamen Vitzthum und Volumier zurück. Der Oberkämmerer, ein in grünen Samt gebundenes Notenbuch im Arm haltend, schritt auf den König zu, der ihn fragend anblickte.
»Majestät halten zu Gnaden: wir fanden die Wohnung von Monsieur Marchand leer; vor einer Viertelstunde hat er mit Sack und Pack Dresden verlassen. Das einzige, was von ihm zurückgeblieben, ist das Chanson mit Variationen, das er Euer Majestät unlängst dedizierte.«
Die Versammlung war starr vor Schreck. Aller Augen wandten sich nach der unglücklichen Denhof und nach Fleming, die den Franzosen so angelegentlich empfohlen hatten. Jeder wußte, daß August am wenigsten der Mann sei, eine Täuschung zu ertragen; er bezwang sich jedoch noch, nahm mit großer Ruhe das Chanson, das ihm Vitzthum reichte, entgegen und winkte Bach zu sich: »Sein Gegner hat, wie's scheint, aus irgendeinem Grunde für jetzt das Feld geräumt. Das beweist aber noch nicht, daß Er ihm überlegen ist. Wir haben hier eine seiner Kompositionen, die das Geistreichste und Schwierigste ist, was er vor uns spielte. Seh Er sie an! Traut Er sich, sie nachzuspielen?«
Bach blätterte einen Augenblick in den Noten.
»Majestät, solch Zeug spiele ich nicht. Die Musik ist eine schöne, edle Kunst, eine Gottesgabe, die nicht zu solchen Schnurren da ist. Wollen Euer Majestät das da aber hören, so hab' ich meinen Jungen, den Friedemann, bei der Hand; der kann sie spielen.«
»Was? Was sagt Er da?! Er kann oder will das nicht spielen?«
»Nein, das spiele ich nicht, Majestät! Ich bin mir bewußt, meinen Gott anzubeten durch meine Kunst, - und wie kein Diener des Herrn sich soll zum Narren machen, so wird's Sebastian Bach auch nicht tun!«
»Hm! — Nun, laß Er seinen Jungen rufen!«
Man ließ sich nieder. Bach trat in die Galerie und brachte Friedemann an der Hand herein. Der Knabe, rot vor innerer Bewegung, setzte sich an das Instrument, und Volumier wandte, in sich hineinlächelnd, die Blätter um. Bach, der Vater, trat zur Seite, als ginge ihn das alles nichts an.
Friedemann begann ruhig und sicher das Thema und führte die Variationen durch alle Umkehrungen und Verschlingungen mit solcher Reinheit und so leichter Ungezwungenheit aus, daß der König, der Hof und die ganze Versammlung in rauschenden Beifall ausbrachen.
»Er hat da einen exzellenten Jungen, Bach! Das ist ganz unerhört! Wie ist's möglich, daß man das in solchem Alter leisten kann?«
»Er hat mit vier Jahren schon angefangen, Majestät. Die Hauptsache aber ist, daß er sein Leben lang die ernste Musik, den großen Kirchenstil, in dem polyphone Gedanken sind, praktiziert hat. Die deutsche Musik blendet vielleicht nicht so, aber sie ist schwerer, und es gehört Kopf und Herz dazu, wenn man ihr etwas abgewinnen will.«
»Dann war' es schlimm für uns, daß man sie uns so lange vorenthalten hat. Kann Er uns nicht etwas davon zeigen?«
»Gewiß, Majestät! -— Ich hab' mich gegen Marchand unterfangen, jedes Thema, das er mir stellen würde, zu variieren und zu fugieren. Wenn mir Euer Majestät ein Thema, womöglich ein kirchliches, stellen wollen, so bin ich bereit.«
»Das geht wohl mehr die Damen an,« sagte August, sich zur Königin wendend. »Wollen Euer Majestät das vielleicht übernehmen?«
Die Königin errötete leicht. -— »Als ich vor einem Jahre in Hamburg war, hörte ich in der Kirche einmal auf der Orgel den alten Organisten Reinken einen Choral spielen. Der ergriff mich damals so sehr, daß ich mich heute noch des Eindrucks wie von gestern her erinnere. Ich glaube, das Lied begann: An Wasserflüssen Babylons.«
Da war's, als wenn Sebastian Bach erschauerte, und eine heilige Rührung kam über ihn.
»Ja, Majestät, das kenn' ich! Und wenn ich auch nicht wert bin, dem alten Reinken die Schuhriemen zu lösen, so danke ich doch Euer Majestät herzlich, daß Sie mich würdig erachten, ihm das nachzuspielen. Mit Gott will ich's versuchen!«
Er trat ans Klavier, nicht gebückt mehr wie der arme Organist aus Weimar, sondern wie Ariel, der zum Preise der Gottheit singt. Mit hastiger Gebärde warf er das Marchandsche Chanson vom Klavier aufs Parkett, legte das Pult um und setzte sich.
Sein Blick richtete sich nach oben, und in tiefer, feierlicher Stille begann er leise und ernst den Choral:
»An Wasserflüssen Babylons sitzen die verstoßenen Kinder des Herrn Und weinen ob ihres Elends. Der alte Serubabel singt schwer und klagend das Tränenlied, Daß der Herr die Seinen verstoßen, Und die Weiber und Männer und die lallenden Kinder fallen klagend und seufzend ein. Zu ihren Füßen murmelt der Strom und trägt Auf den Wellen ihre Sehnsucht weiter Zu fernen Gestaden.