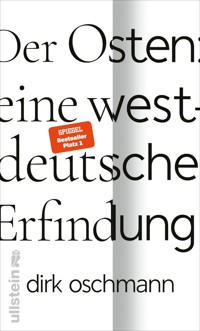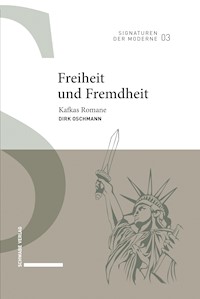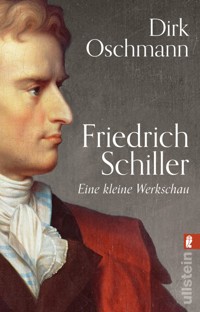
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Überblick über Schillers gesamtes literarisches Schaffen Dieses kleine Buch bietet eine gleichermaßen kompakte wie umfassende Einführung in Schillers Werk und setzt dabei einen Akzent auf seine poetischen Texte. Es stellt Friedrich Schiller als Lyriker, Dramatiker und Epiker in den Mittelpunkt, zeigt ihn aber ebenso als Mediziner, Historiker und Theoretiker von Rang. Studierenden und anderen literarisch Interessierten wird ein schneller, am aktuellen Forschungsstand orientierter Überblick ermöglicht. Darüber hinaus gibt Dirk Oschmann eine Antwort auf die Frage, welche Relevanz die Werke Schillers heute noch beanspruchen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Friedrich Schiller
DIRK OSCHMANN, geboren 1967 in Gotha, Studium der Germanistik, Anglistik und Amerikanistik in Jena und Buffalo / USA; seit 2011 Professor für Neuere deutsche Literatur an der Universität Leipzig; Gastdozent an der University of Canterbury / UK 2009; Gastprofessuren in den USA an der UC Davis 2006, der University of Notre Dame 2010 und der Brown University 2013. Bücher u. a.: Bewegliche Dichtung.Sprachtheorie und Poetik bei Lessing, Schiller und Kleist, München 2007; Freiheit und Fremdheit. Kafkas Romane, Basel 2021. Bei Ullstein erschien 2023 Der Osten: eine westdeutsche Erfindung, das auf große bundesweite Resonanz stieß und wochenlang auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste stand.
Schriftsteller, Mediziner, Historiker, Theoretiker, Übersetzer, Mann der Theaterpraxis und Herausgeber von Zeitschriften: Friedrich Schiller (1759–1805) war auf vielen verschiedenen Gebieten tätig. Dabei prägen zwei Aspekte sein gesamtes Werk. Erstens soll der Mensch frei sein, zweitens soll er ein ganzer Mensch sein – er soll an seiner Verstandesbildung ebenso arbeiten wie an seiner Herzensbildung. Die Begegnung mit Kunst muss dem Menschen beides ermöglichen: sich als frei und ganz zu erfahren. Das aber hängt ausschließlich von der Form eines Kunstwerks ab, und so präsentiert dieses Buch Schiller ebenso als Theoretiker wie als virtuosen Praktiker der Form.
Dirk Oschmann
Friedrich Schiller
Eine kleine Werkschau
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2024Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: akg-Images (F. v. Schiller / Portrait by Gerhard von Kügelgen, 1808/09)Autorenfoto: © Jakob WeberE-Book Konvertierung powered by pepyrusISBN 978-3-8437-3259-8
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
Vorwort zur Neuausgabe
Einführung
Schillers Sprache
Schiller als Mediziner
Schiller als Dramatiker I: Die frühen Dramen
Schiller als Lyriker
Schiller als Erzähler
Schiller als Historiker
Schiller als Theoretiker
Schiller als Dramatiker II: Die klassischen Dramen
Schluss
Literaturhinweise
Biografische Eckdaten
Anmerkungen
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Vorwort zur Neuausgabe
Vorwort zur Neuausgabe
Dieses Buch erschien zuerst 2009 im Verlag Böhlau/UTB in der Reihe Profile. Es war seit Langem vergriffen. Ich freue mich deshalb sehr, dass der Ullstein Verlag mir nun eine bibliografisch leicht aktualisierte Neuausgabe mit neuem Untertitel ermöglicht.
Die hochgradig ausdifferenzierte Literatur zu Schiller ist längst unübersehbar geworden. Das Buch unternimmt den Versuch, die Grundlinien seines kurzen, aber mannigfaltigen Schaffens in leicht zugänglicher Form zu skizzieren. Es verfährt dabei im Unterschied zu den meisten anderen Einführungen nicht biografisch, sondern orientiert sich an Werkphasen, Tätigkeitsfeldern und literarischen Gattungen im engeren Sinne. Die in rund 25 Jahren, nämlich von etwa 1780 bis zu Schillers Tod 1805 entstandenen Texte bezeugen das große Spektrum seiner Aktivitäten ebenso wie seine ungeheure Produktivität. Darüber hinaus zeigen sie ihn als einen der wichtigsten, radikalsten und einflussreichsten Dichter und Denker der anbrechenden Moderne.
Leipzig im Juni 2024
Dirk Oschmann
Einführung
Schiller war auf vielen verschiedenen Gebieten tätig: als Lyriker, Dramatiker, Erzähler, als Mediziner, Historiker, Theoretiker, als Übersetzer, Mann der Theaterpraxis und Herausgeber von Zeitschriften. Ungeachtet der Verschiedenheit der Gebiete hat er freilich immer wieder ähnliche, sein gesamtes Werk prägende Gesichtspunkte verfolgt. Zwei von ihnen ragen heraus, die sich beide auf die Bestimmung des Menschenrichten. Erstens soll der Mensch frei sein: Er soll unabhängig von äußeren Zwängen und in der Lage sein, sich auf dem Fundament seiner Vernunft selbst zu bestimmen. Und zweitens soll er ein ganzer Mensch sein: Er soll an seiner Verstandesbildung ebenso arbeiten wie an seiner Herzensbildung und Körper und Geist in Einklang bringen.
Diese beiden Forderungen stellt Schiller aber auch an die Kunst, sofern sie den Menschen befähigen muss, sich in der Begegnung mit ihr als frei und ganz zu erfahren, als Sinnen- und Vernunftwesen zugleich. Ermöglicht wird diese doppelte Erfahrung jedoch ausschließlich durch die Form eines Kunstwerks. In seiner wichtigsten theoretischen Schrift, den Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen, heißt es dazu: »[D]enn durch die Form allein wird auf das Ganze des Menschen, durch den Inhalt hingegen nur auf einzelne Kräfte gewirkt. Der Inhalt, wie erhaben und weitumfassend er auch sey, wirkt also jederzeit einschränkend auf den Geist, und nur von der Form ist wahre ästhetische Freyheit zu erwarten.« (NA 20, 382)1 Diesem starken, sowohl ästhetisch als auch anthropologisch aufgeladenen Konzept der Form sucht das vorliegende kleine Buch dahingehend zu entsprechen, dass es den Autor nach den Hauptgattungen seines Werkes geordnet präsentiert. Schiller gilt als »Idealist«. Was aber heißt »idealisieren«? Einen Gegenstand »in reine Form verwandelt« zu haben (NA 26, 227).
Am Ende sind zu jedem Kapitel jeweils fünf Publikationen aufgeführt, die als Minimalorientierungzur vertiefenden Auseinandersetzung mit dem behandelten Themenkomplex dienen können. Unverzichtbar für die Beschäftigung mit Schiller als Autor insgesamt sind die folgenden vier Überblicksdarstellungen:
Peter-André Alt: Friedrich Schiller. Leben – Werk – Zeit. München
2
2004
Helmut Koopmann (Hg.): Schiller-Handbuch. Stuttgart 1998
Matthias Luserke-Jaqui (Hg.): Schiller-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart 2005
Steven D. Martinson (Hg.): A Companion to the Works of Friedrich Schiller. Rochester 2005
Breit erfasst und kontinuierlich aktualisiert wird die Forschungsliteratur zu Schiller in der digitalen Schiller-Bibliografie des Deutschen Literaturarchivs Marbach am Neckar (https://www.dla-marbach.de/bibliothek/bibliografien/schiller-bibliografie/).
Für Hinweise, Vorschläge und Präzisierungen bin ich Julia Müller, Mario Hähnlein, Nikolas Immer, Harald Liehr, Stefan Matuschek und Stephan Pabst sehr zu Dank verpflichtet.
Schillers Sprache
Die Menschen suchen immer gleich Worte zu allem, und durch Worte hintergehen sie sich dann. Jede Empfindung ist nur einmal in der Welt vorhanden, in dem einzigenMenschen der sie hat; Worte aber muss man von tausenden gebrauchen, und darum passen sie auf Keinen.
Schiller an Charlotte von Lengefeld am 10. Februar 1790 (NA 25, 415)
Natur der Sprache – Natur des Menschen
Das 18. Jahrhundert reflektiert so intensiv und so umfassend über Sprache wie kaum eine Epoche zuvor. Dies liegt unter anderem am europäischen »Kampf der Sprachen«. Mit dem Bedeutungsverlust, den das Lateinische als allgemein verbindliche Kirchen- und Gelehrtensprache durch die Aufwertung der Volkssprachen seit dem 15. Jahrhundert erleidet, tritt zugleich die Frage ans Licht, welche Vorzüge und Defizite nun die einzelnen Volkssprachen aufzuweisen haben und wie es um ihre Hierarchie untereinander bestellt ist. Aus französischer Sicht etwa gilt das Deutsche als schwerfällig, ungelenk und letztlich nicht fähig zu großer Literatur. Im Gegenzug erscheint den Deutschen das Französische als oberflächlich und verlogen. Die Betrachtung der Sprachen führt also in einem zweiten Schritt auch zur Einschätzung der anderen Kulturen und Wertsysteme. Dabei verwandelt sich in der Epoche der Aufklärung das Nachdenken über die verschiedenen Sprachen allmählich in ein Nachdenken über die Sprache, vor allem über ihre Naturund ihren Ursprung, da man sich hier grundsätzliche Antwort verspricht auf die existenzielle Frage nach der Menschennatur selbst. Wenn die Sprache den Menschen in seiner natürlichen Anlage von anderen Lebewesen unterscheidet und er mithin als »Sprachgeschöpf« aufzufassen ist, wie Johann Gottfried Herder vorschlägt,2 dann erscheint umgekehrt die Sprache als Ort, wo der Mensch seiner selbst als eines geschichtlich-kulturellen Wesens innezuwerden und wo er sich als ganzesWesen zu begreifen vermag. Nach 1750 werden allgemeine Sprachnatur und allgemeine Menschennaturkontinuierlich aufeinander bezogen. Zu dieser anthropologischen Dimension der Sprache kommt außerdem die erkenntnistheoretische Einsicht hinzu, dass Wissen nicht ohne Sprache zu haben ist und dass die Art der sprachlichen Vermittlung von Wissen dieses selbst konstituiert und beeinflusst.
Für die Literatur und ihre Darstellungsverfahren konnte ein solch intensives Nachdenken über die Sprache nicht ohne Folgen bleiben. Beinahe jeder Dichter in der zweiten Hälfte des 18. und des frühen 19. Jahrhunderts hat sich mit dem Problem befasst, auf welche Weise das Sprachbewusstsein in die Poesie als »Kunst durch Sprache« (Wilhelm von Humboldt) einwandert und diese zugleich mitbestimmt. Auch Schiller befasst sich gründlich mit den Eigenheiten der Sprache, und die hierbei gewonnenen Überzeugungen wirken sich direkt auf seine Sprachverwendung aus.
Schillers Formalisierung der Sprache
Schillers Sprache ist schwierig, seine Reflexion von Sprachfragen ebenso. Das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Erstens hält er im Unterschied zu etlichen Autoren seiner Zeit an der rhetorischen Traditionfest, vielfach auch mit Bezügen zum Barock, und verweigert die zeitgenössische Forderung einer »natürlichen Rede«. Mit Ausnahme von Kabale und Liebe sind beispielsweise seine Dramen fast durchgängig vom hohen Ton, also dem genus grande geprägt. Zweitens verwendet Schiller eine ganze Reihe zentraler Begriffe gezielt mehrdeutig. Das gilt besonders für seine theoretischen Schriften, greift jedoch auch auf die literarischen Texte über. Zu diesen Begriffen zählen etwa Natur, Freiheit, Schein, Bewegung, Schönheit, Spiel oder Technik.Für ihren ambivalenten und variablen Gebrauch ist er zum Teil scharf kritisiert worden, namentlich von Johann Gottlieb Fichte, der Schiller vorwirft, sich nicht an die Regeln klarer Begriffsverwendung zu halten, und beklagt, dass man sich Schillers Texte immer erst ins Schulmäßige »übersetzen« müsse, um sie verstehen zu können. Am 27. Juni 1795 heißt es in einem Brief Fichtes an den Autor: »Ihre philosophischen Schriften sind gekauft, bewundert, angestaunt, aber, soviel ich merke, weniger gelesen, und gar nicht verstanden worden.« (NA 35, 232)
Um sogleich ein anschauliches Beispiel für die angestrebte Mehrdeutigkeit zu geben, sei kurz der Begriff »Natur« betrachtet, der eines der zentralen Leitkonzepte des 18. Jahrhunderts darstellt. Ganz allgemein bezeichnet auch Schiller damit den Gegensatz zur Kultur oder das Wesen einer Sache. Doch sein Verständnis des Begriffs als solchen lässt sich nicht festlegen, weil er häufig dessen Bedeutung in Abhängigkeit von anderen Begriffen variiert, mit welchen er »Natur« jeweils zusammenspannt. So bedeutet »Natur« in Kombination mit »Schein« etwas völlig anderes als »Natur« in Beziehung zu »Freiheit«: Im ersten Fall meint »Natur« das Wahre, Echte, Ursprüngliche, im zweiten Fall jedoch das Triebgesteuerte, Determinierte, Unentrinnbare; im ersten Fall ist »Natur« demnach eher positiv besetzt, im zweiten Fall klar negativ. Die Begriffe »Schein« und »Freiheit« werfen je verschiedene Lichter auf den Begriff »Natur« und legen zugleich seine unterschiedlichen Facetten frei. Solch kombinatorische Sprachverfahren, durch Begriffe andere Begriffe in bestimmte Perspektiven zu rücken, nutzt Schiller ausgiebig, um einerseits den inneren Reichtum eines Wortes auszuleuchten und dieses andererseits semantisch beweglich zu halten. Seine Bedeutung bringt der einzelne Terminus also nicht schon mit, vielmehr entsteht sie erst durch das jeweilige syntaktische Gefüge. Mit Wittgenstein könnte man sagen: Über die Bedeutung eines Wortes entscheidet sein Gebrauch.3 Der Anschein, mit dem Wort immer schon die Sache zu haben, wird auf diese Weise zerstört, weil das Wort zwar dasselbe ist, aber die Sache sich fortwährend ändert. Schiller rückt gewissermaßen die Wörter immer wieder von den Sachen weg, um den »Abgrund« zwischen beiden unablässig vor Augen zu führen, den ein verfestigender Sprachgebrauch verdecken würde und von dem er in einem Brief an Goethe vom 27. Februar 1798 spricht: »Ueberhaupt ist mir das Verhältniss der allgemeinen Begriffe und der auf diesen erbauten Sprache zu den Sachen und Fällen und Intuitionen ein Abgrund, in den ich nicht ohne Schwindeln schauen kann.« (NA 29, 212) Im Sinne einer Vergegenwärtigung dieses Abgrundes zwischen Wörtern und Sachen dienen folglich die Gegenbegriffe nicht allein der Perspektivierung, sondern der vom einzelnen Fall abhängigen semantischen Spezifikation.
Schiller war sich über die Spezifik der eigenen Sprache sehr wohl im Klaren. An Wilhelm von Humboldt schreibt er am 26. Oktober 1795: »Das mag seyn, dass meine Sprache immer künstlicher organisiert seyn wird, als sich mit einer homerischen pp Dichtung verträgt […].« (NA 28, 84) Doch besteht sein Ziel gerade darin, auch beim Leser im Vollzug der Darstellung das kritische Bewusstsein für die Sprache als künstliches System wachzuhalten, damit von vornherein jeder Anschein einer vermeintlich natürlichen – »homerischen« – Sprache zerstört wird. Sein Wissen um diese Künstlichkeit war bereits Thema in einem Brief an Goethe vom 31. August 1794, in dem er sowohl sein Darstellungsverfahren knapp umreißt als auch den Unterschied zu Goethe hervorhebt: »Weil mein Gedankenkreis kleiner ist, so durchlaufe ich ihn eben darum schneller und öfter, und kann eben darum meine kleine Baarschaft beßer nutzen, und eine Mannichfaltigkeit, die dem Innhalte fehlt, durch die Form erzeugen. Sie bestreben Sich, Ihre große Ideenwelt zu simplificieren, ich suche Varietaet für meine kleinen Besitzungen. Sie haben ein Königreich zu regieren, ich nur eine etwas zahlreiche Familie von Begriffen, die ich herzlich gern zu einer kleinen Welt erweitern möchte.« (NA 27, 32) Und tatsächlich ist es eine »durch Form erzeugte Mannichfaltigkeit«, indem Schiller die oben erwähnte Reihe von Begriffen, fallweise ergänzt um weitere Termini, immer wieder aufs Neue arrangiert und durchspielt und deren semantische Beziehungen untereinander immer wieder anders in den Blick zu nehmen versucht. Wiederholung, Variation und Formalisierunggehören somit zu den sprachkritischen Grundprinzipien seines sich über fast dreißig Jahre erstreckenden Reflexionsganges. In Sachen Sprache ist Schiller nicht Idealist, sondern »Formalist« und zugleich Pragmatiker.