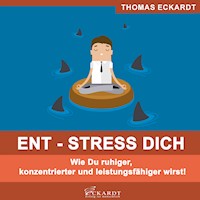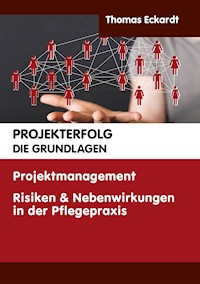9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Besprechungen ohne Ergebnisse, Präsentationen ohne Aha-Erlebnisse, genervte Mitarbeiter und vor allem: verlorene Arbeitszeit. Dieses traurige Bild gehört in vielen Firmen zum Alltag. In Ihrer auch? Sie als Führungskraft haben das Steuer in der Hand und deshalb können Sie auch den Kurs ändern. Die Voraussetzung ist allerdings, dass Sie lernen, wie Sie Ihre kommunikativen Fähigkeiten zielführend trainieren. Vergessen Sie dicke Fachbücher! Wichtig ist, dass die Grundlagen sitzen und immer wieder geübt werden. Erfolgreich kommunizieren und professionell präsentieren: Wenn Sie als Führungskraft diese Kompetenzen lernen, üben und immer wieder verfeinern, sparen Sie Zeit und Nerven - bei sich selbst und Ihren Mitarbeitern. Mit diesem kompakten Ratgeber wird es ganz einfach. Nach einer kurzen Einführung in die Grundlagen der Kommunikation gehts in die alltägliche Praxis. - Wie Sie Gespräche erfolgreich führen und steuern. - Was Sie über Rhetorik wissen müssen. - Wie Sie Besprechungen kompetent leiten und lenken. - Wie Sie Präsentationen erfolgreich vorbereiten und gestalten. Kommunikation ist ein Handwerk, das sich lernen lässt und immer wieder geübt werden muss. Nutzen Sie die langjährige Erfahrung, die in diesem Ratgeber steckt: Konkrete Anleitungen, kompakte Checklisten und praktische Tipps geben Ihnen die Sicherheit, die Sie als Führungskraft brauchen. So umschiffen Sie Klippen im Alltag und steuern einen klaren Kurs.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Thomas Eckardt
Führungserfolg – die Grundlagen
Kommunikation & Rhetorikfür Ihren Alltag
Impressum
Führungserfolg – die GrundlagenThomas EckardtCopyright: © 2018 Thomas EckardtIndependently published von Thomas Eckardt, Am Oberfeld 12, 35606 Solms
[email protected]: Claudia FlöerUmschlaggestaltung & Formatierung: autoren-marketing.deCover: network digital © vege (fotolia.com)
Dieses Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung. Alle Rechte sowie Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Kommunikation – die Grundlagen
1.1 Feedback – Konstruktive Rückmeldung
1.2 Gespräche fördern durch „Aktives Zuhören"
1.3 Friedemann Schulz von Thun: Die vier Seiten einer Nachricht
1.4 Fragetechniken
1.5 Die Distanzzonen
2 Kommunikation – die wichtigsten Regeln für Führungskräfte
2.1 Verblüffend selten, aber höchst effektiv: Schweigen
2.2 10 Regeln für gutes Zuhören
2.3 Bodyfeedback – Auf Ihre Haltung kommt es an!
2.4 Gesprächsführung
2.5 Gesprächsleitfaden
2.6 Konflikt- und Kritikgespräch
2.7 Gesprächsführungstechnik: „Wer hat eigentlich das Problem?"
2.8 Gesprächssteuerung
2.9 Schlechte Nachrichten überbringen
3 Rhetorik: Die Kunst des wirkungsvollen Redens
3.1 Sprechen Sie, aber frei und überzeugend
3.2 Lampenfieber hat jeder und auch Sie können damit umgehen
3.3 Roten Faden verloren? Hier sind die wichtigsten Tipps
3.4 Zuhörerreaktionen auf Verhaltensweisen des Redners
3.5 Atemübungen
3.6 Entspannungsübungen vor Beginn der Rede
3.7 Small Talk
3.8 Zentrale Small Talk-Regeln: eine kleine Auswahl
4 Gruppengespräche leiten und steuern
4.1 Besprechungen – So viel wie nötig, aber so wenig wie möglich
4.2 Besprechungsarten: Wählen Sie mit Bedacht
4.3 Ausnahme: Die Besprechung ohne Tagesordnung
4.4 Die Besprechungsvorbereitung
4.5 Erfolgreiche Besprechungen
4.7 Moderation von Besprechungen
4.8 Moderationsmethoden
4.9 Regeln im Umgang miteinander
4.10 Checkliste zur Bewertung einer Besprechung für den Leiter
5 Präsentieren und Vortragen
5.1 Selbstpräsentation
5.2 Wie Sie Ihr Fachwissen prägnant präsentieren
6 Medien einsetzen
6.1 Mit dem Flip-Chart arbeiten
6.2 Pinnwände und Moderationskarten
6.3 Multimedia-Präsentation
6.4 Schriftliche Gestaltung von Flip-Charts und Moderationskarten
Nachwort
Einleitung
„Man kann nicht nicht kommunizieren“ – diesen Spruch von Paul Watzlawick kennt wohl jeder. Aber, Hand aufs Herz: Beherzigen Sie ihn auch? Kennen Sie die Konsequenzen? Ist Ihnen bewusst, dass Sie auch dann mit Ihren Mitarbeitern kommunizieren, wenn Sie sie nur schweigend anblicken?
Wer führen will, der muss auch kommunizieren können. Genau darum geht es in diesem Ratgeber. Ich möchte Ihnen kurz und knapp die Grundlagen vorstellen, die Sie bei jeder Kommunikation mit Ihren Mitarbeitern brauchen – vom Sinn des Schweigens angefangen (ja, auch Schweigen hat einen hohen Stellenwert, wenn Sie es richtig einsetzen) bis zur gelungenen Präsentation vor kleinem oder größerem Publikum.
All das werden Sie bei Ihrer Lektüre ganz leicht und locker mitnehmen können. Fachchinesisch braucht niemand und Sie als Führungskraft sind mehr als alle anderen gehalten, sich klar, kompetent und verständlich auszudrücken.
Wie jedes andere Handwerk auch, braucht Kommunikation Übung. Soll heißen: Sie brauchen Routine, die sich an konkretem Handwerkszeug orientiert. Glauben Sie bitte nicht, dass jedes Gespräch schon eine Kommunikation ist – auch dann nicht, wenn Sie „Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräch“ darüberschreiben.
Kommunikation, wie Sie in diesem Ratgeber verstanden wird, ist ein Handwerk, das sich glücklicherweise lernen lässt. Schön, dass Sie es anpacken!
1 Kommunikation – die Grundlagen
1.1 Feedback – Konstruktive Rückmeldung
Phase 1: Beginnen Sie immer zuerst mit den positiven Eindrücken, was gut läuft oder gut gelungen ist. Damit öffnen Sie den Menschen für Ihre zukünftigen Erwartungen. Bleiben Sie ehrlich. Menschen brauchen Rückmeldungen zu dem, was gut funktioniert oder ihnen gelingt, um ihre Unsicherheit reduzieren zu können. Damit ist kein pauschales Lob gemeint, sondern eine sachliche Rückmeldung gut ausgeprägter Fähigkeiten und Fertigkeiten. Damit signalisieren Sie gleichzeitig Interesse am Menschen.
Phase 2: Sprechen Sie das Verhalten an, das Sie sich in Zukunft wünschen oder erwarten und zeigen Sie die Konsequenzen auf, die dem erwünschten Verhalten folgen. („Ich erwarte, dass ich in Zukunft rechtzeitig über ihre privaten Probleme informiert werde, so können wir schneller eine gemeinsame Lösung finden, ohne dass die Arbeit erst darunter leiden muss.")
Für beide Phasen gilt unbedingt zu beachten:
Beschreiben Sie Ihr persönliches Erleben, Ihre Gefühle („Ich"- Botschaften) und werden nicht persönlich. Bleiben Sie immer bei sich!
„Ich habe Interesse daran, wie Sie …"
„Mir gefällt, wie ich von Ihnen …"
„Ich sehe meine Interessen nicht gewahrt, weil …"
„Ich habe den Eindruck, dass …"
„Ich bin ärgerlich darüber, …"
Bleiben Sie sachlich und gehen Sie nur auf beobachtbares Verhalten ein – keine Interpretation oder Bewertung.
Achtung
Feedback kann keine Aufforderung zur Änderung sein; jeder Mensch muss für sich gemessen an den Konsequenzen entscheiden, ob er sein Verhalten verändern möchte.
Falls Sie eine Rückmeldung erhalten, dann betrachten Sie sie bitte positiv! Feedback ist ein Geschenk, denn es setzt voraus, dass sich ein Mensch mit Ihnen beschäftigt, zumal, wenn er Ihnen ein Angebot macht, mit welchem Verhalten Sie z. B. mehr Anerkennung genießen oder mehr Erfolg haben können.
Empfangen Sie Feedback und lassen es auf sich wirken, ohne sich zu rechtfertigen.
Stellen Sie Rückfragen bzw. Verständnisfragen, falls Ihnen etwas nicht klar geworden ist.
Bedanken Sie sich beim Feedbackgeber.
Entscheiden Sie dann, was Sie tun werden.
1.2 Gespräche fördern durch „Aktives Zuhören"
Wenn es gilt, etwas vom anderen zu verstehen, das Problem des anderen zu erfassen, oder sich in die Situation des anderen hineinversetzen zu können, benötigen Sie die Fähigkeit des Zuhörens.
Bei aktivem Zuhören wollen Sie das Problem des Gesprächspartners sachlich und gefühlsmäßig richtig und vollständig erfassen und überprüfen, bzw. durch den Gesprächspartner überprüfen lassen. Aktives Zuhören geht also über das reine Zuhören hinaus, indem Sie „zwischen den Zeilen" zuhören und dem Gesprächspartner entsprechend signalisiert, dass Sie seine Lage verstehen.
Achtung
Ein erfolgreiches Gespräch besteht aus ca. 50% eigenem Sprechen und ca. 50% aktivem Zuhören.
Unterstützen Sie die persönliche Entfaltung Ihrer Gesprächspartner durch folgende Zuhör-Verhaltensweisen, die Sie abwechselnd situationsbezogen einsetzen können:
Stellen Sie weiterführende Fragen zum Verständnis
Sie wirken auf ihr Gegenüber wie ein Denkanstoß und führen das Gespräch fort.
„Was bedeutet Ihnen denn …"
„Ich überlege mir gerade, was Sie so daran bewegt."
„Ich frage mich gerade, wie viel Ihnen daran liegt."
Stellen Sie klärende Fragen
Mit ihnen greifen Sie nebensächlich erscheinende Teilaussagen auf, um in einem inneren Abwägungsprozess Erläuterung zu erhalten („eigentlich", „im Grunde genommen", „im Prinzip", „vielleicht", „man", etc.)
„Sie sagen „vielleicht"?"
„Was meinen Sie mit „im Prinzip in Ordnung"?"
„"Eigentlich zu viel", heißt für Sie …?
Zeigen Sie Aufmerksamkeitsreaktionen durch Verstärker
Aussagen des Gegenübers werden durch Blickkontakt und kurze sprachliche Äußerungen, wie "hm", "interessant", "tatsächlich", "ja" verstärkt, sie ermuntern, mehr zu erzählen. Direkte Aufforderungen verstärken intensiv, z. B.:
„Ihr Standpunkt interessiert mich."
„Darüber würde ich gerne mehr hören."
Wiederholen Sie mit eigenen Worten
Die folgenden Formulierungen signalisieren, dass Sie sich aktiv um das Verständnis Ihres Gegenübers bemühen. Der Umfang darf verändert werden, nicht jedoch der inhaltliche Kern!
„Wenn ich Sie richtig verstehe, meinen Sie …"
„Was meinen Sie damit …? Geben Sie mir doch ein Beispiel."
Wiederholen Sie, indem Sie zusammenfassen
Sie dient zur Zusammenfassung des Problemkernes und bietet dem Gegenüber Orientierungspunkte für weitere präzisere Aussagen.
„Auf der einen Seite möchten Sie … Auf der anderen Seite …"
„Einerseits … andererseits …"
Greifen Sie Gefühle auf
Mit den folgenden Formulierungen greifen Sie unausgesprochene Gefühle auf und signalisieren, dass Sie Ihr Gegenüber ernst nehmen und seine Gefühle akzeptieren.
„Sie befürchten, dass …"
„Sie ärgern sich, weil …"
1.3 Friedemann Schulz von Thun: Die vier Seiten einer Nachricht
Wer kennt ihn nicht, den Hamburger Psychologen und Kommunikationsforscher Friedemann Schulz von Thun. Sein Gesamtmodell der Kommunikation ist überaus hilfreich und leicht zu lernen. Es geht davon aus, dass jeder Nachricht, jeder Aussage, vier Aspekte innewohnen – sie alle sind gleichzeitig wirksam.
1. Sachaspekt
Er betrifft den Inhalt und ist häufig auch Anlass des Gesprächs. So geht es im Gespräch z.B. um das Ergebnis einer Analyse oder den Inhalt eines Arbeitsauftrages.
2. Beziehungsaspekt
Er kennzeichnet, welches „Mensch-zu-Mensch-Verhältnis" zwischen Sender und Empfänger besteht. In jeder Nachricht sind auch Informationen darüber enthalten, wie man zu seinem Gesprächspartner steht. Im Gespräch stabilisiert oder verändert man immer – bewusst oder unbewusst – die Beziehung zu seinem Gesprächspartner.
3. Selbstoffenbarungsaspekt
Wenn eine Person etwas sagt, liefert sie gleichzeitig auch immer Informationen über sich selbst: „Jede Nachricht ist eine Kostprobe der Persönlichkeit."
4. Appellaspekt
Mit jeder Nachricht will der Sender auf seinen Gesprächspartner Einfluss nehmen: auf sein Denken, Fühlen oder Handeln. Appelle können verbal oder nonverbal sowie direkt oder indirekt übermittelt werden
1.4 Fragetechniken
„Wer fragt, führt“, heißt es und deshalb kommt es in jeder Kommunikation darauf an, dass Sie die Fragen stellen – und Ihr Gegenüber die Antworten liefert. Für die unterschiedlichen Situationen innerhalb eines Gespräches können Sie verschiedene Fragearten einsetzen, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.
Offene Frage
Offene Fragen sind Fragen, bei denen mehrere Antworten möglich sind. In der Regel fangen sie mit wo, welche, wie, was, wann etc. also sogenannten W-Fragen an. Mit den so gewonnenen Informationen kann ein vertrauensvolles und partnerschaftliches Gespräch aufgebaut werden.
Wie haben Sie diesen Punkt verstanden?
Was für ein Vorgehen schlagen Sie vor?
Was hat an der Planung nicht funktioniert?
Welcher Termin würde Ihnen am besten passen?
Was kann ich für Sie tun?
Geschlossene Frage
Geschlossene Fragen beschränken die Antwortmöglichkeiten auf wenige bekannte Alternativen. Die Frage beginnt in der Regel mit einem Verb. Typische Antworten sind hier Ja oder Nein. Die einzelnen Informationen sind schon in der Frage oder den Aussagen direkt vor der Frage enthalten. Geschlossene Fragen dienen zur Verständnisüberprüfung und zur Beschleunigung von Gesprächen.
Haben Sie bestimmte Vorstellungen?
War das Team von Ihrer Entscheidung informiert?
Kennen Sie den Prozessablauf?
Wussten Sie schon, dass Sie von uns … erhalten?
Direkte Frage
Eine direkte Frage spricht den Gesprächspartner direkt an. Der Fragende möchte damit auf dem kürzesten Weg zu bestimmten Informationen gelangen. Dem Gesprächspartner bleibt wenig Zeit zu taktieren und er antwortet häufig sehr spontan. Diese Frageart sollte nur begrenzt eingesetzt werden. Sie gibt einem Gespräch ansonsten den Charakter eines Verhörs.
Was verdienen Sie?
Wie alt sind Sie?
Indirekte Frage
Eine indirekte Frage nimmt einen Umweg und gibt dem Gesprächspartner Ausweichmöglichkeiten. Insbesondere bei persönlichen Fragen und sogenannten Tabu-Themen helfen indirekte Fragen, eine Anspannung im Gespräch zu vermeiden.
Wenn ich wüsste, was Sie verdienen, könnte ich Ihnen …
Kontrollfrage
Die Kontrollfrage deckt Widersprüche auf, ergänzt Informationslücken und sichert den Kenntnisstand ab. Immer wieder eingebaute Kontrollfragen bringen das für ein erfolgreiches Gespräch notwendige Feedback und vermeiden unnötige Doppelläufe und Diskussionen über Unwesentliches.
Sagten Sie nicht vorhin, dass Sie mehrere Niederlassungen besitzen?
Haben Sie noch Fragen zu meinen Ausführungen?
Was darf ich Ihnen hierzu zusätzlich erläutern?
Ist Ihnen der Aufbau soweit klar?
Motivierende Frage
Diese Frage zielt auf das Gefühl des Gesprächspartners ab.